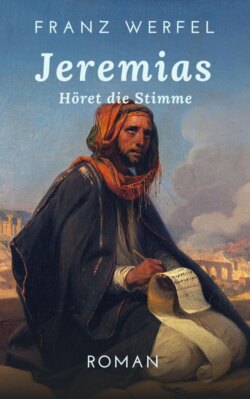Читать книгу Jeremias. Höret die Stimme - Franz Werfel - Страница 7
Viertes Kapitel.
Die Schule der Gesichte
ОглавлениеJirmijah hatte, von dem Knaben Baruch begleitet, einen verborgenen Ort in der Wüste Jehuda aufgesucht, um sich durch Fasten, Wachen, Beten für den Herrn zu reinigen und zu heiligen. Im Hinblick auf Mose selbst, der vierzig abgesonderte Tage und Nächte auf dem Horeb zugebracht hatte, gebot dies der Brauch solchen, die Männer Gottes waren oder Grund besaßen, sich dafür zu halten. Nur mit Anspannung aller Kräfte war es Jirmijah gelungen, nicht gleich im Anfang zu versagen. Wohl hörten sich all diese Worte wie »Heiligung«, »Reinigung«, »Kasteiung« vortrefflich an, wenn man sie, auf einem weichen Lager sitzend, in den Schriften las. Der verwöhnte Sohn eines begüterten Vaterhauses hatte nie erfahren, was Entbehrung heißt. Unbekannt waren ihm Hunger, Durst und Angst, das einsame Nachtlager im Freien und die ständige Anfechtung, diesem Zustand, der in keiner äußeren Notwendigkeit begründet war, ein schnelles Ende zu setzen. Er blieb in dem ersten, freilich selbstgewählten Ungemach seines Lebens mit knapper Not Sieger.
Doch nicht einen Augenblick lang empfand er während dieser Tage die wohltuende Befriedigung, über die vielen Geister der Begierden und Ängste mächtig geblieben zu sein. Es war ihm ja nicht darum zu tun, über die eigene Schwäche Triumph davonzutragen. Heiligung und Reinigung bedeuteten für ihn keinen Selbstzweck, sie waren auf ein ganz bestimmtes Ziel gerichtet. Und dieses Ziel hatte er nicht erreicht. Nie war ihm der Herr ferner gewesen als zu dieser Frist, da er in Hunger, Durst, Hitze, Frost und Angst betend und nachtwachend um seine Annahung und Niederneigung kämpfte. Er, der Barmherzige, schien sich in spöttischer Quälsucht vor Jirmijah in seine eigensinnigste Entlegenheit zurückzuziehen. Mit derselben unberechenbaren Laune, ja Willkür, mit der er unter Zehntausenden den jungen Priestersohn aus Anathot ausgesucht und ihm seine Stimme geliehen hatte, nahm er sich jetzt wieder zurück und war durch keinerlei Künste der Kasteiung umzustimmen.
Jirmijah war kein Gewaltiger der Urzeit, er war das Kind eines neuen, kleinmütigen und mißtrauischen Geschlechts. Er zweifelte. Er zweifelte, auch noch wenn er betete und sich mit seinen Versuchungen herumschlug. Wohl hatte ihm die sanfte und klare Mannesstimme Adonais Geheimnisse verraten, die aus seinem eigenen Geiste nicht stammen konnten: »Ich habe dich gekannt, eh ich im Leib deiner Mutter dich schuf. Ich habe dich ausgesondert, noch ehe sie dich gebar.« Niemals hatte auch nur der Hauch einer ähnlichen Vermessenheit sein Herz gekreuzt, das scheu war und ohne viel Zutrauen zu sich selbst. »Ich habe als Künder dich unter die Völker gestellt.« Kam das aus ihm? Wo, in welchem Abgrund des Gemütes, konnte sich wohl ein besessener, totfremder Traum so lange verborgen haben? Erwiesen diese Sprüche nicht klar die Echtheit der Berufung? Und dennoch, Jirmijah zweifelte und zweifelte: Wenn alles Täuschung ist, was mich seit dem dreizehnten Jahr meines Lebens an Erscheinungen und Rufen bedrängt hat, um sich dann in einer letzten großen Täuschung zusammenzuballen und mich zu verlassen für ewig?! Je heftiger Jirmijah in den Tagen der Reinigung und Heiligung gegen solche Fragen anstritt, um so dringender wurden sie in ihm selbst gestellt.
Der Herr schien von Stunde zu Stunde kühler zurückzuweichen. Zermürbt eröffnete sich der Zweifler Baruch, seinem Jünger. Er mußte Gewißheit bekommen über sich selbst. Aber gab es diese Gewißheit in der Welt? Und welcher Mensch konnte sie ihm schenken? Der verständige Knabe Baruch hatte einen hilfreichen Einfall.
In Jerusalem lebte ein angesehener Mann namens Schallum, Tokhebets Sohn. Er hatte das Hofamt eines königlichen Kleiderbewahrers inne, besaß aber zugleich eine Schneiderei, die größte Handwerkstätte dieser Art. Sein Haus lag südwestlich vom Tempelberg an der Straße, die Millo hieß und das Palastgeviert der herrschenden Könige mit der alten ungefügen Davidsburg wie eine Brücke verband. Es war eines der stattlichsten Häuser in ganz Jerusalem, zwei Stockwerke hoch, das große Dachgemach nicht mitgerechnet. Im Erdgeschoß befand sich die Werkstätte. Hier stand Schallum, ein flinkes, mageres Männchen, in eigener Person und prüfte die Leinwand, das Flachs-, Garn- und Wollgewebe, die einfachen und doppelten Gespinste von feinstem Purpurfaden, all die gebleichten und gefärbten Stoffe, die ihm die Marktfahrer und Händler zum Kaufe anboten. Hier empfing er auch, hin und her flitzend wie eine Eidechse, seine Kundschaft. Er war sogar gewürdigt, manche Gewandarbeit für den Tempel zu liefern. Da galt es, die vielfältigsten Regeln und Vorschriften genau zu beachten, Nicht gleichgültig war es, wie breit bei diesem oder jenem Amtskleid die Säumung zu sein hatte, wie der Schnitt bei den höheren und niederen Ordnungen sich unterschied, ob die Dienstschärpe eines Altpriesters mit zwölf lilien- oder granatapfelförmigen Zieraten bestickt werden mußte. Die Schwierigkeiten der weltlichen Gewandung beherrschte Schallum nicht minder als die der geistlichen. Wie die Falten der Schimla, des Mantels, zu fallen, wie sich der Chuttonet passim, das Ärmelkleid der Frauen, der Gestalt und der anmutigen Spannung des Schrittes anzuschmiegen hatte, das entschied Schallum selbstherrlich.
Die Räume des Oberstocks, in denen Stille und Leere herrschte, waren dem königlichen Dienste gewidmet. Zwar bedeutete das Hofamt eines »Kleiderbewahrers« mehr einen Titel als eine wirkliche Beschäftigung. Dieser Titel aber verpflichtete, denn es konnte der Tag und die Notwendigkeit kommen, daß sein Inhalt in Anspruch genommen wurde. Deshalb stand ein Teil des Hauses immer leer, um die Gewänder des Königs gegebenenfalls ehrfürchtig aufnehmen zu können.
Schallums Titel, Reichtum und Kenntnisse hätten genügt, das hohe Ansehn eines Mannes zu begründen. Im Falle des königlichen Kleiderbewahrers aber bildeten sie nur einen bescheidenen Anlaß. Die wahre Ursache seiner Hervorgehobenheit lag weder in Schallums Amt, noch in seiner Person. Er hatte sie einem anderen, weit ruhmvolleren Wesen zu verdanken, seinem eigenen Weibe. Dieses glorreiche Weib aber, das seinen schlichten Gatten in dem tätigen Schneider besaß, hieß und war Hulda, die Seherin, deren Namen zum ewigen Gedächtnisse in das Chronikbuch der Könige Jehudas aufzunehmen, Josijah höchstselbst dem Schriftmeister Schaffan anempfohlen hatte. Nannte man sie aber eine Prophetin oder Künderin, wie es oft geschah, so war sie die erste, die gegen solche grobe Verwechslung der Begriffe Einspruch erhob. Hulda zählte nicht zu jenen Persönlichkeiten, die gemeinhin »Künder Gottes« hießen. Die Künder Gottes, wo und wann sie auch auftraten, waren vornehmlich Männer Gottes, Männer, deren Geist einzig auf den Willen des Herrn gerichtet stand, ihn im irdischen Bereiche durchzusetzen. Eine einzige Ausnahme hatte es in grauer Zeit gegeben: Deborah, die Richterin, eine Mutter in Israel, die das Kampflied des Herrn sang. Hulda aber verglich sich nicht mit Deborah. Sie war keine Künderin, sondern eine Seherin.
Der Herr hatte ihr Ohr nicht geschaffen, seinen Auftrag zu hören, jedoch ihr Auge geöffnet, Einblick zu nehmen in die Tiefen. Vor ihrer geheimnisvollen Hellsicht lagen die verborgenen Zustände der Menschen und Dinge deutlich da, sowohl was die Gegenwart, als auch die ferne Vergangenheit oder nahe Zukunft anbetraf. Seit dreißig Jahren, seit ihrer Jugend schon, wahrsagte die Frau des königlichen Kleiderbewahrers, und man konnte die Fälle an den Fingern abzählen, wo ihre Vorhersagen nicht eingetroffen waren. Ein Blick in ein menschliches Antlitz und Hulda kannte die Krankheit, die ein Jahr später dieses Antlitz in die Erde schmolz. Die Hand leicht unter die Brust einer jungen Frau gelegt, und Hulda nannte Anzahl und Geschlecht der Kinder, mit denen die Hoffende im Laufe des Lebens gesegnet werden sollte.
War ihre Wirksamkeit auch für viele Leidende und Irrende von hohem Werte, so bestand ihr wahrer Ruhm in einigen Staats-Orakeln, die bei ihr eingeholt worden waren. Das wichtigste dieser Orakel betraf das wiedergefundene Buch der Lehre. Nachdem König Josijah dieses durch die erste Vorlesung Schaffans kennengelernt und den Entschluß zur großen Umkehr gefaßt hatte, wollte er sich vorher der wahrhaftigen Gottentflossenheit der Buchrolle noch einmal versichern. Von Hulda war es bekannt, daß sie zwar Geschriebenes nicht lesen, doch aus Geschriebenem so manches herausdeuten konnte, was der Wortlaut der Zeilen verbarg. Die ihr unbekannten Schriftzeichen bauten vor ihrer Hellsicht Bilder auf, die wie die Sternbilder des Himmels ablesbare Schicksale enthielten. Josijah stellte aus dem Hohenpriester, aus Schaffan, dessen Sohn Ahikam und zwei Hoffürsten eine Abordnung zusammen, um durch Hulda das geschriebene Altertum auf seine göttliche Echtheit prüfen zu lassen und von ihr einen Orakelspruch zu fordern. Die Seherin erfüllte die staatsbetreffende Aufgabe in eindringlichster Art. Auf den ersten Blick bestätigte sie das Uralter und die wahrhaftige Gottentflossenheit der Schrift. Vor den staunenden Ohren der Abgesandten sagte sie einige wichtige Stellen, die sie ja nicht lesen konnte, auswendig her. Zum Schluß gab sie das Orakel, der Herr werde alle Drohungen über Volk und Land erfüllen, aber nicht in diesem Zeitalter und in Josijahs Tagen. Hulda überschritt die Grenzen der Seherin und verwandelte sich in eine Künderin, da sie ihre Wahrsagung an den König mit folgendem Versprechen des Herrn schloß:
»Siehe, ich will dich sammeln zu deinen Vätern, daß du in Frieden ins Grab eingehst und kein Unglück mehr siehst ...«
Josijah, der für die Fülle der Verfehlungen unmittelbare Ahndung und Strafe erwartet hatte, jubelte über Huldas Wahrspruch, welcher, was zumindest ihn selbst betraf, unerhofft günstig lautete.
Es läßt sich denken, daß von diesem Tage an die Huld des Königs überreich auf die Seherin niederstrahlte. Mit der auffälligen Ehrerbietung, die er ihr erwies, bekräftigte er den Spruch, den sie gesprochen. Das Beispiel des Königs zog das Volk nach sich. Wo immer Hulda, die Seherin, auftauchte, sammelten sich Menschenhaufen, die ihr ergriffen nachstarrten. Sie selbst aber blieb von diesem Ruhm völlig unberührt. Es fiel ihr nicht ein, ihr absonderliches Wesen dem Ansehen unterzuordnen, das sie genoß. Hulda war eine kleine verwitterte Frau. Sie schwankte, wenn sie über die Straße ging, wie eine Betrunkene und pflegte mit sich selbst zu murmeln und zu hadern. Ihre Kleidung war ungewöhnlich wie sie selbst. Auf dem Kopf trug sie kein Tuch wie andre Frauen, sondern eine breite Fellmütze und zu allen Stunden klirrenden Schmuck, der wertlos war. Ihr Abzeichen bildete ein hoher Hirtenkrummstab, der sie überragte. Wäre es nicht die große Hulda gewesen, die Straßenjungen und Spottvögel Jerusalems wären mit Grimassen und Hohnliedern hinter ihr hergezogen. So aber wurde ihr murmelndes Vorbeischwanken mit ehrfürchtiger Scheu begrüßt. Schallum, der königliche Kleiderbewahrer, diente seiner erhabenen Gattin täglich und stündlich auf den Knien. Betrat sie die Straßen, die Plätze, den äußeren Tempelhof, so lief er mit flitzender Geschwindigkeit vor ihr her, um Raum für sie zu schaffen, die Gaffer zurückzudrängen und jederlei Belästigung abzuwehren. Die alte Forderung der Weisen, »der Mann gehe dem Weibe voran«, verkehrte er, indem er sie erfüllte. Zugleich aber unterließ er es nicht, damit auch die Unkundigen Kenntnis gewännen, laut auszurufen: »Hulda naht ... Platz für die hohe Seherin ...«
Schallum sorgte auch dafür, daß sich sein gottbegnadetes Weib nicht unter die weihelosen Menschen mische, die seine Werkstatt belebten. Sie erschien niemals im Erdgeschoß. Ihr Reich war das große Dachgemach, durch dessen vier offene Fenster stets ein starker Luftzug wehte. Hier hatte sie die Staatsgesandtschaft des Königs empfangen. Hier ließ sie die Wahrheitsuchenden vor sich treten, deren Anliegen sie Gehör lieh. Hier aber versammelten sich auch nach Sonnenuntergang regelmäßig einige Männer um sie, die sich mit gedämpfter Stimme über die Geheimnisse Adonais und seines Eingreifens in die Welt unterredeten, in freierer und gefährlicherer Art freilich, als solches in den Wandelhallen und Lehrzellen des Tempels möglich war. In früheren Zeitaltern hatte es ganze Gemeinschaften von Erweckten und Gottbegeisterten gegeben, die mit verzückten Tänzen und Gesängen durchs Land zogen und »Prophetenschulen« hießen. Nun, der abendliche Kreis um Hulda glich diesen vom Herrn berauschten Zusammenrottungen recht wenig. Schweigen oder Flüstern herrschte im Dachgemach, aus dessen Fenstern niemals ein lauter Ton in die Stadt drang, welche Ruhe den neuen nüchternen Tagen besser entsprach als tobende Ergriffenheit. Zu dieser Versammlung pflegte sich manchmal ein älterer Mann Gottes einzufinden, der nicht zu den gewöhnlichen Tempelpredigern gehörte, sondern im Rufe eines echten Ausgesonderten und Künders stand. Sein Name war Urijah, Schemajahs Sohn.
Baruch hatte seinem Meister den Gedanken eingegeben, bei Hulda, der Seherin, und den wissenden Männern, die sich um sie scharten, Wahrheit und Hilfe zu suchen. Jirmijah aber, der in seinem Zweifel immer tiefer versunken war, zögerte keinen Augenblick, nach dieser Hilfe zu greifen. Sie brachen ihr Zelt in der Wüste Jehuda ab und zogen nach Jerusalem.
Schallum wollte ihnen zuerst den Eintritt verwehren. Der Arbeitstag war zu Ende, die Zeit des Abendgebetes gekommen, das Haus mußte verschlossen werden. Bescheiden warteten Jirmijah und Baruch in einem Winkel. Als sich die letzte Kundschaft verlaufen und die Werkstatt geleert hatte, herrschte der königliche Kleiderbewahrer die beiden jungen Männer an:
»Und ihr ... Was wollt ihr noch?«
Ruhig trug Jirmijah seine Bitte vor, Schallum möge ihnen vergönnen, das Antlitz der Seherin zu erblicken. Darauf geriet der kleine Mann des erhabenen Weibes in kreischendes Eifern.
Jirmijah ließ es geduldig abschnurren. Dann erklärte er, daß er keinen der üblichen Orakelsprüche suche, sondern ratsbedürftig sei in einer Sache des Herrn. Und er nannte seinen priesterlichen Namen. Die mißtrauische Ungunst des königlichen Kleiderbewahrers klärte sich sofort. Ein forschender Blick in das in sich gekehrte, bleiche Gesicht Jirmijahs und er erhob, plötzlich still geworden, keinen Einwand mehr, sondern winkte den verspäteten Besuchern, ihm zu folgen.
Das Dachgemach war ein weitläufiger Raum, beinahe ohne Einrichtung. In der Mitte stand eine breite Mittah, ein niedriges, mit Fellen bekleidetes Ruhelager. Auf dieser Mittah hockte die verwitterte Hulda, die Pelzkappe auf dem kleinen Kopf, den bunten Glasschmuck um den Hals und den langen Krummstab neben sich. Auf weit abgerückten Sesseln saßen einige Männer wortlos in der Runde. Ein Leuchter mit einer einzigen matten Lampe strahlte sein geringes Licht aus, das die Gesichter mehr verbarg als enthüllte. Die vier Fensterluken, die sich nach allen Himmelsrichtungen öffneten, ließen einen blaß bewölkten Dämmerhimmel sehen. Schallum hatte eine Tonschale voll dicker Milch mitgebracht, die er nun zärtlich Hulda unter die Augen hielt. Seine Ehrfurcht der eigenen Frau gegenüber war so groß, daß er sie niemals unmittelbar anredete, sondern in schmeichelndem Tone nur von ihr sprach, wenn er zu ihr sprach:
»Die Seherin verschwendet ihr armes Herz und die Kräfte ihres kranken Leibes mehr als die andern groben Menschen ... Nie aber denkt sie an Schlaf und Mahlzeit. Die Seherin wird jetzt verständig sein und dieses winzige Schüsselchen mit süßem Rahm auslöffeln, das ich ihr vorbereitet habe, weil ich die Unlust ihres Gaumens kenne und gar viel Sorge trage um sie ...«
Der königliche Kleiderbewahrer hatte mit lispelnder Stimme gesprochen, wie man lockend zu einem Kinde spricht, das zum Essen genötigt werden muß. Seine alten Hände, die schon lange die Milchschüssel Hulda hinhielten, zitterten immer stärker. Mit einem Seufzer nahm sie die Speise an und begann versonnen zu löffeln, aber so, daß jeder merkte, sie überwinde sich und esse nur dem sorgenden Quälgeist zuliebe. Dieser verfolgte gespannt den hölzernen Löffel, der immer langsamer und widerwilliger in den fetten Rahm getaucht wurde. Doch Schallum war unnachgiebig. Erst als unter deutlichen Zeichen der Verzweiflung die Speise zur Hälfte verzehrt war, wies er auf den Neuling und nannte seinen Namen:
»Dieser Priestersohn aus Anathot will von der Seherin keine niedre Vorhersage ...«
Da Hulda zu keinem weiteren Löffel mehr zu bewegen war, verließ der königliche Kleiderbewahrer schüchtern und auf Zehenspitzen das Dachgemach wie einen heiligen Raum. Jirmijahs kurzsichtige Augen wanderten im Kreise, sahen aber in dem matten Dämmerlichte nur verschwimmende Flecken von Männergesichtern. Eines aber wurde ihm selbst in dieser Undeutlichkeit deutlich. Die Gestalten der Männer, die schweigend und gleichsam einander abgekehrt umhersaßen, drückten eine Traurigkeit aus, die den Raum beklemmend durchlastete. Wie war das zu fassen? Derselbe Gott, der bei allen Opfermählern von den Menschen festliche Freude, der von seinen Engeln ewiges Frohlocken forderte, derselbe Gott erfüllte diejenigen, welche er mehr als alle Engel »mit seiner Hand berührte«, mit dem Geist der Trauer? Litten sie an ihrem eigenen Los oder unter dem Unabwendbaren, das sie vorwußten? Nur Hulda, die Seherin, war von der Schwermut dieser Gottes-Männer ausgenommen. Aus der Dämmerung heraus blickte sie Jirmijah gespannt an, dann glitt es wie ein schalkhaftes Lächeln der Mitverschworenheit über ihr faltenreiches Gesicht. Wer weiß, wie lange dieses lastende Schweigen noch gewährt hätte, wäre Baruch nicht kühn genug gewesen, um Jirmijahs willen die Schicklichkeit zu verletzen. Seine rauhe Knabenstimme stammelte erregt:
»Dieser Mann hier ... Jirmijah, Hilkijahs Sohn ... Zu ihm ist der Herr gekommen ... Mit Gesicht und Wort ... Gürte deine Lenden und geh, sprach der Herr ... Seitdem aber kam der Herr nicht mehr zu ihm, und er weiß nicht, ob es echt ist und was er tun soll ...«
Nach dieser stotternden Schilderung des Zweifelfalles brach der mutige Baruch plötzlich ab, während ihm der Schweiß auf die Stirn trat. Die Seherin hatte, ihren pelzverbrämten Kopf schief zur Seite neigend, wie eine Schwerhörige gelauscht, ohne ein Zeichen des Verständnisses zu geben. Da erhob sich ein hagerer hochgewachsener Mann aus der Dämmerung und trat dicht vor Jirmijah hin, ihn zwischen halbgeschlossenen Lidern betrachtend. Von der Stirn abwärts, am linken Auge vorbei bis zum Backenknochen lief eine breite Narbe, ungleichmäßig und ausgezackt, als stamme sie nicht von einem Schwertstreich, sondern von dem Hieb der Skorpionsgeißel. Diese Narbe sprach von andern Leiden als von jenen innerlichen, die Jirmijah quälten. Erschauernd fragte dieser sich, ob er je die Kraft aufbringen könnte, die Schmach einer solchen Züchtigung zu ertragen. Der Mann öffnete seinen Mund zur Rede. Da sah der Priestersohn – und jene Frage gewann noch mehr Nachdruck dadurch –, daß die Feinde und Hasser dieses Mannes ihm die Vorderzähne ausgeschlagen hatten. Alle Entstellungen aber machte ein zartes Lächeln wett und eine klare und sanfte Stimme, die fern an jene Stimme gemahnte, die Jirmijah berufen und wieder verlassen hatte.
»Öffne dein Herz getrost«, sagte er, »und vergiß nichts ... Denn der mit dir spricht, ist Urijah ...«
Jirmijah begann stockend. Der feinhörige Blick des Künders aber ermutigte ihn so sonderbar, daß seine Zunge rasch sich löste und keine Einzelheit des ungeheuren Geschehens zwischen Passahnacht und Morgen zurückhielt. Urijah unterbrach ihn dann und wann, indem er sich die Schilderung der Gesichte und die Sprüche wiederholen ließ. Jede dieser Fragen bewies Jirmijah eine unerwartete Vertrautheit und Erfahrungsfülle in der Begegnung mit Adonai. Ihm wurde leichter ums Herz. Er stand nicht allein in der Welt. Es lebten brüderliche Männer, die dasselbe erfahren hatten wie er. Ein Gefühl großer Geborgenheit erfüllte ihn. Dann aber fiel sein Blick wieder auf die Leichenfarbe dieses Anlitzes, auf die brennende Narbe, den zahnlosen Mund ... Nachdem Urijah ihn eingehend vernommen hatte, seufzte er tief auf:
»Der Herr ist bei dir gewesen, Jirmejahu ... Zweifle nicht länger, du bist nicht getäuscht, was du gesehn und gehört hast, ist echt ... Dies aber ist nur ein Anfang ... Es gibt so manche, die hören und sehen, doch ob sie wahr künden oder falsch künden, das liegt nicht in ihrer Macht ... Er verkehrt das Wort der Wahren, so wie er das Wort der Verkehrten bewährt, wenn er will ... Verstehst du das, Jirmejahu ...«
Wie sollte der junge Mensch diesen grausamen Widerspruch verstehn, den der im Umgang Gottes Gewiegte in einem langen Leben erlernt hatte. Jirmijah aber quälte nur ein einziges Anliegen: Bin ich berufen und zugleich verworfen worden? Bin ich ausgesandt, um ziellos umherzuirren? Und er forschte angstvoll:
»Kann es möglich sein, daß ich ihn nie wieder höre ... daß er mir nimmer wiederkehrt ... daß er treulos ist ...«
Urijah lachte kurz auf, nicht ohne spöttische Bitterkeit:
»Treu oder untreu ... Das sind deine Worte ... Du kannst untreu oder treu sein, nicht er ... denn was ist er dir schuldig? ... Frage nicht, Sohn, sondern warte ... Warte mit großer Geduld ... Und wenn du bis zur Stunde deines Todes warten müßtest, warte!«
»Und wenn ich vergeblich warte? ...«
»Dann ist es sein Entschluß, daß du vergeblich wartest, vielleicht zum Guten für dich ... zurückkehren aber kannst du nicht mehr ...«
Von der Mittah her erscholl jetzt der Seherin tiefe Stimme mit tadelndem Laut:
»Grausam sind, die nur mit Ohren hören, die Männer ...«
Sie hatte den Krummstab ergriffen und deutete mit ihm ungefähr in die Richtung, wo Jirmijah stand. Dieser trat vor und bückte sich tief. Dann wollte er sprechen. Sie aber winkte heftig ab. Huldas Gesicht schien unter der inneren Anstrengung, die sich plötzlich ihrer bemächtigt hatte, immer faltiger einzuschrumpfen, die Pelzkappe auf ihrem Kopfe aber zu wachsen. Der Mund der alten Frau begann sich in einem lautlosen Geplapper zu regen. Nach und nach wurden Worte vernehmbar, die abgerissen rasch aufeinanderfolgten, als habe die Seherin nicht Zeit genug, alles, was in wildem Ablauf an ihr vorüberzog, ebenso schnell hervorzubringen:
»Dieser Mann steht in einem Haus ... Er spricht mit einem Weibe in der Finsternis ... Das Weib weint ... Er tut recht, in der Nacht aus seinem Vaterhause zu gehen ... Ich sehe einen öden Ort ... Dort sitzen zwei, er und der Knabe ... Der Knabe bleibt bei ihm ... Sie sitzen an einem Feuer und fürchten die Tiere der Nacht ...«
Hulda stockte. Unmut veränderte den Klang ihrer Stimme:
»Es ist nicht das Richtige, was du getan hast ... Darum verbirgt sich der Herr ...«
Jirmijah war den undeutlich hervorgesprudelten Sätzen der Seherin mühsam gefolgt. Bei ihren letzten Worten schrak er zusammen. Worin hatte er gefehlt? Er hob die Stimme zu einer Frage. Sie aber wies ihn zornig zur Ruhe, winkte ihn noch näher heran und legte ihre winzigen Knochenhände auf seine Hüften. Dann befahl sie:
»Bedecke mit deinen Händen meine Schultern, berühre mit deinen Füßen meine Füße ...«
Nicht ohne ein eigentümliches Grauen zu überwinden, tat Jirmijah wie Hulda ihm geheißen. Sechsfach mit der alten Frau zusammengeschlossen, durchdrang ihn als erste Empfindung die Leichenkälte, die von ihren Gliedern ausging. Sie wiegte den Kopf hin und her und murmelte:
»Eins wie das Kind mit der Mutter ...«
In Jirmijah aber wuchs das Grauen vor dieser neuen Mutter, vor dieser künstlichen Verbundenheit, die sich jetzt auch zur Mitte seines Herzens den Weg bahnte. Am liebsten hätte er sich losgerissen. Der Vollmond trat prall in das westliche Fenster des Dachgemaches und meißelte Huldas zusammengeduckte Gestalt klar aus dem Dunkel. Der Blick ihrer Augen war in sich zurückgesunken. Sie sah ihn an, ohne ihn anzusehn. Dann begann sich ihr zerknittertes Gesicht immer fremder zu verzerren. Der Mund schnappte. Schwer und schwerer pfiff der Atem. Rasche Krämpfe zuckten durch alle Muskeln. In die Blindheit der Augen trat ein schreckerfülltes inneres Leben. Die Brust bäumte sich unter dem Drang von Greuelbildern. Der schwere Atem ging in lautes Stöhnen über, das Stöhnen verwandelte sich in ein wildes Schluchzen, das die kleine Alte hin und her schüttelte. Jirmijah wußte, daß sie im inneren Bilde ihn sah, sein Leben, seine Zukunft, sein Geschick. Er konnte sich nicht länger beherrschen und flehte:
»Was siehst du? ... So rede! ... Alles will ich wissen ...«
Sie hatte ihn nicht gehört. Ihr weinender Atem formte an Wortsplittern:
»Nicht Einsamkeit ... Zum Volke ... Unter die Völker ... Zu den Königen ... Davidsöhne ...«
Jirmijahs Hände umkrampften ihre Schultern. Die Seherin aber wurde von ihrer Schau hochgerissen, so daß er zurücktaumelte. Und jetzt brach aus der Gebrechlichen ein gewaltig lauter Jammer, der sich zu einem gellenden Schrei steigerte.
Die Männer sprangen hinzu, um die aus ihren Gesichten Erwachende zu stützen, sonst wäre sie hingestürzt. Schon aber kam der königliche Kleiderbewahrer durch die Tür gefahren, keuchend vor Zorn.
»Was tut ihr«, schalt er, »ihr tötet mir die Seherin noch ... Habe ich dieses nicht verboten und einen Bund gemacht mit euch? ... Nie wieder kommt mir ein Fremder vor ihr Antlitz ...«
Der alte Schallum kniete vor Hulda hin und begann die Stirn der Erschöpften mit starkem Balsam einzureiben. Dabei knurrte er über seine Schulter:
»Wer verharrt noch? ... Es ist Zeit ... Die Seherin muß schlafen ... Einen langen Schlaf muß Hulda schlafen ... Möchte sie doch Schonung finden, endlich ...«
Über die Treppe, die an der äußeren Mauer zum Dachgemach emporführte, stiegen die Männer im Mondlicht auf die Straße hinab. Trotz seiner Erschütterung gewahrte Jirmijah plötzlich einen jungen Menschen, den er kannte. Es war Chananjah aus Gibeon, sein Amtsbruder an der königlichen Passahtafel. Wie kam Chananjah zu den Männern Gottes? Sollte auch über ihn die Stimme Adonais gekommen sein. Jirmijah verwunderte sich darüber, selbst noch in seiner Erstarrung.