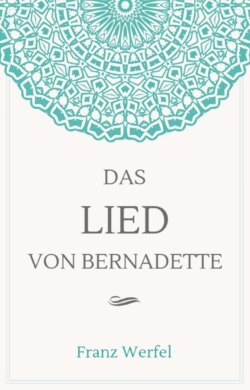Читать книгу Das Lied von Bernadette - Franz Werfel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel Vier. Café Progrès
ОглавлениеAuf dem Stadtplatz Marcadale, wo zumeist sich das öffentliche Leben von Lourdes abspielt, liegt zwischen den beiden großen Speisehäusern das Café Français. Es ist nicht weit entfernt von der Haltestelle der Postomnibusse, von dem wichtigsten Einfallspunkt der großen Welt in die kleine Welt des Pyrenäenstädtchens. Der Cafétier, Monsieur Duran, hat unter erheblichem Kostenaufwand das Lokal im vorigen Jahre neu eingerichtet. Roter Plüsch, Marmortische, Spiegelscheiben, ein riesiger Kachelofen, der einem zinnengekrönten römischen Wachtturm gleicht. Dank dieser Festung von einem Ofen ist das Café Français der bestgeheizte Raum von Lourdes. Herr Duran aber sorgt nicht nur für Wärme, er sorgt auch für Licht. Er hat eine neuartige Form der Beleuchtung eingeführt. Starke, grünbeschirmte, dauerhaft strahlende Petroleumlampen, die, an waageförmigen Stangen befestigt, von der Decke herabhängen und ihren weißlich heimeligen Schein über die Marmortische gießen. Der Cafétier ist überzeugt davon, dass in dem neuerungstollen Paris, das jeder modernen Erfindung atemlos nachläuft, nur sehr wenige Gaststätten mit solchem Lichte gesegnet sind. Duran ist im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute kein besonders sparsamer Mann. Er lässt sein Licht auch am Tage leuchten, wenn es nötig ist, wie zum Beispiel heute, da die Winterdämmerung nicht weichen will. Er geht in seiner Großmut noch weiter. Nicht beim materiellen Lichte lässt er es bewenden. Er ist bestrebt, geistiges Licht zu verbreiten. Zu diesem Zwecke hängen an den Kleiderrechen, wohleingerahmt, eine Menge der großen Pariser Zeitungen, deren Abonnementsspesen der Inhaber des Café Français nicht scheut. »Le Siècle« ist vorhanden, »L'Ère Impériale«, »Le Journal des Débats«, »La Revue des Deux Mondes«, »La Petite République«. Jawohl, auch diese »Petite République«, ein höchst revolutionäres Blatt, gegen den Kaiser und seine Regierung gerichtet, eine kampflustige Gazette, hinter der, wie jedermann weiß, Louis Blanc in Person steht, der sozialistische Gottseibeiuns. Dass »Le Lavedan«, das Wochenblatt von Lourdes, aufliegt, muss nicht eigens erwähnt werden. Die Redaktion hat mit Herrn Duran ein beiderseits günstiges Abkommen getroffen, demzufolge jeden Donnerstag vier Exemplare des frischen »Lavedan« auf den Marmortischen zu liegen haben. Im Hinblick auf all diese Bemühungen um die geistige Verpflegung seines Gästekreises ist es zu verstehen, dass Durans ehrgeiziges Café Français von manchen Leuten auch »Café Progrès« genannt wird.
Zweimal des Tages hat das Lokal ganz großen Zuspruch. Das ist um elf Uhr herum, zur Stunde des Apéritifs, und dann am Nachmittag um vier, wenn die Büros des Landgerichtes schließen. Die Beamten dieser Behörde sind treue Stammgäste des Café Français. Der französische Staat verfolgt bei der Dislozierung seiner Ämter ein eigensinniges Prinzip. Die Préfecture des Départements befindet sich in Tarbes. Demgemäß sollte die Sous-Préfecture in der nächstwichtigen Kantonalstadt ihren Sitz haben, in Lourdes. Aber nein, diese hohe Behörde ist in dem winzigen Argelès untergebracht, wo sie und das Oberkommando der Gendarmerie vom Blutkreislauf der Verwaltung so ziemlich abgeschlossen sind. Der Grund für diese Verbannung bleibt unerfindlich. Lourdes ist darüber mit Recht gekränkt. Lourdes muss besänftigt werden. Man macht es also zum Sitz einer hohen Gerichtsinstanz, die von Rechts wegen nach Tarbes gehört. So kommt es, dass Monsieur Duran zu seinen Gästen zählt Pougat, einen regelrechten Landgerichtspräsidenten, mehrere Richter, den kaiserlichen Staatsanwalt Dutour, eine Anzahl von Verwaltungsbeamten, Rechtsanwälten und Gerichtsschreibern.
Zur Stunde ist noch keiner dieser Herren erschienen. Am runden Tisch in der Ecke sitzt Monsieur Hyacinthe de Lafite allein. Monsieur de Lafite ist nicht Monsieur de Lafite in Person, sondern ein unbegüterter Vetter des reichen Mannes. Ihm ist ein Turmzimmer im Château eingeräumt, das zu beziehen ihm freisteht. Die Familie de Lafite ist sehr oft auf Reisen. Umso mehr macht in letzter Zeit Herr Hyacinthe von seiner Zuflucht Gebrauch. Dieses Lourdes ist für einen leeren Beutel die reinste Klinik, und Paris, das nicht unterscheiden kann zwischen echt und unecht, möge der Teufel holen! Wer kann in Paris arbeiten? Journalisten, Huren und Seelenverkäufer.
Man sieht Hyacinthe de Lafite auf den ersten Blick an, dass etwas Besonderes in ihm steckt. Er trägt sich mit einem Stich ins Altväterische. Die üppig geschlungene Plastronkrawatte zum Beispiel erinnert an Alfred de Musset. Das aus der abgeeckten Stirn zurückgestrichene Haar erinnert an Victor Hugo. Obwohl de Lafite das vierzigste Jahr noch lange nicht erreicht hat, ist dieses Haar schon grau meliert. Man war einmal fast befreundet mit Victor Hugo, das heißt, dieser Gigant hat sich vor langen Jahren einmal zu einer angenehmen Bemerkung über de Lafite herabgelassen. Man hat damals mitgewirkt in der Hernani-Schlacht der Comédie Française. Man hat zu jenen Auserwählten gehört, die rote Westen trugen. Man kennt übrigens außer Hugo, der längst im Exil ist, auch noch den alten Lamartine und den jungen Théophile Gautier und viele andere und will nichts mehr wissen von dieser ganzen überheblichen Gesellschaft.
Lourdes scheint der rechte Ort zu sein, um an den Busen einer etwas gewalttätigen Natur zu flüchten und, unbekümmert um die verletzenden Wertungen der Pariser Salons und Cafés, ein langatmiges Werk zu frönen. Hyacinthe de Lafite wälzt in seinem Haupte den tollkühnen Plan, die romantische Schule, der er sich selbst zugehörig fühlt, mit dem Klassizismus zu versöhnen. Unbegrenzte Phantasie in strenger Form, das ist seine Parole. Er arbeitet an einer Tragödie »Die Gründung von Tarbes«. Den Stoff verdankt er seinem Freunde, dem Schuldirektor Clarens, der ein emsiger Sagenforscher ist und im »Lavedan« die Rubrik »Loredanische Altertümer« redigiert. Es handelt sich in den genannten Werken um eine äthiopische Königin namens Tarbis, die zu einem biblischen Helden in Liebe erglüht, von diesem abgewiesen wird und nach Westen in die Länder der Pyrenäen flüchtet, um ihren Schmerz zu vergessen. Hier kommt sie, befreit von den düsteren Göttern des Orients, in Berührung mit den heiteren Gottheiten des Abendlands, die ihr die Qual vom Herzen zaubern. Als ihre Priesterin erbaut sie Tarbes.
Kein schlechter Stoff, wie man sieht, und voll von sinnbildlichen Anspielungen. Der Dichter schreibt ihn in puren Alexandrinern, eine verwegene Kampfansage gegen den Shakespearismus Victor Hugos. Auch ist er eisern entschlossen, als Nachfahre Racines, an der dramatischen Einheit von Ort und Zeit festzuhalten. Bedauernswert ist es nur, dass er nach mehr als zweijähriger Arbeit über das vierzigste Alexandrinerpaar noch nicht hinausgekommen ist. Hingegen bringt der heutige »Lavedan« einen Artikel von ihm, in dem er seine literarischen Stilprinzipien darlegt. Die Redaktion hatte sich lange gewehrt, diesen Artikel zu veröffentlichen, indem sie ins Treffen führte: »Das ist nichts für unsere Analphabeten.«
Der »Lavedan« liegt vor Lafite auf dem Tisch. Er ist heute Morgen pünktlich erschienen. Das geschieht nicht allzu häufig. Meist erscheint dieses fortschrittliche Wochenblatt zwei und drei Tage nach dem festgesetzten Termin. Abbé Pomian pflegt deshalb zu sagen: »Ein merkwürdiger Fortschritt das, der immer zu spät kommt.«
Der befreundete Gegner Victor Hugos brennt darauf, dass sein Artikel gelesen werde. Insbesondere ist ihm daran gelegen, dass der Philolog und Humanist Clarens sich ehemöglichst in ihn vertiefe. Es stehen drei Sätze über Racine darin, die man auf der Zunge zergehen lassen muss. Clarens aber, der soeben auftaucht, ist so tief in seine eigene fixe Idee verfangen, dass er dem neuen »Lavedan« und dem Autor Lafite keine Aufmerksamkeit zollt. Es ist die alte Tragik solcher schöngeistigen Beziehungen. Der Gelehrte hat einen tellergroßen, abgeplatteten Stein mitgeschleppt, den er jetzt vorsichtig aus einem Tuch knüpft. Eigensüchtig schiebt er ihn dem Schriftsteller unter die Augen und drängt ihm eine Lupe auf:
»Da sehen Sie nur, mein Freund, was ich für einen Fund gemacht habe. Raten Sie, wo? Ah, Sie werden es nicht erraten. Auf dem Spelunkenberg, in einer der Grotten, mitten unter dem Geröll lag dieser Stein und hat mich geradezu angerufen. Betrachten Sie ihn gut! Mit der Lupe! Sie erkennen das Stadtwappen von Lourdes, nicht wahr! Es unterscheidet sich im Stil wesentlich von der heutigen Form. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es auf das frühe sechzehnte Jahrhundert zurückgeht. Über den Türmen der Burg schwebt der Adler mit dem Fisch im Schnabel. Die Türme aber zeigen, anders wie im gegenwärtigen Wappen, die reinste maurische Architektur. Mirambelle – ich brauche Sie nicht zu belehren – war der mittelalterliche Name unsrer Stadt. Miriam-Bell. Miriam ist die maurische Form von Maria. Die Forelle, die der Adler im Schnabel trägt, ist nichts andres als Ichthys, das Christuszeichen, das über die frisch für Maria eroberte Burg abgeworfen wird. Sie sehen wie überall im Lande das marianische Prinzip ...«
Lafite unterbricht ihn, weil er sich ärgert, aus blankem Widerspruchsgeist:
»Ich bin durchaus nicht Ihrer Ansicht, mein Freund. Meines Dafürhaltens gehen alle diese heraldischen Tiersymbole auf vorchristliche Zeiten zurück.«
»Aber Sie werden doch nicht leugnen, mein Freund«, wendet der alte Clarens ein, »dass selbst der Gave in seinem Namen ein Ave umschließt.«
Der Dichter leugnet es rundweg. Wie alle Geister seiner Art lässt er sich von der Improvisation auf einen ihn selbst überraschenden Weg verlocken, nur um recht bald an das Ziel zu gelangen, das einzig ihn beschäftigt:
»Als Philologe wissen Sie besser als ich, mein Freund, dass der Buchstabe Gamma in manchen Sprachen zum Jota hinüber metastasiert und umgekehrt. Warum soll der Gave nicht nach dem biblischen Jahwe benannt sein, den meine Königin Tarbis nach ihrer unglücklichen Erfahrung mit dem Hebräer ins Land gebracht hat? Wenn Sie mein Werk lesen oder zumindest den heutigen Aufsatz ...«
Weiter kommt er nicht. Das feinsinnige Gespräch muss abgebrochen werden. Es hat elf geschlagen. Die Stunde des Apéritifs ist da. Nacheinander erscheinen sie alle, die zur Intelligenz und Notabilität von Lourdes gehören. Unterhaltungen freilich wie die soeben stattgehabte kann man mit all diesen Anwälten, Offizieren, Beamten, Ärzten nicht führen. Ihr Sinn ist dem nutzfreien Humanismus nicht gerade hold. Zuerst kommt Doktor Dozous, der Stadtarzt, eine vielbeschäftigte Seele. Immer auf dem Sprung, immer zwischen zwei ›Fällen‹, die seiner bedürfen, lässt er sich's zu dieser Stunde nicht nehmen, unter anderen angesehenen Männern ein Glas Portwein oder Malvasier zu leeren. Es gibt Ärzte genug in Lourdes. Da ist der Doktor Peyrus, der Doktor Vergez, der Doktor Lacrampe, der Doktor Balencie. Dennoch ist der Stadtarzt Dozous überzeugt davon, dass die ganze Last der hiesigen medizinischen Wissenschaft auf seinen etwas zu hohen Schultern liegt. Noch nicht ist erloschen in seiner Seele die leidenschaftliche Neugier des Naturforschers. Deshalb unterhält er neben seinem vollgemessenen Tagespensum eine rege ärztliche Korrespondenz, um in der Provinz nicht wissenschaftlich zu verbauern. Wie mag der große Charcot, wie der berühmte Voisin, Leiter der Salpêtrière in Paris, erschrecken, wenn er einen der langen Briefe des Stadtarztes von Lourdes unter seiner Post findet, diese wissbegierigen Fragebogen, die zu beantworten eine gute Stunde fordert.
»Ich werde die Herren nur drei Minuten stören«, sagt Dozous. Es ist sein täglicher Gruß. Er nimmt auf dem Rande eines Sessels Platz, ohne Hut und Mantel abzulegen, was im Hinblick auf den Feuerofen Durans und die prophylaktische Praxis ein bemerkenswerter Fehlgriff ist. Jetzt greift er nach dem ›Lavedan‹, schiebt die Brille in die Stirn und beginnt das Blättchen durchzuschmökern. Wie sehr sich Hyacinthe de Lafite auch in den Anblick des Lesenden vertieft, er nimmt auf der Miene des Doktors kein günstiges Anzeichen wahr, dass sein Artikel bemerkt wird. Inzwischen ist Monsieur Jean Baptiste Estrade, der Steuerverwalter von Lourdes, zu dem Tisch gestoßen. Dieser Mann mit dem dunklen Spitzbart und dem schwermütigen Blick besitzt in den Augen des Schriftstellers einige Vorzüge. Er redet wenig, aber hört vortrefflich. Er scheint geistigen Erkenntnissen und Formulierungen nicht ganz verschlossen zu sein. Der Arzt hat gleichgültig die Zeitschrift dem Steuerverwalter in die Hand gespielt. Nun blättert Estrade sie mit zerstreuten Fingern durch. Als er gerade die Seite erreicht hat, wo Lafites Aufsatz prangt, muss er aber den ›Lavedan‹ hinlegen, denn alle Herren erheben sich. Es geschieht nicht alle Tage, dass der Herr Bürgermeister in Person die Tafelrunde beehrt.
Die gewichtige Figur A. Lacadés schiebt sich, nach allen Seiten grüßend, leutselig heran. Man sieht es dem Maire von Lourdes an, dass er die längste Zeit seines Lebens nicht mit Unrecht der ›schöne Lacadé‹ hieß. Angesichts seines Bauches, der Backentaschen und Augensäcke kann niemand mehr von Schönheit sprechen, dafür umso nachdrücklicher von einer gut geölten, ja geschmeidigen Würde, wie sie bei politisch begabten Korpulenten nicht selten ist. Er hat sich, obwohl aus der engsten bäuerlichen Armut des Landes Bigorre stammend, glänzend in seine öffentliche Rolle eingelebt. Als er das erste Mal zum Bürgermeister von Lourdes gewählt wurde, das war um 1848 herum, sagten ihm böse Zungen nach, er sei ein ausgemachter Jakobiner. Heute ist er ein bewährter Anhänger des kaiserlichen Regimes. Wer ändert seine Anschauungen nicht mit der reifenden Zeit? Lacadé geht immer schwarz gekleidet, als sei er unablässig bereit, sich von seinen zeremoniellen Pflichten überraschen zu lassen. Er hat weite, fast majestätische Bewegungen. Seine Stimme ist herablassend. Wenn er spricht, so scheint es stets, dass er anspricht. Auch die beiden staatlichen Funktionäre, die mit ihm eingetreten sind, begönnert er. Dies ist Vital Dutour, Procureur Impérial, ziemlich jung, glatzköpfig, ehrgeizig und zu Tode gelangweilt. Der andere ist der Polizeikommissär Jacomet, ein Mann Anfang Vierzig, mit schweren Händen und jenem unheilverkündenden Blick, der nun einmal auch bei harmlosen Leuten zum Kriminalistenberuf gehört.
Der Bürgermeister schüttelt allen die Hände, lässt seine Jovialität spielen. Der Cafétier Duran stürzt herbei, nimmt die Bestellungen entgegen und bringt nach einer Weile das Tablett mit den Getränken eigenhändig:
»Ah, Messieurs! Leider sind die Zeitungen aus Paris heute nicht eingetroffen! Welch ein Kreuz mit unserer Post!«
»Bah, die Pariser Zeitungen«, spottet jemand. »Im Februar ist die Politik ebenso finster wie das Wetter ...«
Der kleine Duran beeilt sich zu versichern:
»Wenn aber die Herren die gestrige Nummer des ›Mémorial des Pyrénées‹ oder den ›Intéret Public‹ von Tarbes zu sehen wünschen ... Und ›Le Lavedan‹ ist erschienen, pünktlich, liegt auf ...« Er neigt sich ein wenig zu Lacadés Ohr:
»Und ein Artikelchen ist drin, Monsieur le Maire, ein feines, sauberes Stück Arbeit ...«
Lafite horcht auf. Der Cafétier spitzt genussvoll die Lippen:
»Das Artikelchen werden sich die diversen Soutanen hier nicht hinter den Spiegel stecken ... Noch einen Malvasier, Monsieur le Maire?«
Lacadé erhebt einen seherischen Blick und eine füllige Stimme:
»Ich kann Ihnen und uns allen eine bessere Post versprechen, mein lieber Duran. Großes wird für unser armes Lourdes geschehen. Auf meine unaufhörlichen Vorstellungen hin erwägt man hohen Ortes einen Anschluss an das Netz der Eisenbahn ... Ich hoffe, die Herren sind alle Lokalpatrioten, gleich mir. Nicht wahr, Monsieur le Procureur?«
Vital Dutour erwidert mit trockener Höflichkeit:
»Wir vom Gericht sind wie die Vagabunden. Heute sind wir hier, morgen versetzt man uns anderswohin. Unser Lokalpatriotismus kann nicht recht warm werden ...«
»Gleichviel, der Bahnanschluss kommt«, weissagt Lacadé.
Das Gesicht Durans leuchtet auf. Ihm fällt eine der goldenen Wortprägungen ein, die er in der Zeitung gelesen hat. Da er so viel Geld für sie ausgibt, fühlt sich der Cafétier auch verpflichtet, all diese Blätter bis in die Nacht hinein zu studieren. Ein mühsames Werk, das den ungeübten Augen schadet, der gebildeten Ausdrucksweise aber förderlich ist. Er spricht:
»Verkehrsmittel und Schulbildung, das sind die beiden Grundpfeiler der sich höher entwickelnden Menschheit ...«
»Bravo, Duran«, nickt Lacadé. »Besonders das mit den Verkehrsmitteln! Schau einmal an, da liefert mir dieser alte Kellner eine tadellose Wendung für eine Festrede. Ich muss sie mir merken.« Das Lob des Bürgermeisters beflügelt Duran. Er hebt etwas steif die rechte Hand, wie es Dilettanten tun, die Theater spielen:
»Wenn die Entfernung zwischen den Menschen geringer, ihr Wortschatz aber größer sein wird, dann schwinden Aberglauben, Fanatismus, Intoleranz, Krieg und Tyrannei, dann wird vielleicht schon die nächste Generation oder spätestens das nächste Jahrhundert Zeuge des Goldenen Zeitalters sein ...«
»Woher haben Sie das, mein Freund?« staunt Lacadé misstrauisch.
»Das ist halt so meine bescheidene Ansicht, Monsieur le Maire ...«
»Ich schätze weder die Verkehrsmittel noch auch die Schulbildung so hoch ein wie Freund Duran«, sagt plötzlich Lafite, der seine Missstimmung kaum beherrschen kann.
»Oho«, lacht Dutour. »Ein Dichter aus Paris wird doch kein Reaktionär sein.«
»Ich bin weder Reaktionär noch Revolutionär. Ich bin ein unabhängiger Geist. Als solcher aber sehe ich in der Höherentwicklung der breiten Massen durchaus nicht den Sinn der Menschheit.«
»Vorsichtig, mein Freund, vorsichtig«, mahnt der Humanist Clarens.
»Und was wäre dieser Sinn?« fragt J. B. Estrade nachdenklich vor sich hin. Hyacinthe de Lafite nimmt mit grundloser, aber fühlbarer Erbitterung das Wort:
»Wenn die Menschheit überhaupt einen Zweck besitzt, so nur diesen einzigen, das Genie hervorzubringen, das außerordentliche Wesen. Dies ist meine Überzeugung. Die Massen mögen leben, leiden und sterben dafür, dass von Zeit zu Zeit ein Homer entstehe, ein Raffael, ein Voltaire, ein Rossini, ein Chateaubriand und meinetwegen ein Victor Hugo ...«
»Traurig«, sagt Estrade, »traurig für uns andere unbedeutende Erdenwürmer, gar nichts Besseres sein zu dürfen als der schmerzhafte Umweg zu diesen glänzenden Resultaten ...«
»Es ist die Philosophie eines Dichters«, erklärt Lacadé nachsichtig und unaufmerksam. »Da wir aber einen Dichter in unserer Stadt haben, so sollte er etwas für Lourdes tun. Auf, Herr de Lafite, schreiben Sie in der Pariser Presse, schreiben Sie über unsre Naturschönheiten, über unsre Aussichtspunkte, über die Pibeste, den Pic de Ger und den überwältigenden Anblick der Pyrenäen. Schreiben Sie über die städtischen Einrichtungen, über das trauliche Leben, das unser feuriges Völkchen in all seiner Bedürfnislosigkeit führt. Schreiben Sie über dieses prächtige Café Français! Schreiben Sie über was Sie wollen! Rufen Sie aber Paris und damit der ganzen Welt zu: Warum lasset ihr Hochmütigen Lourdes beiseite liegen, wenn ihr nach Cauterets und Gavarnie in die Bäder fahrt? Auch wir sind bereit, euch würdig zu empfangen mit guten Unterkünften und erstklassiger Küche ... Ich frage mich übrigens sehr lange Zeit schon, meine Herren, warum Cauterets und Gavarnie, diese elenden Nester, bevorzugt sein sollen? Die Thermalbäder? Die Mineralquellen? Nun, wenn es einige Meilen von uns, in Gavarnie und Cauterets, Heilquellen gibt, warum dann nicht in Lourdes? Es ist ein einfaches Rechenexempel. Wir müssen nur diese Heilquellen entdecken. Wir müssen sie nur aus dem Felsen schlagen. Jawohl, das ist meine feste Absicht! Ich habe schon mehrere Relationen an Baron Massy, den Präfekten, abgesandt. Bessere Straßen, bessere Post, höhere Aufwendungen. Wir werden den Strom des Geldes und der Zivilisation nach Lourdes leiten ...«
Der Bürgermeister hat zum Apéritif eine glänzende Rede gehalten, das muss er sich selbst zugestehen. Die pathetische Wärme, die ihn erfüllt, gibt ihm das Bewusstsein, ein Stadtvater sondergleichen zu sein. Wie verwaist wird Lourdes nach seinem Tode dastehen! Er schlürft zufrieden die Neige seines Malvasiers. Knapp danach bricht man auf. Die Frauen warten daheim mit dem Déjeuner.
In seine Pelerine gewickelt, geht Hyacinthe de Lafite einsam die Rue Basse entlang. Ihn durchdringt keine pathetische Wärme, sondern schneidende Kälte außen und innen. Plötzlich bleibt er stehen und starrt die schmutzigen Häuser an, die seinen trostlosen Blick trostlos erwidern. Zum Teufel, was suche ich hier? Auf den Boulevard des Italiens gehöre ich und in die Rue du Faubourg Saint Honoré. Warum lebe ich in diesem dreckigen Nest? Während er weitergeht, gibt er sich die Antwort: Ich lebe in diesem dreckigen Nest, weil ich selbst ein dreckiger Hund bin, dem man einen Knochen zuwirft, der arme Verwandte, der für die Mildherzigkeit dieser aufgeblasenen Provinzfamilie dankbar zu sein hat. Ich habe ein warmes Zimmer und ausgezeichnetes Futter und kann am Tag kaum fünf Sous anbringen. Mein Umgang sind die kleinen Leute des Café Français, für die ich ein verschlossenes Buch bin. Nicht zu Gott gehöre ich und nicht zu den Menschen. Wahrhaftig, der höhere Geist ist in dieser Welt der arme Verwandte par excellence.