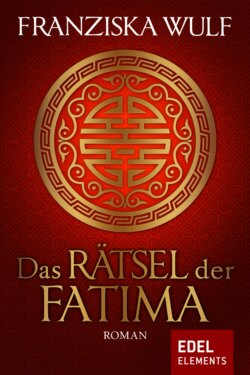Читать книгу Das Rätsel der Fatima - Franziska Wulf - Страница 7
3
ОглавлениеMaffeo Polo saß auf seinem Pferd und starrte geistesabwesend in die Ferne. Aus einem unerfindlichen Grund hatte er an diesem Tag überhaupt keine Freude an der Jagd. Da ihm keine andere Erklärung einfiel, schob er es auf die Anwesenheit seines Bruders Niccolo, der ihn und Dschinkim heute begleitete. Was allerdings nur selten geschah, denn normalerweise hatte er wichtigere Aufgaben zu erledigen und für »nutzlose Zerstreuung«, wie er sich immer ausdrückte und womit er natürlich die Jagd meinte, keine Zeit. Doch lag es wirklich an Niccolo, dass heute das Gewicht des Adlerweibchens auf seinem Arm lastete, als wäre der Vogel aus Blei gegossen? Vielleicht war es ja die Kälte. Der Winter war nicht mehr weit. Das lange Steppengras war mit silbrig weißem Reif überzogen und knirschte unter den Hufen der Pferde. Über die baumlose Steppe wehte ein eisiger Wind, der trotz des strahlend blauen Himmels nach Schnee schmeckte und wie tausende winziger Nadeln in die Haut stach. Doch tief in seinem Inneren wusste Maffeo, dass dies alles nicht stimmte. Weder Niccolo noch die Kälte waren der Grund für Unzufriedenheit und Schwermut. Er scheute sich einfach, der Wahrheit ins Auge zu sehen – welche Wahrheit es auch immer sein mochte.
»Worauf wartest du, Maffeo?«, rief Dschinkim und riss ihn aus seinen trüben Gedanken. Der Mongole lachte über das ganze Gesicht und schien die schlechte Stimmung seines Jagdgefährten nicht zu bemerken. »Wenn du es nicht bald fliegen lässt, bleibt für dein Adlerweibchen kein Wild mehr übrig!«
Maffeo blickte empor. Er musste seine Augen mit der Hand beschatten, damit die Sonne ihn nicht blendete. Und doch konnte er das Steinadlerweibchen kaum sehen, das Dschinkim vor wenigen Augenblicken aufgelassen hatte. Flog der Vogel bereits so hoch, oder lag es daran, dass die Sehkraft seiner Augen allmählich nachließ?
Maffeo seufzte. Gern wäre er einfach nur gemächlich über die sanften Hügel geritten, um den Winterduft des hohen Grases einzuatmen, anstatt in halsbrecherischem Tempo den Steinadlern und ihrer Beute hinterherzujagen. Doch Dschinkim gegenüber konnte er das kaum zugeben, er hätte es nicht verstanden. Wie denn auch. Der Mongole befand sich in der Blüte seiner Jahre, er strotzte vor Leben und vor Kraft und liebte die Falknerei ebenso wie schnelle, anstrengende Ritte über die schier endlosen Hügel der mongolischen Steppe. Die zermürbenden Gebrechen des Alters, der Wunsch nach Ruhe und die Sehnsucht nach einem wärmenden Feuer waren ihm noch fremd.
Maffeo zuckte zusammen. Nun hatte seine Unzufriedenheit und Lustlosigkeit doch einen Namen bekommen, einen hässlichen, verhängnisvollen – das Alter.
»Dschinkim hat recht«, sagte Niccolo mit glühenden Wangen. Der Bruder, der sich sonst nur mit den niedrigsten Getreidepreisen und den günstigsten Handelswegen beschäftigte, schien die Jagd mehr zu genießen als Maffeo. »Dschinkim wird dir noch die ganze Beute wegschnappen.«
Das Steinadlerweibchen schien Niccolos Worte unterstreichen zu wollen. Ungeduldig zerrte es an dem Lederband, an dem Maffeo es festhielt. Es wollte fliegen, es wollte jagen, es wollte seiner Schwester folgen, deren Schrei es trotz der Kapuze hören konnte. Allmählich wurde Maffeos Arm lahm unter dem Gewicht des großen Vogels, und seine Schulter begann zu schmerzen. Immer deutlicher spürte er die scharfen Krallen, die sich trotz des Falknerhandschuhs aus doppelt genähtem und gefüttertem Leder in seinen Unterarm gruben. Die Krallen und Schnäbel der Steinadler waren kräftig genug, um Füchse oder gar Wölfe zu reißen. Und die Falkner mussten stets auf der Hut sein, um nicht ebenfalls verletzt zu werden.
Meine Finger werden langsam steif, dachte Maffeo, als er umständlich die Kapuze losband und dabei dem spitzen Schnabel des Adlers zu nahe kam. Ich bin ein alter Mann. Ich sollte zu Hause bleiben und meine Glieder am Kohlenfeuer wärmen, anstatt auf die Jagd zu gehen.
Doch Dschinkim hatte ihn und Niccolo darum gebeten, an dieser Jagd teilzunehmen. Nur er und die beiden Brüder, keine weitere Begleitung. Und wer war er, Maffeo Polo, dass er dieses Zeichen der Freundschaft des Bruders und Thronfolgers des großen Khubilai Khans ablehnen konnte?
Er ließ die Leine los. Der Steinadler kreischte und hackte noch mal wütend nach Maffeos Hand, als wollte er seinen Herrn dafür bestrafen, dass dieser ihn so lange festgehalten hatte. Dann breitete er seine Flügel aus. Die Federn streiften Maffeos Wange und rissen ihm beinahe die pelzgefütterte Mütze vom Kopf, als sich der große, majestätische Vogel in die Luft erhob und dorthin flog, wo er hingehörte. Hoch oben am Himmel, zwei winzige schwarze Punkte inmitten des unendlichen Blaus, trafen sich die beiden Adler. Sie umkreisten einander, stießen abwechselnd hinab, fingen ihren Sturzflug abrupt ab, um gleich darauf wieder emporzusteigen. Es sah aus, als würden sie miteinander tanzen.
Der Tanz der Freiheit, dachte Maffeo. Wehmütig sah er den beiden Adlern zu und hoffte, dass sie ihre Chance ergreifen und diesmal nicht zu ihnen zurückkehren würden. In Gedanken begleitete er den Flug der Steinadler. Er flog mit ihnen über die mongolische Steppe und die Wüste, überquerte das Gebirge, gelangte an die Küste und erreichte schließlich eine Stadt fern im Westen; eine Stadt, in der die Menschen sich in Booten fortbewegten, weil es dort mehr Kanäle als Straßen und Gassen gab. Seine geliebte Stadt...
Seit über sechs Jahren lebte er gemeinsam mit seinem Bruder Niccolo und dessen Sohn Marco am Hof des großen und allmächtigen Khubilai Khans. Einem Hof, den nichts auf dieser Welt, nicht einmal die Wohnstätte des Papstes in Rom, an Pracht und Reichtum überbieten konnte. Ihnen erging es gut. Sie waren Berater des großen Khubilai Khans und als solche überall hoch angesehen. Der Herrscher selbst behandelte sie voller Freundlichkeit. Sie wohnten im Palast des großen Khans in eigenen Wohnungen, die so geräumig waren wie die Paläste der Dogen in Venedig. Maffeo hatte Diener, die ihm das Essen zubereiteten, so wie er es liebte, und die sich ausschließlich um seine Bedürfnisse kümmerten. Es mangelte ihm an nichts, und selbst der ausgefallenste Wunsch wurde prompt erfüllt. Es war fast wie im Paradies. Doch sogar im Garten Eden hatte die Schlange gewohnt. Das höfische Leben mit seinen Heuchlern, den Schmeicheleien und Intrigen ermüdete Maffeo. Immer öfter träumte er von seiner Heimat. Und er hätte sein Leben dafür gegeben, wieder dort zu sein. Venedig – der Klang dieses Namens trieb ihm manchmal Tränen der Sehnsucht in die Augen. Vielleicht war auch das ein Zeichen seines fortschreitenden Alters, der Wunsch eines alten Mannes, sein Leben dort zu vollenden, wo es begonnen hatte.
»Sieh nur!«, rief Dschinkim in diesem Augenblick und riss dadurch Maffeo erneut aus seinen trüben Gedanken. »Die Adler haben Beute erspäht.«
Als Maffeo sich anstrengte, konnte auch er erkennen, dass die beiden Steinadler über ein und derselben Stelle kreisten und schließlich einer nach dem anderen hinabstießen. Dschinkim stieß den hohen, sirrenden Jagdschrei der mongolischen Krieger aus, trat seinem Pferd in die Flanken und galoppierte los. Er musste schnell sein, um die Steinadler zu erreichen, bevor sie die Beute mit ihren scharfen Klauen und Schnäbeln in Stücke gerissen und damit das Fell des Beutetiers wertlos und unbrauchbar gemacht hatten.
Niccolo und Maffeo folgten dem Mongolen, so schnell es ihnen möglich war. Doch für Maffeo wurde der kurze Ritt zur Qual. Jeder Schritt, jede Unebenheit, jeder Stein und jede Senke trafen seine Knochen wie gewaltige Hammerschläge, und er musste aufpassen, dass die Zügel seinen steifen Händen nicht entglitten. Wo war nur die Geschmeidigkeit geblieben, mit der er noch bis vor Kurzem auf dem Pferderücken gesessen hatte? Er warf Niccolo einen verstohlenen Blick zu. Wenn auch er unter den beginnenden Anzeichen des Alters zu leiden hatte, dann ließ er es sich nicht anmerken.
Wenn wir wieder in Shangdou sind, werde ich mich an einen der chinesischen Ärzte wenden, dachte Maffeo. Ihre Kräuter und ihre Nadeln werden mir bestimmt helfen.
Doch in Wirklichkeit machte er sich keine großen Hoffnungen. Selbst die weisesten Ärzte waren wohl kaum in der Lage, ihm seine Jugend zurückzugeben.
Sie hatten Dschinkim noch nicht eingeholt, da wusste Maffeo, dass etwas nicht stimmte. Er konnte es hören. Hinter der nächsten Hügelkuppe schrien die beiden Steinadler, als wären Dämonen oder die Geister von Untoten in sie gefahren. Ihre Schreie klangen nach Zorn, nach Todesangst und nach Qual; sie wurden begleitet von Dschinkims lauten Rufen und dem tiefen, unheilvollen Knurren eines wilden Tiers.
Schauer liefen Maffeo über den Rücken. Nie zuvor hatte er etwas Derartiges gehört. Sogar Niccolo, dem jede Jagderfahrung fehlte, wurde misstrauisch.
»Was ist da vorne los?«, fragte er.
»Ich weiß es nicht. Aber normal ist das nicht.«
War Dschinkim in Gefahr? Vergessen waren seine Schmerzen. Voller Angst um seinen Freund trieb Maffeo sein Pferd den Hügel hinauf. Er hatte kaum die Kuppel erreicht, als sich sein Adlerweibchen mit einem Schrei auf ihn stürzte. Geistesgegenwärtig riss Maffeo den linken Arm hoch, damit sich der Vogel dort niederlassen konnte. Trotzdem warf ihn das plötzliche Gewicht beinahe aus dem Sattel. Der Steinadler trat von einem Bein auf das andere, rieb seinen Kopf an Maffeos Falknerhandschuh und stieß Töne aus, die klangen, als hätte er Maffeo schon lange schmerzlich vermisst. Seit sie am Hof des Khubilai Khans lebten, ging Maffeo regelmäßig mit den Mongolen zur Jagd. Trotzdem war ihm so etwas in all den Jahren nicht passiert. Die Steinadler waren zwar für die Jagd abgerichtet und kehrten immer wieder zu ihrem Herrn zurück, aber sie waren nicht gezähmt. Es waren wilde Tiere, die ihrem Falkner niemals Zuneigung entgegenbrachten -höchstens in den Geschichten und Legenden aus den Anfängen der Zeit, die sich die Alten abends oder beim Naadam-Fest erzählten, wenn sie sich um die Kohlenfeuer versammelten. Was war also geschehen?
»Beim Allmächtigen!«, rief Niccolo in diesem Moment aus und bekreuzigte sich hastig. Er war kreidebleich. »Ich fürchte, Dschinkim ist tot!«
Nun sah auch Maffeo, was seinen Bruder erschreckt hatte, und ihm stockte der Atem. Vor ihnen lag ein breites, flaches Tal, und fast genau in dessen Mitte kniete Dschinkim regungslos wie eine Statue. Um ihn herum hatte sich eine Blutlache gebildet. Doch er war nicht tot – wenigstens noch nicht. Niccolos Stimme schien den Mongolen aus seiner Erstarrung zu erlösen. Langsam, als würde er aus einem furchtbaren Traum erwachen, sah er auf. Sein Gesicht war blutüberströmt.
»Maffeo!«, rief Dschinkim, und es klang, als würde eine unsichtbare Hand versuchen ihn zu erwürgen. »Maffeo!«
Maffeo gab seinem Pferd einen Tritt in die Flanken und galoppierte den Hügel hinunter. Empört kreischte der Steinadler auf, schlug mit den Flügeln und bohrte seine Krallen tief in den Arm seines Herrn, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Doch Maffeo achtete nicht darauf. Er sprang vom Pferd und verdrängte sogar die Schmerzen, die durch seine Gelenke peitschten. So schnell seine Beine und der flügelschlagende Adler es zuließen, rannte er das letzte Stück und fiel schließlich neben seinem Freund auf die Knie.
»Dschinkim!«, keuchte er. »Bist du verletzt?«
Dschinkim schüttelte den Kopf. Und im gleichen Augenblick erkannte Maffeo, dass das Blut nicht von dem Mongolen stammte. In der Blutlache schwammen braune Federn, und gleich daneben lag der grauenvoll zugerichtete Körper des Steinadlerweibchens. Voller Entsetzen starrte Maffeo das zerfetzte Bündel Federn an, das noch vor wenigen Augenblicken ein majestätischer Vogel gewesen war.
»Herr im Himmel, was...«
»Es war ein Fuchs«, sagte Dschinkim und streichelte die Überreste des Vogels, als hätte er einen geliebten Freund verloren.
»Ein Fuchs?«, rief Maffeo aus. »Aber wie ist das möglich? Wie kann ein Fuchs es mit einem Steinadler aufnehmen und ihn sogar töten?«
Dschinkim zuckte ratlos mit den Schultern. »Dieser Fuchs war eine Bestie, ein riesiges Monster mit zotteligem braunem Fell. Ich habe noch nie einen größeren Fuchs gesehen, in meinem ganzen Leben nicht. Beide Adler haben ihn mit ihren Klauen und Schnäbeln attackiert. Aber er biss zurück und kämpfte wie ein Besessener. Auch die Steinadler schienen überrascht zu sein, denn sie versuchten, sich zurückzuziehen. Doch bevor sie es schafften, gelang es dem Fuchs, mein Weibchen mit seinen Pfoten zu packen. Und was dann geschah...« Dschinkim schloss die Augen und erschauerte. »Das war kein normaler Kampf, Maffeo. Dieser Fuchs hat mein Weibchen nicht einfach getötet, er hat es regelrecht abgeschlachtet. Zuerst zerfetzte er ihm die Flügel, um seine Flucht zu verhindern. Doch mein Weibchen gab nicht auf. Vor Angst und Schmerz halb wahnsinnig, versuchte es davonzulaufen. Dabei stolperte es über seine gebrochenen, blutigen Flügel. Es fiel hin und kroch mühsam auf dem Bauch voran. Diesen Anblick werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Dein Weibchen attackierte die Bestie mit Klauen und Schnabel, ich schrie und versuchte, den Fuchs von den beiden Adlern abzulenken. Ich schoss sogar einen Pfeil ab, doch ohne Erfolg. Der Fuchs setzte dem Adler nach und biss ihm in den Rücken. Ich hörte die Wirbelsäule unter seinen Zähnen brechen. Mein Adlerweibchen, das sich gerade mühsam wieder aufgerappelt hatte, knickte zusammen wie ein Halm im Wind. Es schrie, wie ich noch nie zuvor einen Adler habe schreien hören. Hilflos lag es am Boden. Doch der Fuchs ließ immer noch nicht von ihm ab. Erst als es so schwach war, dass es nicht einmal mehr schreien konnte, gab der Fuchs ihm den erlösenden Biss in die Kehle und verschwand, ohne sich noch einmal umzuschauen.«
Maffeo sah die blutige Spur im Gras, die den nächsten Hügel hinaufführte.
»Du sagtest, du hast einen Pfeil abgeschossen. Hast du ihn getroffen?«
Dschinkim nickte. »Ja, hinter der rechten Schulter. Er hat stark geblutet, aber er schien es nicht einmal zu merken.«
»Kommt, wir müssen ihm nachstellen«, erklärte Niccolo. »Wenn der Fuchs tatsächlich verletzt ist, kann er noch nicht weit weg sein.«
Doch Dschinkim schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass wir den Fuchs finden«, sagte er und warf Maffeo einen Blick zu. »Das war kein gewöhnliches Tier. Diese Bestie war entweder ein Dämon, der die Gestalt eines Fuchses angenommen hat, um uns zu täuschen, oder es war ein Zeichen der Götter.«
»Ein Zeichen?«
Dschinkim nickte langsam. »Ja, ein Zeichen. Jemand wird sterben. Bald.«
Niccolo runzelte die Stirn und verdrehte die Augen. Maffeo konnte sich gut vorstellen, welche Gedanken jetzt im Kopf seines Bruders umgingen. Er kannte dessen Einstellung zum Glauben der Mongolen. Die Mongolen sahen in jedem Ereignis gute oder schlechte Zeichen. Zu jeder Zeit rechneten sie damit, Geistern zu begegnen, und glaubten an die unheilvolle Macht von Dämonen. Für Niccolo war das nichts weiter als heidnischer Aberglaube. Natürlich war auch ihm klar, dass auf dieser Welt nicht nur die guten Mächte wirkten. Es gab schließlich den Teufel, der sich zuweilen schwacher Menschen bediente, um die Gläubigen in Versuchung zu führen. Doch letztlich bestimmte der dreifaltige Gott allein die Geschicke der Menschen. Und wenn Er Seinen Kindern ein Zeichen geben wollte, so sandte Er vielleicht einen Seiner Engel oder ließ einen Dornenbusch brennen. Unter gar keinen Umständen tauchte er jedoch als Fuchs auf. Maffeo wich Niccolos Blicken aus. Er war sich da nicht so sicher.
»Vielleicht gibt es auch eine ganz einfache Erklärung«, fuhr Niccolo schließlich fort. »Vielleicht war es eine Füchsin, die ihre Jungen beschützen wollte. Oder das Tier war tollwütig. Oder du hast dich einfach getäuscht, und es war gar kein Fuchs, sondern ein Wolf oder ein junger Bär, der von seiner Mutter getrennt worden ist.«
Maffeo hielt unwillkürlich den Atem an. Dschinkim war ein erfahrener Mann, der wie alle Mongolen seines Standes seit frühester Jugend zur Jagd ging. Er konnte mit geschlossenen Augen einen Fuchs von einem Wolf oder Bären unterscheiden, allein am Geruch. Niccolos unbedachte Worte waren daher eine schwere Beleidigung. Doch Dschinkim bedachte Niccolo lediglich mit einem langen Blick.
»Ich weiß, was ich gesehen habe.«
»Also schön. Dann war es eben ein Fuchs. Trotzdem sollten wir ihn verfolgen«, sagte Niccolo. »Seine Spur ist deutlich im Gras zu sehen. Verspürst du nicht den Wunsch, diesem Vieh seine ruchlose Tat heimzuzahlen? Und wer weiß, vielleicht ist er bereits hinter der nächsten Hügelkuppe verendet. Mit einem Pfeil im Rücken kommt er sicher nicht weit.«
Dschinkim seufzte. »Ihr Männer aus dem fernen Land der Abenddämmerung seid manchmal schwer zu verstehen. Ihr seid so beschäftigt mit eurem unsichtbaren Gott, dass ihr die Zeichen, die offen vor euch liegen, nicht beachtet.« Er schüttelte den Kopf. »Also gut, wir werden der Spur folgen. Aber nur bis über den nächsten Hügel. Sollten wir den Fuchs dann nicht gefunden haben, geben wir die Suche nach ihm auf.«
»Schön«, erwiderte Niccolo und lächelte. »Ihr werdet sehen, dass ich recht habe.«
Maffeo und Dschinkim warfen sich einen Blick zu. Keiner von ihnen rechnete damit, diesen Fuchs je wiederzusehen -höchstens in ihren Albträumen.
Sie bestiegen ihre Pferde und ritten den Hügel hinauf. Die Spur des Fuchses war so deutlich, dass sie ihr ohne Mühe bis über die Kuppe hinweg folgen konnten, doch in der nächsten Senke brach sie unvermittelt ab. Dschinkim glitt vom Pferd und ging in die Hocke.
»Die Spur geht nicht weiter«, sagte er nach einer Weile. Das Grauen in seiner Stimme war unüberhörbar. »Der Fuchs hat sich in einen Geist verwandelt und ist davongeflogen.«
»Unsinn!«, entgegnete Niccolo. »So etwas gibt es nicht. Er muss sich hier irgendwo versteckt haben. Wahrscheinlich hast du nur nicht richtig nachgesehen.«
Niccolo ritt weiter und schaute sich unbefangen um, während Maffeos Herz bis zum Hals klopfte. In den Jahren, seit sie Venedig verlassen hatten, hatte er genug gesehen und erlebt. Wenn ein Menschenleben nicht ausreichte, um allein die Geheimnisse des Neuen Testaments zu ergründen, woher nahm Niccolo sich dann das Recht, die Mysterien in anderen Teilen der Welt als absurde Hirngespinste abzutun? Die Bibel, so wie man sie im christlichen Abendland kannte, war nur ein Teil der Wahrheit.
»Dschinkim!«, rief Niccolo plötzlich aus. »Sieh mal, dort vorne. Liegt dort nicht etwas im Gras? Etwas wie ein Bündel? Das müsste unser Fuchs sein.«
Der Mongole erhob sich aus der Hocke und sah in die Richtung, in die Niccolos Zeigefinger deutete.
»Du hast recht und unrecht zugleich«, antwortete Dschinkim. »Dort liegt tatsächlich etwas. Aber es ist nicht der Fuchs. Es scheint ein Mensch zu sein.«
»Ein Mensch?«, fragte Niccolo und starrte ungläubig in die Richtung. »Dann lasst uns nachsehen, wer es ist. Los, worauf wartet ihr noch. Vielleicht ist er verletzt und braucht unsere Hilfe.«
Niccolo ritt davon. Dschinkim und Maffeo sahen sich an.
»Verzeih mir meine Offenheit, mein Freund, aber ich fürchte, eines Tages wird dein Bruder Verderben über uns alle bringen. Er ist unvorsichtig. Nur ein Narr achtet nicht auf die Zeichen, welche die Götter uns senden.«
Maffeo nickte. »Ich weiß. Aber wir können Niccolo jetzt nicht im Stich lassen, was auch immer dort vorne im Gras auf uns lauert. Schließlich ist er mein Bruder.«
Sie folgten Niccolo langsam. Keiner von ihnen hatte es besonders eilig. Als sie näher kamen, erkannte auch Maffeo, dass Dschinkim recht hatte. Das, was aus der Ferne wie ein Bündel Fell oder ein Ballen Stoff ausgesehen hatte, das eine Karawane auf ihrem Weg durch die Steppe verloren haben mochte, war tatsächlich ein Mensch. Dschinkim glitt vom Pferd und gesellte sich zu Niccolo, der bereits eingehend den im Gras liegenden Körper betrachtete.
Es war eine Frau. Bei ihrem Anblick hielt Maffeo unwillkürlich den Atem an. Die Frau lag mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, die schmalen, schön geformten Hände waren über der Brust gekreuzt. Das lange blonde Haar umgab ihren Kopf wie ein schimmernder Kranz aus feinen Goldfäden. So wie sie da lag, erinnerte sie ihn an die Bilder, die in venezianischen Kirchen hingen. Bilder von Heiligen mit alabasterweißer Haut, goldfarbenem Haar und einem leuchtenden Heiligenschein um den Kopf. Allerdings trugen die Heiligen auf den Gemälden abendländische Kleidung. Das weite, mongolische Gewand mit der bunten Blumenstickerei passte nicht ins Bild. Und die geröteten Hände, die ein wenig den Händen der Waschfrauen in Khubilais Palast glichen, ebenso wenig.
»Ist sie...«
»Nein.« Dschinkim schüttelte den Kopf. »Sie atmet.«
»Wer ist sie?«, fragte Niccolo so leise, als würde er fürchten, die Fremde zu wecken.
»Ich weiß es nicht«, flüsterte Dschinkim zurück. »Sie hat zwar die Hände einer Wäscherin, aber sie trägt die Kleidung einer vornehmen Frau. Und sieh dir nur ihre helle Haut an. Sie arbeitet gewiss nicht auf dem Feld. Wie kommt eine Frau wie sie hier in die Steppe, und noch dazu allein?«
Maffeo schluckte. »Es gibt nur eine Erklärung. Sie ist...«
»Sie könnte eine Frau aus dem Harem des großen Khubilai Khans sein«, unterbrach Niccolo seinen Bruder. »Vielleicht wurde sie von Räubern oder Sklavenhändlern entführt. Oder sie ist geflohen.«
Dschinkim schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Ich bin sicher, ich hätte sie im Gefolge meines Bruders bemerkt.«
Niccolo hob spöttisch eine Augenbraue. »Wie willst du dich an eine einzelne Frau unter den Heerscharen der Geliebten des Khans erinnern? Ich vermute, dass nicht einmal der Kaiser selbst alle Frauen kennt, die seinem Harem angehören.«
»Vielleicht hast du recht, Niccolo Polo«, erwiderte Dschinkim. Maffeo ahnte, welche Anstrengung es den Mongolen kostete, ruhig und höflich zu bleiben. »Dennoch gibt es im Harem meines Bruders nicht viele Frauen aus euren Ländern. Außerdem, wie du wohl selbst bemerkt hast, erwartet sie ein Kind. Dieser Umstand bleibt dem großen Khan nie verborgen.«
»Dann ist sie vielleicht einfach ein Waschweib, das die vornehme Kleidung gestohlen hat und deshalb geflohen ist«, sagte Niccolo und verschränkte die Arme vor der Brust. Er schien mit dieser These zufrieden zu sein. »Wir sollten sie fesseln, auf eines der Pferde setzen und in Shangdou vor den Richter führen.«
Dschinkim und Maffeo warfen sich einen vielsagenden Blick zu. So einleuchtend Niccolos Theorie auch klang, sie glaubten beide nicht daran. Diese Frau mochte vieles sein, aber sie war gewiss kein entflohenes Waschweib.
»Ist sie denn verletzt?«, fragte Maffeo. »Vielleicht sollten wir sie untersuchen?«
Dschinkim wich einen Schritt zurück, und sein Gesicht verlor an Farbe.
»Ich werde diese Frau nicht berühren, unter gar keinen Umständen. Vielleicht wurde sie von einer Karawane zum Sterben hier gelassen, weil sie an einer ansteckenden Krankheit leidet. Oder sie ist ein Dämon. Oder aber...«
Niccolo stieß einen Seufzer aus. »Natürlich, etwas anderes habe ich auch nicht erwartet. Nicht von einem...« Er brach ab. Vielleicht hatte er selbst bemerkt, dass er drohte zu weit zu gehen. »Dein Gedanke ist sehr vernünftig, Maffeo. Da Dschinkim nicht will und du die größere Erfahrung von uns beiden hast, solltest du deinen eigenen Vorschlag in die Tat umsetzen. Bedenke dabei, dass sie vermutlich eine Christin ist, dass sie sogar aus unserer Heimat stammen könnte.«
Ja, Niccolo hatte recht. Es war möglich, dass diese Frau, so blond und weißhäutig, wie sie war, eine von ihnen war. Aber ebenso war es möglich, dass sie ein Geist, ein Dschinn oder ein Dämon war, der sich in die Gestalt einer hilflosen Frau verwandelt hatte, um sie zu täuschen. Um Zugang zur Stadt des Kaisers zu erlangen und dort ihr dämonisches Kind zur Welt zu bringen. Wenn dies aber nun nicht stimmte? Wenn sie wirklich nur das war, was sie zu sein schien, nämlich eine schwangere Frau? Widerstrebend ließ Maffeo sein Steinadlerweibchen auf Dschinkims Arm klettern, dann kniete er sich neben die Fremde.
»Maffeo!«, rief Dschinkim aus. »Du willst das wirklich tun?«
Maffeo nickte. Lieber will ich das drohende Unheil auf mich nehmen, als für den Tod einer Unschuldigen verantwortlich zu sein, dachte er und begann die Frau vorsichtig abzutasten.
Sie wachte nicht auf. Sie zuckte nicht einmal mit den Wimpern, als er ihre Hände nahm und aus der Linken etwas entfernte. Es war ein walnussgroßer Stein, ein strahlend blauer Saphir von so erlesener Schönheit, wie es ihn nur einmal auf dieser Welt geben konnte. Für den Bruchteil eines Augenblicks hörte sein Herz auf zu schlagen, und der Atem stockte in seiner Brust. War es denn möglich, dass dies... Er warf einen Blick auf das Gesicht der Frau, das mit den geschlossenen Augen friedlich wie das eines Engels war. War dies das Gesicht einer Diebin? Einen kurzen Moment betrachtete er den Stein versonnen. Dann steckte er ihn rasch in eine Tasche seines weiten Mantels, bevor Niccolo oder Dschinkim etwas davon merkten.
»Ich kann keine Verletzungen entdecken«, sagte Maffeo, als er seine Untersuchung abgeschlossen hatte, und erhob sich schwerfällig.
»Aber weshalb ist sie dann bewusstlos?«, fragte Niccolo. »Wir sollten sie so rasch wie möglich nach Shangdou bringen.«
»Nein«, rief Dschinkim aus. »Niemals werde ich diese Frau in die kaiserliche Stadt mitnehmen. Ich werde es nicht zulassen, dass...«
»Ich stimme Niccolo zu«, unterbrach ihn Maffeo. »Wir kennen ihre Gesinnung zwar nicht und wissen auch nicht, weshalb sie hierhergekommen ist, dennoch glaube ich nicht, dass eine Gefahr von ihr ausgeht. Soweit ich es beurteilen kann, ist sie kein Dämon. Ich bin sogar bereit, dafür zu bürgen. Aber ich bin sicher, dass die Fremde einen Arzt braucht. Außerdem können wir sie in ihrem Zustand nicht der Kälte überlassen. Sie würde erfrieren. Und wir wären dann ebenso schuld an ihrem Tod, als hätten wir ihr einen Dolch ins Herz gestoßen.«
Dschinkim sah Maffeo lange an, dann nickte er ergeben. »Gut, vielleicht hast du recht. Ich vertraue deinem Urteil, mein Freund.«
Maffeo griff in seine Tasche. Der Stein war warm. Die Hand der Fremden hatte ihn erwärmt – oder war es der Stein, der ihr Wärme gespendet hatte? Maffeos Finger glitten über die Oberfläche. Der Saphir fühlte sich vertraut an und doch fremd. Er war gleich und doch anders, wie Bild und Spiegelbild. War er etwa ein Bruder, ein Zwilling?
Eines ist sicher, dachte Maffeo und schloss seine Hand um den Saphir. Sie ist ebenso wenig ein Dämon wie ich.
Dann stieg er bedächtig, jede Bewegung vorher gut abwägend, in den Sattel, um sich keine Blöße zu geben. Vielleicht war Dschinkim zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt, oder aber er war nur höflich und verschloss seine Augen vor den Gebrechen seines alternden Freundes. Geduldig, ohne auch nur mit einem Wort zur Eile zu mahnen, wartete er, bis Maffeo endlich auf dem Pferderücken saß, um ihm den Adler zurückzugeben. Dann kümmerte sich Dschinkim um die rätselhafte Fremde. Mit Niccolos Hilfe hob er sie zu sich auf das Pferd. Doch bevor sie sich auf den Heimweg machten, trafen sich ihre Blicke. Und Maffeo erkannte im traurigen Ausdruck seiner grünen Augen, dass Dschinkim nichts verborgen geblieben war. So sehr es sie beide auch schmerzen mochte, dies war ihre letzte gemeinsame Jagd.
Maffeo stand am Fenster im Gästegemach seiner Wohnräume und sah nachdenklich nach draußen. Das Licht der aufgehenden Sonne spiegelte sich in den vergoldeten Kuppeln des Kaiserpalastes. Er liebte den Anblick der Kuppeln, Zinnen und Türme. Von seinen Räumen aus konnte er fast den gesamten Palast überblicken. Doch noch schöner, noch erhabener war der Anblick, wenn man sich zu dieser Stunde von Osten her der Stadt näherte. Dann erstrahlte Shangdou in einem fast überirdischen Glanz, und der weiße Marmor bekam eine Transparenz, als wäre die kaiserliche Stadt im Gegensatz zu anderen Städten nicht aus Stein errichtet worden. Aus diesem Grund nannten die chinesischen Untertanen Shangdou auch den »Kristallpalast« oder »die Stadt aus Glas«. Einen treffenderen Namen hätte man wohl kaum finden können.
Hinter ihm, im Halbdunkel des frühen Morgens, lag auf dem schmalen Gästebett die Fremde. Sie war halb erfroren. Diener hatten sie in heißem Wasser gebadet und dann in mehrere Decken eingehüllt, um sie wieder aufzuwärmen. Jetzt standen zwei Becken mit glühender Kohle neben dem Bett, und es war so warm im Zimmer, dass Maffeo der Schweiß auf der Stirn stand. Doch die Frau lag immer noch genauso da, wie Dschinkim, Niccolo und er sie in der Steppe gefunden hatten. Seit gestern hatte sie sich nicht ein einziges Mal gerührt. Wer war sie? Woher kam sie? Wie war sie in die Steppe gelangt? Wer oder was hatte sie dort zurückgelassen? Und warum war sie zurückgelassen worden? All diese Fragen waren immer noch nicht beantwortet.
Behutsam drehte Maffeo den Stein der Fremden in seiner Hand und hielt ihn gegen das Licht. Der Saphir bündelte die Strahlen der Morgensonne und warf tanzende blaue Lichter in den Raum. Wie schön er war! Bis zum gestrigen Tag hatte Maffeo geglaubt, diese Schönheit sei einzigartig. Doch an dem Stein gab es etwas, einen so geringen Unterschied, dass ihn nur das geübte Auge wahrnehmen konnte – die Bruchkante verlief anders und war nicht genau an der Stelle, an der sie eigentlich sein sollte. Hatte die alte, schon fast vergessene Legende doch recht? Gab es wirklich mehr als einen Saphir? Es war schwer vorstellbar. Andererseits war der Stein selbst so voller Rätsel und Geheimnisse, dass ein weiteres kaum auffiel.
Es klopfte leise an der Tür. Noch bevor Maffeo die Erlaubnis erteilen konnte, huschte ein Diener lautlos herein, die Hände sittsam in den weiten Ärmeln seines weißen Gewandes verborgen.
»Herr«, sagte er und verneigte sich so tief, dass Maffeo den langen geflochtenen Zopf auf dem Rücken des Dieners sehen konnte. Er lag dort wie eine träge schwarze Schlange. »Der edle Dschinkim, Bruder und Thronfolger unseres großen und gütigen Herrschers Khubilai Khan, bittet Euch um ein Gespräch.«
»Führe ihn herein«, erwiderte Maffeo.
Niccolo hatte sich natürlich gleich nach ihrer Rückkehr wieder seinen Geschäften gewidmet und sich seither nicht mehr nach dem Schicksal der rätselhaften Fremden erkundigt. Vermutlich hatte er sie mittlerweile sogar über seinen Büchern, Zahlen und Maßen vergessen. So war er eben, ein Kaufmann mit Leib und Seele. Doch mit Dschinkims Besuch hatte Maffeo gerechnet.
Mit den langen, schnellen Schritten eines Kriegers betrat der Mongole den Raum. Wie immer war er allein. Das nutzlose, unablässig schnatternde Gefolge von mindestens einem halben Dutzend Beratern, Dienern und Soldaten, das die anderen Mitglieder des kaiserlichen Hofs auf Schritt und Tritt begleitete, lehnte er ab. Nur bei offiziellen Anlässen ließ sich diese Sitte auch von Dschinkim nicht umgehen. Dann taten Maffeo die Männer leid, die mit ihm kaum Schritt halten konnten. Sie liefen hinter dem Thronfolger her wie eine Schar aufgeregter Hühner und waren am Ende so atemlos, dass andere Diener ihnen Luft zufächeln mussten.
»Sei gegrüßt, Dschinkim, Bruder des großen Khans und geschätzter Freund«, sagte Maffeo und verbeugte sich, wie es das Protokoll vorschrieb. »Was führt dich zu mir in mein bescheidenes Heim?«
Dies war natürlich nicht mehr als eine höfliche Floskel. Er kannte den Grund für Dschinkims Besuch. Außerdem waren sie Freunde, die eigentlich die steifen Formeln des kaiserlichen Protokolls nicht nötig hatten. Andererseits war Dschinkim der Thronfolger, der Bruder des Khans. Sollte Khubilai jemals etwas zustoßen, würde Dschinkim der neue Khan werden und somit Herrscher über Leben und Tod seiner Untertanen. Diese Begrüßungsformel half Maffeo, das nie zu vergessen.
Dschinkim antwortete nicht. Mit zornig gerunzelter Stirn starrte er den Diener an, der umständlich die Decken auf dem Bett der Fremden glatt strich, lautstark mit einem Schürhaken im Kohlenbecken herumstocherte und ein paar Schalen auf einem niedrigen Tisch zurechtrückte.
»Ich traue diesen Chinesen nicht!«, sagte er schließlich, nachdem der Diener endlich das Gemach verlassen und die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Weshalb verbergen sie ihre Hände stets in ihren Ärmeln?«
Maffeo zuckte mit den Schultern. »Das ist wohl so Brauch bei ihnen. Ein Zeichen von Anstand und Bescheidenheit.«
»Anstand und Bescheidenheit!« Dschinkim schüttelte den Kopf, und zwischen seinen Augenbrauen bildeten sich zornige Falten. »Was für ein Brauch soll das sein? Vermutlich ist das nur eine Ausrede, weil wir ihre Sitten und Gebräuche nicht kennen. Dieser ›Brauch‹ ist bestens geeignet, um ein Blasrohr mit vergifteten Pfeilen oder ein giftiges Pulver für einen hinterhältigen Meuchelmord zu verstecken.«
Maffeo lächelte. »Ich denke, du tust den Chinesen unrecht, Dschinkim.«
»Wirklich? Lass dich von ihrem stets lächelnden Gesicht nicht täuschen, Maffeo. Die Chinesen hassen uns mit jeder Faser ihres Herzens. Sie sind wie die Spinnen. Sie tun alles, um als eifrige Untertanen zu erscheinen, wochen-, sogar jahrelang, wenn es sein muss. Sie wiegen uns in Sicherheit. Aber in Wirklichkeit umgarnen sie uns und warten nur auf die richtige Gelegenheit, uns mit ihrem Biss zu lähmen und anschließend bei lebendigem Leib zu verspeisen.« Er ballte die Hände zu Fäusten. »Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht versuche, Khubilai davon zu überzeugen, die Chinesen aus dem Palast oder wenigstens aus seiner unmittelbaren Nähe zu entfernen. Sie hören und sehen zu viel. Und in diesem komischen Singsang, den kein vernünftiger Mensch je verstehen wird, können sie ihre Geheimnisse untereinander weitergeben, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Oder verstehst du ihr Geplapper, wenn sie gemeinsam am Brunnen stehen? Doch mein Bruder lacht mich nur aus. Er sagt, dass er den Chinesen das Gefühl geben will, gleichberechtigte Untertanen in seinem Reich zu sein. Aber glaube mir, wenn es den Chinesen gelungen wäre, uns zu erobern, wären sie nicht so zimperlich mit uns. Mongolen und Chinesen sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht, wie Sommer und Winter, wie Erde und Himmel. Khubilai ist ein Narr, wenn er denkt, dass wir uns jemals zu einem Volk vereinen könnten.«
Maffeo lächelte versonnen. »Und doch können Tag und Nacht, Sommer und Winter, Erde und Himmel nicht ohne einander sein. Sie sind ein Teil des Ganzen. Ich halte Khubilai Khan für einen großen Mann. Er ist ein Träumer, und seine Visionen...«
»Träumer oder Narr«, unterbrach Dschinkim Maffeo. »Du kannst es nennen, wie du willst, ich sehe da keinen Unterschied.«
Maffeo seufzte. So weltoffen und tolerant Khubilai Khan war, so verschlossen und misstrauisch war Dschinkim, sein jüngerer Bruder. Überall vermutete er Verrat und Verschwörung. Es gab Tage, an denen Maffeo sich wunderte, weshalb Dschinkim ausgerechnet zu ihm Vertrauen gefasst hatte. War sein Gesicht ehrlicher, offener, treuer als das der anderen ungezählten chinesischen, arabischen, jüdischen und europäischen Männer, die im Dienste des großen Khans standen? Wohl kaum. Trotzdem waren sie Freunde geworden. War es Zufall, Schicksal oder Vorsehung? Wer konnte diese Frage schon beantworten.
»Was führt dich zu mir?«, fragte Maffeo noch einmal, um das Gespräch wieder in andere Bahnen zu lenken. Dschinkim konnte sich sehr über die Vielzahl der ausländischen Würdenträger, ihre Rolle am Hof und die Einstellung seines Bruders zu ihnen ereifern. Und obwohl er deswegen ebenso gut beleidigt sein konnte, bekam Maffeo jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn Dschinkim davon anfing. Manchmal fühlte er sich, als ob er allein für all jene Chinesen, Araber, Juden und Europäer verantwortlich wäre, die ihre Stellung am Hof des Khans nur ausnutzten, um ihr eigenes undurchsichtiges Spiel zu spielen.
»Ich bin gekommen, um mit dir über die Fremde zu sprechen«, antwortete Dschinkim. »Ist es dir mittlerweile gelungen, mehr über sie und ihre Herkunft zu erfahren?«
»Nein«, antwortete Maffeo. »Noch gestern Abend, gleich nachdem wir von der Jagd zurückgekehrt sind, habe ich einen Diener zu Li Mu Bai geschickt. Er kam, ohne zu zögern. Doch auch er vermochte nicht zu sagen, was ihr fehlt. Wenigstens hat er keine Anzeichen einer für die Sicherheit des Reiches gefährlichen Krankheit an ihrem Körper entdecken können. Er hat ihr zwei seiner goldenen Nadeln gesetzt und ist dann gegangen. Heute früh gleich nach Sonnenaufgang wollte er wiederkommen und mit der Behandlung fortfahren.«
Dschinkim runzelte erneut bedenklich die Stirn. »Du vertraust ihm?«
Maffeo hob seine Hände. Li Mu Bai, Mönch und Arzt in einer Person, war ein großer, ein stiller Mann. Seit über zwanzig Jahren stellte er sein Leben in den Dienst der Lehre Buddhas und der Einwohner von Shangdou. Der Ruf seiner Weisheit, seiner Güte und seiner Fähigkeiten als Arzt war weit über die Grenzen Shangdous hinaus bekannt und von überall her kamen die Leute, um von dem weisen Li Mu Bai Rat und Heilung von ihren Leiden zu erbitten. Doch er war Chinese, und das allein reichte aus, um ihn in Dschinkims Augen verdächtig erscheinen zu lassen.
»Weshalb sollte ich ihm nicht vertrauen?«, erwiderte Maffeo. Er war verärgert, bewunderte er doch Li Mu Bai, und sooft er die Gelegenheit dazu hatte, ließ er sich heimlich von dem Mönch in der Lehre Buddhas unterweisen, »Sein Ruf ist über jeden Zweifel erhaben. Ebenso könntest du Gautama Buddha, den Erleuchteten selbst, des Verrats bezichtigen. Noch nie habe ich jemanden schlecht über den weisen Li Mu Bai sprechen hören.«
»Mag schon sein«, brummte Dschinkim. »Haben seine Maßnahmen wenigstens etwas genützt?«
Maffeo schüttelte den Kopf. »Nein. Bisher hat sich die Fremde nicht gerührt.«
Sie traten an das Bett und betrachteten gemeinsam die schlafende Frau. Ihre Wangen waren rosig, und sie sah aus, als würde sie jeden Augenblick erwachen – oder bis zum Jüngsten Tag weiterschlafen.
»Wer ist sie, Maffeo?«, flüsterte Dschinkim, als wollte er die Fremde nicht stören. »Wie kam sie dorthin, wo wir sie gefunden haben?« Die Falten auf seiner Stirn wurden immer tiefer. »Ich traue ihr nicht, Maffeo. Wenn du mich fragst, sollten wir nicht zögern, dieses Weib in Ketten zu legen und so schnell wie möglich dorthin zurückbringen, wo wir es gefunden haben.«
Maffeo zuckte entsetzt zusammen. »Aber sie ist doch nur eine Frau! Noch dazu eine, die ein Kind erwartet. Wie soll sie...«
»Eben, das ist es ja gerade. Sie erwartet ein Kind. Woher willst du wissen, dass es sich dabei nicht um den Balg eines Dämons handelt? Vielleicht hat ein Dämon sie geschwängert und in diesen todesähnlichen Schlaf versetzt.« Dschinkim ergriff Maffeos Arm. »Kannst du mir erklären, wie sie in die Steppe gelangt ist? Weit und breit gab es keine Spuren außer unseren eigenen. Dieses Weib muss durch die Luft geflogen sein! Denke auch an den Fuchs. Du selbst hast diese Bestie zwar nicht gesehen, aber ich sage dir, das war kein gewöhnlicher Fuchs. Es war ein Geist oder ein Dämon. Und er hat uns direkt zu ihr geführt.«
Maffeo kämpfte mit sich. Sollte er dem Mongolen sagen, dass er glaube die Antwort auf seine Fragen zu kennen? Allerdings würde ihm das wohl kaum gelingen, ohne sein eigenes Geheimnis preiszugeben. Ein Geheimnis, von dessen Existenz nicht einmal Niccolo etwas ahnte, und der war immerhin sein Bruder.
»Ich bin sicher, dass es auch dafür eine Erklärung gibt«, entgegnete er stattdessen und versuchte, Dschinkim möglichst unbefangen anzusehen. »Ich verspreche dir, dass ich sie beobachten werde. Und sobald sie aufwacht, werde ich sie ausfragen und sie nicht eher aus den Augen lassen, bis ich meine Hand für sie ins Feuer legen kann.«
Dschinkim sah ihn so lange an, dass es Maffeo unter seinem Blick unbehaglich wurde und er sich zu fragen begann, ob der Mongole ihn durchschaut hatte. Doch schließlich nickte er.
»Gut, es sei, wie du sagst. Du bist mein Freund, und ich vertraue dir. Ich weiß, dass dir das Leben des großen Khans und die Sicherheit unseres Volkes ebenso am Herzen liegen wie mir. Aber sie ist ein Weib und somit in der Lage, Herz und Verstand zu verwirren. Selbst die tapfersten und treuesten Männer sind schon über das Antlitz und den Liebreiz einer schönen Frau gestrauchelt und zu feigen Verrätern geworden. Deshalb sage ich dir: Sollte sich jemals herausstellen, dass sie unter dem Vorsatz zu uns kam, meinem Bruder oder unserem Reich Schaden zuzufügen, und sei es auch nur ein Verdacht, werde ich nicht zögern und sie auf der Stelle töten lassen.«
»Sollte dieser Fall eintreten, so werde ich selbst das Todesurteil vollstrecken«, erwiderte Maffeo und verneigte sich. »Sei unbesorgt, Dschinkim, Bruder und Thronfolger des großen und mächtigen Khubilai Khans. Meine Kraft und mein Leben gehören Khubilai Khan. Ich diene dem mongolischen Volk. Und das werde ich nicht vergessen. Nicht für einen einzigen Augenblick.«
Abrupt drehte sich Dschinkim um und stürmte mit langen Schritten aus dem Zimmer. Laut fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Geistesabwesend schaute Maffeo ihm nach. Ja, er würde sein Versprechen halten und auf die Fremde achtgeben. Und nicht nur das. Sobald er wusste, dass sie frei von bösen Absichten war, würde er mit ihr reden – über den Stein. Er hatte so unendlich viele Fragen. Fragen, die ihn seit Jahren in seinen schlaflosen Nächten beschäftigten. Fragen, die ihm bisher niemand hatte beantworten können. Vielleicht wusste sie mehr als er. Vielleicht kannte sie die Antworten, nach denen er so lange vergeblich gesucht hatte. Allerdings musste sie zuerst das Bewusstsein wiedererlangen.
Maffeo trat näher an das Bett, schlug die Decken zurück und betrachtete die Fremde. Sie lag regungslos auf dem Rücken wie eine verstorbene Königin, die auf ihre Beisetzung wartet. Aus einem Impuls heraus legte er seine Hand auf ihren schwangeren Bauch. Das Kind schien die Berührung zu spüren und begann sich unter seiner Hand zu bewegen. Maffeos Herz wurde schwer. Das Kind war so lebendig. Doch was sollte aus dem Ungeborenen werden, wenn seine Mutter das Bewusstsein nicht wiedererlangte? Nach Li Mu Bais Aussage war die Niederkunft noch lange nicht zu erwarten. Wie sollte das Kind die Zeit überleben ohne die Lebenskraft seiner Mutter?
Maffeo ergriff die rechte Hand der Frau. Sie war kühl, doch war es nicht die Kälte des Todes. Er konnte fast spüren, wie das Blut durch ihre Adern floss – ungewöhnlich langsam, aber lebendig. Er legte seine andere Hand, in der er den Stein hielt, auf ihre Stirn. Die Stirn war warm. Die Frau lebte, sie atmete. Doch warum wachte sie nicht auf? Warum stand sie nicht auf? Da fiel ihm eine Passage aus der Bibel ein, ein Satz aus dem Evangelium nach Lukas.
»Talitha kumi«, flüsterte Maffeo und schloss die Augen wie zum Gebet. »Talitha kumi.«