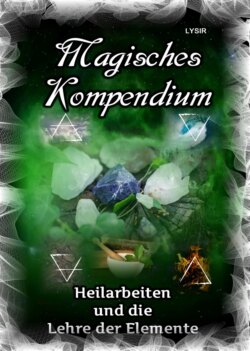Читать книгу Magisches Kompendium - Heilarbeiten und die Lehre der Elemente - Frater LYSIR - Страница 5
Heilung und Heilarbeiten
ОглавлениеEin sehr großes Themengebiet in der Magie ist die Heilung. Es gibt unzählige Ideen, Praktiken, Ansätze, Rituale, Gebete, Reliquien und andere Materialien, die hier unterstützende oder auch vollkommen heilende Wirkungen haben sollen. Dabei löst der Begriff „Heilung“ in jedem Menschen eine individuelle Idee aus und bezieht sich primär auf Selbsterfahrungen, die man mit diesem Begriff assoziiert. Jeder Mensch wird schon mal eine kleine Verletzung oder eine Krankheit gehabt haben, sodass er aus seinem „Alltagsleben“ kurzzeitig ausgeschlossen wurde und nicht mehr das leisten konnte, was er wollte. Doch wenn man sich mit „einer“ Heilung beschäftigt, ist das immer etwas ganz anderes, als wenn man sich mit „seiner“ Heilung beschäftigt. Wenn man sich mal das Ding „Heilung“ anschaut, dann kann man erkennen, dass es erst einmal um ein „Abstellen“ einer misslichen, ungünstigen, unangenehmen, bedenklichen, unerfreulichen, üblen oder bösen Lage geht. Natürlich ist dies sehr, sehr weit gefasst, auch wenn mal eine „Männergrippe“ wirklich „böse“ sein kann. Im Allgemeinen gilt aber, dass man durch einen Zustand, der Heilung bedarf (nicht unbedingt eine Krankheit), in eine „Lage“ oder in eine „Lebenssituation“ gerät, die uns daran hindert, den „normalen Alltag“ nachzugehen. Wobei der „normale Alltag“ – der sowieso absolut individuell definiert werden muss – auch die Selbstverwirklichung, die Selbsterfüllung oder die Selbstbeherrschung (den menschlichen „freien Willen“) umfasst. Man sieht, dass es hier schon sehr große Varianten der Definition bzw. der Erklärung gibt. Apropos Definition, wenn man sich dann wirklich einmal die aktuell gängigen Definitionen des Wortes „Heilung“ ansieht, erkennt man sofort, dass es um physische und psychische Erkrankungen bzw. „Deformationen“ geht.
Im Folgenden habe ich einmal verschiedene Definitionen des Begriffs „Heilung“ abdrucken, bzw. es wurden Versuche abgedruckt, wie man am sinnigsten diesen Begriff definieren oder auch umschreiben kann.
Definitionsversuch 1:
Die Heilung charakterisiert einen biologischen Prozess – aller Art – der zu einer Rückbildung einer Erkrankung, einer Beschwerde bzw. einer unnormalen (bzw. pathologischen) Veränderung des biologischen Gewebes führt. Diese Änderung tendiert in Richtung des gesunden Ausgangszustands bzw. des ursprünglichen Zustandes des biologischen Systems.
Hierbei beruht der Prozess der Heilung auf verschiedenen Mechanismen bzw. Möglichkeiten, die sich an körpereigenen Instandsetzungs- und Erneuerungskomplexen orientieren. Diese können intern, durch den Patienten, aber auch extern, durch Ausführungsbestimmungen eines Arztes, Heilers oder Therapeuten, in unterschiedlicher Art und Weise auf den Heilungsprozess auswirken (positiv, aber auch negativ, da es auf die jeweilige Anwendung ankommt. Hierdurch können Prozesse vollzogen und ausgeführt werden, sodass die Heilung arrangiert, unterstützt, und / oder begünstigt bzw. beschleunigt wird bzw. werden kann. Ferner werden bei dem Begriff „Heilung“ verschiedene Stadien berücksichtigt. Stadium I ist eine „vollständige Heilung“, hierbei bleiben keine Narben, Wundmale oder Schäden zurück, und wird mit dem Fachterminus „RESTITUTIO AD INTEGRUM“ (ausgehend vom lateinischen Wort „restitutio“ für Wiederherstellung, über „ad“ für auf/bei/zu, zum lateinischen „integritas“ für Unversehrtheit / Echtheit) beschrieben. Stadium II trägt die Bezeichnung der „Reparations- bzw. Defektheilung“, welche mit zurückbleibenden Narben, Wundmale oder Schäden vollzogen wird.
Definitionsversuch 2:
Die Heilung impliziert einen Prozess, einen Verlauf oder einen Entwicklungsgang, der eine Herstellung und / oder Wiederherstellung (bzw. Genesung, Linderung, Erleichterung) einer (ursprünglichen) körperlichen und seelischen Ordnung / Korrektheit bzw. Selbstintegrität hervorbringt, sodass ein Leiden, eine Krankheit, eine Beeinträchtigung überwunden wird / werden kann, um zu einer ursprünglichen Unversehrtheit oder vollständigen Genesung (ohne Regresse) zu gelangen.
Definitionsversuch 3
Heilbehandlungen sind allgemeine Ausführungen, die zu einer Heilung führen sollen – egal, ob hier ein Eigenverschulden (hiermit ist einfach eine Krankheit gemeint, die aus dem eigenen Körper entsteht) oder ein Fremdverschulden (z. B. ein Unfall) vorliegt. Hierbei geht es um die Behandlung und Regelung einer Krankheit und / oder einer Unfallverletzung bzw. eines Unfallschadens, wodurch das Leben des Patienten in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird. Hierbei kann eine häuslich, ambulant oder stationär durchgeführt werden.
Zur häuslichen Heilung gehören alle positiven Tätigkeiten und Unterstützungen körperlicher / physischer und geistiger / seelischer / psychischer Art. Zur ambulanten Heilung zählen alle ärztlichen Beratungen, Untersuchungen, Diagnostiken und alle Arten von Therapien (Schmerz-, Chemo-, Strahlen- und / oder Wundheilungstherapien), die sich u. a. auf Arzneistoffe (unverarbeitet und weiterverarbeitet), Fertigmedikamente, Wund- und Verbandsmittel, Heil- und Hilfsmittel beziehen. Zur stationären Heilung (klassisch als Krankenhausbehandlung, aber auch als stationäre Rehamaßnahme zu verstehen) gehören alle Fragmente der ambulanten Pflege sowie zusätzlich die Krankenpflege und –hygiene, die Unterbringung allgemein, sowie die allgemeine oder spezielle Verpflegung (Sonder- und Sondennahrung). Die Heilung unterliegt hierbei aber verschiedenen Gesetzten bzw. Paragrafen (u. a § 27-29 SGB V) in denen der Anspruch einer Heilung (u. a. in Bezug auf Behandlung und Krankenhausaufenthalt) geregelt ist. Hier geht es um die notwendigen Prozesse und Arbeiten (alle Behandlungs- und Diagnostikmethoden), um eine Krankheit zu identifizieren bzw. zu klassifizieren, sodass eine Heilung erreicht oder zumindest eine Verschlimmerung ausgeschlossen oder minimiert werden kann. Es soll daher möglich sein, alle Krankheitsbeschwerden zu verhüten oder zumindest zu lindern. (Dies schließt z. B. auch unter gewissen Umständen die künstliche Befruchtung mit ein).
Definitionsversuch 4:
Der Begriff Heilung umfasst das eigene UND das fremde Arbeiten an den Prozessen, dass eine von dem Patienten individuell erforderliche Konstruktion bzw. eine Wiederherstellung der physischen, psychischen und seelischen Beherrschung/Kontrolle bzw. Gefasstheit und Überwachung erreicht wird, sodass der Patient FÜR SICH SELBST „sagen“ / „erkennen“ kann, dass sein Leiden (Verletzung, Versehrtheit, Unpässlichkeit etc.) oder seine Krankheit, vollkommen zurückgegangen ist, wodurch der Urzustand, die vollständige Genesung, erreicht wurde!
Man sieht bei diesen verschiedenen Definitionen, dass es einmal nur um den Körper, bzw. um biologische Prozesse, und einmal auch um die „Seele“ bzw. die „seelische Integrität“ geht. Hier existieren also gigantische Unterschiede.
Gut, es dürfte daher klar sein, dass die „Heilung“ letztlich für verschiedene Bereiche definiert werden muss und dass man ganz allgemein sagen kann, dass es um einen „harmonischen Zustand“ oder „gesunden Zustand“ geht. Doch WER definiert „harmonisch“ bzw. „gesund“? Letztlich muss man dies selbst machen, denn nur man selbst SOLLTE diese Definitionsmacht besitzen und nur in Ausnahmefällen, sollte man diese Macht (z. B. bei psychischen Störungen, die auf biologischen und biochemischen Gründen beruhen) abgeben bzw. verlieren.
Was gibt es denn jetzt für „große Heilungsbereiche“? Wenn man es sehr groß fächern will, dann gibt es die Heilung im physischen (körperlichen), psychischen (geistigen oder seelischen) und sozialen Sinne. Diese drei Punkte beziehen sich auf das biopsychosoziale Modell des Menschen, was bedeutet, dass eine sog. Anamnese (griechisch „Erinnerung“) gemacht werden muss, die die „Leidensgeschichte“ des Patienten, aus dessen individueller Sicht und Erfahrung zusammenfasst. Dies ist ein unendlich essenzieller Punkt, denn es geht um die individuelle Sicht des Patienten. Während der eine für sich sagt „Ist ein Kratzer! Mir fehlt nichts!“, bricht der andere bereits schreiend zusammen und windet sich vor Schmerzen. Hier muss man also klare Unterscheidungen treffen können, gleichzeitig aber auch eine Bewertung mit einfließen lassen. Dies ist nicht so einfach, egal, ob es nun um physische, psychische oder soziale Punkte geht. So umfasst die Anamnese die Sichtung, Auswertung und das Verstehen aller „Krankheitsdaten“, die der Mensch in der heutigen Zeit „gesammelt“ bzw. „gespeichert“ hat. Es wird davon (sinnigerweise) ausgegangen, dass man die „gesamte Geschichte“ des Patienten wissen soll/muss, um ihn zu heilen. Die gesamte Geschichte. Sehr guter Ansatz, doch wo fängt die Geschichte des Patienten an und welche kausalen Faktoren müssen wirklich berücksichtigt werden? Ist eine Familientragödie in früher Kindheit wichtiger oder ausschlaggebender als der erste Kuss? Es gibt hierauf keine universelle Antwort, da der Prozess der Heilung immer individuell sein wird.
Wenn man von dem körperlichen, psychischen und sozialen Aspekt abrückt, wird man zu großen Überschriften der Gesellschaft kommen. Diese Überschriften lauten: „Heilung unter medizinischer Sichtweise“, „Heilung unter psychotherapeutischer Sichtweise“ und „Heilung unter spiritueller Sichtweise“.
Von den Statistiken ist natürlich die „Heilung unter medizinischer Sichtweise“ am weitesten verbreitet, doch auch die „Heilung unter psychotherapeutischer Sichtweise“ wächst und wächst und wächst, sodass hier letztlich auch die „Heilung unter spiritueller Sichtweise“ zulegt. Wie gut oder wie schlecht dies alles im Einzelnen ist, ist irrelevant. Relevant sind hingegen, die genauen Bezeichnungen oder Vorsätze der verschiedenen „Behandlungsinstanzen“. Nicht alle agieren hier gleich. Wenn es z. B. um Heilung in der Medizin geht, gilt – vereinfacht ausgedrückt – die „Wiederherstellung“ der Gesundheit, in Bezug auf den Ausgangszustand des Menschen. Dies gilt als Heilung bzw. der Patient ist geheilt, wenn der Ausgangszustand erreicht wird. Der Ausgangszustand kann aber meilenweit vom Urzustand entfernt sein. Wenn man also einen Heilungsprozess „in“ dieser Definition nicht erfolgreich abschließen konnte, z. B. durch eine Kampfverletzung fehlt einem die Schwerthand (kennt man ja heutzutage), spricht man von einer Defektheilung. Wenn dann, nach dieser „missglückten Heilung“, eine weitere Krankheit (ein normaler Schnupfen, keine Männergrippe) auftritt und diagnostiziert wird, erfährt der Patient, wenn man dann den Schnupfen „heilen“ würde, nach dieser Definition eine echte Heilung. Man gilt dann definitionsgemäß als „geheilt“, auch wenn man immer noch seine Schwerthand vermisst. Natürlich ist dies jetzt ein krasses und sehr überzogenes Beispiel, dennoch zeigt es sehr gut die Vorgehensweise in der heutigen Zeit. Offensichtlich reicht es, wenn bei der Diagnostik bzw. bei der Anamnese Scheuklappen aufgesetzt werden, damit man das Offensichtliche nicht aus den Augen verliert. Kausale Faktoren und Begleitumstände werden hier oft übersehen. Natürlich sind die Ärzte keine „Wahrsager und Magier“ (im wahrsten Sinne des Wortes), die sofort auf Anhieb alles erkennen und denen ein flüchtiger energetischer Scann reicht, um zu diagnostizieren, dass die Schmerzen im Fuß von einer biochemischen Störung im Gehirn herrühren, die durch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit ausgelöst wurde. Doch oft wird nur das Offensichtliche behandelt, ohne auch mal in die Tiefe des Patienten zu dringen. Dass die Ärzte zum Teil sehr wenig Zeit für ihre Kunden (von Patienten kann man in der heutigen Zeit kaum noch sprechen) haben, und dass die „Sozial-Schere“ im deutschen Gesundheitssystem viele Klingen hat (reiche und prominente Menschen, privat versicherte Menschen, Kassenpatienten und Unversicherte, die durch die Maschen des Netzes gefallen sind), dürfte jedem klar sein. Doch die Praxis zeigt auch immer wieder, dass es bei den Ärzten einen Unterschied in Beruf und Berufung gibt. Wenn man Glück hat, gerät man an jemanden, der seine Berufung wortwörtlich genommen hat und diese als Beruf ausübt.
Oder man gerät an jemanden, der einfach einen Job macht, um einen Job zu machen (was zum Teil verständlich ist, da viele in dem „seltsamen Wirtschafts-Gesundheitssystem“ einfach kapitulieren). Natürlich muss man gerade in der Medizin auch Kosten-Nutzen-Rechnungen aufstellen, doch es ist schon manchmal seltsam, wofür alles in der allgemeinen Gesellschaft Geld ausgegeben wird und wo extrem gespart wird. Selbst wenn man in Studien herausgefunden hat, dass die Sterblichkeitsrate der Patienten im Krankenhaus steigt, wenn die prozentuale Bettenauslastung steigt. Gut, was soll man auch als diensthabende Kraft (egal, ob nun Arzt oder Pflege- bzw. Fachpersonal) machen, wenn für zwei lebensgefährliche Notfälle Kapazitäten da sind und plötzlich ein dritter oder vierter Notfall reinkommt? Münzwurf? Versicherungsstatus? Manipulation der Raumzeit? Anrufung von Erzengel Raphael, dem „Heiler Gottes“? Oder ausreichend Fachpersonal zur Verfügung stellen, dass auch solche Notfälle behandelt werden? Man wird sicherlich selbst auf eine passende Antwort kommen.
Doch so ähnlich sieht es auch bei den Heilungsarbeiten bzw. der Heilung in der Psychotherapie aus. Auch hier wird die Heilung als „Wiederherstellung der psychischen Gesundheit“ definiert, d. h., dass auch hier wieder das Erreichen des „Ausgangszustandes“ gemeint ist. Hinzu kommt, dass die Heilung in der Psychotherapie doch noch kleinere Variationen hat. So gilt das Erreichen einer „Alltagsfunktionalität“ als mögliche Heilung. Das Gleiche gilt auch für die sog. „Problemlösung“, das „Stärken eines positiven, inneren Erlebens“ oder die „mentale Grundgesundheit“. Auch diese drei „Umschreibungen“ würden als Heilungsziel gelten. Wenn man also wieder „unfallfrei“ einkaufen kann, kann man in dieser Definition als „geheilt“ gelten. Toll, oder? In diesem Fall werden zum Teil auch Einschränkungen „erlaubt“, wie z. B. Psychosen oder „harmlose“ Neurosen. Hierbei handelt es sich dann um sog. Residuen – um ein Symptom, das auf eine Erkrankung hinweisen kann. Es wird als „übrig gebliebene Resteinschränkungen“ der mentalen Konstitution gedeutet. So sieht man gerade in Bezug auf die Deutung der Heilung aus Sicht der Psychotherapie deutlich, dass Heilung definitiv nicht gleich Linderung, Befreiung, Erlösung oder eben Ganzwerdung ist. So ist die Heilungsarbeit bzw. die Heilung in der Psychotherapie natürlich auch wieder von sehr vielen Faktoren abhängig, die an der Spitze sicherlich die Stichworte „Erfahrung“, „Fachlichkeit“, „Kapazität“, „Zeit“ und „Geld“ haben, wobei „Geld“ hier eigentlich vollkommen überflüssig ist.
Tja und die Heilung im soziologischen bzw. sozialpsychologischen Sinne, ist natürlich auch nicht ganz so einfach zu klassifizieren. Die Heilung bezieht sich hier auf ein „intaktes Alltagsleben“, d. h., dass der Patient, der „geheilt“ ist, kann wieder seinem Alltag nachgehen. Er kann arbeiten, einkaufen, selbstständig leben und all das machen, was die Gesellschaft als „Normal“ oder „Alltag“ definiert. Erst wenn der Patient sein Leben wieder organisieren kann und nicht mehr auf die Hilfe Dritter angewiesen ist, wird von einer Heilung im soziologischen bzw. sozialpsychologischen Sinne gesprochen – wobei es hier natürlich auch wieder immens viele Abstufungen gibt. Der Mensch ist individuell und nur weil man an der Wursttheke „Ich hätte gerne 100g Salami“ sagen kann, ist man nicht automatisch im Sinne der soziologischen bzw. sozialpsychologischen Erwartung geheilt. Daher muss man der Heilung im soziologischen bzw. sozialpsychologischen Sinne eine hohe Kompetenz zutrauen, denn es ist logisch, dass die therapeutischen Sichtungen letztlich auch nur Momentaufnahmen sind, selbst dann, wenn der Patient über einen langen Zeitraum begleitet wird.
Es sind sehr filigrane Entscheidungen zu treffen, bevor das Wort „Heilung“ bzw. der Zustand „geheilt“ vergeben wird. Dies kann sinnig, gleichzeitig aber auch unsinnig sein, denn der Mensch ist ein sehr kompliziertes Ding. Während der eine Charakter permanent betreut und gestreichelt werden muss, um wieder „heil“ oder „ganz“ zu sein bzw. zu werden, muss der andere Charakter allein im (Über)Lebenskampf bleiben, um über sich bzw. seine gedachten und gesetzten Grenzen hinaus zu wachsen. Die Feinfühligkeit des jeweiligen Therapeuten muss hier sehr hoch sein. Da dies ein rein subjektives und dazu auch noch menschliches Empfinden ist, ist es unmöglich, hier eine sinnige Bewertung durchzuführen bzw. irgendwelche Grenzen oder Richtlinien zu erlassen. Im Grunde kann man dies auch für alle Arten der Heilung sagen, denn natürlich spielt bei jeder Heilung der Faktor „Mensch“ eine essenzielle Rolle, nicht nur als Patient, sondern auch als Therapeut. Dies ist aber auch sehr gut, denn man stelle sich einmal vor, man hätte einen „unmenschlichen“ Therapeuten, wobei hier „unmenschlich“ wortwörtlich zu deuten ist und somit alle diskarnierten Energien und Entitäten umfasst. Wenn man mit Erzengel Raphael therapeutisch arbeiten würde, dem „Heiler Gottes“, würde man mit einem „unmenschlichen Therapeuten“ agieren. Ist das jetzt gut oder eher schlecht? Wie sieht es sowieso mit der spirituellen Heilung aus?
Nun, diese hebt sich eigentlich sehr deutlich von den vorherigen Definitionen ab. Hierbei ist es sogar egal, ob es um „religiöse“ oder um „energetische“ Heilungen geht. In diese Rubrik der „spirituellen Heilung“ fallen die klassischen Wunder, egal, ob es nun das Wunder der Auferstehung oder die Gesundung der Aussätzigen, Lahmen, Blinden und anderer Menschen ist oder andere – aktuelle – medizinische Wunder, die an Wallfahrtsorten auftauchen bzw. angeblich schon des Öfteren aufgetaucht sind. Natürlich muss man mit solchen Wundern immer sehr kritisch umgehen, denn es wird auch sehr viel gelogen und fantasiert. Dennoch gibt es diese „Wunderheilungen“, egal, ob es Krebs, Blindheit, Lahmheit (oder allgemeine körperliche Einschränkungen der Bewegung, wie man sie bei Multiples Sklerose beobachten kann) oder andere Krankheiten sind, die von der Schulmedizin bereits ad acta gelegt wurden (zumindest aus Sicht des Patienten / des Betroffenen). Dies sind natürlich Extrembeispiele für eine spirituelle Heilung, denn es gibt natürlich auch „sehr alltägliche“ spirituelle Heilungen. Wenn man es sich genau anschaut, kann jede energetische Arbeit, die einen harmonischen Zustand erreichen bzw. bewirken will, als spirituelle Heilung definiert werden. Doch auch ein Exorzismus, ein Chakrenausgleich, eine Energiekörpereinigung, ein Schutzritual, Reiki-Gaben, Bachblütentherapie oder das Einrichten der Wohnung via Feng-Shui, würde in diesen Bereich fallen. Man sieht, dass hier das Spektrum sehr groß sein kann, auch wenn im Allgemeinen bei einer „spirituelle Heilung“ meist das Wort „Heilarbeit“ mitschwingt, was sich sehr oft darauf bezieht, dass ein körperliches Leiden beseitigt wird. Das Wort „Heilarbeit“ besitzt aber auch oft den Verwendungsgrund, dass das Wort „Heilung“ zu sehr in den medizinischen Bereich tendiert und – laut Definition – auch etwas „Messbares“ impliziert. Dies ist bei der Heilarbeit nicht so bzw. es ist nur subjektiv in meisten Fällen zu messen. Dass man via Meditation und autogenes Training seine Blutdruckprobleme in Ordnung bekommen kann, wäre so eine messbare Heilarbeit. Etwas anders sieht es aus, wenn Schmerzen gelindert werden oder der Hormonhaushalt verändert wird. Letztlich ist es nur eine Wortklauberei, ob man nun die Vokabel „Heilung“, „Heilarbeit“, „therapeutische Behandlung“ oder sonst einen Begriff verwendet, der eine vollkommene Genesung einer Person beschreibt. Doch bei allen Ideen und Begrifflichkeiten, wie sieht eigentlich eine solche „Heilarbeit“ aus? Gut, eine Reiki-Gabe fällt unter diesen Begriff, also ein Handauflegen und ein energetisches Arbeiten. Aber auch ein Exorzismus oder ein Heilungsritual, fallen hier ja hinein. Deswegen will ich doch einmal die „Heilarbeit“ etwas aufschlüsseln und beleuchten, was sie so alles beinhaltet und was sicherlich schon die meisten schon mal erlebt haben.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*