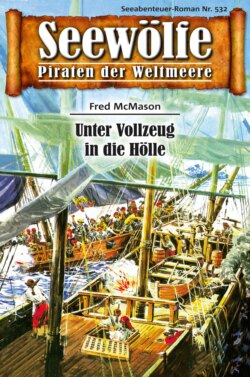Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 532 - Fred McMason - Страница 7
2.
ОглавлениеZu Bengosas lebhaftem Bedauern gab es zwei Tage lang keine einzige Insel zu sehen. Aber das war eben gottgewollt. Schließlich konnte der Herr in seiner großen Güte nicht überall Inselchen wachsen lassen. Dann wäre ja kein Platz mehr für das Wasser übrig gewesen.
Die anderen Kerle erfüllte die Weite der See mit Schadenfreude, denn jetzt ging es unter Vollzeug weiter. Auch der Segelmacher freute sich. Jetzt hatte er keine rotgeweinten Augen mehr und brauchte nicht ständig neue Flaggen anzufertigen. Die letzten hatten sie schon aus Seide hergestellt, die man von der Ladung nahm.
Wenn das so weiterging, war die „Estrellamar“ am Ende ihrer Reise bereits um einige Tonnen geleichtert.
Zu allem Unglück sichteten sie bald darauf wieder eine Insel. Da diese völlig von der Norm abwich, mußte sie natürlich auch angelaufen werden.
Diese Insel konnten sie allerdings nicht betreten, was Bengosa lebhaft bedauerte. Sie wuchs als Felsen aus dem Meer, der mit seinen schroffen Wänden absolut unbesteigbar war. Ganz oben wurde der Inselfelsen von einer Reihe Kokosnußpalmen gekrönt. Das sah aus, als wäre er besonders liebevoll garniert worden.
Bengosa ließ die Felseninsel runden, was jedoch keinerlei neue Erkenntnisse brachte, denn der garnierte Felsen sah von allen Seiten gleich aus. Er hatte keinen Strand und war mit Untiefen und kleinen Riffen gespickt.
Etwas verärgert darüber, daß dieses hochgewachsene Juwel nicht zu erklimmen war, taufte Bengosa die Insel auf den Namen tarta grande. Das hieß soviel wie Riesentorte und war direkt bezeichnend. Ob die spanische Krone mit dieser Riesentorte etwas anfangen konnte, wurde von jedermann an Bord stark bezweifelt. Nur in Bengosas Hirn spukte die Idee herum, daß man die Torte vielleicht zu einer uneinnehmbaren Festung ausbauen könne.
Wieder ging es ein paar Tage lang ohne Inselsichtung südwärts. Nur das Meer umgab sie und die samtene Bläue des Himmels.
Nochmals zwei Tage später erlitt der Ausguck fast einen Herzanfall, denn da tauchte erneut Land auf. Sehr stockend gab er die Meldung an Deck durch. Die anderen zuckten zusammen, nur Bengosa nicht. Der hatte verklärte Gesichtszüge und leuchtende Augen, in denen sich alle Freude dieser Welt widerspiegelte.
Immer wieder starrte er angestrengt durch das Spektiv. Was er sah, ließ sein Herz vor Freude hüpfen. Offenbar war es eine breite Insel, die vor ihnen lag. An Steuerbord war nochmals Land zu sehen und Steuerbord voraus zog sich ebenfalls Land hin.
Als sie näher heran waren, klatschte er begeistert in die Hände. Da waren Hütten zu sehen, Palmen, lange Strände und Menschen, die sich am Ufer bewegten und zu der heransegelnden Galeone blickten.
„Ein Bild des Friedens, der Ruhe und der Beschaulichkeit“, sagte Bengosa erfreut. „Diese Leute leben wahrhaftig im Paradies und sind zu beneiden. Nur schade, daß sie keine Christen sind. Aber sicher werden sie es gern werden wollen“, setzte er hinzu.
„Jetzt geht die Heidenbekehrung wieder los“, seufzte der Erste verhalten. „Womöglich werden wir auf dieser Insel endlos lange Tage verbringen müssen. Wo hat die Welt so was jemals gesehen!“
„Und das nennt sich nun ein Kauffahrer“, jammerte der Segelmacher. „Der segelt immer tiefer in die Schulden. Zum Schluß wird er nicht einmal mehr uns noch bezahlen können.“
Bengosa hörte nicht, was sie über ihn dachten. Er war nur von dem Wunsch beseelt, hier vor Anker zu gehen, den unbedarften Leutchen zu verklären, was wahrer Glaube sei, und die Insel in spanischen Besitz zu nehmen. Damit konnte die Krone ganz sicher etwas anfangen.
„Wir segeln zwischen den Inseln hindurch und gehen bei der an Backbord liegenden Insel vor Anker“, entschied er nach einem weiteren Blick auf die malerische Umgebung.
Der Erste spürte, wie sich sein Brustkorb zusammenzog.
„Wir werden sehr viel Zeit verlieren, Señor Capitán“, wandte er ein.
„Nur ein paar Tage“, sagte Bengosa, als sei das ein Klacks. „Wenn wir erst im Indischen Ozean sind, geht es unaufhaltsam weiter. Dort gibt es nicht viel Land. Aber diese Perle üppigster Pracht dürfen wir einfach nicht auslassen. Sehen Sie nur diese Harmonie in der Natur, diese unüberbietbare Friedfertigkeit, die freundlich winkenden Eingeborenen. Sicher haben sie noch nie ein Schiff aus unmittelbarer Nähe gesehen.“
Der Erste wollte das gerade bezweifeln, dafür bemerkte er etwas anderes, das ihm die Haare zu Berge stehen ließ.
„Riffe an Steuerbord!“ warnte er. „Da sind Schaumwirbel! Wir dürfen nicht zu dicht heran.“
Der Ausguck meldete im selben Augenblick ebenfalls Riffe, die jetzt immer deutlicher zu erkennen waren. Wasser schäumte auf, brodelte und kochte. Untiefe neben Untiefe befand sich dort, ganz zu schweigen von den Korallenriffen, die dicht unter der Wasseroberfläche lagen und erst dann gesehen wurden, wenn es schon zu spät war.
Für ein paar Sekunden lang vergaß Bengosa die Idylle und Pracht, die ihn umgab.
Schaudernd blickte er auf die Riffe, die immer gewaltiger wurden. Auch auf der anderen Seite glaubte er Verwirbelungen im Wasser erkennen zu können.
Der Wind wehte mehr achterlicher als dwars und schob sie unter Vollzeug auf die Riffe zu. Für Manöver irgendwelcher Art war es bereits zu spät.
Verzweifelt hielten sie nach einer freien Fahrrinne Ausschau. Es war völlig ungewiß, ob es überhaupt eine gab.
Da entdeckte Bengosa das Fischerboot. Es war ein Auslegerboot, in dem zwei braunhäutige Männer hockten, und es befand sich ein paar Kabellängen voraus. Die Männer in dem Ausleger gestikulierten wild und näherten sich ihnen.
„Glück zu“, sagte Bengosa erleichtert. „Sie werden uns helfen und einen Weg durch die Riffe weisen. Die Fischer kennen sich hier aus. Wir werden sie anpreien.“
Aber das war nicht mehr nötig. Die braunhäutigen Männer hatten längst erkannt, daß das Schiff in großer Gefahr war und auf die Riffe zu laufen drohte.
Bengosa ließ in seiner Verzweiflung ein paar Segel wegnehmen, aber da waren die beiden Fischer zum Glück schon heran.
Selam war Malaie, ein kleiner, freundlich aussehender Mann mit einer Knubbelnase und tiefschwarzen Augen, die immer höflich in die Welt blickten.
In seiner freien Zeit fischte Selam gern, sonst diente er sich als Lotse bei Schiffen an, die von den Molukken kamen und Kurs auf den Indischen Ozean nahmen.
Seit Wochen schon hatten sie kein fremdes Schiff mehr gesehen, doch als jetzt am nördlichen Horizont Masten auftauchten, brandete Jubel auf, und das scheinbar freundliche Inselvölkchen rottete sich am Strand zusammen. Männlein, Weiblein und Kinder zeigten sich, und auch ein paar Hunde, die zwischen ihnen herumtollten.
Selam stand am Ufer und blickte durch einen kostbaren Messingkieker. Sie hatten mehr als zwei Dutzend davon. Mit einigen spielten die Kinder, ein paar andere lagen unbeachtet in den Hütten am Strand.
Die Strandhütten waren einfach eingerichtet, aber hinter einem Wall aus Büschen, Palmen und dichtem Verhau standen weitere Hütten, und die waren alles andere als spartanisch eingerichtet. Da gab es Kupferkessel, Eisenpfannen, eiserne Herde und Werkzeuge aller Art – eben alles das, was auf Schiffen zu finden war.
Diesen Reichtum hatten die Insulaner Selam zu verdanken, beziehungsweise seinem hellen und ausgefuchsten Köpfchen, und weil er der Teufel in Person war, der noch nie etwas von Skrupeln gehört hatte.
Selams ständiger Satz hieß immer: „Es gibt nur zwei Arten von Schiffen: Solche, die auf dem Riff liegen, und solche, die bald auf dem Riff liegen werden.“
Auf den Riffen lagen wahrhaftig genug, und auf den unsichtbaren Riffen würden demnächst noch mehr liegen, die die teuflische Falle nicht erkannten und ahnungslos hineinsegelten – oder von Selam hineingesegelt wurden.
Die natürlichen Riffe waren aus Korallen gewachsen und scharfgeschliffen wie die Schneidezähne einer Riesensäge. Sie zogen sich über mehr als eine Meile hin. Manche von ihnen waren deutlich sichtbar. Andere waren unter Wasser verborgen und nicht zu erkennen. Vom Norden her gab es auf der linken Seite eine breite Durchfahrt, die dem Anschein nach frei von Riffen war.
Hier hatten die freundlichen Inselbewohner jedoch tatkräftig nachgeholfen und in mühevoller Arbeit Bollwerke unter Wasser angebracht.
Das war Selams Idee gewesen, seit sie von Java mit einer Horde Männer und Frauen herübergekommen waren. Sie hatten lange nach einer derartigen Inselpassage gesucht, die harmlos aussah und dennoch voller Tücken steckte, und hier hatten sie eine solche Passage endlich gefunden.
Anfangs hatten sie ein armseliges und karges Leben geführt und mußten sich mit dem begnügen, was die Inseln hergaben. Dann ging es ihnen immer besser, seit sie die künstlichen Riffe gebaut hatten und die ersten Schiffe in die Falle gelaufen waren.
In der scheinbar freien Durchfahrt waren kleine und größere Schiffe versenkt und mit Steinen gefüllt worden. Auch ein paar abgetakelte Galeonen waren dabei, die dicht unter der Wasserfläche lagen. Im Lauf der Zeit war das alles verfeinert worden. Etliche steingefüllte Wracks waren untereinander mit schweren Eisenketten verbunden. Masten waren bei Ebbe in den Sand gerammt worden, Pfähle steckten darin wie die Rammsporne von Galeeren. Es gab nur eine kleine schmale Durchfahrt zwischen den Inseln, die nur die Insulaner selbst kannten. Jeder Fremde segelte entweder auf die Korallen oder die künstlichen Bollwerke.
Es war eine mühevolle und harte Arbeit gewesen, aber sie trug Früchte, und sie bescherte ihnen ein sorgenfreies Leben.
Auf den heransegelnden Schiffen sah man von weitem nur ein paar alte und abgetakelte Wracks. Grund genug, bei diesem Anblick so schnell wie möglich zur anderen Seite auszuweichen.
Ein Portugiese hatte es auch einmal geschafft und war ihnen vor der Nase unbeschadet davongesegelt.
Seitdem halfen Selam und sein Freund Nusando immer nach, damit solche Zwischenfälle nicht mehr passierten. Dabei tarnten sie sich als harmlose Fischer, die ihre Hilfe als Lotsen anboten. Meist wurde das auch dankbar angenommen.
Selam hatte schon Portugiesen, Holländern, Spaniern und selbst seinen Landsleuten „geholfen“. Er verstand auch von jeder Sprache ein paar Brocken, die er geschickt anwandte.
Nach dem Anbieten der „Lotsenhilfe“ ging er oft selbst an Bord, ließ das fremde Schiff in die künstlichen Riffe laufen und verschwand dann beim Aufprall, als sei alles nur ein Versehen gewesen. Dann saß das Schiff hoffnungslos fest, und besorgte Insulaner halfen der verstörten Mannschaft beim Abbergen. Dabei packten auch die Frauen tatkräftig mit an. Sie verstanden es hervorragend, mit dem Kris umzugehen, jenem schlangenförmig gewundenen Dolch, der sich so gut in den Gewändern verbergen ließ.
Auf manchen Schiffen durfte Selam allerdings nicht an Bord. Dann segelten er und Nusando mit dem kleinen flachgehenden Fischerboot voraus, fuhren über die künstlichen Riffe und warteten in aller Ruhe ab, bis die großen Schiffe aufliefen.
Selam und Nusando bestiegen inzwischen ihr Boot und ruderten hinaus, als hätten sie die Absicht, Fische zu fangen.
„Ein schönes Schiff“, sagte der braunhäutige Nusando anerkennend. „Wieder mal ein Spanier, der auf Heimatkurs segelte und schwer abgeladen ist. Was mag er wohl an Bord haben?“
„Das werden wir nachher sehen. Lassen wir uns überraschen, dann ist der Nervenkitzel größer. Aber ganz sicher hat er wertvolles Zeug geladen. Unsere Frauen sind schon ganz wild auf Stoffe und Tücher.“
Sie beobachteten die heransegelnde Galeone genauer. Das Spektiv hatten sie nicht mitgenommen. Auf den großen Schiffen hätte man sich mit Sicherheit gewundert, wenn Eingeborene etwas Derartiges besaßen. Sie brauchten es auch nicht, sie sahen jetzt jede Einzelheit.
„Sie werden unsicher und ängstlich“, sagte Selam. „Sie haben die Wracks und die Riffe gesehen, aber jetzt können sie nicht mehr zurück.“
Grinsend sahen sie, wie auf der Galeone Segel weggenommen wurden, um die rasende Fahrt zu bremsen. Es war ein verzweifeltes Bemühen. In den Gesichtern der Spanier stand Angst.
Sie brachten ihr Auslegerboot auf Kurs und setzten das Segel. Auf der Galeone herrschte mächtige Aufregung. Ein paar Männer rannten ziemlich sinnlos von einem Deck zum anderen und schrien sich die Kehlen heiser.
Selam und Nusando begannen aufgeregt zu winken und zu gestikulieren. Sie schoben sich noch näher an das große Schiff heran, das mit scharfer Bugwelle die See zerschnitt.
„Spanier?“ brüllte Selam, als sie auf Rufweite heran waren.
Ein dicklicher Mensch mit einem mächtigen Bauch bestätigte schwitzend, daß sie Spanier seien. Sein Gesicht war sehr besorgt. Sein Blick wanderte zwischen den Riffen und den beiden Männern hin und her.
„Ihr lauft in die Riffe!“ schrie Selam und gestikulierte wieder wild. „Ihr müßt zur anderen Seite, aber da sind auch ein paar Riffe.“
Wieder nickte der dicke Mensch ängstlich. Jetzt war sein Gesicht völlig ratlos.
„Könnt ihr uns helfen?“ fragte der dicke Mensch. „Kennt ihr den Weg durch die Riffe?“
„Ja, wir kennen ihn. Sollen wir an Bord kommen?“
Der Spanier schwitzte jetzt Blut und Wasser, als Schaumwirbel immer deutlicher zu erkennen waren. Hin und wieder sah er auch die scharfen Zacken von Korallen. Wenn er da hineingeriet, würden die Sägezähne sein Schiff von vorn bis achtern aufschlitzen und in zwei Teile schneiden.
„Nicht nötig!“ brüllte er übernervös zurück. „Segelt voraus, ich werde euch später belohnen!“
Er wunderte sich nicht einmal, daß der braunhäutige und freundliche Mann seine Sprache sprach, wenn auch etwas holperig. Aber die Rettung war da, wie er meinte.
Selam ging auf den anderen Kurs, fiel nach Süden ab und segelte auf die unterseeischen Bollwerke zu.
Außer Nusando sah niemand sein teuflisches Grinsen.