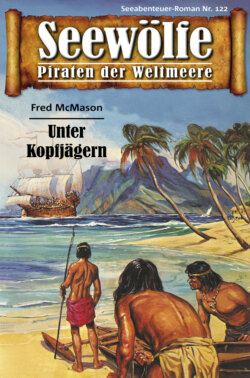Читать книгу Seewölfe - Piraten der Weltmeere 122 - Fred McMason - Страница 4
1.
ОглавлениеNach dreitägiger Irrfahrt erreichten sie nachts die Insel. Daß es eine Insel war, wußte keiner der beiden, sie waren so benommen, ausgehungert und halb verdurstet, daß sie kaum merkten, wie ihr kleines Boot auf den Sand stieß, wie eine Welle es hochhob und schließlich ganz auf den flachen Strand trieb.
Sie taumelten auf festes Land zu, warfen sich in den feinkörnigen Sand und blieben liegen. Mehr als zehn Stunden schliefen sie ununterbrochen. Dann wurde Virgil Romero von der Sonne gekitzelt und fuhr mit einem leisen Schrei hoch.
Seine Lippen waren aufgeplatzt, die Haut gedunsen und seine Vorderzähne so locker, daß er sie ohne Mühe mit den Fingern hätte herausziehen können.
Sein Schrei weckte Antonio, den Steuermann, und dieser Schrei wirkte so ansteckend, daß Antonio ebenfalls aufsprang und in wilder Panik davonlaufen wollte.
Virgil hielt ihn fest und starrte in das vertraute Gesicht, das jetzt so fremd wirkte.
Ein vier Tage alter Bart aus schwärzlichen Stoppeln bedeckte das Gesicht des Steuermanns. Seine Wangen waren eingefallen, seine Augen lagen tief in den Höhlen, und Salzwasser und heiße Sonne hatten sein Gesicht verbrannt. Virgil sah die Haut in Fetzen von diesem Gesicht herunterhängen.
„Wir sind – in Sicherheit“, sagte er mühsam lallend. Seine Stimme war ein heiseres Krächzen, sein Hals brannte bis hinunter in den Magen.
„Ich habe entsetzlichen Durst“, klagte Antonio und sah sich wieder gehetzt um.
Niemand war zu sehen. Anscheinend waren sie allein. Man hatte sie auch nicht mehr verfolgt, seit ihrer überstürzten Flucht.
Es dauerte eine Weile, bis sie begriffen, daß es hier keine Kopfjäger mehr gab.
Vor ihnen dehnte sich weißer Strand, knapp eine halbe Meile lang. Dann schien der Strand hart nach links zu laufen und verschwamm vor ihren Blikken.
„Ich glaube, wir sind auf einer Insel“, sagte Virgil. „Und diese Insel scheint verdammt klein zu sein.“
„Durst“, murmelte der Steuermann schwach. „Nur einen Tropfen Wasser, es zerfrißt mir die Eingeweide.“
Seine tief in den Höhlen liegenden Augen glänzten fiebrig, seine pelzige Zunge schob sich zwischen den Lippen hervor und versuchte sie zu benetzen.
An Bord der „Nuestra Madonna“ war er immer der harte Kerl gewesen, dachte Virgil. Da hatte er die anderen wissen lassen, wer der Steuermann war, und nicht gezögert, brutal hinzulangen, auch wenn kein besonderer Anlaß vorhanden gewesen war.
Aber jetzt war er ein kraftloses Bündel, halbtot vor Angst und dem Wahnsinn nahe. Ein Feigling, dachte Virgil, einer der sich nicht mehr zurecht fand.
Am liebsten hätte er es diesem Lumpenhund heimgezahlt, doch hier war nicht der richtige Ort und nicht die Zeit dafür. Sie waren aufeinander angewiesen und mußten zusammenhalten, wenn sie überleben wollten. Und, verdammt, sie wollten überleben, nachdem sie diesen Teufeln in Menschengestalt entkommen waren.
„Zuerst das Boot auf den Sand“, sagte Virgil, „sonst treibt es ab, und wir sind erledigt.“
„Zuerst Wasser“, protestierte der Steuermann schwach.
„Zuerst das Boot!“ schrie Virgil.
Der Steuermann fügte sich widerspruchslos.
Es wurde eine höllische Plackerei, das leichte Boot höher auf den Sand zu ziehen, bis die Wellen es nicht mehr erreichten. Mit letzten Kräften schafften sie es. Virgil beschwerte den Anker, den er in den Sand grub, zusätzlich mit einem Stein.
„Wasser“, jammerte der Steuermann. „Ich will nicht krepieren.“
„Verdammt noch mal, ich auch nicht. Steh jetzt auf, dann suchen wir Wasser“, sagte Virgil und riß den apathisch dahockenden Steuermann an den Armen hoch.
Mehr taumelnd als gehend, manchmal auf allen vieren kriechend, bewegten sie sich am Strand entlang.
Über ihnen flirrte erbarmungslos die Sonne, der Sand heizte sich auf. Kleine Krebse flohen vor ihnen und verschwanden eilig in den Sandlöchern, wenn die Männer sich näherten.
Sie erreichten die Stelle, wo der Strand aufhörte und nach links lief. Dicht hinter dem Strand standen ein paar Palmen, niedrige Büsche und kleine Blumen, deren blutrote Blüten einen entsetzlichen Duft verbreiteten.
Virgil kniff die Augen zusammen. Ein leises Stöhnen entrang sich seiner Brust, aber er riß sich zusammen und kroch weiter.
Nach einer weiteren halben Meile bot sich ihnen immer noch das gleiche Bild. Es gab ein paar Palmen, einige Sträucher und eine größere Bodenerhebung, die dicht bewachsen war.
„Wir gehen im Kreis“, sagte der Steuermann, „da vorn liegt ein Boot.“
„Ja, da vorn liegt ein Boot“, sagte Virgil schweratmend. „Und das ist das Boot, mit dem wir hier gelandet sind. Jetzt weißt du, wo wir sind, und ich weiß es auch. Der liebe Gott persönlich hat uns in den Arsch getreten.“
Der Steuermann begriff immer noch nicht. Sein zitternder Finger deutete auf das Boot.
„Sie holen uns, diese Teufel!“ schrie er. Wie besessen rannte er plötzlich los, doch schon nach wenigen Schritten fiel er kraftlos in den Sand und heulte.
Virgil hockte sich neben ihn, seine Augen waren leer, glanzlos und starrten in die Ferne, wo sich bis zum Horizont nichts weiter als eine endlos glitzernde Wasserfläche erstreckte.
„Eine Insel“, murmelte er, „eine kleine verdammte Insel, und es gibt nicht einen einzigen Tropfen Wasser.“
Blicklos waren seine Augen auf das Boot gerichtet. Sie hatten die winzige Insel einmal in ganz kurzer Zeit umrundet und befanden sich jetzt wieder am Ausgangspunkt.
Wasser? Davon hatten sie mehr als genug, es ließ sich nur nicht trinken. An die Kokosnüsse, die in den Palmwedeln hingen, reichten sie nicht heran. Die befanden sich in unerreichbarer Ferne.
„Ich will was zu trinken“, jammerte der Steuermann nach einer Weile erneut und zerrte wütend an Virgils Arm.
Der stieß ihn hart von sich und schrie ihn mit hochrotem Kopf an. „Es gibt hier kein Wasser, verdammt! Hier hat es nie welches gegeben, und es wird auch nie etwas geben. Wir werden hier verrecken, todos los santos.“
Die Hitze wurde immer unerträglicher. Antonio lag im Sand und rührte sich nicht. Virgil schleppte sich kraftlos zu der Kokospalme hinüber und ließ sich in deren Schatten fallen.
Der Durst höhlte ihn aus, fraß in ihm und trocknete das Blut in den Adern, bis er glaubte, er bestände nur noch aus Staub.
Spätestens morgen würden sie elend krepieren, wenn nicht ein Wunder geschah. In dieser Gluthitze überlebte man nicht lange, wenn es kein Wasser gab.
Er sah sich um, starrte auf die übelriechenden Blüten und dachte nach. Wenn hier Blumen wuchsen, mußte es auch Wasser geben, eine winzige kleine Quelle nur, wovon sonst sollten sich diese Pflanzen ernähren?
Er begann mit der Suche, dabei warf er immer wieder einen Blick zu den großen Nüssen, die in schwindelerregender Höhe über ihm in dem Wedel der Palme hingen. Sie waren noch nicht ganz reif, aber das war nicht weiter wichtig. Wichtiger war, wie man sie kriegte.
Zuerst buddelte er mit beiden Händen wie besessen in dem Sand bei den Pflanzen, doch der Sand war trocken und heiß, und von dem Geruch, den die Blüten verströmten, wurde ihm schlecht.
„Madre de Dios“, betete er laut, „laß es auf dieser beschissenen Insel Wasser geben! Jeden Tag nur einen Schluck!“
Er wühlte weiter wie ein Tier. Er hatte ein tiefes Loch gebuddelt, über dem er mit dem Oberkörper hing. Schweiß rann ihm über das Gesicht, verklebte ihm die Augen, aber er gab nicht auf und grub weiter, bis seine Hände auf etwas Kühles stießen. Seine Finger wurden feucht, dann naß. Mit einem irren Auflachen erkannte er vor sich tief im Boden ein Rinnsal, das aus dem Sand quoll und einen Teil des Bodens bedeckte.
Als er sich vorbeugen wollte, wurde er zur Seite gerissen. Eine Hand packte ihn, schleuderte ihn fort, ein Fuß trat nach ihm.
Der Steuermann warf sich in das Loch. Sein Gesicht war vom Wahnsinn gezeichnet, seine Hände hielt er wie Klauen gestreckt abwehrbereit zur Seite.
Virgil hatte seine letzten Kräfte verbraucht. Er lag halb auf der Seite im Sand und stöhnte leise.
„Du verdammter Hund“, murmelte er immer wieder. „Laß mir auch einen Schluck, ein paar Tropfen nur!“
Antonio zuckte zurück, als hätte er einen Hieb ins Gesicht erhalten. Erstaunlich rasch kroch er aus dem Loch heraus, Sand auf den Lippen, in den Augen. Sandige Brühe troff ihm aus dem rechten Mundwinkel, und er spuckte.
„Salzwasser!“ heulte er laut. „Und ich habe fast alles gesoffen.“
Virgil konnte kein Mitleid mit ihm empfinden. Der Steuermann hätte ihm keinen Tropfen übriggelassen, wäre es Süßwasser gewesen.
Der Steuermann erbrach sich, aber so sehr er auch zuckte und bebte, er brachte nur ein paar Tropfen heraus. Das schwächte ihn so, daß er wieder in den Sand fiel und sich nicht mehr rührte.
Auch Virgil wollte sich erschöpft und ausgelaugt wieder in den Schatten lehnen, als ihn ein Gedanke durchzuckte, der seine Lebensgeister schlagartig aufpeitschte.
Im Boot lag eine Muskete!
Er lief los, stolperte, fiel der Länge nach hin und raffte sich wieder auf, bis er das Boot erreichte.
Ja, die Muskete lag noch da, sie hatten sie auf ihrer überstürzten Flucht mitgenommen, als sie sich gegen die Wilden gewehrt hatten. Mit der Muskete konnte er ein paar Kokosnüsse herunterschießen, und wenn sie nur eine oder zwei erwischten, dann würde das in jedem Fall ihr Leben verlängern. Virgil hatte von einem spanischen Schiffbrüchigen gehört, daß man ein ganzes Jahr lang leben konnte, wenn man jeden Tag nur eine einzige Kokosnuß verzehrte.
Die nächste Enttäuschung versetzte ihm einen fast körperlich spürbaren Schlag. Das Pulver war naß und matschig, ein unbrauchbarer dunkler Brei. Er goß die dunkle Suppe vorsichtig auf die Ducht und wartete darauf, daß die Sonne es trocknen möge.
Antonio rührte sich nicht. Es hatte den Anschein, als würde er den morgigen Tag nicht mehr erleben, und er selbst, Virgil, konnte sich trotz seiner besseren Kondition ausrechnen, wann es auch mit ihm soweit war.
Er fühlte sich hundeelend und war den Tränen nahe. Einmal begann er laut zu fluchen, dann wieder betete er laut und inbrünstig, und schließlich verfluchte er Gott und die Welt.
Drei Tage hatten sie gebraucht, um diese verdammte Insel zu erreichen. Drei Tage mindestens würden sie auch wieder brauchen, um zum Festland zu gelangen, wo es Trinkwasser gab.
Aber da gab es auch die Kopfjäger und Menschenfresser, die sie unbarmherzig jagen würden.
Nein, es war nicht zu schaffen, entschied er. Sie würden auf See verdursten oder hier, es blieb sich gleich. Hier hatten sie wenigstens die Wilden nicht zu fürchten.
Alle Augenblicke sah er nach, ob das Pulver trocken war. Es klebte langsam zu einer kuchenartigen Masse zusammen, war im Innern aber immer noch feucht.
Die Hitze nahm zu. Mörderisch heiß schickte die Sonne sengende Strahlen zur Erde. Selbst im Schatten war es kaum zum Aushalten. Die heiße und schwüle Luft legte sich beklemmend auf die Lungen.
Gegen Mittag zerbröselte Virgil einen Teil des Pulvers und lud mühsam und mit gequollenen Händen die Muskete.
Doch das Pulver entzündete sich nicht, er konnte tun, was er wollte, es gab keinen Blitz, nichts.
Wütend und enttäuscht warf er die Muskete ins Boot zurück.
Danach versuchte er es mit Steinen, und als er damit ebenfalls keinen Erfolg hatte, rüttelte er wie besessen am Stamm der Palme, ohne daß es etwas einbrachte.
Schließlich versuchte er sie zu erklimmen. Er schaffte nur ein paar Schritte, dann hielten seine Hände nicht mehr fest, er konnte nicht zupacken, verlor den Halt und stürzte kopfüber in den heißen Sand.
Der Tobsuchtsanfall, der dann folgte, zehrte seine letzten Kräfte auf. Dort hoch oben hing das, was sein Leben verlängerte, kühle süßliche Milch, die seinen Durst löschte, Fruchtfleisch, das seinen Hunger stillte, aber es war so weit entfernt wie der Mond.
Zwei Stunden lang lag er reglos da, mit pochendem Herzen, rasselndem Atem und jagenden Lungen, dann verfiel er auf die Idee, den Stamm der Palme zu kappen.
Er kroch zu dem Steuermann hinüber und riß ihm das Messer aus dem Hosenbund. Antonio rührte sich nicht, er hatte sich in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr bewegt. Vielleicht war er tot, oder das Salzwasser hatte ihm den Rest gegeben.
Mit dem Messer hieb er wütend und knurrend wie ein gereizter Hund immer wieder in den Stamm der Palme. Er hieb zu, als hätte er seinen Todfeind vor sich, immer und immer wieder.
Aus dem zerfetzten Stamm rann etwas Flüssigkeit. Virgil preßte die aufgesprungenen Lippen daran und begann gierig zu saugen.
Er spürte, wie neue Kraft in ihm aufloderte, und wie besessen hackte er weiter. Er hatte nicht gedacht, daß das Holz dieser Palme so unglaublich hart und zäh war und sich immer nur winzige Späne herausfetzen ließen.
Aber mit dem weiteren Abspänen sickerte auch immer wieder etwas von dieser Flüssigkeit aus dem Stamm, die ihm neues Leben verlieh.
Nach einer Ewigkeit hörte er auf. Diese Arbeit war allein nicht zu schaffen, und er sah nicht ein, daß sich der lausige Steuermann im Sand ausruhte und nichts zur Arbeit beitrug. Schließlich kam er ja auch in den Genuß der Früchte, sobald die Palme gefällt war.
Er stieß ihn mit dem Fuß an.
„Steh auf“, sagte er heiser. „Hilf mir, den Stamm zu fällen, du fauler Hund! Dann haben wir Milch, kühle Milch!“
Antonio ächzte leise und sah aus blicklosen Augen in den Himmel.
„Wasser!“ brüllte Virgil ihn an, um seine Lebensgeister zu mobilisieren, doch der Steuermann begriff nicht mehr, was er wollte. Ein häßliches Grinsen hatte sich um seine Mundwinkel eingekerbt, in den blicklosen Augen lag ein fast spöttischer Ausdruck.
Virgil zuckte mit den Schultern und wollte sich abwenden. Geschieht dem Kerl ganz recht, sagte eine innere Stimme in ihm. Um den ist es nicht schade. Warum sollst du dich mit ihm abrackern?
Aber da war auch noch eine andere Stimme, und die appellierte an sein Gewissen.
Du kannst ihn nicht verrecken lassen. Ihr seid durch tausend Höllen gegangen. Hilf ihm! Gib ihm etwas zu trinken!
Virgil ließ sich auf die Knie fallen und starrte in das aufgedunsene dreckige Gesicht des Mannes.
Helfen! Hatte das noch einen Sinn? Der Steuermann würde es doch nicht überleben. Weshalb sollte er den kostbaren Saft mit ihm teilen.
„Grins nicht so!“ fuhr er ihn an, doch dann hatte die andere innere Stimme gesiegt.
Mühsam, fluchend und schwitzend, schleppte er den Mann zu der Palme hin und drückte sein Gesicht an den Stamm, hielt ihn im Genick fest und drückte.
Antonio hieb in wilder Gier die Zähne in den Stamm, seine Lippen preßten sich darauf, er stöhnte leise.
Als Virgil ihn losließ, fiel er zurück in den Sand.
Etwas später, die Sonne stand jetzt senkrecht am Himmel, brach das Messer ab.
Virgil starrte es ungläubig an, lachte heiser und begann am ganzen Körper zu zittern.
„Das darf nicht sein“, stammelte er, „Madonna, gib, daß es nicht wahr ist!“
Ein kleiner scharfkantiger Stumpf ragte nur noch aus dem Heft.
Zuerst wollte der spanische Seemann aufgeben, aber der Palmensaft hatte doch seine Lebensgeister geweckt und ihn ermuntert.
Diablo, vielleicht geht es auch mit diesem Stumpf hier, überlegte er. Er brachte es nicht fertig, sich einfach hinzulegen und auf das Ende zu warten. Er wollte kämpfen, solange noch ein winziger Funke Leben in ihm war.
Nachts wurde es unangenehm kühl. Tagsüber war die Hitze nicht zum Aushalten gewesen, doch jetzt kroch eisige Kälte durch Virgils Körper.
Er hockte vor der Palme, wiegte seinen Oberkörper und stieß den Messerstumpf rhythmisch in das faserige Holz. Immer wieder hieb er zu, bis der Mond über dem Wasser stand und silbrige Muster auf die kleinen Wellen zeichnete.
Ein paarmal schlief er vor Erschöpfung ein. Wenn er dann erwachte, rasten heiße und kalte Wellen durch seinen Körper. Fieber, dachte er, das Fieber hat mich gepackt, deshalb friere und schwitze ich abwechselnd, denn in diesen südlichen Breiten wurde es nachts gar nicht kalt.
Als der Morgen über dem Meer heraufdämmerte, erwachte Virgil schweißgebadet. Alpträume hatten ihn geplagt. Wilde waren hinter ihm hergelaufen und hatten versucht, seinen Kopf abzuhacken, wie sie es bei den anderen getan hatten.
Fieber schüttelte ihn. Er biß die Zähne aufeinander und fror erbärmlich.
Dann sah er nach dem Steuermann, blickte in die grinsende Fratze, sah die offenen Augen, die blicklos in den Himmel starrten, und wußte, daß Antonio kein Wasser mehr brauchte.
Der Steuermann war tot. Virgil befand sich jetzt allein auf einer winzigen Insel irgendwo in der Nähe der Insel Kalimantan.
„Eine Toteninsel“, sagte er kichernd. Dann deutete er mit dem ausgestreckten Finger auf den toten Antonio.
„Du hast dich davongeschlichen“, sagte er anklagend, „bist einfach abgehauen. So einfach hast du dir das gemacht!“
Er befand sich in einem merkwürdigen Zustand zwischen Schlafen und Wachsein, einem Halbdämmer, das die Konturen der Insel verzerrte, das den Toten mitunter hoch in den Himmel zu heben schien. Manchmal stand auch die ganze Insel auf dem Kopf oder schwebte zwischen weit entfernten Wolken am Horizont dahin.
Dann wankte er über die Insel, durchquerte sie, lief am Strand entlang und suchte erneut nach Wasser oder Tieren.
Aber auf der kleinen Insel gab es keine Tiere. Kein Vogel war zu sehen, nichts regte sich zwischen den kleinen Pflanzen.
Er war allein in einer unwirklichen Stille, allein mit Antonio, der sich so heimlich davongeschlichen hatte. Vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der Welt, dachte er, wenn er einen lichten Augenblick hatte.
Immer wieder irrte er umher, blickte sehnsüchtig zu den Kokosnüssen und kratzte mit dem abgebrochenen Messer weiter am Stamm der Palme.
Am dritten Tag hatte er es immer noch nicht geschafft. Der Stamm war teilweise zerfetzt, aber er fiel nicht um, und er gab auch nur noch ein paar Tropfen von dem Saft her, der sein Leben rettete.
Müde, mit knurrendem Magen erklomm er die kleine Erhebung der Insel und blickte sich aus glanzlosen Augen um.
Wasser, wohin das Auge sah. Wasser, auf dem goldene Strahlen tanzten, das von silbrigen Wellen glitzerte, Wellen so klein wie krause Haare.
Ein Schreck durchzuckte ihn plötzlich, als er das Schiff sah.
Es lief mit vollen Segeln aus nördlicher Richtung genau auf die Insel zu. Es war ein Dreimaster, der eine mächtige Bugwelle vor sich herschob. Und die Segel waren so prall vom Wind gefüllt, daß die Masten sich unter dem Druck bogen.
Es ging nur kein Wind, überlegte Virgil. Wie konnte das Schiff also so schnell segeln?
Mit klopfendem Herzen lief er zum Strand hinunter und wartete. Doch als er einmal einen Blick auf Antonio warf und dann wieder zum Meer blickte, war das Schiff verschwunden.
Er konnte es nicht glauben, suchte wieder den Hügel auf, sah nach allen Himmelsrichtungen. Nichts, es gab kein Schiff, es hatte nur in seiner Phantasie existiert, oder er war einem Trugbild zum Opfer gefallen.
In der Nähe der Palme lag ein ekelhafter süßlicher Geruch in der Luft, der sich wie eine Wolke am Boden ausgebreitet hatte.
Sein leerer Magen drehte sich um, es würgte ihn, und als er ein paar Schritte in Antonios Richtung ging, wußte er, woher der ekelhafte Geruch stammte. Die Sonne zersetzte Antonios Körper.
Apathisch aß er von den Fasern des Palmenstammes, kaute sie und schlang sie hinunter. Danach ging er wieder an die Arbeit, aber der Geruch wurde immer unerträglicher.
Er hielt es schließlich nicht mehr aus, so übel wurde ihm, aber er konnte diesen Platz auch nicht verlassen, denn nur hier hingen die halbreifen Kokosnüsse.
Also mußte Antonio weg.
Es kostete ihn außer Kraft auch Überwindung, den toten Steuermann an den Armen zu packen und ihn ins Wasser zu schleifen. Dabei hatte Antonio immer noch dieses höhnische Grinsen im Gesicht, als lache er ihn aus.
Erst im Wasser wurde der Körper leichter. Virgil ging so weit mit ihm hinaus, bis er nicht mehr stehen konnte. Dann ließ er den Steuermann treiben, der auch gleich unterging.
Jetzt konnte er seine mühevolle Arbeit fortsetzen, doch kaum hatte er den Strand erreicht, als er Getümmel im Wasser sah. Um die Stelle, an der Antonio versunken war, huschten Schatten hin und her.
„Haie“, sagte er heiser. „Gott sei deiner armen Seele gnädig, Steuermann!“
Bis zum Abend hatte er es immer noch nicht geschafft, die Palme zu fällen, und so gab er es für heute auf. Morgen würde der Stamm stürzen, er schwankte jetzt schon, wenn man an ihm rüttelte.
Doch in dieser Nacht fand Virgil nur wenig Schlaf und warf sich alle Augenblicke unruhig hin und her. Er hatte Angst, denn er sah, wie der Steuermann wieder an den Strand zurückkehrte und dicht am Wasser liegenblieb. Ein Bein und der rechte Arm fehlten.
Auch am nächsten Morgen lag er noch so da, und Virgil verfluchte ihn und die Haie, die es nicht geschafft hatten, ihn draußen zu behalten.
Verbissen nahm er sich wieder den Stamm vor. Der Durst ließ ihn halb wahnsinnig werden, an den nagenden Hunger dachte er nicht mehr. Nur einen Schluck Wasser, einen winzigen nur, so betete er ständig vor sich hin.
Gegen Mittag schrie er vor Freude laut auf. Im Stamm war ein hartes Knakken zu hören, die Palme neigte sich und stürzte dann in den Sand.
Virgil fühlte sich wie neugeboren, als er zu dem großen Wedel rannte und wie ein Irrer, laut kreischend, grüne Kokosnüsse abriß. Er warf sie in die Luft, tanzte herum und lachte, riß immer wieder die Arme hoch und gebärdete sich wie toll.
Mit feierlichem Ernst ging er daran, eins der drei Löcher mit dem Messerstumpf aufzubohren. Dann setzte er die Nuß an die Lippen und trank gierig, schlürfte und schmatzte.
Zu seiner grenzenlosen Enttäuschung gab sie nicht viel her. Es war wirklich nur ein winziger Schluck, nicht einmal ein Mundvoll. Doch er labte ihn, und so zerschlug er die Nuß und fiel gierig über das harte Fleisch her. Die leeren Schalen warf er in den Sand und öffnete die nächste, etwas später die dritte.
Erst nach der vierten Nuß sah er sich ernüchtert um. Jetzt hatte er noch sieben, mehr hatte die Palme nicht getragen.
Wenn er jeden Tag nur eine Nuß aß, konnte er sieben Tage überleben, rechnete er sich aus. Trieb er es aber so wie heute, dann war seine Zeit in zwei Tagen abgelaufen, denn die Nüsse an den beiden anderen Palmen, die noch auf der Insel wuchsen, waren erst winzig klein und noch lange nicht reif. Diese hier schien einen besonders günstigen Standort zu haben.
An einem der nächsten Tage ging die Veränderung mit Antonio rapide voran. Sein Fleisch zerfiel und die Knochen wurden sichtbar. Dieser grausige Anblick veranlaßte Virgil, auf die andere Seite der Insel zu gehen. Begraben konnte er den Steuermann nicht, dazu fehlte ihm jegliches Gerät, und mit den Händen ein Loch in den steinigen Sand zu buddeln, dazu konnte er sich nicht durchringen, denn dann mußte er ihn anfassen.
Seine restlichen drei Kokosnüsse nahm er mit und hütete sie wie einen kostbaren Schatz.
Aus den mittlerweile trockenen Wedeln der Palme hatte er sich im Sand ein Lager bereitet, in das er abends hineinkroch und sich wie ein krankes Tier versteckte.
Er wußte nicht, wie es weitergehen sollte. Noch fühlte er sich einigermaßen wohl, das Fieber hatte sich nicht mehr gemeldet, aber die grelle Sonne ließ seine Haut aufplatzen und überall kleine Wunden entstehen.
Immer wieder achtete er auf Wolken, die Regen versprachen, doch wenn wirklich mal eine am fernen Horizont auftauchte, dann war sie etwas später schon wieder verschwunden.
Wie lange er sich jetzt auf der Insel befand, wußte er nicht mehr. Vielleicht eine Woche? Er hatte jeglichen Zeitbegriff verloren.
Danach ging es ständig mit ihm bergab. Ein paar Tage war er, wie in Trance versunken, auf der Insel herumgelaufen, dann wieder beschäftigte er sich stundenlang mit dem Pulver und der Muskete. Einen Sinn darin sah er nicht, er konnte keine Tiere jagen und die Muskete auch nicht verwenden. Dennoch gab er sich mit einem Eifer der Sache hin, der an Wahnsinn grenzte.
Mitunter verlor Virgil das Bewußtsein, wachte dann irgendwo am Strand wieder auf und begriff nicht, wo er sich befand. Er starrte auf das Gerippe des Steuermanns und sprach mit ihm.
„Wir müssen zurück, Steuermann“, sagte er dann, „die warten bestimmt nicht länger auf uns. Los, steh auf!“
Da Antonio keine Anstalten unternahm, aufzustehen, brüllte und schrie er mit ihm, nannte ihn einen gottlosen Nichtstuer und faulen Lumpenhund, der sich nur ausruhen wollte, ohne an seine Pflicht zu denken.
Wahnsinn befiel ihn. Er sah Schiffe auf dem Meer fahren, sah Seeleute, die ihm zuwinkten, und erblickte große Fässer an Deck, die mit klarem frischen Wasser gefüllt waren. Und als er bittend die Hände ausstreckte und ihm niemand etwas zu trinken gab, nahm er die Muskete und feuerte auf das Schiff.
Danach brach er zusammen.