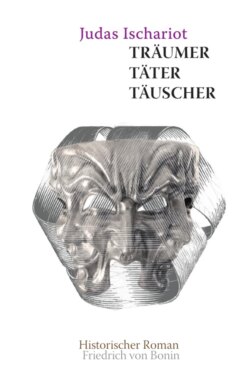Читать книгу Judas Ischarioth Träumer, Täter, Täuscher - Friedrich von Bonin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеISAAK BEN ZACHARIAS
1.
Still lag der Weg im gleißenden Licht der Sommersonne, kein Lüftchen regte sich, kein kühlender Hauch strich über den weißen Sand, in den die Spuren der Karrenräder eingedrückt waren. Absolute Ruhe herrschte jetzt da und glühende Hitze, wo am frühen Morgen die Luft von dem Knarren der Wagen, dem Gelächter und Geschimpfe der Bauern, dem Ächzen der Ochsen, die die schwere Last zum Markt in Nazareth trugen, die Luft erfüllt hatte. Menschen, Tiere und die Karren ließen den feinen Sand wie Staub aufwirbeln, niemand konnte in dem Dunst auch nur die Hand vor Augen sehen, schwitzend, schiebend, schimpfend hatte sich der Zug nach Nazareth bewegt und mittags zurück. Nichts ließ jetzt noch darauf schließen, dass in der flimmernden Luft, der brennenden Hitze Leben sein könnte, wie erstarrt lag die Welt. Nicht einmal Schlangen oder Eidechsen unterbrachen ihren Schlaf.
Und doch bewegte sich aus der Richtung Nazareth ein kleiner Zug. Römer waren es, nur Römer waren närrisch genug, sich dieser Glut auszusetzen, um ihren Geschäften nachzugehen und diesen Weg benutzten, wenn ihre merkwürdigen Angelegenheiten es erforderten. Zehn Legionäre in voller Waffenmontur gingen voran, gefolgt von einer Sänfte, die von vier Sklaven getragen wurde. Lucius Falba, der Steuereintreiber von Galiläa, war auf dem Weg von Nazareth nach Tiberias, um dem jüdischen König Bericht zu erstatten und ihm die eingetriebenen Gelder zu bringen. Herodes Antipas, der von den Römern eingesetzte König in Galiläa, würde wie immer neun Zehntel der Steuern nach Cäsarea, zum römischen Statthalter, schicken, ein Zehntel verbrauchte er für seine Hofhaltung.
Lucius Falba fluchte in seiner Sänfte leise vor sich hin. Der Schweiß lief ihm von der Stirn in der Hitze, obwohl er die Vorhänge der Fenster weit zurückgeschlagen und seine Träger angewiesen hatte, schneller zu laufen, damit etwas Luftzug ihn erleichtere. Immer wieder wischte er sich mit dem Schweißtuch über den Kopf, ohne dass dies Linderung brachte, der Stoff war durchnässt. Aber der Römer wusste: Die Träger konnten nicht schneller laufen, auch sie litten unter der Sonne, obwohl sie schwarze Sklaven aus Nubien waren, die eigentlich an diese Temperatur gewöhnt sein sollten.
Nach seiner Meinung war der Weg überhaupt überflüssig. Er hätte um diese Steuern nicht solch ein unsinniges Aufheben gemacht, er würde die Steuern direkt nach Cäsarea bringen, nicht zu diesem eigenartigen König der Juden, der auch noch einen Teil für sich behielt. Er, Falba, würde sich mit diesen Galiläern sowieso nicht so lange aufhalten. Sie sollten arbeiten, Steuern bezahlen und im Übrigen Ruhe geben. Zahlten sie zu wenig Steuern, schickte man die Legionen, die würden schon dafür sorgen, dass diese sturen Bauern sich unterwarfen. Und dann auch Legionen für die Rebellen, die hier und in ganz Palästina ihr Unwesen trieben. Es konnte doch nicht sein, dass der Steuereintreiber eine ganze Gruppe Legionäre als Bewachung brauchte, nur, weil er von Nazareth nach Tiberias reisen musste. Wie oft schon hatte er den Präfekten, Annius Rufus, schon in aller gebotenen Höflichkeit gebeten, endlich durchzugreifen in diesem Land mit seinen widerspenstigen Bewohnern, die sich nicht unterstanden, ihn, den Steuereintreiber, auf das Übelste zu beleidigen, wenn er das Recht Roms auf Steuern einforderte. Aber nein, Rufus war viel zu ängstlich, er habe keine Befehle aus Rom, antwortete er regelmäßig auf die Vorhaltungen, Rom habe ihn zu mäßiger Amtsführung aufgefordert und dabei bleibe es.
Falba wischte sich abermals mit dem Tuch den Schweiß aus der Stirn. Es hatte keinen Zweck, sich bei dieser Hitze aufzuregen, es änderte sich ja doch nichts und der Grimm erhöhte nur die Temperatur.
Falba sah aus dem Fenster. Der Weg führte zwischen den Höhenzügen Galiläas hindurch, gerade passierten sie einen dichten Wald, hauptsächlich aus Olivenbäumen, aber auch aus Eichen und Terebinthen.
Der Anführer der Legionäre, ein Decurio, ließ sich zur Sänfte zurückfallen.
„Wollt Ihr nicht lieber die Vorhänge zuziehen, Herr?“, fragte er, „wenn an diesem Weg Rebellen sind, dann hier, wo sie durch den Wald geschützt sind.“
„Ach was“, entgegnete Falba ärgerlich, „bei dieser Hitze schlafen auch die Rebellen in Galiläa.“
In diesem Augenblick schrien die Legionäre der Vorhut panisch auf: „Alarm! Wir werden überfallen!“ Die letzten Worte wurden erstickt in einem Gurgeln und übertönt von einem wüsten Kampfgeschrei. Wohl vierzig schwarzbärtige, zerlumpte Männer waren aus dem Wald hervorgesprungen, hatten sich über die Legionäre hergemacht, sie fast kampflos überwältigt und getötet. Die Träger, auch sie bewaffnet, hatten die Sänfte hart auf den Boden gestellt und ihre Waffen zur Gegenwehr gezogen, waren aber niedergehauen worden. Der Decurio konnte noch das Kurzschwert ziehen und dem ersten Angreifer den Kopf spalten, ehe er von hinten von einer Lanze durchbohrt wurde. Er starb im selben Augenblick.
Lucius Falba erstarrte. Um die Sänfte und die erschlagenen Römer tanzten jetzt düstere Gestalten.
„Komm heraus, Dicker!“, schrien sie, „damit wir dich ansehen können!“
Falba konnte die Worte kaum verstehen, sie waren in diesem fürchterlichen Dialekt gesprochen, den sie hier benutzten, mit einigen griechischen Brocken durchsetzt. Er begriff aber sehr wohl, dass sie ihn zum Aussteigen aufforderten. Zitternd erhob er sich in der Sänfte, ordnete seine Tunika und zitternd stieg er aus. Die Sonne traf ihn wie mit einem Schlag. Lucius Falba war tatsächlich fett. Seine kleinen schwarzen Augen verschwanden fast ganz unter den dicken Wangen, die jetzt vor Aufregung bibberten.
„Ihr könnt mir nichts antun, ich bin Lucius Falba, Steuereintreiber des göttlichen Kaisers Augustus in Rom. Augustus wird mich furchtbar rächen, wenn ihr mich berührt.“
Ängstlich sah er sich um. Da lagen die Legionäre, die ihn eskortieren sollten, tot, einige erstochen, andere von Pfeilen getroffen und zwei offensichtlich mit Knüppeln erschlagen. Der weiße Sand war durchtränkt mit Blut. Falba sah, wie einer der Legionäre den Kopf hob und mit einem schnellen Messerstich getötet wurde.
Aus der Masse der Banditen löste sich jetzt ein stämmiger älterer Mann, wie die anderen in eine zerlumpte Hose und Jacke gekleidet, aber mit einem glänzenden langen Schwert, mit Dolch und Pfeil und Bogen sehr gut bewaffnet.
„Schön, du Steuereintreiber“, antwortete er in fast fließendem Griechisch, der Sprache, die hier alle gebildeten Menschen sprachen, „wir werden dir nichts antun, vorausgesetzt, dein göttlicher Kaiser bezahlt das Lösegeld, das wir für dich verlangen. Und deine Kasse hier in der Sänfte, die werden wir für uns beschlagnahmen. Und damit du weißt, mit wem du es zu tun hast“, er vollführte eine ironische Verbeugung, „ich bin Isaak Ben Zacharias, der Anführer dieser Truppen hier. Ihnen ist der Name aber zu lang, sie nennen mich hier alle Isaak, unter diesem Namen solltest du mich kennen.“
Falba erschrak. Tatsächlich kannte er den Namen, so hieß der wohl berühmteste Kämpfer in Galiläa, er galt als rücksichtslos, brutal und grausam, ein Terrorist und Mörder, auf dessen Ergreifung von dem römischen Statthalter in Cäsarea eine hohe Belohnung ausgesetzt war, die sich aber seit mehr als zehn Jahren niemand hatte verdienen können.
Isaak Ben Zacharias war nur mittelgroß, aber sehr stämmig gebaut. Unter der zerlumpten Jacke waren imponierende Muskeln zu erkennen, der Hals war kurz und stark. Auf dem Kopf hatte er die Reste eines Doktorhutes, der Zierde der Schriftgelehrten unter den Juden, der seinen Schädel nur unvollkommen bekleidete. Niemand wusste, wie die in dieser Umgebung absurde Kopfbedeckung zu Isaak gelangt war. Darunter trug er ein Tuch, mit dem er sich die Stirn trocknete. Kleine, flinke und kalte Augen blickten den Römer jetzt an, befriedigt von der Wirkung, die sein Name auf ihn offenbar hatte.
„Die Kasse gehört dem Kaiser in Rom“, antwortete Falba kleinlaut, „ihr werdet furchtbar bestraft werden, wenn ihr euch daran vergreift. Und ich glaube nicht, dass der Statthalter Lösegeld für mich bezahlen wird, dazu bin ich nicht wichtig genug.“
„Umso schlimmer für dich“, sagte Isaak, „aber das werden wir sehen. Jetzt kommst du mit uns, wir können dich aber leider nicht in der Sänfte transportieren, du wirst laufen müssen.“
„Ich kann nicht laufen“, protestierte Falba, „sieh doch meine Schuhe, darauf kann man keine weiten Wege zurücklegen, und schon gar nicht in dieser Hitze.“
„Dann wirst du es eben lernen“, sagte Isaak mit einem Blick auf die Sandalen des Römers, die aus einem hoch geformten Holzstück bestanden, geschnürt mit breiten Riemen, „wenn es dir in den Schuhen zu beschwerlich wird, kannst du ja barfuß gehen und die Hitze musst du eben aushalten. Denke immer daran, was wir Juden alles ertragen müssen.“
Falba begann, von den Rebellen vorwärts gestoßen, den Gang in den Wald, auf seinen hohen Sandalen mehr stolpernd als gehend.
Er bemerkte jetzt, als er hinter dem Anführer herging, dass Isaak das rechte Bein nachzog. Dennoch ging er so schnell, dass der fette Römer Mühe hatte, ihm zu folgen. Er wagte aber nicht, zurückzubleiben, weil hinter ihm die Sänfte folgte, von zweien der Männer getragen und dahinter die ganze Rotte, lachend, spottend und drohend, sobald er langsamer wurde. Nach kurzer Zeit hatte er Blasen an den Füßen, verursacht durch die zum Gehen nicht geeigneten Sandalen, zog sie aus und ging barfuß weiter.
Ohne Weg zogen sie durch den dichten Wald, ohne auf das Unterholz zu achten, über altes Holz- und Wurzelwerk, immer bergan, bis sie nach drei Stunden die Richtung wechselten und bergab in ein tief in das Gebirge eingefurchtes Tal stiegen. Obwohl die Sonne den Wald nicht durchdringen konnte, war die Temperatur immer noch unerträglich. Mehrfach weigerte sich der Römer, erschöpft von Hitze, Durst und Hunger, weiter zu gehen, wurde aber jedes Mal brutal von den Männern hochgezogen und weitergeschleppt, bis er erkannte, es sei immer noch angenehmer, selbst zu gehen, als von seinen Peinigern roh vorwärts gezogen zu werden. Die Rebellen schienen unter der Hitze kaum zu leiden, auch Durst schienen sie nicht zu kennen, lachend und scherzend folgte sie dem Anführer, ihrem Gefangenen und der Sänfte, bis der Zug gegen Abend eine tiefe Schucht erreichte, die dicht mit Zypressen und Zedern bestanden war. Hier, am Rande einer mannshohen Felswand, erkannte Falba ein Lager, das offenbar schon längere Zeit bestand.
„Unser Hauptquartier!“, lachte Isaak, als er den Römer anwies, sich zu setzen, „hier lagern wir. Aber bilde dir nicht ein, dass du diese Stelle wiederfindest, wenn wir dich freilassen. Wir streifen durch die Gegend und haben sehr viele andere Verstecke.“
Erleichtert ließ der Gefangene sich auf den weichen Waldboden sinken und befühlte seine brennenden und blutenden Füße.
„Kann ich etwas Wasser haben?“, fragte er kleinlaut und erschöpft, „ich muss meine Füße kühlen.“
„Zum Trinken bekommst du Wasser, streng rationiert. Wenn du es für deine Füße benutzt, wirst du Durst leiden“, war die Antwort, und tatsächlich ließ Falba seine Füße los und trank aus dem Wasserschlauch, den man ihm reichte.
2.
Isaak Ben Zacharias hatte es sich mit drei seiner Getreuen am Feuer bequem gemacht.
„Das war ein guter Fang heute“, sagte Mathias, ein junger Mann, der erst sehr kurz unter Isaaks Rebellen war, sich aber trotz seiner Jugend schon die Achtung seines Anführers erworben hatte. Nicht nur, dass er äußerst tapfer und im Kampf immer in vorderster Reihe war, er war Isaak von Anfang an durch seine planerischen Fähigkeiten aufgefallen. Er war es auch gewesen, der die Nachricht von der Reise des Steuereintreibers ausgekundschaftet und den heutigen Zug vorbereitet hatte.
„Ja, das Lösegeld wird mindestens fünfzigtausend Sesterzen betragen, damit kommen wir eine Weile hin, ohne zu neuen Kämpfen gezwungen zu sein.“ Isaak versank in Grübeleien, wie in letzter Zeit häufiger, wenn ihm sein Bein zu schaffen machte.
Er mochte jetzt knapp über vierzig Jahre alt sein, mit zunehmendem Alter empfand er die Behinderung durch das Bein schlimmer. Er war gerade sieben Jahre alt gewesen, als der römische Legionär ihn angegriffen hatte, ihn, das Kind, als er sich gegen die Verhaftung seines Vaters zur Wehr gesetzt hatte. Mitten am Tag waren sie über das kleine Gehöft in der Nähe von Nazareth hergefallen und hatten seinen Vater verhaften wollen. Sie behaupteten, er sei angezeigt worden, mit den Aufrührern in der Nähe zusammen zu arbeiten, ihnen Tipps für ihre Raubzüge zu geben und ihnen die gestohlene Ware abzunehmen, um sie auf seinem Hof zu verkaufen.
Isaak hatte sich gegen die Ungerechtigkeit, die in diesem Vorwurf lag, gewehrt, wusste er doch, dass sein Vater auf keinen Fall etwas gegen die Römer unternahm. Zu oft hatte er mit seinem Sohn über die Sinnlosigkeit von Widerstand gegen die Besatzer gesprochen. Der Junge hatte sich vor die Legionäre geworfen und immerfort geschrien: „Lauf weg, Vater, ich halte sie auf“, und geheult und geweint. Zwanzig Mann hoch waren sie auf dem Hof erschienen, als sie den Jungen nicht bändigen konnten, hatte einer der Männer ihm das Schwert in die Wade gestoßen, er fiel hin und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Das Schwert war bis auf den Knochen durchgedrungen und hatte eine hässliche Wunde hinterlassen, von der sich das Bein nie erholt hatte. Bis heute hatte er immer wieder Schmerzen in der Wade, er zog das Bein nach, war aber, wie er mit grimmigem Lächeln bedachte, immer noch schneller als mancher der jungen Männer, die sich ihm angeschlossen hatten.
Sie hatten den Vater trotz seiner Gegenwehr mitgenommen. Vier Tage hatten sie ihn eingesperrt und wieder und wieder verhört, bis sie endlich überzeugt waren, er sei kein Feind der Römer und schon gar nicht ein Terrorist.
Sein Vater und seine beiden älteren Brüder hatten den elterlichen Hof bestellt und auch er, obwohl er sehr jung war, hatte mitarbeiten müssen. Seit Menschengedenken war seine Familie auf diesem kleinen Betrieb ansässig, wo sie einen Olivenhain bewirtschafteten, klein genug, einen Weinberg, von dessen Trauben sie einen süßen Wein kelterten auf dem Feld hatten sie ein bisschen Getreide gesät und geerntet. Arm war es in seiner Familie immer zugegangen, nicht sein Vater war reich oder auch nur vermögend gewesen, nicht sein Großvater und sein Urgroßvater. Aber sie hatten ihr Auskommen gehabt in guten Jahren, wenn die Winterregen reichlich geflossen waren, in Dürrezeiten, die, Jehova sei Dank, schon lange nicht mehr vorgekommen waren, war es knapp gewesen, sie hatten hungern müssen.
Aber dann waren die Römer gekommen, hatten das Land besetzt, noch zu Zeiten seines Großvaters, und hatten ihre eigene Verwaltung begründet. Sein Großvater hatte die Römer freundlich empfangen, ihm und seinen Nachbarn war es egal, wer regierte, die Römer oder die klugen Schriftgelehrten aus dem fernen Jerusalem. Immer hatten sie den Zehnten ihres Ertrags an Steuern bezahlen müssen, auch fast immer können, nur manchmal hatten sie den Steuereinnehmer auf das nächste Jahr vertrösten müssen, weil nichts da war.
Die Römer hatten die Steuern erhöht, erst auf den fünften Teil, zuletzt hatten sie verlangt, dass die Bauern die Hälfte ihrer Ernte an die Behörden ablieferten.
Finster blickte Isaak auf seinen Gefangenen. Es war ihm sehr lieb, einen von diesen römischen Blutsaugern in seiner Hand zu haben, so konnte er ein bisschen von der Angst, die seine Familie jedes Mal ergriffen hatte, wenn sie auf den Hof kamen, zurückgeben.
So lange es ging, hatten sie, sein Vater und seine Brüder, den Hof bewirtschaftet und die Steuern gezahlt, die die unersättlichen Besatzer verlangten.
Aber irgendwann stellten sie fest, dass plötzlich die Kunden, an die sie Wein und Öl und Getreide geliefert hatten, nicht mehr bei ihnen bestellten. Besonders der Wein vom Hof Zacharias war weithin berühmt gewesen, bis nach Syrien im Norden und nach Unterägypten im Süden hatten sie ihre kleinen Mengen zu hohen Preisen verschickt. Eines Tages wollte, für sie überraschend, auf einmal niemand mehr ihren Wein, ihr Öl und ihr Getreide haben.
Ratlos hielten die Bauern Versammlungen ab, woher mochte es kommen, dass die Früchte aus Galiläa plötzlich nicht mehr verkäuflich waren?
Bis Zacharias Nachbar, der streitbare Samuel Ben Ruben, ein reicher Mann, groß, mit einem kräftigen Bass, auf einer Versammlung seinen Ärger hinausgeschrien hatte:
„Sie nehmen uns unsere Kunden weg, die Römer. Sie verschicken ihren eigenen Wein, ihr eigenes Öl und ihr eigenes Getreide in alle Welt, bis hierher, nach Juda, selbst bei uns in Galiläa kaufen die Menschen die römischen Erzeugnisse.“
„Aber warum denn?“, ereiferte sich der lange Gad, ein Bauer aus dem Nachbardorf, ebenso arm wie Zacharias.
„Weil die Waren aus Rom billiger sind, darum“, schrie Samuel mit tiefer Stimme, „sie produzieren in Mengen in ihren neumodischen Manufakturen, so viel erzeugen sie, dass sie selbst das alles in ihrem Italia nicht verbrauchen können. Und dann überschwemmen sie uns mit ihrem billigen Kram, der zwar lange nicht so gut ist wie unser Wein, unser Öl, aber eben nur ein Zehntel kostet von unseren Früchten.“
„Ein Zehntel?“ Zacharias war ungläubig. „Von solchen Preisen kann doch niemand leben, vor allem nicht, wenn sie doch über das Meer erst hierher transportiert werden müssen.“
„Den Transport bezahlt ihnen die kaiserliche Kasse. Der römische Kaiser will auf jeden Fall, dass ihre Waren verkauft werden, damit ihre Bauern nicht arbeitslos werden und auf die Straße gehen.“
„Und wir hier, wir sollen auf die Straße gehen?“, fragte Gad.
„Als ob das die Römer kümmert, wie es uns ergeht. Hauptsache, sie sind ihre Waren los.“
Wie diese, erinnerte Isaak sich, gab es viele Versammlungen, in allen Dörfern in Galiläa. Versammlungen, zu denen auch die reichen Schriftgelehrten aus Jerusalem kamen, Doktor Elesser zum Beispiel, ein kleiner, feiner Herr, in schwarzes, wertvolles Tuch gekleidet, mit einem Smaragd vor dem Auge als Sehhilfe und dem steifen Doktorhut auf dem Kopf.
„Unser Prophet Jesaja lehrt uns, dass wir der Regierung gehorchen“, mit leiser, eleganter Stimme sagte er das, „deshalb geben wir ihnen die Steuern, die sie festsetzen und leisten keinen Widerstand. Wenn Jehova gegen sie ist, werden wir uns gegen sie wehren können, aber vorher nicht.“
Samuels Stimme klang grob gegen die des feinen Herrn aus Jerusalem.
„Es mag ja sein, dass ihr ihnen gebt, was sie verlangen, aber wir Bauern in Galiläa, wir haben nichts mehr, was wir ihnen geben könnten. Wir haben selbst nichts zu essen und sie wollen immer noch mehr.“
Verächtlich zog Isaak den Mundwinkel herunter an seinem Feuer. Weiche Feiglinge waren das, in Jerusalem, und nicht in der Lage, ihren Bauern zu helfen. Einer nach dem anderen gab seinen Betrieb auf, den dann reiche Kaufleute aus der Stadt, aus Tiberias, für sehr wenig Geld kauften und durch Verwalter bewirtschaften ließen. Und die richteten nach römischem Vorbild Manufakturen ein, die billig produzieren konnten, ihre Erzeugnisse waren immer noch teurer als die römischen, allerdings auch kaum mehr besser, aber sie verstanden es, sie den Menschen als „Originalware aus Galiläa“, etwas Besonderes, anzubieten, so dass sie verkaufen konnten.
Die alten Bauern aber, Zacharias, Gad und die anderen, wurden von ihren Höfen verjagt. Hilflos trieben sie in der ersten Zeit auf den Straßen dahin, bettelten, bis zu Skeletten abgemagert, die ebenfalls dürren Kinder an den Händen, bei den Reichen. Immer wieder wurden sie aus den Dörfern vertrieben, weil die verbliebenen Bauern ebenfalls immer ärmer wurden, bis sie in den Städten landeten, in Tiberias, in Cäsarea, selbst in Nazareth, wo es reichere Häuser gab, in der Hoffnung, dass darin mitleidige Menschen wohnten. Aber auch dort wurde ihnen schnell klargemacht, dass sie nicht erwünscht waren. Schließlich fielen sie, sie wurden immer mehr, den römischen Legionären als bettelnde, arme, gesetzlose Menschen auf, die die römische Ordnung störten. Die Offiziere vertrieben sie auch aus den Städten.
Isaak fröstelte, obwohl ihn das Feuer wärmte. Er sah sich noch, den fünf- sechsjährigen, mit seinem Vater über das Land gehen, allein, einsam. Seine Mutter war dem Schreck nicht gewachsen gewesen, der die Familie ergriff, als ihr reicher Nachbar, der Römerfreund Chaim, der sich selbst den Beinamen „Tertius“ gegeben hatte und den römischen Adelstitel um geheimnisvolle Verdienste erhalten hatte, mit fünf Legionären auf dem Hof erschien und die arme Hütte betrat, in der die Familie zu Abend aß.
„Ihr verschwindet jetzt hier, und zwar schnell“, sagte er, nicht einmal unfreundlich, „ich habe die Schuldpapiere von Mordechai, dem Geldverleiher, gekauft. Ihr könnt die hundert Sesterzen, die er euch geliehen habt, nicht zurückzahlen, also nehme ich euer Land. Ihr habt hier nichts mehr zu suchen.“
Isaak erinnerte sich bis heute an den leisen Laut, den seine Mutter von sich gab, als sie die Hände an der Schale, aus der sie trank, verkrampfte, die Schale zu Boden fiel und zerbrach und seine Mutter ganz langsam in sich zusammensank.
„Das hast du verschuldet, du Römerfreund“, Zacharias sprang auf und wollte Chaim fassen. Aber sofort warfen sich zwei der Legionäre auf ihn, fesselten ihn und trugen ihn hinaus, wohin Isaak ihnen folgte, nach einem letzten Blick auf die Mutter.
Erst sehr viel später begriff er, dass seine Mutter bei dem brutalen Überfall des Nachbarn gestorben war.
„Papa“, weinte er, „Mama soll wiederkommen, ich habe Hunger.“
Zacharias drückte die Hand seines Sohnes fester.
„Mama wird nicht wiederkommen, Isaak“, flüsterte er mit gebrochener Stimme zu ihm hinunter, „ich weiß, du hast Hunger, warte nur ab, heute Abend wird es was zu essen geben.“
Das war der Tag, an dem sein Vater zum ersten Mal in ein reiches Haus eingebrochen war. Zacharias hatte erfahren, dass der Besitzer verreist und das Haus nur sehr schwach von drei Sklaven bewacht war, die fest schlafen würden. Isaak musste vor dem Hoftor warten und Wache stehen.
„Wenn irgendwer kommt, schrei ganz laut und lauf weg, so schnell du kannst“, schärfte ihm sein Vater ein, „lauf immer in diese Richtung bis zum Wald und versteck dich, bis ich wiederkomme.“
„Und wenn du nicht wiederkommst?“, weinte der Junge.
„Sei ganz sicher, wenn ich erwischt werde, wird das für die anderen gefährlicher sein als für mich.“ Zacharias Stimme verriet seine Entschlossenheit und grimmig zeigte er dem Sohn das lange Messer, das er an der Seite unter dem Umhang trug.
Als der Vater aus dem Haus zurückkam und Isaak wieder an der Hand nahm, trug er einen prall gefüllten Beutel auf dem Rücken. Sie gingen ruhig in den Wald, lagerten sich dort und aßen zum ersten Mal seit Wochen wieder ausreichend.
Immer öfter brach nun Zacharias in Häuser ein, fand Lebensmittel, aber auch Gold, Schmuck und bares Geld der Römer, Sesterzen, so dass sie nicht mehr oft hungern mussten.
3.
Isaak schüttelte den Kopf. Es war mittlerweile dunkel geworden, sie hatten vier Feuer entzündet, an denen sie das Gerstenbrot rösteten, um es mit Gurken, Oliven und Käse zu essen. Fleisch gab es nur selten bei ihnen zu essen, nur dann, wenn sie ein Schaf oder eine Ziege erbeuteten, was selten genug geschah.
Isaak sah von seinem etwas erhöhten Platz auf das Lager. Seine Männer hatten sich um die Feuer herum versammelt, sie lagen auf dem Boden, aßen, tranken und redeten. Gelächter erfüllte den Platz, in einer Lautstärke, die Isaak niemals geduldet hätte, wäre er nicht sicher gewesen, dass sie unbeobachtet und kein Mensch in der Nähe war. Er hatte insgesamt acht Wächter ausgestellt, obwohl er keine Gefahr sah, das war reine Routine. Die Feuer flackerten lebhaft, die Männer hatten ausschließlich trockenes Holz gesammelt, so dass fast kein Rauch zu sehen war. Die Bäume um sie herum waren dicht belaubt, ab und zu drehte sich im leichten Wind, der jetzt aufkam, ein Blatt und erweckte den Eindruck, ein Mensch oder Tier beobachte sie. Die Männer schreckte das nicht, sie waren die Umgebung gewöhnt.
Über dreißig Rebellen waren hier versammelt, zum Teil zerlumpt, einige besser gekleidet, weil sie von ihren Opfern Hosen, Jacken und Schuhe genommen hatten. Isaaks Gesicht verfinsterte sich: sie waren nicht zimperlich, durften es nicht sein, wenn sie überleben wollten, und so hatte mancher Mann sein Leben lassen müssen, weil er sein Paar Schuhe nicht freiwillig hergegeben hatte. Ihre Kleidung war sehr unterschiedlich, aber auch die zerlumptesten unter ihnen trugen hochwertige Waffen: Schwert und Dolch und Schild die einen, Dolch und Pfeil und Bogen die anderen und alle waren kampferfahren, sie fürchteten keinen Feind, und erst recht nicht die römischen Legionen. Sie hatten sich mit ihren dreißig Mann schon an eine ganze Hundertschaft gewagt, die sie einmal drei Tage lang gejagt hatte. Sie hatten sich in einen Hinterhalt gelegt, hatten ihre Pfeile abgeschossen und waren dann hervorgestürmt. Im Kampf Mann gegen Mann war jeder einzelne seiner Männer jedem Legionär haushoch überlegen, das wusste Isaak.
In Gedanken kehrte er zum heutigen Tag zurück. Heute hatten sie bessere Beute gemacht, der Römer würde ihnen eine Menge Geld bringen, aber erst einmal musste der römische Statthalter Annius Rufus wissen, dass sein Steuereinnehmer gefangen war und Isaaks Forderung kennen. Wen sollte er nach Cäsarea schicken, wer war klug und mutig genug, um mit dem obersten römischen Beamten zu verhandeln? Er durfte nicht die Gefahr vernachlässigen, in die sich der Bote begab. Es konnte gut sein, dass Annius Rufus ihn hinrichten ließ, wenn er von der Geiselnahme hörte. Die Römer waren für Isaak unberechenbar, entweder ließen sie sich auf Verhandlungen ein oder sie ermordeten seinen Boten, egal, wer es war. Und die Hinrichtungsmethoden der Römer waren grausam. Sie kreuzigten unweigerlich diejenigen, die sie für politische Straftäter hielten, und einen Angriff auf ihren Steuerbeamten würden sie jedenfalls für ein politisches Verbrechen halten. Isaak schüttelte sich. Ein Gekreuzigter, der nicht durch Nägel verwundet, sondern nur an das Kreuz gebunden wurde, starb nicht schnell. Er hing in der Sonne, er verblutete nicht, sondern er verdurstete in drei Tagen, bis alle Flüssigkeit aus ihm gewichen war. Er war eines Tages mit seinem Vater an so einer Hinrichtungsstätte vorbeigekommen und hatte noch heute die heiseren Verzweiflungsrufe des Delinquenten im Ohr, der dort schon den zweiten Tag gehangen hatte.
Wen also sollte er beauftragen?
Der beste Unterhändler wäre wohl Mathias, auf ihn hätte Isaak sich am liebsten verlassen, er würde auch gehen, wenn ihn sein Hauptmann darum bat, er würde auch die Gefahr kennen, aber darüber mit jugendlichem Übermut lachen. Isaak hatte Mathias in sein Herz geschlossen, der junge Mann war wie ein Sohn für ihn, nein, den würde er nicht gehen lassen.
David vielleicht. Ein furchtbarer Kämpfer, stark, verwegen und klug. David war alt genug, um die Gefahr zu kennen, manchmal allerdings zu mutig. Schon mehrmals hatte er sich in Gefahr gebracht, weil er allzu stürmisch den Feind angegriffen hatte, obwohl er sich, wie Isaak zugeben musste, aber auch immer selbst herausgehauen hatte, mit Stärke und, wo das nicht reichte, auch mit List. Ja, David konnte er schicken. Und zum Begleiter konnte er ihm den jungen Judas mitgeben, der sich ihnen vor sechs Monaten angeschlossen hatte. Judas würde vor der Stadt warten und ihnen Nachricht geben, wenn David festgenommen würde.
„He, David“, rief er zum nächsten Feuer hinüber, an dem der junge Mann mit anderen saß, „Komm mal rüber.“
„Ich habe überlegt, dass du am besten nach Cäsarea gehst, zum Statthalter, um Lösegeld von ihm zu fordern.“
David war jünger als Isaak, knapp dreißig Jahre, riesig von Gestalt mit einem scharf geschnittenen Gesicht. Die schwarzen Augen glühten Isaak jetzt an.
„Gern, Bruder, ich gehe gern nach Cäsarea, wieviel soll ich für unsern Römer denn fordern?“
„Du musst vor allem aufpassen, dass du mit keinem andern darüber sprichst als dem Statthalter. Sonst kommst du in Gefahr, dass dich irgendein Centurio aufhängt, bevor Rufus überhaupt von unserem Gefangenen erfährt. Also nur mit Rufus, verstehst du?“
„Höre, Isaak, du hast mich doch nicht ausgesucht, weil du mir das nicht zutraust. Ich werde auf keinen Fall von irgendjemand Lösegeld verlangen, als nur vom Statthalter, und wenn ich Wochen auf eine Audienz warten muss. Aber wieviel soll ich fordern?“
„Fordere achtzigtausend Sesterze, aber wenn er dir fünfzigtausend gibt, ist das auch in Ordnung. Er wird, wenn er überhaupt zahlt, mit dir verhandeln wollen. Kannst du, akzeptiere aber nicht weniger als fünfzigtausend.“
„Hat er so viel Geld in Cäsarea?“
„Ganz sicher. Alle Steuern, die die Juden zahlen, gehen dorthin, und er schickt Geld nur einmal im Jahr, im beginnenden Winter, nach Rom, er hat jetzt mehr als genug in seinen Truhen. Und höre, du kannst nicht Wochen in Cäsarea auf eine Audienz warten. Mach es dringend, aber wenn du in zwei Tagen nicht mit ihm gesprochen hast, komm zurück. Wir müssen dann neu nachdenken. So lange können wir diesen dicken Steuereinnehmer nicht ernähren, auch wenn wir ihn kurzhalten.“
David lachte.
„Ich glaube auch, dass er uns die Haare vom Kopf fressen wird, aber eine Woche können wir ihm ein wenig von unseren Vorräten abgeben, gerade so viel, dass er nicht verhungert.“
„Der junge Judas soll dich begleiten, schick ihn mit Nachrichten, wenn du länger bleiben musst. Und Judas wird uns auch benachrichtigen, wenn die Römer dich gefangen nehmen.“
Schnell wurde der junge Rebell ernst.
„Ich weiß, es ist gefährlich, in ihr Hauptquartier zu gehen. Aber mach dir keine Sorgen, Isaak, ich komme da wieder raus. Ich habe schon ganz andere Dinge erlebt.“
Isaak nickte. Er erinnerte sich an den Moment vor drei Jahren, als dieser jetzt so kräftige Mann plötzlich vor ihm stand. Eine Gruppe seiner Männer hatte ihn auf der Straße aufgelesen, vollkommen ausgezehrt, so schwach, dass er kaum allein laufen konnte.
„Was habt ihr den angeschleppt?“, hatte er die Leute erbost angefahren, „das fehlt uns noch, dass wir hier einen Schwächling durchfüttern, wir haben selbst gerade genug, um am Leben zu bleiben.“
„Aber Hauptmann“, hatte einer der Leute geantwortet, „das ist David, von dem du gehört hast. Sie haben ihn in Jerusalem verhaftet und nach Cäsarea gebracht. Sie meinten, er gehöre zu den Politischen und haben ihn eine Woche gefoltert. Und dann ist es ihm tatsächlich gelungen, aus ihrem Gefängnis auszubrechen und bis hierher zu flüchten. So einen können wir bestimmt gebrauchen, wenn er wieder zu Kräften kommt.“
Und so hatten sie ihn aufgenommen und kräftig durchgefüttert, bis aus ihm der starke und tapfere Mann wurde, der jetzt neben ihm saß. Manchmal hatte er Isaak von ihren Gefängnissen und den Foltern erzählt, die er erlitten hatte und hatte die Narben gezeigt, die sie ihm mit ihren Feuerqualen zugefügt hatten. Isaak war gewiss: David hasste die Römer ein für alle Mal, er würde sich mit keinem von ihnen verbrüdern.
„Aber warum willst du mir Judas mitgeben?“, fragte David gerade.
„Ich fühle mich sicherer, wenn du einen Begleiter hast, den du mit Botschaften zu mir schicken kannst. Bring ihn nicht in Gefahr, er soll auf keinen Fall mit in die Stadt gehen, er soll sich in den Dünen dort verstecken oder meinetwegen in den Olivenwäldern etwas weiter. Ihr werdet schon einen Platz finden.“
Wieder lächelte David.
„Aber Hauptmann, wenn Judas mit der Nachricht kommt, sie hätten mich hingerichtet, wirst du nicht mit deiner Truppe aufbrechen und die Stadt erobern, nein?“
Jetzt lächelte auch Isaak.
„Nein, so weit würde ich selbst für dich nicht gehen. Aber sicher kannst du sein, wenn sie dich umbringen, wirst du furchtbar gerächt werden. Jetzt leg dich hin, du hast morgen früh einen weiten Weg zu gehen, brich vor der Morgendämmerung auf. Sag Judas jetzt gleich Bescheid, damit er sich ebenfalls schlafen legt.“
4.
Wie er sich nach Rom sehnte! Annius Rufus war seit drei Jahren Statthalter in diesem gottverlassenen Land, gesandt von seinem Kaiser Augustus, der ihn getröstet hatte, als er ihm seine neue Aufgabe eröffnete.
„Geh, mein Rufus, geh in dieses Juda, zivilisiere die Menschen dort, bringe ihnen römische Lebensart bei. Sie sind Bauern, unwissend, sie wirtschaften ohne Gewinn. Finde heraus, mein Rufus, ob es an ihrer Religion liegt, dass sie sich nicht an unsere Lebensweise anschließen wollen. Seit wir in Syrien sind und von da aus die Juden unterworfen haben, machen sie uns Ärger, schon Julius Cäsar hat von ihren Räubereien berichtet, ihr Eroberer Pompeius soll ständig über diese Dickköpfe geflucht haben und auch ich muss mich dauernd mit diesem Volk von Terroristen beschäftigen.“
„Warum schicken wir nicht einfach zwei Legionen hin“, hatte Rufus vorsichtig eingewendet, „sie sind doch militärisch nicht sehr tüchtig? Es müsste ein leichtes sein, sie endgültig zu unterwerfen.“
„Nein, mein Freund, ich will Legionen erst dann einsetzen, wenn es keine andere Wahl gibt. Und so schicke ich dich, meinen geschicktesten Verwalter.“
Der Kaiser hatte ihn auf die ehrenvollste Art verabschiedet, hatte ihn in den Arm genommen und zweimal auf die Wangen geküsst, Rufus erbebte noch jetzt, wenn er an die neidischen Blicke der anderen Senatoren dachte.
Aber nun war er hier, in diesem verdammten Land, mit dieser elenden Hitze. Jeden Morgen, wenn sie sich erhob und ihn beim Frühmahl traf, fragte ihn Flavia, seine Frau:
„Mein Gatte, Annius, wann können wir heimfahren, nach Rom?“
Und der Statthalter traute sich nicht, ihr zu gestehen, dass sie ursprünglich für zwei Jahre hergeschickt wurden und jetzt im dritten Jahr waren; der Kaiser hatte ihn gebeten, noch länger zu bleiben, wie es aussah, auf unbestimmte Zeit.
„Ja, was ist denn, beim Jupiter?“, rief er, es hatte geklopft, obwohl seine Diener wussten, dass er im Arbeitszimmer nicht gestört werden durfte.
Läsius steckte vorsichtig den Kopf zur Tür hinein.
„Statthalter, da ist ein Jude, der will dich unbedingt sprechen, es sei zum Wohl des römischen Reiches, sagt er.“
„Schickt ihn zu Lucius, der soll das regeln.“ Lucius war seine rechte Hand.
„Das haben wir versucht“, antwortete Läsius, „er weigert sich, mit Lucius zu sprechen, er will nur mit dir reden, sagt er, wir würden es bereuen, wenn wir dir nicht von ihm berichten.“
„Komm rein Läsius, bleib nicht in der Tür stehen, jetzt hast du mich sowieso schon gestört.“
Rufus hatte diesen Sklaven aus Rom mitgebracht, Läsius war ein Gallier, der ihm seit fünfzehn Jahren treu diente, er war ihm ans Herz gewachsen.
„Erzähl, was ist das für ein Jude?“
„Du weißt ja, Herr, wie sie sind, starrköpfig und hartnäckig. Erst ist er an der Wache gewesen, der Decurio hat ihn nach seinem Begehr gefragt. Das wollte er nur dir, dem Statthalter sagen, hat er geantwortet. Der Offizier hat ihn weggeschickt, er aber hat den Wachwechsel abgewartet und es beim zweiten Decurio noch einmal versucht. Und so ist er durch das Tor gekommen und hat im Palast angeklopft. Die Wächter dort konnten mit ihm nichts anfangen und haben mich gerufen. Er heißt David, sagt er und hat eine wichtige Botschaft für den Statthalter. Immer wieder hat er betont, dass die Botschaft für die Römer wichtig sei, nicht für ihn.“
„Und wo ist er jetzt?“
„Ich habe ihn in die Wachstube führen lassen, man hat ihm Brot und Wein gegeben und da wartet er jetzt auf deine Entscheidung.“
Unwillig dehnte sich Rufus in seinem Sessel. Sie waren unmöglich, die Juden, aber vielleicht hatte dieser eine ja wirklich eine wichtige Botschaft? Rufus wog ab, war seine Neugier größer oder seine Angst, von so einem dahergelaufenen Bewohner seines Bezirkes hereingelegt und lächerlich gemacht zu werden? Aber er hatte sich ohnehin schon zu viel mit diesem Mann beschäftigt, jetzt kam es darauf nicht mehr an.
„Also gut, führ ihn ins Audienzzimmer und sag mir Bescheid, wenn er da ist, dann höre ich mir an, was er zu sagen hat.“
Nach zehn Minuten ging der Statthalter langsam und würdig in den Saal, in dem er Besucher empfing. Er wusste, dieser Raum machte Eindruck auf jeden, er war mit dicken Teppichen belegt, die Wände waren geschmückt mit Bildern vom Kaiser in goldenen Rahmen, Jagdszenen, Waffen aus seinen Kriegszügen waren da ausgestellt, unter anderem ein mit Edelsteinen verzierter persischer Krummsäbel.
Als er den Raum betrat, sah er sich einem großen, muskulösen Juden gegenüber, der in einfachste Lumpen gekleidet war. Er war unbewaffnet, wenn er Waffen gehabt hatte, waren ihm die abgenommen worden.
„Ich bin Annius Rufus, Statthalter in Juda, du hast mit mir zu sprechen verlangt.“ Hochmütig sah er den Besucher aus seinen kurzsichtigen Augen an.
David ließ sich Zeit, den Römer zu betrachten. Er war trotz seines hohen Postens schlank, er hielt sich sehr aufrecht. Das Gesicht wurde von einer großen, gekrümmten Nase beherrscht, stechend und streng fixierten ihn die schwarzen Augen. David erinnerte sich daran, was er über diesen Statthalter gehört hatte: Ein herrischer Mann sollte er sein, schnell aufbrausend, aber nicht sehr gewalttätig.
„Nun, was starrst du?“ Rufus wurde ungeduldig, „dafür, dass du mit mir sprechen willst, bist du sehr schweigsam. Also sag, was du zu sagen hast und dann geh deiner Wege.“
„Statthalter“, begann David und seine Augen blitzten, „mich schickt Isaak Ben Zacharias, ich glaube, du hast von ihm gehört.“
„Der Isaak? Isaak, der Terrorist? Bist du wahnsinnig geworden?“ Annius Rufus konnte es nicht glauben, seine Stimme war leise und gepresst vor Grimm. „Du wagst es, mir hier, in meinem Palast, meine Legionäre um mich herum, zu sagen, dass du ein Komplize dieses Isaak bist? Ich werde dich auf der Stelle hinrichten lassen, und das ist das Humanste, was ich machen kann.“ Er wischte sich den Schweiß mit dem Tuch von der Stirn, die sommerliche Hitze hatte vor dem Audienzzimmer nicht Halt gemacht.
„Willst du nicht erst die Botschaft hören, die ich dir bringe?“
Auch David sprach leise, ihm schien die Temperatur nichts anzumachen.
„Also gut, sag deine Botschaft, damit ich die Wache rufen kann.“
„Wir haben deinen Steuereinnehmer gefangen, Lucius Falba, mitsamt den Steuern, die er unseren Landsleuten gestohlen hat. Wenn du ihn wiederhaben willst, musst du mir achtzigtausend Sesterzen geben, wir lassen ihn dann frei, das lässt dir Isaak sagen.“
Rufus stand sprachlos. Eine so impertinente Botschaft hatte er in seiner ganzen Laufbahn nicht erhalten. Als er sich gefasst hatte, ging er zur Tür und öffnete sie.
„Wache!“ schrie er, und vier Legionäre mit gefällten Speeren betraten den Raum.
„Nehmt diesen Juden fest, er ist ein Terrorist und Mörder, ich werde ihn hinrichten lassen. Sperrt ihn ein. Du, Decurio, haftest mir mit deinem Kopf dafür, dass er morgen noch da ist, und zwar lebendig.“
Der Decurio trat hinter David, der sich widerstandslos fesseln und abführen ließ.
5.
„Wen hast du denn da heute Morgen empfangen?“ Flavia war eine große, selbstsichere Frau. Annius Rufus hatte sie geheiratet, weil sie eine gute Partie war und weil Kaiser Augustus sie ihm empfohlen hatte, aber nicht zuletzt auch deswegen, weil sie so stolz und schön war. Mit den kohlschwarzen Haaren, dem aufrechten Gang ihrer schlanken Gestalt und im vollen Bewusstsein ihrer vornehmen Herkunft aus dem Geschlecht der Flavier saß sie ihm bei ihrem allmorgendlichen späten Frühstück gegenüber.
„Da war ein aufdringlicher Jude, der meinte, er müsse unbedingt mit mir sprechen“, antwortete Annius, „es ist ihm aber nicht so gut bekommen.“
„Wieso nicht gut bekommen?“
„Na, ich habe ihn einsperren lassen, morgen bei Sonnenaufgang wird er gekreuzigt.“
„Und sein Verbrechen?“ Annius Rufus liebte es, mit seiner Frau die Staatsgeschäfte zu besprechen, sie hatte ihm mit ihrer Klugheit und ihrer weitläufigen Bildung so manchen guten Rat gegeben, er war geneigt, auf sie zu hören.
„Ein Terrorist war das, ein Abgesandter dieses Isaak, du hast seinen Namen schon gehört. Dieser Isaak führt einer der schlimmsten Banden in unserer Provinz an, die doch wirklich mit Kriminellen allzu reichlich gesegnet ist.“
„Richtig, du hast es mir erzählt. Ist dieser Isaak nicht sogar ein politischer Aufrührer?“
„Das weiß man bei solchen Leuten nie so genau, aber richtig ist, dass er zum Widerstand gegen unseren Kaiser und seine Behörden aufruft. Wir hätten ihn und seine Familie und viele andere Familien arm gemacht, so behauptet er immer wieder, dabei sind sie einfach nur arbeitsscheu. Wer arbeiten will im Reich, der verhungert auch nicht.“
„Und weshalb ist der Mann zu dir gekommen?“
„Er nannte sich David und behauptet, Isaak hätte einen unserer Steuerbeamten entführt und verlangt nun ein Lösegeld von achtzigtausend Sesterzen.“
Flavia lächelte verächtlich.
„Der ist ja verrückt“, meinte sie leichthin, „und so einer soll ein berühmter Hauptmann sein?“
„Das habe ich David auch gesagt, bevor ich ihn habe verhaften lassen. Sollen sie doch ihren Falba behalten, wir haben noch mehrere Steuerbeamten.“
Flavia stutzte: „Falba? Den haben sie gefangen genommen? Lucius Falba?“
Rufus nickte nachlässig. „Ja, Lucius Falba ist in ihrer Gewalt, für ihn wollen sie das Lösegeld haben.“
Flavia war jetzt aufgeregt.
„Aber, mein Annius, wenn es Lucius ist, über den wir reden, den musst du mir freikaufen, auf jeden Fall, bitte. Lucius Falba ist ein entfernter Verwandter von mir, er ist ein Schwager meiner Schwester, du musst dich doch an ihn erinnern.“
Flavia war jetzt gar nicht mehr herrschaftlich. Sie sah ihren Mann flehend an.
„Mein Gatte, Annius. Du hast bei ihrer Hochzeit viel mit ihm gesprochen, erinnerst du dich? Und du hast ihm sogar den Posten verschafft, bei dem er jetzt in die Hände der Bande gefallen ist. Du musst ihm helfen, das kannst du doch, oder?“
Rufus lehnte sich zurück und sah sich um, während er nachdachte. Der Palast des Statthalters in Cäsarea war von dem ersten Inhaber dieses Postens sehr aufwändig errichtet und eingerichtet worden. Dieses Zimmer, das er mit seiner Frau nur nutzte, um die Morgenmahlzeit einzunehmen, enthielt einen langen Esstisch, der mit wertvoll geschnitzten und behaglich gepolsterten Stühlen umstanden war. Er fühlte sich immer etwas einsam, wenn sie zu zweit daran saßen, leicht zwanzig Personen hätten hier untergebracht werden konnten. Dieser Raum war der einzige im ganzen Palast, in dem er Gäste bewirten konnte, die es nicht gewohnt waren, nach römischer Sitte an niedrigen Tischen auf Polstern zu liegen und in dieser Stellung die Mahlzeiten einzunehmen. Er hatte sich an die sitzende Position, die in Rom sonst nur der Hausfrau oder niederen Gästen vorbehalten war, gewöhnt und Gefallen daran gefunden. Und so genoss er die Fladen, die er in Olivenöl tunkte, den Käse und den Honig, den er darüber fließen ließ und freute sich auf die süßen Feigen zum Nachtisch. Und nun wollte seine Frau sofort eine Antwort wegen dieses ungeschickten Falba, der sich hatte fangen lassen.
„Du weißt, dass ich eine große Summe immer im Palast im Schatzkeller liegen habe. Wir könnten den geforderten Betrag wohl bezahlen. Andererseits kann ich nicht einfach achtzigtausend vom Geld des Kaisers ausgeben, ohne ihn zu fragen. Man könnte mir sonst leicht den Vorwurf machen, ich unterstütze jüdische Umsturzbestrebungen gegen den Kaiser.“
„Aber du gibst doch sonst auch durchaus größere Summen aus, ohne dir solche Gedanken zu machen“, erwiderte seine Frau. Beide hatten aufgehört zu essen und schwiegen eine Weile nachdenklich. Wie durch einen Schleier hörte Annius die Geräusche aus der Residenz, hier rief ein Diener, da tönte ein Hundegebell, das schnell aufhörte.
„Natürlich“, sagte er dann gedehnt, „dafür habe ich ja mit meiner Ernennung zum Statthalter auch die Vollmacht erhalten. Das Besondere ist hier, dass dieses Geld ausgerechnet diesem Isaak zugutekommt, der es nutzen wird, weiter unsere Landsleute auszurauben und Soldaten gegen den Kaiser zu sammeln. Bitte, Flavia, das weißt du doch auch und normalerweise, wenn es sich nicht um deinen Schwager handelte, wärest du die Erste, die mir rät, nicht zu zahlen.“
„Aber es ist nun mal mein Schwager. Annius, ich bitte dich nicht häufig um etwas, aber hier musst du eine Ausnahme machen.“
„An sich würde ich jetzt einen Schnellboten nach Rom schicken und mir Anweisungen erbitten.“
Flavias Stimme klang jetzt schrill.
„Nach Rom schicken? Aber der Bote kann frühestens in sechs Wochen wieder hier sein, wenn alles gut geht. Bis dahin ist Falba doch längst getötet worden.“
Annius Rufus war gewöhnt, auf seine Frau zu hören, war also auch diesmal geneigt, nachzugeben, vor allem, weil er die Bedeutung dieses Tonfalls kannte und den wochenlangen Unfrieden fürchtete.
„Aber ich werde mit Isaaks Boten verhandeln müssen, ich biete ihm erst einmal dreißigtausend, und dann sehen wir weiter.“
„Und du richtest ihn nicht hin?“
„Das kann ich dir nicht versprechen, Flavia, aber ich werde mit ihm handeln, er wird nicht hingerichtet, wenn ich mich mit ihm einige.“
Damit gab sich Flavia zufrieden und die Gatten beendeten ihr Frühstück in Harmonie.
6.
Zwei Menschenalter waren es jetzt ungefähr her, grübelte Rufus später, als er in seinem Arbeitszimmer saß und überlegte, wie er mit David verfahren sollte. Damals war Pompeius gefeiert worden für die Eroberung des syrischen Brückenkopfes gegen die Perser.
Aber von Anfang an drangen diese Nachrichten von Überfällen jüdischer Rebellenbanden auf römische Bürger nach Cäsarea. Sie griffen nicht nur Reisende an und raubten sie aus, sie überfielen auch die Latifundien der Römer und führten regelrecht Krieg gegen die römischen Bürger, die nach hier eingewandert waren und sich als Großbauern angesiedelt hatten. Als schließlich eine Abteilung Legionäre unter einem Centurio auf offener Straße angegriffen, besiegt und ermordet worden war, kam es zum offenen Aufstand der Juden gegen die Römer, der von den Römern blutig niedergeschlagen wurde. Immer noch war das Land aber nicht endgültig befriedet. Als die Räubereien und die Klagen der römischen Bewohner erneut überhandnahmen, musste der Kaiser eingreifen. Er schickte Annius Rufus mit dem Auftrag, die Juden nach römischer Tradition liberal zu behandeln, gegen die Terroristen aber mit aller Schärfe vorzugehen.
Rufus seufzte. Gerade das erwies sich als äußerst schwierig, weil seine Beamten kaum unterscheiden konnten, wer politisch kriminell und wer ungefährlich war. Und hier war nun einer gekommen, bei dem klar war, was der Kaiser befehlen würde. Hinrichten lassen müsste er diesen David, ohne Rücksicht auf den römischen Gefangenen. Gab er in diesem Fall erst nach, ermunterte er Isaak geradezu, weitere römische Beamte zu entführen und Lösegeld zu fordern.
Isaak Ben Zacharias führte eine der schlimmsten Banden an. Sie überfielen erklärtermaßen ausschließlich Römer. In ihren Nachrichten stellten sie eindeutig politische Forderungen: Die Römer und ihre Legionen, so forderten sie, sollten aus dem Land verschwinden, vorher würden sie keine Ruhe geben.
Seit drei Jahren bekämpfte Rufus diesen anmaßenden Mann, hatte ihm aber noch keine ernsthafte Schlappe beibringen können. Und nun schickte der verdammte Aufrührer ihm, dem römischen Statthalter, dreist einen Boten, mit dem er verhandeln sollte. David steckte seinen Kopf in die Höhle des Löwen und Rufus sollten die Hände gebunden sein aus Rücksicht auf seine Frau.
Sollte er auch diesmal dem Ratschlag seiner Frau folgen? War das überhaupt ein Ratschlag? Flavia hatte Angst um ihren Verwandten, nur deshalb hatte sie für den Juden gesprochen, nicht etwa, weil sie ein Nachgeben für richtig hielt.
Aber er, Rufus, durfte den Terroristen kein Geld geben, er durfte nicht nachgeben, der Kaiser würde ihn wegen Hochverrates hinrichten lassen. Hatte er einmal einer solchen Erpressung nachgegeben, würde Isaak immer wieder römische Bürger gefangen nehmen und Geld zu erpressen versuchen. Und Rufus konnte nicht jedes Mal nachgeben, das verbot die Staatsraison, also musste er gleich jetzt das Lösegeld verweigern, im Gegenteil, er würde den Boten pflichtgemäß hinrichten lassen.
Aber Flavia? Sie würde ihm nie verzeihen, dass der Schwager ihrer Schwester getötet wurde, weil er, Rufus, nicht hatte nachgeben können. Er durfte daher den Juden eigentlich nicht kreuzigen, wie er gedacht hatte.
Unvermittelt trat sein Stellvertreter ein, wie immer, ohne anzuklopfen. Rufus hatte ihm das immer und immer wieder verboten, hatte befohlen, dass Marcus Julius sich wie jeder andere anzumelden habe. Aber Marcus hatte jedes Mal nur gelacht, er war aus der Familie der Julier, niemand legte sich mit einem Spross dieser Familie an, auch nicht Rufus, obwohl er der Vorgesetzte war.
„Was hast du beschlossen über den Boten des Rebellen?“, fragte er, nachdem sie sich begrüßt hatten.
„Habe ich denn eine Wahl?“, fragte Rufus zurück, „ich kann doch nicht unseren Steuereinnehmer von denen ermorden lassen, und schon gar nicht Falba.“
„Du willst diesem Kriminellen, diesem Isaak, tatsächlich Geld aus dem Staatsschatz geben?“ Marcus Julius war entsetzt. Er war zehn Jahre jünger als Rufus und hatte für sein Alter schon eine erstaunliche Karriere hinter sich, die ihn schließlich hier nach Juda gebracht hatte, als stellvertretender Statthalter. Die Karriere verdankte er vor allen Dingen seiner Herkunft aus der Familie der Julier, deren berühmtesten Sohn, Gaius Julius Cäsar, er sich zum Vorbild genommen hatte und seiner Fähigkeit, die Wünsche des Kaisers zu erahnen, bevor dieser sie ausgesprochen hatte.
„Das führt doch nur dazu, dass er seinen Krieg gegen unsere Legionen und unsere Bürger mit unserm eigenen Geld fortsetzt. Und denk doch nur, wenn du ihm jetzt Geld gibst, überfällt er sofort den nächsten Beamten und verlangt wieder hohe Summen. Nein, Annius Rufus, das kannst du nicht tun.“
„Aber Marcus“, antwortete der Statthalter, ärgerlich über diese Einmischung seines Vertreters, „wir können doch nicht zusehen, wie sie einen von uns einfach hinmorden.“
„Das wusste Falba, als er sich hierher abordnen ließ“, antwortete Marcus ungerührt, „jeder von uns weiß, dass er hier sein Leben riskiert, die Juden geben keine Ruhe. Aber du und ich, wir wissen, dass der Staat vorgeht, dass man auch nicht nachgeben würde, wenn wir die Gefangenen wären. Nein, Rufus, ich bitte dich, lass den Gedanken fallen, auch wenn diesmal das Opfer ein Verwandter von Flavia ist, wie ich höre.“
„Danke, Marcus, ich habe deinen Einwand zur Kenntnis genommen, jetzt lass mich bitte allein, ich muss über das Problem in Ruhe nachdenken.“
Marcus Julius ging hocherhobenen Hauptes hinaus, Rufus wusste, gab er jetzt den Rebellen nach, würde sein Stellvertreter das dem Kaiser melden mit schlimmen Folgen für ihn.
7.
„Bringt mir den Juden her, den ich heute Morgen verhaftet habe“, befahl er seinem Sklaven am nächsten Morgen und kurze Zeit später stand Isaaks Bote wieder vor dem Statthalter.
„Ich habe mir die Sache überlegt“, fuhr Rufus David an, „ich werde deinem Anführer Isaak keinen Sesterz zahlen. Stattdessen werde ich dich kreuzigen lassen, mit gebrochenen Knochen, und du wirst einen langsamen Tod sterben.“
David sah ihn durchdringend an.
„Hast du dir das gut überlegt, Statthalter?“, fragte er, „ich habe dir gesagt, dass dann dein Steuereinnehmer stirbt, und je langsamer ich sterbe, desto qualvoller wird sein Tod sein.“
„Du hast noch eine Chance“, antwortete Rufus drohend, „du kannst mir versprechen, dass ihr Falba freilasst, ohne Lösegeld, ohne Gegenleistung, dann schicke ich einen Boten zu eurer Bande und biete den Tausch an. Verweigerst du die Mithilfe daran, hängst du morgen am Kreuz.“
„Ich werde weder dir noch irgendeinem Römer helfen, ich werde dir auch nicht mein Wort geben“, antwortete David kalt, „glaube mir, selbst wenn ich dir helfen würde, käme dein Beamter nicht frei. Isaak wird nicht tun, was du verlangst, selbst wenn ich ihn darum bitte. Falba wird sterben.“
„Gut, wenn das dein letztes Wort ist, stirbst du auch“, herrschte ihn Rufus an und brüllte „Wache!“
„Hier, nehmt diesen Mann, er ist ein galiläischer Aufrührer und Terrorist“, befahl er dem eintretenden Centurio, „bindet ihn ans Kreuz, gleich neben dem Stadttor, jeder soll sehen können, wie wir mit solchen Verbrechern umgehen.“
Sie führten David hinaus und hängten ihn vor dem Tor an ein hohes Kreuz, wo er nach drei Tagen qualvoll starb
„Du bist ein Barbar“, weinte Flavia am Abend, „du bist schuld, wenn Falba stirbt, ich hasse dich, ich will dich nicht mehr sehen.“
Rufus nickte traurig. Von diesem Tag an lebten die Eheleute getrennt. Rufus verabscheute das Land mehr denn je.
8.
Judas, Davids junger Begleiter, hatte sich in den Tamariskenbüschen nahe der Stadt versteckt, um auf die Rückkehr Davids zu warten. Er war am ersten Tag nicht beunruhigt, dass sein Gefährte nicht zurückkam. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass er bei dem römischen Statthalter ein leichtes Spiel haben würde. Es war klar gewesen, dass sie David erst einsperren und bedrohen würden. Sie mussten sogar damit rechnen, dass die Römer ihn umbrachten, aber das Risiko kannten beide vorher.
Judas war vielleicht vierzehn, fünfzehn Jahre alt, vielleicht auch ein Jahr älter, wer wusste das schon so genau. Er war eines Tages in dem Lager des Isaak aufgetaucht, einfach so, hatte sich an den sehr aufmerksamen Wachen vorbeigeschlichen, war bei Nacht durch die lagernden Männer gekrochen und hatte den Anführer geweckt.
„Höre, Isaak, ich bin Judas, ich will mit euch kämpfen.“
Isaak war aufgesprungen, sofort hellwach.
„Wie bist du durch unsere Wachen gekommen?“ schrie er so laut, dass mit einem Schlage alle seine Männer aus dem Schlaf gerissen wurden und zu den Waffen griffen.
„Ich bin einfach durchgekommen“, antwortete Judas leise und bescheiden, „ich habe mich jahrelang darin geübt, unsichtbar zu werden, niemand kann mich sehen, wenn ich mich verstecken will, und schon gar nicht nachts.“
„Das werden wir sehen“, Isaak war immer noch voller Grimm, dass dieser Grünschnabel so einfach direkt neben ihm im Lager aufgetaucht war. Was, wenn die Römer einen ebenso geschickten Spion hatten?
„Wir machen morgen früh die Probe. Da wirst du dich an mich schleichen, und wehe dir, wenn ich dich erwische. Jetzt legen wir uns wieder hin, du wirst von fünf Männern bewacht, versuche ja nicht, zu fliehen.“
„Warum sollte ich fliehen?“ Judas Stimme hatte einen kecken Unterton, „ich habe mich ja hergeschlichen, um hierzubleiben, nicht um wegzulaufen.“
Am nächsten Tag hatte der Junge erstaunliche Proben seiner Geschicklichkeit abgegeben, sich selbst aufmerksamen Personen unbemerkt zu nähern.
„Und kannst du kämpfen?“ fragte Isaak danach.
Wortlos deutete Judas auf den Dolch, den er im Gürtel trug.
„Stell mich auf die Probe“, sagte er.
„Los, wirf den Dolch auf den Stamm dieser Terebinthe“, befahl Isaak und wies auf den Baum, der etwa sechs Schritt von Judas entfernt war. „Nein, das ist zu leicht“, antwortete Judas, „auf den Olivenbaum da hinten will ich werfen, der ist schmaler und weiter weg.“
Das Bäumchen stand in einer anderen Richtung, war zehn Schritte entfernt und nur so breit wie sein Handgelenk.
Judas stellte sich vor den Baum, zog den Dolch aus dem Gürtel, warf ihn so schnell, dass die anderen die Bewegung kaum sehen konnten, und traf den Stamm.
Und dann, zum Entsetzen der anderen, flog ein zweiter Dolch auf die Olive zu und grub sich einen Fingerbreit unter den ersten tief hinein.
„Das ist meine Art zu kämpfen“, rief Judas stolz, „wollt ihr mich jetzt haben?“
„Aber Junge, wo kam denn das zweite Messer her?“, fragte Mathias erstaunt.
„Ich habe immer zwei Messer bei mir, das eine sichtbare, vor dem sich meine Feinde in Acht nehmen können, das zweite habe ich hier, in meinem Ärmel, in der Scheide, mit einer Schlaufe festgebunden. Es steckt so leicht in der Hülle, dass ich es mit einem Ruck des Arms in die Hand bekomme und werfen kann.“
Judas zeigte den Umstehenden die Vorrichtung an seinem Ärmel. Zum Beweis steckte er das Messer in die Scheide, ein kurzer Ruck und er hatte es wurfbereit in der Hand.
„Mann, du bist ja sehr gefährlich“, rief Isaak.
„Noch viel gefährlicher“, gab Judas zurück. „Seht, wenn ich beide Messer geworfen habe, bin ich nicht wehrlos, ich habe hier, unter meinem Umhang, an einer Schnur ein drittes Messer. Erst wenn ich das geworfen habe, bin ich ohne Waffen.“
Die Männer setzten sich auf einen Wink ihres Hauptmannes hin, um ihr Frühstück einzunehmen. Isaak lud den Gast zu seinem Feuer ein, um ihn auszufragen, was er hier bei seinen Leuten wollte und woher er käme.
„Aber was interessieren euch meine Eltern, wofür ist es wichtig, warum ich zu euch gekommen bin?“ rief Judas selbstbewusst aus, „reicht es nicht, dass ich ein guter Kämpfer bin und euch helfen kann?“
„Nein, das reicht eben nicht“, entgegnete Isaak ernst, „sieh mal, wir kämpfen hier nicht einfach, um zu rauben und uns reich zu machen. Klar, vieles von dem, was wir erbeuten, verbrauchen wir selbst, weil wir uns ernähren müssen. Aber vor allem haben wir uns zusammengetan, weil wir immer stärker werden und mit unserer Stärke die Römer bekämpfen wollen, und zwar so lange, bis unsere Landsleute merken, dass wir alle gemeinsam die Besatzer besiegen können und müssen. Wir wollen sie aus dem Land vertreiben, sie zerstören unsere Wirtschaft, unsere Kultur, alles.“
„Ja, aber gegen die Römer will ich doch auch kämpfen.“ Judas war voller Eifer, „so lange ich denken kann, habe ich diese kalten, nüchternen Menschen mit den Quadratschädeln gehasst. Sie haben aus meinem Vater, den ich noch als starken und selbständigen Mann kannte, ein schwaches und jammerndes lebendes Wrack gemacht und ihn dann getötet, das sollen sie mir bezahlen.“
Daran dachte Judas jetzt, als er in Deckung in den Büschen lag. Der zweite Tag des Wartens war vergangen, und Judas hoffte, dass David nun bald zurückkehren würde, und zwar erfolgreich. Aufmerksam beobachtete er aus seinem Versteck die Straße, die zur Stadt führte, und das Stadttor. Er hatte den Tag über die glühende Hitze nicht bemerkt, die ihm das Blut aus den Adern saugen wollte, immer hatte er nach David Ausschau gehalten. Viele Menschen hatte er in die Stadt gehen und aus ihr herauskommen sehen, aber David war nicht darunter gewesen. Stolz hatte Judas mit dem Wasser gespart und nur dann getrunken, wenn er kurz vor dem Verdursten war.
Am Abend dieses Tages marschierte eine Kohorte römischer Legionäre aus dem Stadttor, sie führten einen Gefangenen mit sich, aber sie kamen nicht näher, sondern brachten den Gefangenen neben das Tor, wo sie eines ihrer hohen Kreuze errichteten, an die sie die von ihnen Verurteilten hingen. „Armer Kerl“, dachte Judas, „sie wollen ihn hinrichten.“
Und dann wurde er aufmerksam. Er kannte den stolzen, aufrechten Gang, mit dem der Gefangene zwischen den Römern schritt, er kannte das lange, schwarze Haar und nun glaubte er, von weitem auch die Gesichtszüge Davids zu erkennen.
Sie würden doch den Boten nicht wirklich kreuzigen?
Aufmerksam verfolgte Judas die Bewegungen der Kohorte, hören konnte er nichts, aber nach zwei Stunden zogen die Römer ab, nur zehn Mann als Wache zurücklassend und einen Mann, der an das Kreuz gefesselt war.
Langsam und ängstlich, jede Deckung ausnutzend, schlich sich Judas näher, bis er den Mann erkennen konnte. Tatsächlich, es war David. Judas hatte keine Möglichkeit, ihm zu helfen, zu viele Legionäre bewachten die Richtstätte.
Erschrocken und weinend vor Wut schlich sich Judas davon, um Isaak zu berichten.