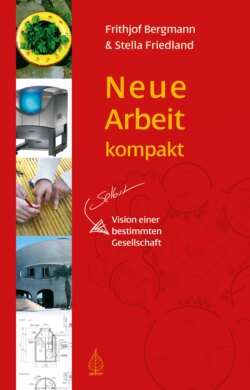Читать книгу Neue Arbeit kompakt - Frithjof Bergmann - Страница 8
ОглавлениеDie Welt im 21. Jahrhundert
Wohin geht die Fahrt?
Hatten Sie auch schon einmal das Gefühl, dass etwas nicht stimmt damit, wie der Mensch auf der Erde lebt? Dass es nicht mehr lange gut gehen kann? Das es zur Katastrophe kommen wird, wenn sich nichts ändert?
Dass es Möglichkeiten geben sollte, glücklicher zu leben?
Frithjof Bergmann vergleicht dieses Gefühl mit dem der Insassen eines führerlosen Zuges, der seine Fahrt höchstwahrscheinlich anders beenden wird, als es Züge normalerweise tun.
Die Passagiere haben das Gefühl, dass der Zug nicht bremsen und im Zielbahnhof anhalten, sondern diesen deutlich verfehlen wird.
„Wir fühlen uns ohnmächtig, im Lauf der Dinge gefangen als Fahrgäste im Zug unseres Erdendaseins. Wir sehen eine Geschichte sich entfalten, der wir nicht entrinnen können. Die Situation ist unheilschwanger und wird immer erschreckender. Und was alles noch furchtbarer macht: Wir haben nicht die allerleiseste Ahnung, wie diese Fahrt anzuhalten oder umzukehren wäre. Natürlich laufen Leute gestikulierend und laut rufend durch die Waggons, aber jeder weiß mit schreckensstarrer Überzeugung, dass das nur ein Ablenkungsmanöver ist. Was früher oder später unausweichlich geschehen wird, geschehen muss, ist inzwischen allen klar geworden: Der Zug wird entgleisen, gegen eine Felswand prallen oder auf eine Brücke kippen und in die Tiefe stürzen.“
Mit anderen Worten: die Menschheit steuert ihrem Untergang entgegen. Gründe für apokalyptische Gefühle gibt es so viele wie Indizien, dass das Ende der Fahrt schneller kommen könnte, als man denkt. Für den Klimawandel gibt es deutliche Anzeichen. Möglicherweise werden Städte im Meer versinken, Stürme mit ungekannter Stärke über die Erde fegen, der Golfstrom wird den Wärmetod sterben und in Europa wird es kein gemäßigtes Klima mehr geben. Könnte aber auch sein, dass der Menschheit vorher das Öl ausgeht oder der Krieg ums Öl die Völker endgültig ins Unglück stürzt.
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Teilung der Menschheit in Arme und Reiche die Erde mit Hass und Gewalt überzieht. Möglicherweise macht der weltweite Terrorismus das Leben aber zuvor schon wenig lebenswert.
Auch wenn ein von materiellen Sorgen relativ freies Leben noch eine Weile möglich sein sollte, verliert die westliche Zivilisation nach und nach ihre Werte, kommt eine über Jahrhunderte gewachsene Kultur an ihr Ende.
Der Kultur und der Wissenschaft gehen das Geld aus. Sie scheinen so wenig wert zu sein, dass sie immer weniger gefördert werden. Universitäten, Theater, Museen und Bibliotheken stehen reihenweise vor der Schließung. Der Einfluss von Künstlern und Intellektuellen als Vordenker gesellschaftlicher Entwicklungen schwindet. Stattdessen greift die Verdummung durch das Fernsehen, die Bestechlichkeit des Journalismus und die Prostitution der Politik gegenüber der Wirtschaft um sich.
Und auch die Manager in den Führungsetagen haben Angst. Ihre Angst ist nicht die vor der Katastrophe, davor, dass der Zug möglicherweise von der Brücke fällt oder gegen eine Felswand rast. Ihre Angst besteht darin, dass dem Zug der Antrieb fehlt, dass er einfach stehen bleibt. Die Angst vor dem Stillstand, vor dem Ende des Wachstums, vor dem unaufhaltsamen Niedergang der Marktwirtschaft führt dazu, dass sie versuchen, den Zug mit immer aberwitzigeren Methoden zu beschleunigen. Was am Ausgang der Fahrt überhaupt nichts ändert.
Noch mehr ins Grübeln kommen lässt einen der Umstand, dass es die absolute Mehrheit der Menschheit ist, die das Gefühl hat, so wie es läuft, läuft es verkehrt. Frithjof Bergmann stellt die verzweifelte Frage, warum all diese vielen Menschen nicht die Energie aufbringen, die Richtung zu ändern.
Ist die schweigende, tatenlose Mehrheit, die in einer somnambulen, komatösen Opposition lebt, nicht eine Beleidigung für den letzten Rest des uns verbliebenen gesunden Menschenverstands?
Gibt es denn überhaupt noch jemanden, der daran glaubt, dass wir als Gesamtzivilisation auf dem richtigen Weg sind? Dass es möglich und sinnvoll sein soll, dieses moderne, weiße industrielle Superunternehmen so weiterzuführen wie bisher.
Denkt man diese Problemlage zu Ende, kommt man unweigerlich zu der Frage, was uns in diese Situation gebracht hat, wo die Gründe für dieses tatenlose Abwarten zu suchen sind.
Das tote Gleis
Ende des Sozialismus = Ende der Hoffnung?
Frithjof Bergmann geht davon aus, dass das Ende des real existierenden Sozialismus nicht nur das Ende eines Systems war, das in der praktischen Umsetzung so viele Fehler gemacht hat, dass sein Scheitern fast unvermeidlich war. Vielmehr ist mit der Erkenntnis der praktischen Unrealisierbarkeit dieser Idee eine Lücke im utopischen Denken entstanden, derer man sich in den letzten fünfzehn Jahren weder vollständig bewusst geworden ist, noch hat jemand über die Konsequenzen dieses utopischen Defizits nachgedacht.
Auf der theoretischen Ebene ist der Sozialismus für mehrere Generationen die Hoffnung auf ein dem Menschen gemäßes Leben schlechthin gewesen. Millionen haben an diese Idee geglaubt und für ihre Realisierung gelitten und gekämpft.
Angesichts dieser Tatsache ist es nur äußerst schwer nachvollziehbar, dass diese Idee so sang- und klanglos untergegangen ist. Nicht nur der wahre Kern des Sozialismus – dass die Welt gerechter wäre, wenn es weniger Privateigentum gäbe, und der Reichtum der Erde an alle verteilt werden sollte – ist untergegangen. Auch die milderen, verdünnten, verwässerten Formen des Sozialismus, die nicht dafür plädierten, dem Treiben des Kapitalismus sofort per Revolution ein Ende zu setzen, sind seit 1989 schal und lahm geworden. All jene kaum noch links, allenfalls blassrosa zu nennenden Parteien mit sozialdemokratischem, liberalem, sozialem Anspruch haben ihre Identität und Zielsetzung verloren.
Allem, was eine ferne Verwandtschaft mit dem sozialistischen System hatte, haftet das Versagen und die Niederlage an.
An der nächsten Weiche
Licht am Ende des Tunnels: die andere Kultur
Obwohl Frithjof Bergmann keine gesellschaftliche Kraft sieht, die für einen ähnlich radikalen Neuentwurf des Zusammenlebens kämpft, wie es der Sozialismus gewesen ist, sieht er doch Tendenzen, die Grund zur Hoffnung geben.
Viele Menschen in der westlichen Welt lehnen den hemmungslosen Konsum ab, suchen nach neuen Formen des Zusammenlebens, sind offen für spirituelle Erfahrungen, haben ein ökologisches Bewusstsein ebenso wie eine starke Abneigung gegen Hierarchien und Autoritäten. Sie glauben, dass Krieg auf keinen Fall ein Mittel der Politik sein sollte.
Bergmann nennt das „die andere Kultur“.
Die andere Kultur
Diese andere Kultur ist in jedem Erdteil und jedem Land zu finden. Ihre Mitglieder erkennen sich meist wortlos. Es sind Menschen, die glauben, dass Wirtschaftswachstum um jeden Preis nicht alles sein kann und der daraus abgeleitete Konsumzwang nicht notwendigerweise glücklich macht. Menschen, die darüber nachdenken, wie der Mensch leben soll, und ihre Haltungen mehr oder weniger konsequent in ihr individuelles Leben integrieren.
Der Geist dieser anderen Kultur lebt in Büchern, Philosophien und im Theater, in Bildern und in Musik ebenso wie in Universitäten und Selbsthilfegruppen und Vereinen. Aber eben leider nicht in Parlamenten und ähnlichen gesetzgebenden Versammlungen. Dieser Geist fehlt meist in Wahlkämpfen und auf Gewerkschaftskongressen, in allen Bereichen der offiziellen Kultur.
Psychologie der Reisenden I
Apathie oder Auf-der-Lauer-Liegen?
Die ernüchternde Anfangsdiagnose von den Menschen im Zug, den Lemmingen, die nichts dagegen unternehmen, dass sie von einer unbekannten Kraft in den Abgrund gezogen werden, überdenkt Frithjof Bergmann noch einmal. Bei dem Versuch, die Schwingungen der gesellschaftlichen Befindlichkeiten genauer zu erspüren, kommt er zu dem Schluss, dass vielleicht doch nicht Apathie und Verzweiflung der Grund für die weit verbreitete politische Gleichgültigkeit sind, sondern eine Haltung des Abwartens. „Man liegt auf der Lauer und spart seine Kräfte für einen späteren Zeitpunkt. Die Zuginsassen haben den Blick fest auf Notbremse und Steuerung gerichtet. Sie halten nur still, weil sie warten.“
An späterer Stelle schreibt Bergmann:
„Irgendetwas müsste diesen Wartenden das Gefühl geben, dass es einen Plan gibt, dass konkrete Schritte möglich sind, dass es eine gangbare Leiter gibt, die Sprosse für Sprosse hinaufführt zu der Kultur, die sie sich wünschen. Wenn ein Zeichen davon am Horizont erschiene, dann würden sie ihre Apathie ausziehen wie Regenmäntel. Dann würden sie die Ärmel hochkrempeln und würden anfangen, an einer mehr Leben gebenden und das Leben stärkenden Welt zu arbeiten.“
Die Neue Arbeit setzt darauf, dass sich diejenigen, die zur anderen Kultur gehören, sich von der Idee der Neuen Arbeit inspirieren lassen. Die neue Arbeit und die andere Kultur könnten die Lücke füllen, die mit dem Tod der sozialistischen Idee entstanden ist.
Psychologie der Reisenden II
Was hindert uns daran, den Zug zu stoppen?
Welche Kräfte sind es, die den Zug in Richtung Abgrund lenken? Warum scheint die gegenwärtige Organisation des menschlichen Zusammenlebens auf der Erde so ohne Perspektive?
Bevor Frithjof Bergmann die Neue Arbeit als Ausweg aus der Misere entfaltet, führt er zur deutlicheren Abgrenzung noch einmal eine Analyse des Systems der Lohnarbeit durch.
Zunächst einmal sind es vier Faktoren, die den gegenwärtigen Zustand verursacht haben:
Erstens Arbeit ist alles
Arbeit ist zu etwas geworden, was Frithjof Bergmann einen „Omni-Wert“ nennt.
Arbeit hat für den modernen Menschen dieselbe Bedeutung wie einst die Büffel für die Indianer. Die Büffel wurden gegessen, die Häute zu Behausungen und Kleidungsstücken bearbeitet, die Knochen zu Werkzeugen. Der Büffel lieferte den Indianern alles, was sie brauchten. So geht es dem modernen Menschen mit der Arbeit. Außer dass er sie nicht jagen kann, sondern eher schicksalsmäßig zugeteilt bekommt. Arbeit beherrscht das ganze Leben.
Ohne Arbeit ist der Mensch nichts.
Arbeit sichert die menschliche Existenz. Arbeit ist gleichbedeutend mit Geld verdienen, ohne das man nicht leben kann. Aber nicht nur das. Sie sichert auch den sozialen Status und die Selbstachtung des Menschen. Ein Mensch ohne Arbeit ist nicht viel wert. Er fühlt sich nutzlos und überflüssig. Arbeit ist auch „alles“ in dem Sinne, dass sie viele andere Dinge verdrängt. Sie beansprucht Zeit, die für Familie und Freunde, zum Lesen, zum Musikhören und zum Nachdenken fehlt.
Zweitens Abschaffung der Arbeit durch Automatisierung
Der Prozess, der die Arbeit in der westlichen Zivilisation zum Omni-Wert gemacht hat, wird nun von der Automatisierung vollkommen unterlaufen. Automatisierung setzt Arbeitskräfte frei und macht damit die menschliche Arbeit zunehmend überflüssig. Einige Jahre gab es die Illusion, dass Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich diejenigen ersetzen könnten, die in der Industrie der Automatisierung zum Opfer gefallen sind. Aber diese Annahme hat sich schnell als Irrglaube herausgestellt. Es wird zunehmend selbstverständlich, dass ein Automat Fahrkarten verkauft und dass Bankgeschäfte per Internet erledigt werden. Das Resultat dieser Entwicklung ist eine paradoxe Situation: Es wird viel Energie und Intelligenz darauf verwandt, Arbeit abzuschaffen, jenes Gut, um das die gesamte menschliche Existenz eigentlich kreist.
Drittens Globalisierung
Industrialisierung und Automatisierung haben einen weltweiten Prozess in Gang gesetzt, der immer mehr Menschen nach Arbeit suchen lässt. Noch vor wenigen Jahrzehnten hat die Mehrzahl der Menschen auf dem gesamten Globus als Bauern in Dörfern gelebt und sie haben sich von dem Land ernährt, das sie als Bauern bestellt haben. Seitdem Agrarkonzerne das Land aufkaufen und Lebensmittel zu extrem niedrigen Preisen erzeugen können, haben immer mehr Bauern die Dörfer verlassen, weil der Acker sie nicht mehr ernährt. In Afrika, Asien und Südamerika sind riesige Wanderungsbewegungen im Gang. In letzter Zeit wird man sich im Westen der Problematik immer bewusster, die die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in China mit sich bringen.
Millionen und Abermillionen Menschen ziehen in die Städte, in denen sie bestimmt keine Arbeit finden werden. Sie werden nur den Gürtel der Slums um die Metropolen vergrößern. Dieser Prozess vollzieht sich weltweit. Mit der bäuerlichen Arbeit verschwindet auch eine Lebensform. Bisher gibt es keinen adäquaten Ersatz. Im Jahr 2007 werden erstmalig mehr Menschen in Städten als auf dem Land leben.
Viertens Wer entscheidet darüber, wie viel Arbeit es gibt?
Wer eigentlich hat diese Situation herbeigeführt, dass immer weniger Menschen sich durch Arbeit ernähren können? Will man diese Frage beantworten, kommt eine Macht ins Spiel, die weltweit von Politikern und von der Bevölkerung „die Wirtschaft“ genannt wird. Dieses mächtige gottgleiche Wesen macht uns alle zu Bittstellern. Diese Macht kann Arbeitsplätze verschwinden lassen oder erschaffen. Politiker bringen dieser Macht immer wieder Geschenke und Opfergaben in Form von Steuerersparnissen und Subventionen, damit so die geheimnisvollen Kräfte walten, die Arbeitsplätze schaffen können.
Summa summarum
Diese vier Faktoren halten uns in einem Würgegriff, sie haben unseren Verstand und unsere politische Vorstellungskraft lahmgelegt. Es ist erschütternd banal: Arbeitsplätze sind unser Ein und Alles, der „Omni-Wert“ eben. Durch Automatisierung und Globalisierung werden permanent Arbeitsplätze abgeschafft, Arbeit wird ein immer knapperes Gut. Der Hunger nach Arbeit lässt uns die Wirtschaft als Heilsbringer verehren und uns ihr gegenüber immer noch ergebener, noch unterwürfiger werden. Frithjof Bergmann nennt das die Kopplung von Business und Arbeitsplätzen. Wir glauben, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Der Zug ist nach wie vor in voller Fahrt. Es gibt viele Probleme, für die niemand eine Lösung kennt.
Weiter Richtung Abgrund
➤ Arbeitsplätze um jeden Preis
Von allen Seiten ertönt der Ruf, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, und diese Forderung ist absolut und nicht verhandelbar. Pazifisten rufen die weißen Tauben zurück, wenn in ihrer Kleinstadt eine Munitionsfabrik aufmacht. Arbeitsplätze gehen über alles.
Was geschieht? Weitere Opfergaben werden der Wirtschaft dargebracht, denn ihre Gewinne müssen sich vergrößern, damit sie mehr Arbeitsplätze schaffen kann. Also nehmen die Politiker mit unsere Duldung Geld aus dem sozialen und kulturellen Bereich und spielen es der Wirtschaft in Form von Steuersenkungen zu. Die Wirtschaft wird immer mächtiger, und soziale und kulturelle Bewegungen ziehen sich in immer kleiner werdende Nischen zurück.
➤ Die Opfergaben gehen ins Leere
Dabei ist die Wirtschaft äußerst uneffizient in ihrer Fähigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen. Unsere Opfergaben gehen ins Leere. Mit maximalem Aufwand wird ein minimales Ergebnis erzielt. Der Wirkungsgrad der Arbeitsplatzerzeugungsmaschine ist lächerlich klein. Jeder wirtschaftlich denkende Betrieb hätte sie längst ausgemustert.
Die Wirtschaft erobert immer mehr Bereiche, die einst unter kommunaler oder staatlicher Verwaltung standen, wie Krankenhäuser, Wasser- und Elektrizitätswerke, den sozialen Wohnungsbau, die Bahn und die Post.
Um den Kessel unter Dampf zu halten, werden in übertragenem Sinne die alten Familiengemälde, wertvolle Möbel, Bücher und das Klavier verheizt.
➤ Das Verhältnis von Wirtschaft und Ökologie
Irgendwann kollidieren die ökologischen Interessen mit denen der Wirtschaft. Egal ob es um die Qualität des Wassers, der Luft oder die Bewahrung der Schönheit eines Tales geht, meist kommt es schnell zum Entweder-oder zwischen Naturschützern und der Wirtschaft: Entweder lasst ihr Grünen von euren Ansprüchen oder wir gehen mit unseren Arbeitsplätzen woandershin. Dieses erpresserische Argument funktioniert in den allermeisten Fällen.
➤ In der Dritten Welt
Auch hier tut die Kopplung von Business und Arbeitsplätzen ihr Werk. Millionen von Menschen sind ohne Arbeit und leben in Slums, und die Regierungen betteln vor den Toren der Wirtschaft, sie möge zu ihnen kommen und sich dort ansiedeln.
Unter der „Dritten Welt“ versteht Frithjof Bergmann alle wirtschaftlich und sozial unterentwickelten Länder. Unter dem Aspekt der Verelendung können jedoch auch ohne weiteres die Armenviertel der Metropolen hinzugezählt werden. Gleich ob es sich dabei um die Slums von Rio de Janeiro oder die Elendsviertel von Los Angeles handelt.
➤ Verelendung
Es ist ein Charakteristikum unserer Zeit, dass immer mehr Menschen verelenden. Niemand kennt die exakte Zahl aller Slumbewohner, weil dort nicht gezählt wird.
Was uns aber berühren sollte, ist die Tatsache, das fast jede große Stadt gleichzeitig eine Stadt und ein Slum ist. Und die Slums wachsen ständig. Die Menschen leben dort beengt, zusammengekauert, mit einem Minimum an Wasser und unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen. Sie hausen ungenügend geschützt vor Hitze und Kälte unter Plastefolien oder Blechstücken. Schätzungsweise eine Milliarde Menschen leben so. Das sind mehr, als Europa Einwohner hat. Jedes Jahr nimmt ihre Zahl um 27 Millionen zu. In den Slums von Bombay leben schon heute mehr Menschen als in Norwegen.
Der Ort der Armut verschiebt sich vom Land in die Stadt. In einigen afrikanischen Ländern südlich der Sahara wie Tschad, Niger oder Sierra Leone ist die Not in der Stadt schon jetzt größer als auf dem Land. Das Gleiche gilt für Lateinamerika und die Karibik.
Das Ganze ist eine riesige soziale Zeitbombe. Es gibt bisher keine Maßnahmen, die gezeigt hätten, dass sie die Verelendung stoppen können. Wirtschaftswachstum und die dadurch erreichbare Zunahme an Arbeitsplätzen kann definitiv kein Gegenmittel für ein Problem dieses Ausmaßes sein. Dies alles läuft auf ein Schreckensszenarium hinaus: Der Graben zwischen Arm und Reich wird so tief, dass diejenigen, die über Wohlstand verfügen, in Schutzzonen leben, um sich vor den aufbegehrenden Besitzlosen zu sichern. Glücklich wird dabei niemand mehr, alle Betroffenen kämpfen nur noch ums Überleben und gegen die Bedrohung durch den jeweils anderen.
Darauf weist Frithjof Bergmann schon seit vielen Jahren hin.
Wie sehr er damit recht hat, zeigte sich im Herbst 2006, als es mitten in Europa einen Vorgeschmack auf diesen Kampf gab. Die zumeist jugendlichen Bewohner der Pariser Vorstädte revoltierten mehrere Tage und waren auch durch massiven Polizeieinsatz nicht unter Kontrolle zu bringen. Hier bekam eine westliche Industrienation erstmalig die Quittung für ihren Zynismus. Hier zeigte sich, dass Staatenlose, Flüchtlinge, Entwurzelte und Arbeitslose – alles Menschen, die von der Gesellschaft nicht gebraucht werden – nicht bereit sind, ihr Schicksal stumm zu erdulden.