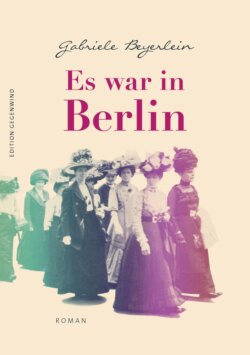Читать книгу Es war in Berlin - Gabriele Beyerlein - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie Spindeln drehten sich in rasender Geschwindigkeit. Der breite Wagen der Spinnmaschine fuhr aus und hielt in der Endposition, während die Spindeln sich weiterdrehten und die Wollfäden immer fester spannen. Dann stoppten die Spindeln, die Fäden wurden niedergedrückt, der Wagen fuhr zurück in die Grundposition, die Spindeln wickelten dabei das Garn auf. Und wieder von vorn. Ohne Unterlass, von dem Transmissionsriemen angetrieben, tat die Maschine unter lautem Geratter ihre Arbeit. Sie wurde nicht müde.
Claras brennende Augen huschten unablässig über Fäden und Spindeln, vor und zurück, nach rechts und nach links. Dreihundert Spindeln hatte sie zu kontrollieren, keinen Wimpernschlag lang durfte sie dieses wirbelnde Spiel aus den Augen lassen. Da, links außen, war ein Faden gerissen. Mit einigen Schritten war sie zur Stelle, folgte dem Wagen in der Spur der Schienen, auf denen er lief. Als er fast eingefahren war, beugte sie sich weit über ihn und erwischte das Ende des zerrissenen Garns, zog es heran. Vor der wieder ausfahrenden Maschine zurückweichend, ergriff sie das Fadenende der entsprechenden Spindel, legte die beiden Teile ein Stück übereinander, nicht zu viel und nicht zu wenig. Sofort wurden sie durch die Drehung der Spindeln verbunden. Sorgfältig hielt sie das Garn beim Aufwinden so, dass sich keine Schlaufen bildeten. Dort in der Mitte war schon wieder ein Faden gerissen, sie musste sich beeilen, ihn zu erhaschen, ehe er sich um den Nachbarfaden schlang und Schaden anrichtete.
Mechanisch taten Claras Finger die notwendigen Griffe, stets die gleichen, wie ein Automat. Immer wieder lief sie, die Augen auf die Spindeln gerichtet, vor ihrer Hälfte des Selfaktors, der Spinnmaschine, hin und her. Immer wieder folgte sie der Bewegung des großen Wagens vor und zurück. Immer wieder reckte und beugte sie sich über ihn, angelte nach gerissenen Fäden und legte sie an. Und wieder von vorn. Vor der Maschine nach rechts die Schritte hin bis zu Franz – dem neuen Maschinenführer, der am Maschinenblock stehend den Selfaktor wartete und eben die eisernen Teile reichlich mit Öl schmierte – und dann wieder nach links die Schritte zurück zum äußersten Rand.
Die Schritte zu ihm hin waren ihr lieber. Jedes Mal schaute sie kurz, ob sie vielleicht einen Blick von ihm erhaschte – bevor er zum nächsten Selfaktor hinüberwechselte, denn er hatte zwei Maschinen einzurichten, zu warten und zu überwachen …
Ohrenbetäubender Lärm erfüllte den Fabriksaal. Zahllose rasselnde Maschinen zum Strecken und Spinnen der Wolle von den Vorfäden bis hin zum feinsten Kammgarn standen hier dicht an dicht. Unaufhörlich drehten sich die Wellen unter der Hallendecke, die von der Dampfmaschine im Keller der Fabrik angetrieben wurden, kreischend griffen Zahnräder ineinander, quietschend stießen Stangen vor und zurück, lederne Treibriemen heulten. Viele Tausende von Spindeln ließen ein hohes Surren ertönen. Vom Keller drangen das Pfeifen des Dampfkessels und das Stampfen der Dampfmaschine herauf, vom Erdgeschoss dröhnte das Getöse des lautesten und gewaltsamsten aller eisernen Ungetüme unter den Maschinen der Fabrik: des Öffners, der den ersten Arbeitsgang an der rohen Wolle vollführte und das ganze Gebäude zum Zittern brachte. Nur ein ersehnter Ton unter all diesem nervenzerrenden Krach stellte sich nicht ein: das helle Gebimmel der Mittagsglocke.
Kurz schaute Clara zur großen Wanduhr an der Stirnseite der Halle: noch fast eine Stunde! Seufzend blies sie sich eine Strähne aus der Stirn, die sich aus ihrer straff aufgesteckten Frisur gelöst hatte. Morgens, wenn sie in die Fabrik kam, trug sie ihre dunklen Haare zu einem langen Zopf geflochten. Franz hatte heute Morgen danach gelangt und gesagt, noch nie habe er einen so dicken Zopf gesehen. Aber während der Arbeit war es Vorschrift, die Haare aufzustecken – wie leicht konnten sich offene Haare sonst um die Spindeln winden. Und wie leicht konnte sich ein im hastigen Hin- und Herlaufen fliegender Zopf im Treibriemen der nächststehenden Maschine verfangen, von der Clara nur der schmale Gang trennte! Wer von so einem Riemen erfasst wurde, der wurde mit unwiderstehlicher Macht in die Höhe gerissen und gegen die Decke geschleudert, und wenn er dann wieder herabfiel, blieb kein Knochen heil. Vor Jahren war ein junges Mädchen so zu Tode gekommen, aus sträflichem Leichtsinn, erklärten die Aufseher, die jeder neu in die Spinnerei eintretenden Arbeiterin warnend davon erzählten, damit sie sich in Acht nahmen. Dieser Treibriemen und der vielen ungeschützt sich drehenden Maschinenteile wegen war es ebenfalls Vorschrift, die Schürze über dem Rock mit doppelter Schleife in Kniehöhe fest zurückzubinden, damit kein wehender Rock und kein Schürzenzipfel in die Maschine geriet. Durch diese Art der Kleidung wurde es Clara noch heißer, als es ohnehin schon war.
Ein Schweißfilm stand ihr auf der Stirn und verklebte dort mit dem Staub der in der Luft schwebenden feinen Wollhärchen und des Abriebs der Lederriemen. Schweiß rann ihr in Rinnsalen den Rücken und die Seiten hinunter. Es war heiß und feucht in der Halle, die Luft war geschwängert von Wasserdampf, wie die Wolle es mochte. Die Ofenhitze mischte sich mit der Maschinenwärme und den Ausdünstungen der Wolle und der Arbeitenden, und zu allem Überfluss schien auch noch die Wintersonne tief in die Halle herein. Wie der wirbelnde Staub in ihren Strahlen tanzte! Kaum sah man hindurch.
Gern wäre Clara zu einem der großen Fenster gelaufen und hätte es aufgerissen, den Kopf kurz in die klare Winterluft gesteckt. Aber das Öffnen der Fenster wie das Unterbrechen der Arbeit war durch die Fabrikordnung untersagt – wie so vieles, was gutgetan hätte. Ob die Arbeiterinnen unter der unnatürlichen Schwüle im Raum litten, was spielte das für eine Rolle, wenn nur die Wolle die feuchte Wärme hatte, die sie brauchte, wenn nur die Fäden nicht rissen!
»Diese Hitze!«, rief Franz ihr über das Maschinengetöse zu, als sie wieder neben ihm zu stehen kam. Er blies scherzhaft die Backen auf, wischte sich theatralisch mit dem Handrücken die Stirn und schlenkerte die Hand, als würde er die Schweißtropfen abschütteln.
Sie lachte. »Das kannst du laut sagen! Ich komme um vor Durst.« Sie achtete darauf, dass sie dem Aufseher den Rücken zuwandte, damit dieser nicht sah, dass sie sich mit Franz unterhielt. Privatgespräche während der Arbeit waren verboten, aber bei dem Lärm konnte der Aufseher sie nicht hören.
»Wären wir Orchideen, wir würden hier drinnen gedeihen, bei dem Treibhausklima, das wär eine reine Pracht!«, rief er zur Antwort und grinste ihr zu.
»Aber so gehen wir ein wie die Primeln«, rief sie zurück und freute sich, dass sie eine so gute Entgegnung gefunden hatte.
»Bist ja das reinste Blumenfräulein!« Wieder grinste er, dann beugte er sich tief über den Maschinenblock und justierte eine Schraube.
Blumenfräulein. Das war ein Kompliment, oder? Franzens Eltern hatten früher in einer Gärtnerei im Westen Berlins gearbeitet, als Kind hatte er mit ihnen in der Gärtnerei gewohnt und Gärtner werden wollen. Aber dann hatte die Gärtnerei geschlossen, weil das Grundstück zu Bauland geworden war. So war Franz in eine Spinnerei gegangen und hatte sich zum Maschinenführer hochgearbeitet, er hatte es erzählt, als Olga ihn gefragt hatte. Olga unterhielt sich mit jedem, der ihr gefiel, da kannte die nichts.
Olga hatte ihren Platz auf der rechten Seite von Franz, an der anderen Hälfte der Spinnmaschine. Und natürlich trug sie ihr Hemd am Halsausschnitt wieder offen und so weit, dass es ihr über die Schulter glitt und wer weiß was sehen ließ.
Links außen war der Faden gerissen. Rasch tat Clara ihre Pflicht. Als sie kurz wieder zu Franz sah, hantierte er mit der Ölkanne. Musste nicht rechts ein Garnkörper auf der Spindel höher geschoben werden, um die richtige Aufwicklung zu erhalten – dort dicht neben Franz? Sie eilte hinüber. Da trat ihr nackter Fuß auf einen öligen Fleck, sie rutschte aus, schrie auf, ruderte wild mit den Händen in der Luft, kam den Zahnrädern der nächsten Maschine bedenklich nahe, dann fiel sie und schlitterte an Franz vorbei so weit über den glitschigen Boden, dass sie Olga zwischen die Beine segelte. »So pass doch auf!«, schrie diese auf, kämpfte vergebens um ihr Gleichgewicht und stürzte schließlich über Clara.
Einen Augenblick lagen sie beide benommen am Boden. Clara schloss die Augen. Trotz des Schrecks und des dumpfen Schmerzes durch den Aufprall genoss sie beinahe den Moment des Liegens. Endlich eine unverhoffte Pause.
»Na, die holde Weiblichkeit mir zu Füßen, das lass ich mir gefallen!«, rief Franz mit breitem Lachen.
»Das könnte dir so passen!«, entgegnete Olga, streckte ihm die Zunge heraus und rappelte sich auf die Knie. »Hilf mir lieber beim Aufstehen!«
Franz hielt Olga mit fettem Grinsen die Hand hin, um ihr aufzuhelfen. Olga nahm die Hand, aber einen endlosen Augenblick verharrte sie vor ihm auf den Knien, viel weiter vorgebeugt als nötig. Sein Blick blieb in ihrem Ausschnitt hängen. Und an seinem Gesicht sah man, dass dieser Blick tief reichte, wahrscheinlich bis zum Bauchnabel. Oder doch eher weiter oben hängen blieb. Dann endlich zog Franz Olga hoch und gab ihr einen derben Klaps auf den Hintern. Olga kreischte auf. Aber die Hand, die auf ihrem Hinterteil liegen geblieben war und sich dort unverkennbar wohlfühlte, schüttelte Olga nicht ab.
Rasch sah Clara weg und stand auf. Mit einem kurzen Blick zum Aufseher hin, der auf die Szene aufmerksam geworden war und bereits näher kam, eilte sie an ihren Platz zurück.
»Da hab ich wohl Öl verschüttet«, meinte Franz. »Ich mach's auch wieder gut an den gefallenen Mädchen. Heut Abend auf dem Heimweg spendier ich euch in der Bierhalle eine erstklassige Berliner Weiße!«
Eine Berliner Weiße von Franz. Eben noch hätte sie sich nichts Besseres vorstellen können. Aber nicht mit dieser Olga gemeinsam, so, wie die sich aufführte! »Wie du dir das vorstellst«, rief sie abwehrend. »Daheim warten sie auf mich.«
Franz machte nicht den Eindruck, als täte ihm die Abfuhr leid. Er hatte nur noch Augen für Olga. Was die sagte, konnte Clara nicht verstehen. Aber dass es eine Zustimmung war, das sah sie.
»Und wenn du meinetwegen noch mal fällst, dann hab ich nichts dagegen, du weißt schon, wie ich's meine«, rief Franz Olga zu und lachte anzüglich.
»Bevor ich deinetwegen fallen würde, müsste es bei dir erst mal ordentlich stehen«, gab die zurück.
Clara wandte sich ab. Sie hatte genug.
Zornig beugte sie sich über die Spindeln. Fünf Fäden waren gerissen, aber nicht alle hingen mehr lose herab, dort, dort und dort hatten sie sich mit den Nachbarfäden verbunden. Doppelfäden waren es nun, die von den einen Spindeln aufgewickelt wurden, während die anderen sich leer drehten. Wenn der Aufseher das merkte – eine Katastrophe! Garnkörper mit Doppelfäden waren Ausschussware, dafür würde sie Lohnabzug bekommen. Hastig riss sie die Doppelfäden durch, versuchte sie wieder an den beiden richtigen Spindeln anzulegen, nur schnell, schnell, damit es nicht auffiel! Doch da drüben bildeten sich Schlingen, wie sollte sie das verhindern, sie konnte nicht überall zugleich sein. Die ein, zwei Minuten, die sie durch den Sturz verloren hatte, ließen sich nicht einholen, pflanzten sich als Fehler fort.
Dann stand der Aufseher neben ihr. Mit einem Blick erfasste er die Situation. »Doppelfäden!«, blaffte er sie an. »Und dann auch noch einfach drüberspulen, als wäre nichts! Das ist der Gipfel! Ist dir überhaupt klar, was du hier produzierst? Die Weberei reklamiert dann, dass wir schlechtes Kammgarn liefern, und der Ruf unserer Spinnerei ist ruiniert. Ein Viertel Abzug!«
Ein Viertel Tageslohn Abzug! Zweidreiviertel Stunden umsonst geschwitzt, umsonst sich geschunden
Clara presste die Zähne zusammen. Nur ja nichts sagen. Wenn sie sich jetzt rechtfertigte, dass sie nichts dafür könne, weil sie ausgerutscht sei, dann bekam sie wegen Aufsässigkeit noch einen Abzug dazu.
Früher, beim alten Fabrikherrn, war es anders gewesen, da hatte ein menschlicherer Ton geherrscht. Da hätte sie nicht versucht, einen Fehler zu vertuschen, weil die Aufseher auch mal ein Auge zugedrückt hätten, wenn man an einer Panne wirklich nicht schuld war. Aber seit der Sohn die Firma übernommen und neue Aufseher eingestellt hatte, hagelte es nur so Abzüge und Strafen.
Sie konnte sich das Lamento ihrer Mutter schon vorstellen, wenn die von dem Abzug erfuhr. Acht Mark verdiente Clara in einer Woche, wenn sie keine Strafen zahlen musste, und auf jeden Pfennig kam es an – und die Versicherungen gingen auch noch runter. Die Mutter glaubte, sie könne jede Woche acht Mark verdienen, und wenn es weniger wäre, dann wäre es Claras Schuld. Aber was wusste ihre Mutter schon davon, wie es in einer Fabrik zuging, die hatte nie in einer gearbeitet! Sie würde der Mutter nichts davon sagen, vorerst.
Am nächsten Samstag allerdings, wenn sie den Lohn ausbezahlt bekam, würde es sich nicht verheimlichen lassen.
Und das alles wegen Franz. Franz, der so verwegen aussah, wenn er die Mütze aus der Stirn schob. Aber der Olga in den Ausschnitt starrte und ihr auf den Hintern klatschte und so anzüglich daherredete und sich von der anmachen ließ, dass man sich schämte.
Freilich, Sprüche machten alle Männer in der Fabrik, und die meisten Mädchen und Frauen lachten darüber. Sie fand es nicht wirklich zum Lachen. Von daheim war sie so was jedenfalls nicht gewöhnt.
Gefallene Mädchen! So nannten die besseren Leute Mädchen, die sich mit einem Mann eingelassen hatten, und rümpften die Nasen. Gefallene Mädchen! Was bildete der sich überhaupt ein! Für Olga mochte das ja stimmen, für die mit Sicherheit. Aber sie selbst jedenfalls, sie war kein gefallenes Mädchen, sie hatte noch keinen an sich rangelassen und sie wollte es auch gar nicht und erst recht nicht diesen Franz oder einen anderen Rohling aus der Fabrik.
Aber wo sollte sie einen kennenlernen, wenn nicht in der Fabrik? Ihre Eltern erlaubten ja nicht, dass sie samstagabends zum Tanzen ging wie alle anderen Mädchen. Weil sie vom Dorf waren aus Schlesien, von wo sie erst vor ein paar Jahren hergezogen waren. Und weil sie es mit der Kirche hielten und weil der Pfarrer predigte, dass es Sünde sei vor der Ehe. Es. Dabei wollte sie das sowieso nicht, nur ein bisschen Tanzen und ein bisschen Vergnügen – das konnte doch nicht zu viel vom Leben erwartet sein! Aber der Vater würde sie ja am liebsten einsperren, obwohl sie doch längst siebzehn war. Und vormachen konnte man ihm nichts. Der arbeitete selbst in einer Spinnerei und wusste, wie die Reden in der Fabrik waren, und kannte genug solche wie Franz und Olga.
Fieberhaft arbeitete sie. Ihre Finger flogen. Die Gedanken noch mehr. Und dann endlich ertönte die erlösende Glocke.
Wie durch Zauberhand standen alle Maschinen still. Ein Aufseufzen ging durch die Halle. Im nächsten Augenblick stürzten alle Arbeiterinnen und Arbeiter zur Tür. Im Pulk der anderen drängte Clara die Treppe hinunter, ihren Korb am Arm. Ein Stau bildete sich, weil auch aus der Halle im Erdgeschoss die Mädchen, Frauen und Männer quollen, ein Schieben und Drücken, dann endlich war sie im Freien. Tief atmete Clara auf. Luft! Kalte, klare Winterluft, in der schon ein Hauch von Vorfrühling lag. Die Sonne schien in den Hof und brachte die letzten Schneereste zum Schmelzen.
Auf einer aus ein paar Steinen und Brettern errichteten provisorischen Bank ließ Clara sich nieder und hüllte sich in ihr warmes Umschlagtuch.
Sie blinzelte gegen die Sonne. War da drüben nicht Franz? Wie er dort stand und sich die Mütze aus der Stirn schob … Ihr Herz schlug schneller, ob sie es wollte oder nicht.
Zwei andere junge Arbeiter kamen aus dem Fabrikgebäude, gingen auf Franz zu. Gemeinsam verließen die drei den Hof. Die jungen Männer, die hatten Geld, die verdienten ja das Doppelte von dem, was sie verdiente, und gaben aus, was sie hatten. Die brachten sich nicht ihr Essen mit in die Fabrik, sondern gingen zu einem privaten Mittagstisch oder in eine Kneipe, wenn es nach Hause zu weit war, und aßen Fleisch und tranken Bier. Und konnten sich sogar leisten, zwei Mädchen in die Bierhalle einzuladen. Aber im Grunde waren sie nur an einer interessiert, die ihnen alles zeigte, was sie hatte – und die vor allem mehr tat, als es nur zu zeigen. Ach, was sollte es! An Franz noch einen Gedanken zu verschwenden, lohnte ja doch nicht. Clara hielt ihr Gesicht mit geschlossenen Augen ins Licht. Die Sonne brannte alle Gedanken weg, bis nichts mehr da war außer diesem Rot, das hinter ihren Lidern flimmerte.
Wohlig streckte sie die Beine von sich. Sie war froh, dass der Weg nach Hause zu weit war, um ihn in einer Stunde Mittagspause hin und her zurückzulegen. So erwartete die Mutter nicht, dass sie mittags heimkam.
Endlich einen Augenblick ausruhen, genießen. Frische Luft atmen. Und endlich wieder fühlen, dass man lebte.
Langsam kroch ihr die Kälte von den Füßen aufwärts unter den dünnen Rock, biss ihr in die Haut. Sie schlang die Arme um den Oberkörper, zog das Umschlagtuch fester, rieb sich die Schultern. Obwohl sie immer stärker fror, blieb sie sitzen. Wie ruhig es war. Kein Maschinenlärm mehr, keine Stimmen, nur das Tschilpen der Spatzen.
Wie früher daheim in Schlesien. Immer so bleiben.
Als sie sich schließlich vor Kälte zitternd erhob, war der Hof leer. Clara machte sich zum »Speisesaal« auf, einem düsteren Raum im Kellergeschoss der Fabrik, in dem die Dampfmaschine stand. Widerstrebend stieg sie die Stufen hinunter. Wäre nur endlich Frühling, dass man wieder die ganze Mittagspause im Freien verbringen könnte!
Sie stieß die Tür auf. Stickige Wärme, ein übles Gemisch der verschiedensten Gerüche, Tabakqualm, Kohlenstaub und lautes Stimmengewirr schlugen ihr entgegen. Der Raum war so düster und dunsterfüllt, dass ihre sonnengeblendeten Augen kaum etwas sahen. Fast blind bahnte sie sich den Weg zwischen den langen Bänken hindurch und an den Kohlehaufen vorbei zum vor Hitze glühenden Heizkessel der Dampfmaschine und stellte ihre Blechkanne darauf. Dann ließ sie sich auf dem nächsten freien Platz an einem der rußgeschwärzten Holztische nieder, an dem mehrere junge Mädchen saßen.
»Na, Clara, hast du heut wieder nur Kartoffeln?«, fragte Olga.
Clara hatte nicht gemerkt, dass sie sich ausgerechnet neben die gesetzt hatte. Doch jetzt aufstehen und sich einen anderen Platz suchen, das ging nicht.
»Und Kaffee«, erwiderte Clara, »aber den mach ich grad heiß.« Vor einer wie Olga ließ sie sich nicht anmerken, dass sie auch gern mal etwas anderes zu essen hätte. Sie begann die Pellkartoffeln zu schälen.
Sorgsam bewahrte sie die Schalen in einem Stück Zeitungspapier auf. Die kleinen Brüder würden sich freuen, wenn sie die ihnen auf der Herdplatte röstete und mit etwas Zucker bestreute – die einzige Nascherei, die es daheim gab.
»Da, darfst mal mit eintauchen«, erklärte Olga und schob ihr das Blechgeschirr hin, in dem cremig gerührter Quark Clara verheißungsvoll anlachte. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Sie wollte ablehnen, aber sie brachte es nicht fertig, fuhr mit ihrer Kartoffel in den Quark. Wie kühl und frisch das schmeckte. Ob sie wohl noch einmal durfte? Aber ausgerechnet von Olga …
Rasch stand sie auf und holte ihre Kaffeekanne vom Heizkessel. Sie trank und trank. Süß und herb zugleich rann das heiße Getränk aus Kaffee-Ersatz durch ihre Kehle. Drei gehäufte Esslöffel Zucker hatte sie hineingemischt. Zucker zum Kaffee aus Zichorienwurzel war der einzige Luxus, mit dem die Mutter nie knauserte – und wenn man beim Kaufmann dafür anschreiben lassen musste. Wie ließe sich auch sonst ein Arbeitstag von morgens um sechs bis abends um sechs durchstehen?
»Clara hat heut eine Einladung zur Berliner Weiße ausgeschlagen!«, verkündete Olga den anderen. »Franz wollte sie mit mir gemeinsam in die Bierhalle ausführen. Aber Clara will nicht. Was sagt ihr dazu?« Olga lachte.
Clara stieg das Blut in den Kopf. Dennoch zuckte sie die Schultern und versuchte gleichfalls ein Lachen. »Na und! Ich mach mir nichts aus ihm.«
»Da hör mal eine an«, schaltete sich Emmi ins Gespräch ein, ohne ihren Strickstrumpf sinken zu lassen. »Wo er doch gar nicht schlecht aussieht! Schultern hat der und Muskeln, die könnten mir schon gefallen. Und wenn er so die Mütze zurückschiebt – der hat das gewisse Etwas, da gibt's nichts. So einen lässt man doch nicht stehen! Oder hast du am Ende längst einen Bräutigam, Clara, und wir wissen nichts davon?«
»Was, Clara hat einen Bräutigam? Und, was ist? Wie ist er? Jetzt aber los, erzähl!«, riefen die anderen Mädchen und beugten sich vor.
»Was ihr nur habt«, wehrte Clara ab.
Von Stunde zu Stunde wurde die Luft dumpfer. Wenn man wenigstens einmal einen Schluck Wasser trinken dürfte! Aber die Arbeit an der Spinnmaschine duldete keine Unterbrechung. Der Nachmittag – fünf Stunden am Stück – nahm kein Ende.
Wie benommen tat Clara ihre Arbeit. Eben noch hatte das Anspinnen für eine neue Partie eine gewisse Abwechslung gebracht. Da musste man sich zwar beim Abnehmen und Einsortieren der aufgespulten Garnkörper, der Kötzer, beim Aufstecken frischer Papierhülsen auf die Spindeln und beim Anlegen der neuen Fäden auch beeilen, aber man konnte es wenigstens im eigenen Rhythmus machen, musste sich nicht an die Bewegung der Maschine anpassen und nicht auf dieses wirbelnde Spiel starren. Doch nun hatte sie wieder das Spinnen zu überwachen. Mechanisch erfüllten die Finger ihre Aufgaben, ganz von selbst registrierten die Augen jede Störung, unwillkürlich reagierten ihre Muskeln. Immer dasselbe. Der Lärm schien zuzunehmen, lauter und lauter zu werden. Unerträglich dröhnte er in den Ohren und wollte ihren Kopf schier zersprengen. Schultern und Rücken schmerzten, die Beine waren schwer, die Zehen taten weh. Mehr als einmal hatte sie sich diese an den auf den Boden geschraubten Eisenschienen gestoßen, auf denen der Wagen fuhr. Und noch mehr als zwei Stunden bis zum Feierabend.
Kein Blick mehr für Franz. Nur noch dies eine: aushalten, durchhalten! Da plötzlich schepperte die Glocke. Und die Maschine stand still. Einen Augenblick wurde Clara schwarz vor Augen. Taumelnd hielt sie sich am Wagen des Selfaktors fest. Dann schaute sie zur Wanduhr: Erst vier.
Stimmen erhoben sich, fragten nach dem Grund der Unterbrechung. Der Oberaufseher rief laut: »Schluss für heute! Der Herr Direktor hat Kurzarbeit angeordnet. Täglich neun Stunden, dabei bleibt es fürs Erste. Morgen früh wieder um sechs! Und jetzt gründlich den Arbeitsplatz aufgeräumt und reinegemacht! Vorher verlässt keiner die Fabrik.«
»Kurzarbeit?«, gellte eine Frau, deren Augen vom Staub rot entzündet waren. »Ohne uns was zu sagen! Vier Kinder hab ich großzuziehen und mein Mann ist krank und kann nicht in die Fabrik! Kann mir einer sagen, wie ich die hungrigen Mäuler daheim stopfen soll?«
Andere Stimmen mischten sich in den Protest, doch Clara dachte nichts als: Gott sei Dank. Für heute kann ich entkommen.
Einer der Arbeiter forderte lautstark Aufklärung, wie lange die Kurzarbeit andauern werde, doch er wurde vom Oberaufseher abgefertigt: »Das wirst du dann schon sehen. Seit wann ist dir denn der Herr Direktor Rechenschaft schuldig? Und jetzt halt den Mund! Sonst arbeitest du morgen nur für die Strafe, die dir abgezogen wird. Das gilt für alle!«
Das laute Schimpfen verstummte und wandelte sich in ein leises Murren. »Das können die doch mit uns nicht machen«, klagte Emmi, die an der nächsten Maschine stand, flüsternd. Ihre Stimme zitterte. »Wie soll ich denn jetzt mit dem Lohn auskommen, wo's doch so schon vorn und hinten nicht reicht!« Emmi hatte ein Kind und keinen Vater dazu.
Clara erwiderte nichts. Kurz sah sie in das verzweifelte Gesicht der anderen, blickte rasch wieder weg. Dann kehrte sie hastig die Abfälle zusammen, säuberte die Maschine und ging, ohne auch nur noch ein einziges Wort zu wechseln. Endlich frei.
Erst auf der engen Straße hielt sie inne und wickelte sich in ihr Umschlagtuch. Zwei geschenkte Stunden lagen vor ihr. Doch wie sie nutzen? Wenn sie nach Hause ginge, so würde sie von der Mutter in die Heimarbeit eingespannt werden. Oder sie müsste bügeln. Den ganzen Sonntag hatte sie mit der Mutter gemeinsam Wäsche gewaschen, körbeweise wartete diese darauf, geplättet zu werden. So oder so hätte sie die Schufterei in der Fabrik nur gegen die Schufterei zu Hause eingetauscht.
Sie wandte sich zum Fabriktor um. Im Pulk der anderen sah sie Franz mit Olga herauskommen. Olga hatte sich bei ihm eingehängt und lachte zu ihm empor. Und jetzt legte er seinen Arm um ihre Hüfte und ließ die Hand unter dem Umschlagtuch verschwinden.
Clara wandte sich ab und lief die Straße hinunter, bog um eine Ecke, verließ die übliche Route nach Hause. Vor Franz und Olga herzugehen, nein, dazu hatte sie nun wirklich keine Lust.
Gassen, durch die sie noch niemals gegangen war, altes heruntergekommenes Gemäuer, Hoftore, die den Blick in düstere baufällige Höfe freigaben, in denen morsche Schuppen und schadhafte Holzvorbauten beinahe jeden Winkel ausfüllten, windschiefe Häuser aus längst vergessenen Jahrhunderten – Claras eingeschlagener Weg führte sie durch die ältesten Quartiere des Zentrums.
Eine Idee bildete sich in ihr: Ums Schloss wollte sie spazieren und bei der Baustelle zuschauen, wie der neue Dom entstand, dann die Linden hinab flanieren und in der Friedrichstraße die Geschäfte ansehen und ihre Freiheit genießen. Was für ein guter Tag! Und dann kam noch der beste Abend der Woche. Heute war Donnerstag, und donnerstagabends passte sie immer auf die Kinder ihrer älteren Freundin Jenny auf, während diese in die Arbeiterinnenschule ging, und durfte zum Dank bei Jenny essen, bis sie satt war. Jenny war mit einem Eisengießer verheiratet, der gut verdiente, und deshalb gab es bei Jenny immer herrliche Sachen zu essen, oft sogar Fleisch. Bei dem bloßen Gedanken lief Clara schon das Wasser im Mund zusammen.
Gemächlich schlenderte sie weiter, rieb dabei die Hände aneinander. Die Sonne stand schon so tief, dass die Gasse im Schatten lag. Und so wohltuend sie zunächst die Winterluft nach der stickigen Hitze der Fabrik empfunden hatte – nun wurde ihr kalt. Wenn sie einen Mantel hätte!
Sie seufzte. Ein Wintermantel, das war der Traum, den sie seit Jahren mit sich herumtrug. In einem Mantel aus dichtem Wolltuch müsste sie nie mehr frieren. Und niemand würde ihr auf der Straße ansehen, dass sie keine Bürgertochter war, sondern nur ein Fabrikmädchen. Und am Sonntag könnte sie in der Stadt spazieren gehen und müsste nicht zu Hause sitzen bleiben, weil sie nichts Warmes anzuziehen hatte, womit man sich am Sonntag blicken lassen konnte.
Sie hatte ja Geld. Eine Mark durfte sie jede Woche von ihrem Lohn behalten, wenn sie das verdiente Geld bei ihrer Mutter ablieferte. Davon musste sie ihre Kleidung bezahlen und alle kleinen Vergnügungen, die sie sich gönnte. Sie gönnte sich fast nie etwas, auch keine Abfallwurst oder einen Hering zu Mittag wie manche der Arbeiterinnen in der Spinnerei. So viel Geld als möglich trug sie auf die Sparkasse.
Wenn man heiraten wollte, dann brauchte man mindestens dreihundert Mark für den allernötigsten Hausrat, hatte Jenny gesagt, darunter ging gar nichts. Jenny wusste so was. Jenny wusste überhaupt sehr viel.
Clara bog um eine Ecke und blieb erschreckt stehen. Die Straße war überfüllt von Männern in blauen Arbeitsblusen, die mit besorgten Gesichtern schweigend auf und ab gingen oder sich in bald ernstem, bald erregtem Gespräch vor dem Tor eines schmalen Fabrikgebäudes versammelt hatten. Das Tor aber wurde bewacht von zwei finster dreinblickenden Schutzleuten. Frauen beugten sich aus den Fenstern der umliegenden Häuser und schauten neugierig auf das Geschehen.
»Was ist hier los?«, fragte Clara eine junge Frau, die – in einer gegenüberliegenden Hofeinfahrt stehend – das Ganze beobachtete, einen kleinen Jungen am Rockschoß, ein Baby auf dem Arm.
»Die Arbeiter der Fabrik dort streiken«, erwiderte diese. »Drechsler sind es, denen der Stücklohn um ein Drittel gekürzt worden ist. Aber das sind alles Organisierte, Genossen, die lassen sich das nicht bieten, die haben spontan zum Streik aufgerufen. Na, wenn das mal gut geht! Ich will ja nichts gesagt haben, aber …« Die Frau stockte und wies zum Ausgang der Straße, stieß einen Schrei aus. »Ich hab's ja geahnt!« Damit fasste sie nach der Hand des kleinen Jungen, drehte sich um und verschwand in der Toreinfahrt, den Kleinen hinter sich herziehend.
Clara blickte die Straße hinunter, wohin die Frau gezeigt hatte. Sie schluckte. Berittene Polizei näherte sich von dort, immer mehr Schutzmänner auf hohen Pferden wurden es, die mitten unter die Menschen ritten und die Gruppen zertrennten. Und vom anderen Ende der Straße kamen auch welche.
Polizei. Es war, als setze etwas in ihrem Kopf aus. Weg hier!, dachte sie nur noch, weg hier! Aber wenn sie rechts oder links die Straße hinunterlief, würde sie genau den Schutzmännern in die Arme laufen. Und vor denen fürchtete sie sich mehr, als sie sagen konnte.
Sie verzog sich in die Toreinfahrt, ging immer weiter, kam in einen engen Hof, hörte sie nicht ein Schreien aus der Gasse? Pfiffe?
Wie leicht konnte man in etwas hineingeraten, aus dem man nicht mehr herauskam. Aber sie konnte sich ja nicht ewig in diesem düsteren Hof verstecken. Wer konnte wissen, wie lange das da draußen noch so weiterging! Unschlüssig sah sie sich um.
»Was suchst du denn?«, riefen ihr ein paar spielende Kinder zu.
»Gibt es hier einen zweiten Ausgang?«, fragte sie.
»Ist wohl die Polente hinter dir her?«, fragte ein Junge und grinste mitfühlend. Die anderen Kinder lachten. Es war ein nettes Lachen.
Willig führte der Junge sie durch dunkle Flure, finstere Winkel und enge Höfe, vorbei an stinkenden Latrinen und wirren Haufen von Gerümpel. In einer Ecke lallte ein Betrunkener, eine Frauenstimme zeterte hinter blinden Fensterscheiben, lautes Fluchen antwortete ihr, irgendwo schrie sich ein Baby die Seele aus dem Leib.
»Na, was krieg ich dafür?«, fragte der Junge und wies auf ein offenes Tor, hinter dem man eine schmale Gasse sah, die den Blick frei gab auf den Molken-Markt. Ein Pferdeomnibus ratterte über den Platz.
»Danke!«, erwiderte Clara. »Aber geben kann ich dir nichts. Ich hab nichts.«
Der Junge nickte und grinste. »Hab ich mir schon gedacht. Wie du aussiehst.« Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu: »Lass dich nicht erwischen!« Damit verschwand er.
Es war ruhig auf der Straße. Als würde nicht ein paar Meter weiter Aufruhr herrschen und vielleicht sogar Kampf.
Clara schauderte zusammen. Die Lust auf einen freien Nachmittag in der Stadt war ihr vergangen. Heim wollte sie, nur noch heim.
Auf der Blumenrabatte steckten schon die Schneeglöckchen und Krokusse die grünen Blattspitzen aus der Erde. Und die Christrosen blühten. Clara blieb stehen, schaute. Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. Sie liebte diese Beete im ersten Hof ihrer Mietskaserne, auf die den halben Tag die Sonne schien. Überhaupt dieser Hof mit seiner kleinen Rasenfläche und seinem von Blumenbeeten eingefassten Zierbrunnen, seinen Fliederbüschen, die im Mai so wundervoll dufteten, und seiner rosenumrankten Laube, in der die Herrschaften im Sommer Tee tranken und die beiden alten Damen aus dem dritten Stock des Vorderhauses ihre Stickereien anfertigten. Einmal nur für eine Stunde in dieser Rosenlaube sitzen dürfen!
Aber der Aufenthalt im Garten war nur den Herrschaften aus dem Vorderhaus gestattet, so stand es auf dem Schild im Eingang unter dem stillen Portier – der Tafel, die die Bewohner des Vorderhauses aufführte – gemeinsam mit all den anderen Verboten, die das Herumstehen, das Rufen und laute Reden in den Treppenhäusern und Tordurchfahrten untersagten und das Spielen in den Höfen und überhaupt alles, was Freude machte. Die alte Frau Riefke, die Mutter des Hauswarts, hatte ihren Lehnstuhl am Fenster der Hauswartswohnung im Erdgeschoss rechts und schaute den ganzen Tag in den Garten. Und sobald man auch nur stehen blieb, sagte sie ihrem Sohn Bescheid und schon kam Riefke gerannt und kanzelte einen ab.
Kurz warf Clara einen Blick zu dem besagten Fenster, ob die Gardine sich schon bewegte. Da sah sie eine junge Frau mit Kinderwagen durch die Einfahrt kommen, ein Kind an der Hand, und als diese in den Hof trat, erkannte Clara, dass es ihre Freundin Jenny war. »Clara! Clara!«, rief der kleine Moritz, riss sich von seiner Mutter los und lief ihr entgegen. »Kommst du heut zu uns? Erzählst du mir wieder von Rübezahl?«
Clara ging in die Knie, breitete die Arme aus und fing den Dreijährigen auf. »Aber sicher doch«, erwiderte sie und strich dem Kleinen die Haare aus der Stirn. Hinter dem Fenster wurde mit einem Stock an die Scheibe geklopft und gedroht. Sie erhob sich mit dem Kind auf dem Arm und nickte Jenny zu: »Gleich kommt Riefke!«
Diese verdrehte die Augen. »Könnt ihr nicht lesen?«, äffte sie den Kasernenhofton des Hauswarts nach. »Oder muss ich erst andere Saiten aufziehen?« Sie schüttelte sich und lachte. »Riefke kann nun mal den Feldwebel nicht ablegen. Aber wir sind nicht seine Rekruten – der soll mir nur dumm kommen!« Sie warf den Kopf in den Nacken.
Clara sah die Ältere voller Bewunderung an. Jenny ließ sich von niemandem einschüchtern. Dennoch schob sie den Kinderwagen auf dem Plattenweg rasch weiter. Erst im Dunkel der Durchfahrt zum zweiten Hof verzögerte sie ihren Schritt und fragte: »Aber warum bist du schon zu Hause? Es ist doch noch nicht einmal fünf?«
»Wir haben Kurzarbeit«, erwiderte Clara und trat in den zweiten Hof, der ähnlich geräumig war wie der erste, doch im Gegensatz zu diesem nicht die geringste Begrünung aufwies. Nur ein bisschen vertrocknetes Unkraut zwängte sich zwischen den Fugen des Kopfsteinpflasters zu beiden Seiten des Weges hindurch. An die Mauer zum rechten Nachbargrundstück, über die das sägezahnförmige Dach und der Schornstein einer Fabrik hinausragten, drängte sich ein Schuppen, in dem eine kleine Kohlehandlung sowie der Stall und die Remise eines dürftigen Fuhrunternehmens Fuhren aller Art, schnell, billig, preiswert untergebracht waren. Daneben Mistgrube und stinkende Müllkübel, davor die Teppichklopfstange. Die Wäscheleinenpfosten standen ein Stück entfernt auf der linken Seite des Hofes vor dem Seitengebäude der Mietskaserne mit dem Abgang zur Kellerkneipe Zum unterirdischen Paule. Weiße Tafeltücher der Vorderhaus-Bewohner wehten in der Winterluft.
Trotz seiner Kargheit und des Lärms, der von der Fabrik vom Nachbargrundstück herüberdrang, mochte Clara den zweiten Hof: Hier war es nicht so düster wie in ihrem eigenen Hof, dem dritten. Hier traf man oft auf Gesellschaft und niemand verbot einem, sich zu unterhalten. Im Augenblick freilich war sie mit der Freundin und ein paar Himmel und Hölle spielenden Kindern allein.
»Kurzarbeit? Einfach so?« Jenny sah sie fragend an und blieb stehen.
Clara nickte. »Uns hat keiner was erklärt.«
»Und morgen heißt es dann, der Absatz für Wolle ist eingebrochen und ihr müsst für den halben Lohn arbeiten!«, erregte sich Jenny. »Ich kenne das, ich hab das alles schon erlebt, vor Jahren, als ich als Mantelnäherin in der Fabrik in der Spandauer Straße gearbeitet habe. Und das Garn und die Nähnadeln wollten sie uns auch noch vom Lohn abziehen. Pass bloß auf, Clara, dass es euch nicht auch so geht!«
»Was soll man da schon machen«, antwortete Clara.
»So darfst du nicht reden!« Jenny ereiferte sich immer mehr. »Du musst kämpfen! Wir haben es auch geschafft, damals. Wir haben uns einfach geweigert, zu so einem Schandlohn zu arbeiten. So jung ich war und so bitter angewiesen auf das bisschen Geld, ich war dabei. Mit zwei anderen gemeinsam haben mich die Arbeiterinnen als Delegation zum Unternehmer geschickt. Und der hat tatsächlich klein beigegeben. Denk immer dran: Eine Arbeiterin oder ein Arbeiter alleine ist nichts. Aber alle gemeinsam, die sind eine Macht. Du weißt doch: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will! Ach, wenn ich in eurer Fabrik wäre, dann würde ich agitieren! Ich würde schon Stimmung machen, das darfst du mir glauben!«
»Sei froh, dass du zu Hause bist und deinen Haushalt versorgen kannst und deine Kinder, und dass du einen guten Mann hast und ein schönes Leben und dich nicht in der Fabrik schinden musst«, erwiderte Clara.
Jenny seufzte und warf Clara einen seltsamen Blick zu, den diese nicht zu deuten wusste. »Bin ich ja auch«, erwiderte sie gedehnt. »Einerseits. Aber wenn ich …«
»Entschuldigen Sie bitte«, wurden sie in diesem Augenblick von einer sehr kultivierten Frauenstimme angesprochen. »Dürfte ich Sie wohl um eine Auskunft bitten?«
»Ja?« Clara wandte sich um. Eine hochgewachsene junge Dame stand da in einem halblangen Wintermantel aus edelstem Kaschmir, das erkannte Clara gleich, nicht umsonst arbeitete sie in einer Wollspinnerei und ihre Mutter vernähte schließlich die losen Fäden an Kaschmirschals. Einfach ein Traum war dieser Mantel mit seiner engen Taille, dem großen Pelzkragen und dem Pelzbesatz entlang der Vorderkante und des Saums. Darunter sah ein mit Atlasbändern und -schleifen drapierter Rock aus schwerem Samt hervor und Stiefeletten von atemberaubender Zierlichkeit. Die Hände der jungen Dame steckten in einem Pelzmuff.
Ob es wohl Nerz war? Sie wusste nicht, wie Nerz aussah, nur, dass er besonders teuer war. Und teuer war dieser Pelz bestimmt.
Da könnte eine Arbeiterin ihr Leben lang schuften und würde eine solche Kleidung doch nicht bezahlen können. Und in einem Geschäft für abgelegte Herrschaftskleidung gab es so etwas auch nicht zu kaufen, und wenn doch, dann war es noch immer unbezahlbar. Aber so schön …
Clara unterdrückte ein sehnsüchtiges Seufzen und schaute zu dem Mädchen weiter, das drei Schritte hinter der Dame in einem einfachen schwarzen Wollmantel dastand und unruhig von einem Fuß auf den anderen trat. Offensichtlich war es das Dienstmädchen und ebenso offensichtlich wünschte es sich weit weg.
Auch die Dame sah nicht eben glücklich aus. Sie zog ihre weiß behandschuhte Rechte aus dem Muff, schob sich den halben Schleier zurück, der an der modischen Pelzkappe befestigt war, und lächelte mühsam. Dann nestelte sie einen Zettel hervor. »Ich habe hier eine Anschrift von einer Anna Brettschneider, die ich aufsuchen möchte. Aber ehe ich lange suche, wäre ich für Ihre Auskunft dankbar. Hier steht nur Hinterhof aber nicht welcher – und es gibt ja wohl noch zwei?« Damit machte sie eine Kopfbewegung zur nächsten Tordurchfahrt hin, durch die man auf den letzten Torbogen und dicht dahinter auf das vierte, das letzte Hinterhaus der Mietskaserne sah.
»So ist es«, erwiderte Jenny. Und dann zu Clara: »Kennst du eine Anna Brettschneider?«
Clara nickte. »Früher hat sie in unserem Haus gewohnt. Sie hat fünf Kinder und keinen Mann mehr, meine Brüder stecken manchmal mit denen zusammen, aber meistens müssen die ja Tüten kleben. Sie wohnen jetzt im vierten Hinterhaus im Keller.«
»Das sagt alles!« Jenny seufzte tief. Dann runzelte sie die Stirn und sah die fremde Dame herausfordernd an. »Was wollen Sie denn von Anna Brettschneider?«
»Ich will nichts von ihr. Es ist umgekehrt«, erwiderte diese abwehrend. Eine leichte Röte war in ihre Wangen gezogen. »Sie hat eine Bittschrift wegen einer Nähmaschine an unser Wohltätigkeitskomitee gerichtet. Mein Auftrag ist es, abzuklären, ob wirklich Bedürftigkeit vorliegt. Wenn Sie mir also …«
»Bedürftigkeit!« Jenny lachte, ein Lachen so bitter und verächtlich, dass Clara förmlich zusammenzuckte. »Ich kenne sie nicht, diese Anna Brettschneider, aber eines dürfen Sie mir glauben, meine hochwohlgeborene Dame: Wenn eine im Keller im letzten Hinterhaus wohnt und fünf Kinder hat und keinen Ernährer, dann ist sie bedürftig! Und was so eine braucht, das ist gottverdammt noch mal keine Wohltätigkeit, sondern Gerechtigkeit! Aber gehen Sie nur hin, gehen Sie und überzeugen Sie sich!« Damit ließ Jenny die Dame einfach stehen, riss Clara Moritz vom Arm und schob den Kinderwagen so heftig auf den rechten Hauseingang zu, dass ihre Bewegungen vor Zorn zu sprühen schienen.
Die Wangen der Dame waren inzwischen dunkelrot. Wenn sie nun beleidigt war und umkehrte, nur weil Jenny sie vor den Kopf gestoßen hatte! Dann wäre die einzige Chance vertan, Anna Brettschneiders Not zu lindern. Wo Anna doch von nichts anderem redete, als dass sie eine Nähmaschine bräuchte, um für einen Zwischenmeister Blusen oder Oberhemden zu nähen, damit sie ihre Kinder besser durch Hausindustrie ernähren könnte als mit diesem elenden, miserabel bezahlten Tütenkleben. Weil sie die Kinder ja nicht alleine lassen konnte, um in einer Fabrik zu arbeiten, so klein, wie die Kinder noch waren, und weil sie doch allesamt hungerten und schon ganz elend aussahen …
»Jenny meint es nicht so«, murmelte Clara entschuldigend. Bittend blickte sie die fremde Dame an. »Anna Brettschneider ist ganz bestimmt bedürftig! Und wenn Sie ihr eine Nähmaschine schenken, dann helfen Sie ihr aus höchster Not. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg.«
»Danke, sehr freundlich«, antwortete die Dame. Ihre Stimme klang auf einmal recht belegt. Vor ihr her ging Clara durch die Tordurchfahrt in den dritten Hof. »Mein Gott!«, rief die Fremde aus. »Ist es hier eng und düster!«
Claras Blick ging gleichgültig durch den etwa vier Meter breiten, langgestreckten Hof, der außer den aufgereihten Müllkübeln und einigen windschiefen Verschlägen an der Hauswand keinerlei Einrichtung bot. Wenn die Dame sich schon über den dritten Hof aufregte, was mochte sie dann erst zum vierten sagen? Schulterzuckend erwiderte sie: »Im Winter scheint hier kein Sonnenstrahl herunter, aber im Sommer schon. In den vierten Hof scheint die Sonne nie.« Sie redete sich in Fahrt, auf einmal fand sie es gut, der Dame das alles zu erklären: »Früher, hab ich gehört, war dieser Hof genauso groß wie die beiden vorderen. Aber dann hat der Besitzer noch das zusätzliche Hinterhaus reinbauen lassen, dadurch wurde es so eng.«
Das sei die reine Profitgier gewesen, die den Hausbesitzer zum Bau dieses schmalen weiteren Hinterhauses getrieben habe, hatte Jenny gesagt. Mit den kleinen Wohnungen für die armen Leute ließe sich mehr Geld verdienen als mit den großen Wohnungen für die Reichen. Und was schere es den Hausbesitzer, wenn durch den Bau des zusätzlichen Gebäudes die winzigen Wohnungen und Werkstätten im letzten Hinterhaus zu finsteren Löchern würden, er müsse ja nicht drin wohnen, er hätte sechs Zimmer im Vorderhaus, und bei der Wohnungsnot bekäme er seine miesen Rattenlöcher trotzdem los. Aber so sei das nun mal im Kapitalismus und es würde immer schlimmer werden, immer mehr würden die Massen verelenden bis zum großen Zusammenbruch. Oder so ähnlich.
Clara verstand nicht alles, was Jenny ihr immer über die Kapitalisten erklärte. Aber sie hatte genug verstanden, um zu wissen, dass man davon nichts zu einer vornehmen Dame sagen durfte, die über das Schicksal von Anna Brettschneider entschied. Auf einmal wurde Clara angst, sie könnte bereits durch ihre Bemerkung die Dame verärgert und Anna geschadet haben. Deshalb beeilte sie sich zu beteuern: »Aber im neu eingebauten Hinterhaus ist es gut, da wohnen nämlich wir. Alles modern, sogar für jedes Stockwerk auf halber Treppe zwei Wasserklosetts. Im letzten Hinterhaus müssen die Leute ja noch in den Hof zur Abortanlage. Früher hat Anna Brettschneider sich auch bei uns eine Wohnung leisten können, Küche und Stube, genau wie wir. Aber seit ihr Mann sie verlassen hat, musste sie nach hinten ziehen, in den Keller in einen einzigen Raum. Wie soll man auch mit Tütenkleben das Geld verdienen für eine so teure Wohnung wie unsere! Mit einer Nähmaschine könnte sie wenigstens aus dem Keller raus, meint sie. Jetzt kommen Sie, wir können hier entlang!«
Sie führte die Dame über den dritten Hof nach links und dann zwischen dem Haus und dem Seitenflügel durch einen Spalt in den vierten Hof. Schmal war er wie eine enge Schlucht, keine drei Schritte breit. Rußgeschwärzt die fensterlose Rückwand des dritten Hinterhauses, rußgeschwärzt auch die Front des letzten Hauses. Fünf Stockwerke ragten die Gebäude in die Höhe und schlossen das Licht aus. Es war fast so dunkel, als sei schon Nacht. Trotz der Winterluft hing ein übler Geruch in dem hohen Schlauch. Ein kleines Mädchen lief mit einem randvoll gefüllten Pisspott zur Haustür heraus und strebte den Appartements zu, den an die Mauer zum Nachbargrundstück gebauten Klosetts. Aus dem Pott schwappte es der Dame vor die Füße. Diese wurde blass und hielt sich ihr spitzengesäumtes Taschentüchlein an die Nase. Wenn die im Sommer hierher käme und den Gestank riechen würde, der dann hier herrscht, würde sie glatt in Ohnmacht fallen, dachte Clara.
Sie grinste vor sich hin und stieß die Tür des Treppenverschlages auf, der in den Keller des letzten Hinterhauses hinunterführte. Der Geruch nach Moder, Kohlsuppe, Zwiebeln, Petroleum, Pisse und kaltem Rauch, der ihnen entgegenschlug, nahm selbst ihr beinahe den Atem. Dunkel war es auf der steilen Stiege, nur eine einzelne rußige Petroleumlampe brannte unten im langen Kellerflur. Vorsichtig stieg Clara die schmalen Treppenstufen hinunter. Hinter sich hörte sie einen unterdrückten Aufschrei der fremden Dame und etwas wie ein Würgen. Eine Form von Genugtuung stieg in ihr auf. Für Anna Brettschneider konnte das nur gut sein. Die Dame wollte sehen, ob Anna Brettschneider wirklich bedürftig war. Sollte sie es sehen!
Clara eilte im düsteren Gang vorwärts, zählte die Türen ab, klopfte an die vierte – sie wusste, sie gehörte zu dem Kellerloch, das Anna mit ihren Kindern und einer Schlafgängerin bewohnte –, und öffnete sie, ohne auf eine Antwort zu warten. Anna Brettschneider saß im trüben Schein einer Petroleumfunzel mit ihren beiden Großen, dem siebenjährigen Ludwig und dem sechsjährigen Hans, über Tüten und Leimtopf gebeugt am Tisch. Überall stapelten sich die fertigen Tüten und die Packen braunen Papiers. Aus einem Pappkarton drang das Wimmern eines Babys. Zwei kleine, bleichgesichtige Mädchen hatten sich in das Bettzeug gewühlt, das den neben einem Bett am Boden liegenden Strohsack bedeckte, hatten sich die Decken über den Kopf gezogen und starrten ihnen daraus entgegen.
Als Clara das letzte Mal hier gewesen war, hatten an dieser Stelle noch zwei Betten gestanden. Nun war das eine wohl versetzt worden wie fast der ganze Hausrat. Auf dem Herd kochte ein Kessel mit Wäsche, wabernder Dunst hing in der Luft, das einzige Kellerfenster ging in einen finsteren kleinen Luftschacht, die verschimmelten Wände schimmerten vor Feuchtigkeit.
»Anna«, sagte Clara, »ich bring dir eine Dame vom Wohltätigkeitsverein. Wegen der Nähmaschine.«
Anna Brettschneider sprang auf, wischte sich die Hände an der Schürze ab, putzte dann mit der Schürze den Stuhl, auf dem sie eben noch gesessen hatte, trieb die Jungen an, aufzustehen und sich zu verbeugen, knickste vor der fremden Dame und bat sie, sich zu setzen, kam dabei ins Stammeln, verhaspelte sich immer mehr, begann zu husten und rang in heller Aufregung die Hände. Hektische rote Flecken bildeten sich auf ihren eingefallenen Wangen.
Plötzlich ertrug Clara es nicht mehr. Wortlos drängte sie sich an der Dame und deren vor der Tür wartendem Dienstmädchen vorbei, rannte den Flur entlang, stürmte die Treppe hinauf. Im Hof blieb sie nach Atem ringend stehen.
Wie schnell es gehen konnte. Vor gut einem Jahr hatte Anna Brettschneider noch einen Mann gehabt und wie Claras Familie im dritten Hinterhaus gewohnt, sogar im zweiten Stock. Eine blitzblanke Küche und eine wohnliche Stube hatte Anna Brettschneider gehabt, ein Sofa, drei Betten, eine Wiege und zwei Schränke aus Nussbaumholz – und ein schwarzes Sonntagskleid mit Brosche, in dem sie ausgesehen hatte wie eine Bürgerin. Und nun das.
Ihr Mann hatte sie verlassen, war eines Morgens scheinbar zur Arbeit gegangen wie jeden Tag und am Abend nicht wiedergekommen und auch an den folgenden Abenden nicht. Und als Anna Brettschneider nachgeforscht hatte, da hatte sie erfahren, dass er seine Arbeit gekündigt hatte, und keiner wusste, wohin er gegangen war. Vielleicht nach Amerika. Jedenfalls hatte Anna nie wieder von ihm gehört. Und so hatte sie dagestanden mit den vier kleinen Kindern und dem fünften im Bauch, und wohin so was führte, das konnte man sehen. Wie eine Greisin schaute Anna aus, weil sie Tag und Nacht in ihrem Kellerloch saß und Tüten klebte, und war doch noch nicht einmal dreißig.
Am besten, man heiratete gar nicht. Ließ sich überhaupt nicht erst ein mit einem Kerl. Wenn es doch irgendwo einen gäbe, mit dem es anders war! Einen, bei dem das Glück auf sie wartete – die Liebe, die niemals aufhörte, die hielt für immer und ewig. Einen, bei dem sie wüsste, dass sie nicht so endete wie Anna Brettschneider.
»Kurzarbeit?«, regte sich die Mutter auf und ließ den Kaschmirschal sinken, auf dessen Rückseite sie die losen Fäden vernähte. »Aber das geht nicht! Wie soll jetzt das Geld reichen?«
»Was soll ich denn machen?«, erwiderte Clara. »So ist das eben.«
»Und warum kommst du erst jetzt? Mir wächst hier die Arbeit über den Kopf mit den Schals, fünfzig Stück mehr hat mir der Meister letztes Mal aufs Auge gedrückt, und wenn ich das nicht bis Samstag schaffe, dann verliere ich die Arbeit. Und statt mir zu helfen, trödelst du in der Weltgeschichte herum!« Die Stimme der Mutter wurde immer schriller. »Und mit Lisa ist heute auch nichts anzufangen, die kommt überhaupt nicht vom Fleck mit der Näherei!«
»Es ist ja nur, weil die Finger so wehtun, dass ich die Nadel kaum halten kann«, sagte Lisa leise und beugte den blonden Lockenkopf noch tiefer über die Arbeit.
Clara nahm einen Schal und zog eine Nadel aus dem Nadelkissen, setzte sich zur Mutter und der jüngeren Schwester an den Küchentisch und begann den ersten Faden zu vernähen. »Was ist mit deinen Fingern?«
Lisas blaue Augen füllten sich mit Tränen. Wortlos streckte sie Clara die Hände mit den Handflächen nach oben hin. Über die Fingerkuppen zogen sich dunkelrote, dick geschwollene Striemen.
»Wer war das?«, schrie Clara entsetzt auf und gab sogleich selbst die Antwort: »Der Lehrer?«
Lisa nickte und schniefte. »Weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Weil ich doch nähen musste bis in die Nacht und heut Morgen schon wieder.« Sie schaute kurz zur Mutter, sofort wieder weg.
Diese erregte sich: »Eine Gemeinheit ist das, so ein roher Mensch! Der Herr Wendler daheim im Dorf, der war ganz anders. Du bist doch auch oft ohne Hausaufgaben in die Schule, Clara. Der hat da mehr Verständnis dafür gehabt. Auch, wenn man die Kinder mal für ein paar Wochen daheim behalten hat zum Arbeiten. Und wenn er geprügelt hat, dann auf den Rücken und nicht auf die Finger oder den Hintern, weil er gewusst hat, dass man die Finger braucht zum Haspeln und Spulen und den Hintern zum Sitzen bei der langen Heimarbeit.«
»Wir sind jetzt aber in Berlin und nicht mehr in Schlesien!«, erwiderte Clara gereizt. Dass die Mutter es nie begriff! »Und in Berlin sind die Lehrer nun einmal scharf und dulden es nicht, dass man ohne Hausaufgaben daherkommt oder vor Müdigkeit in der Bank einschläft! Du lieferst Lisa ans Messer, wenn du sie so lange nähen lässt, dass sie ihre Hausaufgaben nicht machen kann! Und jetzt sitzt sie hier schon wieder und näht, statt ihre Schulsachen zu erledigen! Wie soll sie sich denn da morgen in die Schule trauen! Eine Strafarbeit hat sie doch bestimmt auch auf?« Fragend sah sie ihre Schwester an.
Lisa nickte. »Dreißigmal schreiben: Ich muss meine Hausaufgaben immer sauber und ordentlich erledigen. Und die Aufgaben von gestern nachmachen und die neuen dazu.«
»Dann holst du jetzt dein Heft und schreibst!«, bestimmte Clara. »Sonst ergeht es dir morgen in der Schule schlecht. Nähen tust du heut nicht mehr! Ich mach das, und wenn ich die ganze Nacht sitzen muss!« Herausfordernd und zornig starrte Clara ihre Mutter an.
Diese erwiderte den Blick nicht, sah kopfschüttelnd auf ihre Näherei. »Wozu das gut sein soll, so viel Schule!«, murmelte sie starrsinnig. »Ich bin auch nur drei Jahre gegangen und davon nicht einmal die Hälfte vom Jahr, weil ich ja immer den Bauern auf dem Feld geholfen hab. Lesen hab ich trotzdem gelernt, fürs Gesangbuch reicht's. Und die meisten Lieder kann ich auswendig. Was man mit neun noch nicht kann, lernt man auch mit elf nicht mehr.«
»Wie kannst du das sagen!«, fuhr Clara ihre Mutter an. »Soll es Lisa nicht einmal besser haben als du und als ich? Wenn sie ordentlich lernt in der Schule, kann sie vielleicht einmal Schreibfräulein in einem Kontor werden und muss sich nicht so schinden!«
»Schreibfräulein! Kontor!«, erwiderte die Mutter wegwerfend. »Wo sie doch eh einmal heiratet! Bei deinen Brüdern, da würde sich's lohnen. Aber das Geld reicht sowieso nicht dafür. Nee, Lehre, das ist nichts für unsereins. Das ist nur was für die Besseren. Und jetzt red nicht so viel, näh lieber!«
»Immer die Jungen! Die müssen nie etwas tun! Die behandelst du, als wären es die reinsten Kronprinzen«, regte Clara sich auf. Doch dann verstummte sie und beugte sich über die Näherei. Es hatte ja doch keinen Zweck.
Eine Zeit lang nähten sie schweigend. Lisa schrieb eifrig in ihr Heft. Hin und wieder warf sie Clara einen dankbaren Blick zu. Clara lächelte zurück.
Es war schön, eine Schwester zu haben. Wenigstens eine noch. Anne und Hilde, die beiden anderen Schwestern, die im Alter zwischen ihr und Lisa gelegen hatten, waren vor acht Jahren gestorben, in jenem schrecklichen Winter, in dem die Diphtherie im Dorf gewütet hatte.
Der Schmerz über den Tod dieser beiden Schwestern vor acht Jahren … Nein, nicht daran rühren! Sie hatte ja noch Lisa. Nur noch Lisa. Und die musste ihr bleiben.
»Eine Gemeinheit ist das von dem Lehrer!«, ließ sich die Mutter wieder vernehmen. »Hausaufgaben! Wenn doch die Mitarbeit daheim gebraucht wird! Den Eltern das Recht zu nehmen, über ihre Kinder zu bestimmen!«
Halt den Mund, Mutter, dachte Clara. Halt den Mund oder ich schreie.
Die Tür wurde aufgerissen, die drei kleinen Brüder stürmten herein, die Backen rot gefroren vom Spielen auf der Straße. »Gibt es schon Essen?«, rief Heinz, der Älteste. »Wir haben Hunger«, sekundierte Männe, der Zweite. »Hunger«, echote Kalle, der Jüngste.
»Dann geht erst einmal einkaufen!«, bestimmte Clara und sah die Mutter fragend an: »Was brauchst du? Ich esse heute nicht mit, du weißt ja, ich gehe zu Jenny.« Und dann, einer plötzlichen Eingebung folgend, fügte sie hinzu: »Lisa nehme ich mit und teile mit ihr mein Essen, dann hast du hier zwei Esser weniger.« Lisa strahlte.
Jenny würde schon nichts dagegen haben. Hoffentlich jedenfalls.
»Dann holt zehn Pfund Kartoffeln und ein Pfund Steckrüben und für den Vater eine kleine Brühwurst«, trug die Mutter den Brüdern auf.
»Da will ich die Pelle davon ab!«, sagte Heinz sofort.
»Nein! Ich, ich!«, riefen die jüngeren Brüder durcheinander.
»Schlagt euch drum«, antwortete die Mutter mit Gleichmut. »Und für morgen bringt ihr ein Pfund weiße Bohnen, damit ich sie einweichen kann über Nacht. Und lasst anschreiben, sagt, ich zahle dann, wenn ich mein Geld für die Schals hab. Und dann geht zum Unterirdischen Paule und lasst euch zwei Liter Wasser vom Wurstkochen geben, nehmt den Topf mit. Das soll euer Vater zahlen, der sitzt da bestimmt schon wieder und trinkt sein Bier. Aber sagt ihm, mehr als sechs Pfennige darf die Brühe nicht kosten, sonst zahlt er noch zu viel, weil er die Preise nicht kennt.«
Die Jungen nahmen den Topf und stürmten wieder davon, nur der kleine Kalle blieb zurück und drängte sich an die Mutter. Doch diese konnte ihn nicht auf den Schoß nehmen, sie musste ja nähen. So kauerte er sich ihr zu Füßen hin, steckte sich den Daumen in den Mund, umfasste einen Zipfel von ihrem Rock und lehnte seinen Kopf an ihre Knie.
Jemand müsste sich um den Kleinen kümmern!, dachte Clara. Aber wie denn, wenn keine Zeit war? Wie gut es Moritz und Stine hatten, wie Jenny die beiden knuddelte und herzte, sogar mit ihnen spielte. Und sie, Clara, tat es auch, wenn sie auf die beiden aufpasste. Nur für ihren eigenen Bruder hatte sie kaum ein paar Minuten.
So wie ihre Mutter, ein Kind nach dem andern, so wollte sie es einmal nicht haben. Und je mehr Kinder man hatte, desto mehr Arbeit musste man annehmen, um sie durchzubringen, und desto weniger Zeit hatte man für sie und den Haushalt.
Jenny sagte, sie werde nicht mehr bekommen als höchstens noch eines. Weil es beim dritten Kind schon eng werde und ohne Heimarbeit nicht mehr gehe und beim vierten die Not anfange.
Aber wie sie das machen wollte, dass es nicht mehr wurden?
Wenn meine beiden Schwestern nicht an Diphtherie gestorben wären, dachte Clara, und zwei kleine Brüder bald nach der Geburt, und wenn nicht eines eine Totgeburt gewesen wäre, dann wären wir zehn. Dann müssten wir auch im Keller hausen.
Mein Gott, was denke ich da! Hilde und Anne … Josef und Tobias … das totgeborene Mädchen, das nie einen Namen bekommen hat und nicht die heilige Taufe …
Schnell bekreuzigte sie sich.
Den Packen mit den sorgfältig in ein Tuch eingeschlagenen Schals unter dem Arm stieg Clara mit Lisa die Treppe zum zweiten Stock hinauf und ging den langen Flur entlang. Links die Stuben, rechts die Küchen. Nur eine einzige trübe Funzel brannte, aber einige Türen standen offen und ließen Licht in den Flur. Man sah Familien beim Abendessen und Frauen am Herd oder an der Nähmaschine, hörte Kinder lachen, streiten und schreien, wie Clara es auch aus ihrem Haus gewöhnt war. Jennys Wohnung aber war anders. Sie lag am Ende des fensterlosen Flures, hatte ineinander gehend Küche, Kammer und Stube und war ganz getrennt von den anderen. Die Küche schön groß, eine richtige Wohnküche mit einem Fenster zum zweiten Hof! Und daneben Jennys gute Stube mit zwei schönen großen Fenstern ebenfalls zum zweiten Hof, da kam bei Tag richtig viel Licht herein und Luft sowieso. Die Kammer befand sich auf der anderen Seite der Küche mit einem Fenster zum dritten Hof. Hier war es dunkler, aber was machte das, in der Kammer wurde ja nur geschlafen! Eine Wohnung war das, wie sie auch ein Kleinbürger haben könnte, ein Handwerker oder ein Eisenbahner oder ein kleiner Postbeamter, der hinter dem Schalter saß.
Aber Heinrich, Jennys Mann, war ja auch kein einfacher Arbeiter, sondern was Besseres. Ein gelernter Eisengießer war er mit einer richtigen Lehre und hatte während seiner Militärzeit als Bursche bei einem adligen Oberst gedient und feines Benehmen gelernt, und jetzt war er Vorarbeiter in einer Maschinenfabrik und verdiente gut. Jenny hatte einfach Glück.
Clara klopfte und öffnete die Tür, trat in die Küche, stockte. Gewöhnlich, wenn sie kam, um auf die Kinder aufzupassen, war Heinrich schon weg, aber nun saß er am langen Küchentisch, rauchte eine Pfeife und las Zeitung. Und ausgerechnet heute hatte sie Lisa dabei, wo sie doch gar nicht wusste, ob es ihm recht war, dass sich zwei an seinem Tisch satt aßen!
Unsicher grüßte sie den großen Mann und sagte dann zu Jenny gewandt, die – schon in ihrem guten schwarzen Kleid, aber mit vorgebundener Schürze – am Spültisch stand: »Ich hab heute Lisa mitgebracht, wenn es dir recht ist. Sie muss noch Hausaufgaben machen und daheim hat sie nicht so die Ruhe. Und wir teilen uns das Essen, aber wir essen auch nicht mehr als sonst ich allein.«
»Quatsch nicht!«, erwiderte Jenny, ohne das Abspülen zu unterbrechen. »Das Essen reicht für euch beide, Sauerkraut und Kartoffelbrei, eine Blutwurst, eine Leberwurst und auch noch ein Stück Bauchspeck. Ihr könnt alles aufessen. Einer meiner Kostgänger hat heut Mittag nicht so den rechten Appetit gehabt, hat wohl gestern zu tief ins Glas geschaut.« Sie lachte.
»Das kannst du laut sagen«, stimmte Heinrich zu. »Ich predige ihm immer, er soll keinen Schnaps saufen, mit der Branntweinsteuer unterstützt er den Klassenstaat! Aber das ist in diesen Schädel nicht reinzubekommen, wahrscheinlich hat er sich sein bisschen Grips schon weggesoffen. Wir sollten uns nach einem Ersatz für ihn umsehen, Jenny. Einen guten Genossen.«
»Das wäre mir recht«, sagte Jenny. »Aber das ist deine Sache. Bring du mittags aus deiner Fabrik zum Essen mit, wen du für richtig hältst. Hauptsache nur, er zahlt pünktlich und benimmt sich. Ich will keine Zoten, wegen dem Kleinen. Wenn ich denke, was ich als Kind alles mit anhören musste, als ich daheim in der Gastwirtschaft bedient habe – das sollen meine Kinder nicht hören. Nur wenn die Sozis heimlich bei uns getagt haben, da hab ich gern die Ohren gespitzt.«
Heinrich nickte. »Sag ich doch: einen guten Genossen. Ich hab da auch schon einen im Auge. Der liest pünktlich den Vorwärts und ist auch sonst sehr gebildet, den halben Faust kann der auswendig.«
»Die halben Weber wären mir lieber«, antwortete Jenny.
»Hast auch recht«, stimmte er zu. »Ich werd es ihm ausrichten. Na also, dann will ich mal, nicht dass ich noch zu spät zur Versammlung komme. Schön, dass du da bist, Clara, und du auch, Lisa. Sonst könnte meine Jenny nicht in ihre Arbeiterinnenschule, und dann ist die ganze Woche nichts mit ihr anzufangen, so sauer ist sie dann.« Er grinste und gab Jenny einen schallenden Kuss.
»Es sei denn, du würdest mal zu Hause bleiben und auf deine Kinder aufpassen«, meinte Jenny.
»Also hör mal!«, erregte er sich und zog die Augenbrauen zusammen. »Du weißt genau, mein Abend gehört der Partei! Soll ich etwa mit den Kindern zu Hause sitzen, Schlaflieder singen und Windeln wechseln?«
»Warum nicht?«, fragte Jenny und sah ihn herausfordernd an.
Clara hielt den Atem an. Was die sich traute, ihre Freundin! Einem Mann wie Heinrich eine solche Antwort zu geben!
Heinrich lief rot an. Doch ehe er explodierte, fuhr Jenny seelenruhig fort: »Eines Tages, in der klassenlosen Gesellschaft, auf die wir alle warten, eines Tages sind alle Menschen gleich! Du kennst doch deinen Bebel: Frau und Arbeiter haben gemein, Unterdrückte zu sein. Dem Sozialismus gehört die Zukunft, das heißt in erster Linie dem Arbeiter und der Frau. Wenn dann aber Männer und Frauen wirklich gleich sind – vielleicht wickeln dann die Männer genauso die Kinder wie die Frauen und bleiben auch mal zu Hause bei ihnen, damit die Frauen im gleichen Maß an gesellschaftlicher Produktion teilhaben können wie sie.«
Heinrich schnappte nach Luft. Gleich geht er an die Decke, dachte Clara, merkt Jenny das nicht?
Doch diese hatte sich in Fahrt geredet: »Aber bis dahin müssen wir eben noch kämpfen gegen den Klassenstaat und das Kapital: für die Befreiung des Proletariats, wir proletarischen Frauen und Männer gemeinsam, Hand in Hand! Darum müssen wir Frauen uns politisch bilden – auch wenn man uns die politische Tätigkeit verbietet –, damit wir gerüstet sind für den Kampf an der Seite der Männer! Und deshalb muss ich jetzt in meine Arbeiterinnenschule!«
Heinrich brach in lautes Gelächter aus und gab Jenny einen derben Klaps. »Meine rote Jenny! Ich sag's ja! An der ist ein Revolutionär verloren gegangen! Na, dann bilde dich mal schön! Wer weiß, eines Tages führst du ein Agitationskomitee, hältst Reden vor Tausenden von Arbeiterinnen und schreibst Artikel für die Gleichheit! Und nun schönen Abend!« Noch einmal lachte er laut, dann nahm er Jacke und Mütze vom Haken und verschwand.
Ganz heimlich stieß Clara einen erleichterten Seufzer aus. Jenny aber band sich die Schürze mit einer Gelassenheit ab, als hätte sie nicht eben beinahe einen Ehestreit provoziert. Manchmal konnte Clara über ihre Freundin im Stillen nur den Kopf schütteln. Hoffentlich trieb die es eines Tages nicht zu weit …
Lisa nahm den kleinen Moritz auf den Schoß und begann ihm das Märchen von Hänsel und Gretel zu erzählen. Er hörte ihr atemlos zu.
»Was für ein Bild«, sagte Jenny leise zu Clara und schaute voller Rührung auf die beiden Kinder, »der dunkle Haarschopf und die blonden Locken.«
»Und wie trügerisch«, gab Clara mit plötzlicher Bitterkeit zurück und dachte an die Striemen auf Lisas Händen. Sie musste besser darauf aufpassen, dass die Mutter der Schwester die nötige Zeit für die Schule ließ. Wenn die Mutter nur nicht so beschränkt wäre!
Und wenn der Vater nicht jeden Abend beim Unterirdischen Paule einkehren und dabei fast seinen halben Lohn versaufen würde! Dann müsste die Mutter nicht so viel Heimarbeit annehmen, dass sie auf Lisas Mitarbeit angewiesen war …
»Also, ich muss dann los«, erklärte Jenny. »Du weißt ja Bescheid. Und lasst es euch schmecken! Stine hab ich grad vorhin gestillt und trockengelegt, wenn du Glück hast, gibt sie Ruhe, bis ich wiederkomme. Und verwöhnt mir den Moritz nicht zu sehr!« Sie gab dem Jungen einen Kuss, nahm ihr Schultertuch und das Bündel mit ihren Büchern und weg war sie.
Das Abendessen war ein Festmahl, wie sie es daheim nicht einmal vom Sonntag kannten. Clara teilte die Würste und den Speck und achtete darauf, dass die Schwester die größeren Teile bekam. Wie sich Lisas Wangen beim Essen vor Begeisterung röteten!
Während Lisa für den Religionsunterricht sechs Strophen eines Gesangbuchliedes auswendig lernte, brachte Clara in der Schlafkammer Moritz zu Bett und erzählte ihm eine Geschichte von Rübezahl, die der Dorfschullehrer daheim in Schlesien oft vorgelesen hatte. Dann schaute sie noch einmal in die Wiege zu der friedlich schlummernden Stine. Auch Moritz waren die Augen schon zugefallen. Einen Augenblick ließ Clara die Stille dieses Raumes tief in sich eindringen.
Kinderbett, Wiege, die beiden in die Ecke geschobenen Ehebetten, der Kleiderschrank, die Kommode unter dem Fenster – jeder Winkel war ausgefüllt. Die rötlich-braunen Möbel glänzend poliert, das Bettzeug auf Jennys und Heinrichs Bett sorgfältig aufgeschüttelt und glatt gestrichen, eine Vase mit Wachsblumen auf einem Häkeldeckchen auf der Kommode. Wie schön das alles war. Und ein Bett für jeden für sich allein! Was für ein Glück … Noch einen sehnsüchtigen Blick ließ sie durch die Kammer schweifen, dann drehte sie die Lampe aus und ging in die große Wohnküche zurück.
Sie setzte sich auf das Sofa und stopfte sich ein Kissen hinter den Rücken. So ließ es sich doch viel gemütlicher nähen als daheim auf dem Stuhl! Lisa saß am Tisch und schrieb. Nicht einmal das Stampfen der Fabrik im Nachbarhof, das auch in der Nacht nicht abbrach, konnte die Ruhe stören, die Clara empfand. Als die Schwester ihr Heft zuklappte und ganz selbstverständlich nach der Nähnadel griff, schüttelte Clara den Kopf. »Nein, Lisa! Du gehst jetzt schlafen. Sag der Mutter, ich mache die Schals fertig. Du musst dich endlich einmal ausschlafen, du bist noch so jung.«
Lisa umarmte sie stürmisch, drückte den Kopf an Claras Wange. »Du bist so lieb!«, flüsterte sie dicht an Claras Ohr.
»Ach was!«, erwiderte diese und schob sie von sich. »Geh!« Aber die Haare der Schwester meinte sie noch lange an ihrer Wange zu fühlen, als Lisa längst verschwunden war.
Der weitere Abend verlief in gleichförmiger Ruhe. Keines der beiden Kinder verlangte nach ihr. Einen Schal nach dem anderen nahm Clara sich vor und vernähte die Schuss- und Fadenbrüche. Nur einmal machte sie eine kurze Pause, trank ein Glas Wasser und ging mit der Lampe in der Hand in die gute Stube – bloß um diesen Reichtum zu genießen. Die Stube war nicht geheizt, denn nur sonntags und zu festlichen Gelegenheiten wurde sie genutzt, Schonbezüge lagen auf dem Sofa mit der hohen Rückenlehne, auf den Sesseln und den Polsterstühlen. Dennoch war dieser Raum mit seinen gehäkelten Stores und seinen dunkelroten Gardinen der Gipfel der Schönheit. Sie betrachtete Jennys gutes Porzellan hinter den Glastüren des Büfetts, fuhr mit den Fingern die gedrechselten Säulen und geschnitzten Ornamente dieses eindrucksvollen Möbelstücks nach, zog die kleine Spieluhr auf und blieb vor den gerahmten Fotos an der Wand stehen: Jenny und Heinrich als Brautpaar unter einer Samtportiere, daneben das Bildnis von Karl Marx und – mit einer vertrockneten Rosengirlande umkränzt – von noch einem eindrucksvollen Herrn mit mächtigem angegrauten Bart, an dessen Namen sie sich nicht genau erinnerte, obwohl ihr Jenny von dem erzählt hatte. Hieß er nicht Engel? Mit einem Seufzer riss sie sich schließlich von der Pracht dieses Raumes wieder los und kehrte in die Küche zu ihrer Näherei zurück.
Als Jenny gegen zehn Uhr heimkam, wartete immer noch ein Dutzend Schals darauf, vernäht zu werden. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, setzte die Freundin sich zu ihr an den Tisch und beteiligte sich an der Arbeit.
»Sag mal«, begann Jenny mit spürbarem Zögern, »bekommt denn nun diese Anna Brettschneider ihre Nähmaschine?«
»Das hoffe ich schon«, erwiderte Clara und gab einen ausführlichen Bericht darüber, wie sie die Fremde zu Annas Kellerwohnung gebracht hatte.
Jenny seufzte erleichtert auf. »Und ich hatte schon befürchtet, ich hätte die wohltätige Dame so vergrault, dass sie wieder umgekehrt wäre, und meinetwegen ginge nun die arme Frau leer aus«, gestand sie. »Manchmal geht wohl der Gaul mit mir durch.«
Clara lachte. »Das kann man wohl sagen!«
»Aber recht hatte ich doch!«, beharrte Jenny und stimmte in das Lachen ein. Nebenan weinte Stine. Kaum war Jenny in der Kammer verschwunden, um die Kleine zu stillen, da klopfte es leise und verstohlen an der Küchentür.
Verwundert öffnete Clara und sah sich einer ihr unbekannten Frau in einem abgewetzten Wintermantel gegenüber, die sich ängstlich umblickte und hastig in die Küche drängte. »Ist Jenny nicht da?«, fragte sie gehetzt.
»Doch, schon. Sie stillt gerade. Setzen Sie sich doch!«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ich muss mit Jenny reden! Es ist dringend!«
Eine solche Angst sprach aus dem fremden Gesicht, dass Clara in die Kammer ging und Jenny Bescheid sagte. Mit dem Säugling an der Brust kam diese in die Küche. »Gerda! Was ist passiert?«
Nun endlich ließ die Frau sich auf den Stuhl fallen. »Eine Razzia«, erwiderte sie erregt. »Die Polizei führt eine Razzia durch. Und zu mir kommt sie bestimmt auch und ich hab doch die Bücher und …« Vor Aufregung konnte Gerda nicht weitersprechen.
»Bei wem waren sie schon?«
»Bei Ottilie Baader und bei Emma Ihrer und ich weiß nicht, bei wem noch«, antwortete Gerda nach Atem ringend. »Es geht gegen das Frauenagitationskomitee. Dabei ist es doch von Rechts wegen erlaubt, eine Frauenagitationskommission zur Vorbereitung auf eine öffentliche Versammlung zu gründen, und wir haben immer aufgepasst, der Polizei keinen Anhalt für die Behauptung zu geben, dass wir ein politischer Verein wären, damit sie uns nicht verbieten können. Aber anscheinend haben die Volksversammlungen, in denen Bebel, Liebknecht, Ihrer und Baader für die Rechte der Frauen gesprochen haben, viel Staub aufgewirbelt und nun wittert die Obrigkeit wieder einmal den Umsturz. Ottilies Vater hat unbemerkt einem Nachbarjungen einen Zettel für mich zustecken können, der Junge hat ihn zu mir gebracht. Ich habe doch die Bücher mit den Mitgliedern und den eingezahlten Beiträgen, wenn das der Polizei in die Hände fällt, nicht auszudenken!«
Jenny nickte. »Das muss verschwinden«, sagte sie nüchtern. »Hast du die Bücher dabei?«
Gerda klopfte sich an die Brust. Dann knöpfte sie ihren schäbigen Mantel auf und holte zwei dicke Hefte hervor, legte sie auf den Küchentisch.
Jenny sah die Hefte mit gerunzelter Stirn an. »Bei mir sind sie auch nicht sicher«, sagte sie nachdenklich. »Es ist bekannt, dass ich in die Arbeiterinnenschule gehe und meine Beziehungen zu dem Frauenagitationskomitee habe und bei keiner Volksversammlung fehle, wo es um Frauenfragen geht. Bei einigen Versammlungen habe ich sogar was gesagt – und die Polizei hat natürlich alles mitgeschrieben, bestimmt auch meinen Namen, darauf kann man Gift nehmen. Und Heinrich ist in der Partei und in der Gewerkschaft und Gott sei Dank auch keiner, der den Mund hält.« Nachdenklich strich sie über das Köpfchen ihrer kleinen Tochter, die von aller Aufregung unbeeindruckt an Jennys Brust nuckelte. Dann schaute Jenny Clara an.
Clara wurde heiß. Sie begriff, was die Freundin wollte, ohne dass diese es aussprechen musste. Und sie begriff, dass sie, würde sie zustimmen, in etwas hineingezogen würde, was sie nicht überblickte. Was verstand sie schon von Politik!
Sie war noch nie bei einer Volksversammlung gewesen, sie las keine Zeitung und sie wollte mit der Polizei nichts zu tun haben.
Und wenn es herauskam, dann zog sie auch noch ihre Familie hinein, und wenn sie verurteilt wurden, dann mussten sie alle ins Gefängnis, denn das Geld, eine Strafe zu zahlen, hätten sie nicht.
Aber Jenny sah sie an. Und nun auch Gerda.
Clara schluckte. Ihr Hals war trocken und rau.
»Bei euch würde keiner die Bücher vermuten«, sagte Jenny leise. »Dein Vater ist nicht in der Partei. Heinrich sagt, dein Vater redet nicht einmal am Stammtisch über Politik – und wenn, dann für das Zentrum. Und deine Mutter und du – ihr seid völlig unbeschriebene Blätter. Bei euch wäre es sicher.«
»Bitte!«, flehte Gerda. »Bitte!«
Da nickte Clara und schob die Hefte zwischen die Kaschmirschals, schlug das Tuch um den Packen, stand auf und nahm ihn sich unter den Arm. »Dann bring ich sie jetzt lieber weg«, sagte sie mühsam. Und wusste, sie würde es bereuen.