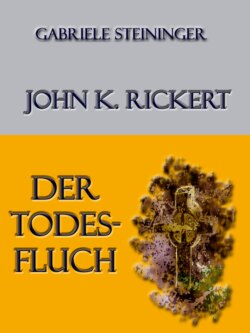Читать книгу John K. Rickert - Gabriele Steininger - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеEine zornige Grünfärbung breitete sich auf Elisabeth Conners Gesicht aus, als Bernard die Akte zuklappte. Die herrschende Stille, seit er seinen letzten Satz beendet hatte, hing unheimlich und unheilschwanger im Raum. Er richtete den graubraunen Papphefter an der Kante seines Schreibtisches aus, während er auf eine Reaktion wartete.
"Soll das heißen, dass alles was meiner Schwester gehört hat einzig und allein ihr bescheuerter Nichtsnutz von einem Ehemann bekommen soll?", fuhr sie den Anwalt giftig an. Sie hatte sich dabei vor dem bequemen Sessel aufgerichtet, auf dem sie bis zu dieser Minute gesessen hatte. Sich mit geballten Fäusten auf der Mahagoniplatte abstützend, fixierte ihr zorniger Blick den Anwalt. Matthew, ihr Mann, versuchte sie vergebens zu beruhigen.
"Es tut mir leid, Misses Conner." unterbrach Bernard den aufgebrachten Redefluss seiner Mandantin. "Doch so wie die Gesetzeslage nun einmal ist, sieht es ganz so aus. Sie können dieses Testament zwar anfechten, jedoch ist es meine Pflicht ihnen zu sagen, dass ihre Aussichten auf Erfolg gleich Null sind. Ersparen sie sich die Aufregungen einer Verhandlung und die Kosten, die dadurch entstehen werden. Das ist der einzige Rat, den ich ihnen als ihr Anwalt geben kann."
Elisabeth sank mit einem verhärmten Gesichtsausdruck zurück in den Sessel. Etwas weniger grün im Gesicht, die Lippen fest aufeinander gepresst, starrte sie auf die Papiere, die Bernard dem Paar über den Tisch hinweg reichte. Matthew griff nach dem Umschlag und stand auf.
"Danke, Mister Burgauer. Danke für die Mühe, die sie sich unseretwegen gemacht haben." Vorsichtig zupfte er seine Frau am Mantelärmel, um sie zum Aufstehen zu bewegen. Elisabeth Conner saß wie festgeklebt auf dem Sessel. Bewegungslos, als hätte man sie für die Ewigkeit eingefroren blickte sie starr vor sich hin. Es musste ein Schock für sie gewesen sein, als sie von ihrer Enterbung erfahren hatte, der jetzt durch die Hilflosigkeit, nichts dagegen tun zu können, zum Tragen kam. Ihr Mann setzte ein verlegenes Lächeln auf und zuckte unbeholfen mit den Schultern. Bernard schenkte ihm einen verständnisvollen Blick.
"Komm Darling. Es ist nun einmal so wie es ist. Gehen wir nach Hause." versuchte er erneut sein Glück.
Elisabeth Conner erhob sich immer noch schweigend und bleich von dem Sitzmöbel. Mit erkennbarem Unwillen folgte sie ihrem Mann zur Tür. Bernard brachte die beiden zum Ausgang und verabschiedete sich.
Der Wartebereich der Kanzlei war leer. Lucy White tippte auf ihrer Tastatur. Hinter unzähligen Ordnern versteckt, die auf der Empfangstheke thronten, bewies lediglich das Klackern ihre Anwesenheit. Oft hatte er sich schon gefragt wie seine Angestellte, bei dem oftmals schwierigen Klientel, so gelassen und ruhig bleiben konnte. Es war ihm über die Zeit nicht entgangen, dass sie oftmals für unerfüllte Erwartungen seiner Mandanten verantwortlich gemacht worden war. Die übervolle Theke, die ihm schon den ganzen Tag aufgefallen war, irritierte ihn. Seine Angestellte hatte immer vieles zu bearbeiten und es war nicht selten, dass sich dort vier, oder mehr Ordner stapelten. Diese Masse besaß allerdings das Ausmaß eines ganzen Schrankfaches.
"Lu?" Bernard wartete, bis das Geräusch der Tastatur verebbte.
"Bernard?", ertönte die sanfte Frauenstimme der jungen Empfangsdame.
"Was machen all diese Ordner auf der Theke?"
"Ich musste kurzzeitig umstrukturieren." lautete die Antwort hinter der Papiermauer. "Keine Sorge, bis heute Abend sind sie wieder weg." setzte Lucy nach, als Bernard nichts verlauten ließ. Diese Antwort genügte ihm. Er kam sich ein bisschen dumm vor, nach den Ordnern gefragt zu haben. Wenn Lu etwas machte, dann hatte sie auch einen triftigen Grund.
"Liegt heute noch irgendein Termin an?", erkundigte er sich stattdessen.
"Die Kanzlei betreffend nicht. Misses Miller hat abgesagt. Zum vierten Mal übrigens. Sie will sich mit ihrem Mann jetzt doch wieder versöhnen."
"Eine sehr unschlüssige junge Frau, nicht wahr?", bemerkte Bernard.
"Einen Termin haben sie aber doch noch. Den dürfen sie auf keinen Fall versäumen."
"Ach ja?", fragte er.
Aber ja! Johns Geburtstag."
"Herrje, den hätte ich fast vergessen." stöhne Bernard. Lucy erinnerte ihn täglich seit einer ganzen Woche, trotzdem entfiel er ihm immer wieder. Hastig blickte er zur Uhr.
"Schon so spät und ich weiß immer noch nicht, was ich ihm schenken soll."
"Es ist im Schrank." sagte Lucy und fing wieder an zu tippen.
"Im Schrank?" Bernard begriff nicht sofort was sie damit meinte. Lucy unterbrach ihre Arbeit erneut. Sie verließ den Turm aus Ordnermauern und holte ein aufwendig verpacktes Geschenk aus dem Schrank.
"Das Geburtstagsgeschenk für John." sagte sie und drückte ihrem Boss das wuchtige Paket in die Hand.
"Lu, sie sind ein Engel." Über das ganze Gesicht strahlend sah er sie neugierig, mit hochgezogenen Augenbrauen an.
"Was ist denn in dem Paket?"
"Na, das müssen sie doch wissen, Bernard. Immerhin ist es ihr Geschenk." zog sie ihn auf.
"Lu, bitte. Ich muss doch wissen, was ich ihm schenke? Verraten sie es mir doch." bat er.
"Na gut. Es ist ein Wollbinger." Bernard traf ein erwartungsvoller Blick seiner Angestellten, die einen gespannten Ausdruck im Gesicht hatte.
"Ein was?", fragte der Anwalt irritiert.
"Ein Wollbinger." wiederholte Lucy. "Sie wissen doch, diese komischen Viecher aus Bayern. Die aus allen möglichen anderen Tieren zusammengesetzt sind." Bernard lachte.
"Ein Wolpertinger! Wie ist es denn zu diesem grandiosen Einfall gekommen?", wollte er wissen.
"John schwärmt immer von Bayern, wenn er sich mit mir unterhält. Da habe ich gegoogelt, was dort denn so an Besonderheiten existiert."
"Das ist genial Lu. Ein Geschenk, das ihm mit Sicherheit gefällt."
"Es ist allerdings kein Echter. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, tote Tiere sind mir zuwider. Egal in welcher Form. Er ist aus Kunstharz." gestand Lucy.
"John wird das nicht stören, da bin ich mir ziemlich sicher." erwiderte Bernard. "Kommen sie, wir machen Schluss für heute. Eine Tasse Kaffee und ein Geburtstagskind warten auf uns." Lucy ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie schaltete den PC aus und packte die Ordner wieder in den Schrank.
"Fünfunddreißig, ist wirklich keine schöne Zahl." bemerkte John. Auf dem Geburtstagskuchen, von Lucy selbst gebacken, prangten zwei Zahlenkerzen. Der Wolpertinger hatte einen Ehrenplatz auf dem Fensterbrett bekommen, wo er neben einem verdorrenden Weihnachtskaktus erhaben dem Kaffeeklatsch lauschte. Lucy blieb nicht lange und verabschiedete sich bereits nach einer Tasse Kaffee. Bernard und John wurden in der Detektei von ihr zurückgelassen.
"Sie hatte es aber eilig heute weg zu kommen." bemerkte Bernard.
"Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man ihre derzeitige Situation betrachtet." warf John ihm entgegen.
"Wie meinst du das?" John sah seinen Freund tadelnd an.
"Ist dir die letzte Zeit nichts an ihr aufgefallen?", fragte er zweifelnd.
"Nein. Ich wüsste nicht was." gestand Bernard.
"Die neuen Kleider? Die Aufmachung? Die Kette?", gab John ihm Hinweise.
"Welche Kette?", fragte er.
"Manchmal bist du wirklich schwer von Begriff, Bernard Burgauer." lachte John. "Lu hat einen Freund und das seit einigen Wochen." Verdutzt sah Bernard ihn an.
"Davon hat sie mir nichts gesagt."
"Marc ist ja auch ihre Privatsache. Egal wie eng ihr miteinander arbeitet, du bist immer noch ihr Arbeitgeber." John stellte die Kuchenteller und die inzwischen leeren Kaffeetassen in den hinteren Raum, der mit einer kleinen Kaffeeküche ausgerüstet war.
"Aber dir hat sie von ihm erzählt?", fragte Bernard erstaunt und ein wenig beleidigt.
"Nein. Das muss sie auch nicht. Der Herzanhänger mit seinem Namen an ihrem Hals hat mir das verraten." John blickte zur Uhr, als er wieder im Büro stand.
"Heute wird wohl niemand mehr meine Dienste in Anspruch nehmen." stellte er fest.
"Was stellen wir dann heute noch an?", fragte Bernard.
"Ich hätte gute Lust den heutigen Abend in einem Pub zu verbringen. Mit Musik und einem guten Beamish, oder auch zwei." Er zwinkerte Bernard aufmunternd zu. Pubs waren keine Leidenschaft des Anwaltes und es brauchte meist enorme Überredungskunst ihn in eines der gemütlichen, verrauchten Wirtshäuser zu entführen.
"Was hältst du von Doheny & Nesbitt? Ich bezahle natürlich." schlug Bernard unerwartet vor.
"Abgemacht. Lass uns dort hingehen." sagte John freudig erstaunt über dieses Angebot.
Das Lokal war gut besucht. John und Bernard fanden dennoch einen Platz an der hintersten Ecke der langen Theke. Ein Mann fiel John sofort nach Betreten des Pubs auf. Er saß zwei Plätze weiter, ebenfalls an der Bar und schüttete sich ein Guinness nach dem anderen in den Kopf. Seine kräftige Statur und das unrasierte Gesicht ließen auf einen Hafenarbeiter schließen. Seine Hände schlossen diese Vermutung zu hundert Prozent aus.
"Sieh mal!", Bernard stieß seinen Freund an. "Die Frau, die dort in der Tür steht, die war heute mit ihrem Mann in meiner Kanzlei." Elisabeth Conner sah sich kurz um und hielt mit zielstrebigen Schritten auf den Guinnessliebhaber zu. Matthew folgte ihr sichtlich unwillig in einigem Abstand. Wild gestikulierend redete sie auf den offensichtlich Betrunkenen ein. Dieser ließ sich das nicht gefallen und erwiderte etwas, was John und Bernard aufgrund des Lärmpegels in der Bar nicht verstehen konnten. Freundlich war die Unterhaltung nicht. Das konnte man an den Gesichtern der Streitpartner deutlich ablesen.
Unerwartet holte der Mann an der Bar aus und seine Hand landete in einer schallenden Ohrfeige auf dem Gesicht der Angreiferin. Matthew zog seine taumelnde Gattin zur Seite und versuchte sie zu verteidigen. Vollkommen in Rage, schlug der Guinnesstrinker auf ihn ein.
Bernard sprang von seinem Hocker auf, doch John hielt ihn am Ärmel zurück.
"Überlass das lieber Leuten, die dieser Situation gewachsen sind." warnte er ihn.
"Das kann ich nicht." sagte Bernard. "Sie sind Mandanten." Er eilte zu den Raufbolden, um die beiden voneinander zu trennen.
Der erste Schlag traf ihn an der Schulter, der zweite im Gesicht. Wankend glitt Bernard zu Boden und seine Welt verdunkelte sich.
"Hier, mein Freund. Für dein Auge." John hielt ihm ein Stück rohes Fleisch hin, welches in einem Gefrierbeutel verpackt war. Bernard, der in dem alten Ohrensessel in der kleinen Bibliothek saß, nahm das Päckchen dankbar entgegen.
"Ich dachte die Zeiten, in denen dich ein Mandat niederstreckt, seien ein für alle Mal vorbei." juxte der Detektiv.
"Das dachte ich auch." Bernards Gesicht verzog sich schmerzhaft, als er die Kühlung für sein Auge in eine neue Position rückte.
"Darf ich fragen, worum es bei den Conners ging?"
"Woher kennst du jetzt schon wieder ihre Namen?"
"Aus der Presse." erwiderte John. "Elisabeth und Matthew Conner. Schwester und Schwager der verstorbenen Mary O'Brian, geborene Headwick. Die Todesanzeigen, Bernard." half er ihm auf die Sprünge.
"Ah ja. Die Todesanzeigen. Und worauf begründest du, dass es sich bei den Personen im Pub um die Conners handelte?", fragte Bernard neugierig weiter.
"Du behandelst zu achtzig Prozent Scheidungsfälle. Diese beiden sahen nicht so aus, als würden sie sich scheiden lassen wollen. Daraus entnehme ich, dass sie wegen eines Erbschaftsfalles bei dir waren. Die Gerüchteküche brodelt, dass Mary O'Brian ihr gesamtes Vermögen ihrem Mann vermacht hat. Was ist naheliegender, als ein Besuch der gekränkten und übergangenen Schwester bei einem Anwalt für Erbrecht? Zumal den Conners finanziell das Wasser bis zum Hals steht."
"Die Gerüchteküche." brummte Bernard. Das Stück Fleisch war verrutscht und er versuchte es durch eine ungeschickte Bewegung aufzuhalten. Schmerzvoll verzog er das Gesicht. "Hervorragend kombiniert. Du hast Recht. Und wenn du schon so gut bist, kommst du mit Sicherheit selbst auf den Grund ihres Besuchs, was mir die Peinlichkeit nimmt, über meine Mandanten zu reden."
"Eine Anfechtung des Testaments?", riet John und sah seinen Freund dabei an. "Von der du ihnen natürlich abgeraten hast. Weshalb Misses Conner dich auch nicht gesehen hat, oder sehen wollte. Nicht einmal, als du dich zwischen ihren Mann und ihren Widersacher geworfen hast." erinnerte er ihn.
"Ich sage einfach mal nichts dazu." resignierte Bernard, der nun endgültig den Versuch aufgab, seine Augenkühlung alleine mit der Kopfhaltung auszujonglieren.
"Das musst du auch nicht. Denn es beantwortet zugleich die Frage, wer der Betrunkene an der Bar war." grinste John.
"Wer war denn der Betrunkene?"
"Ich denke, es gibt nur einen Menschen, auf den Elisabeth Conner wütend genug ist, um ihn in aller Öffentlichkeit zu denunzieren." Er macht eine bedeutungsvolle Pause. Achselzuckend hielt Bernard seinen Beutel auf dem Auge fest.
"James O'Brian." teilte John seine Erkenntnis, als sein Freund nicht verlauten ließ. "Der Mann, der zwischen ihr und der Erbschaft steht." Das Steak vom Gesicht des Leidenden nehmend fing er an zu lachen.
"Du musst den Beutel entfernen. Sonst hilft es nicht." Vorsichtig platzierte er das rohe Stück Fleisch auf dem verletzten Auge. Bernard gab angewiderte Geräusche von sich, wehrte sich aber nicht gegen die Verarztung.
"Und nicht auf den Boden fallen lassen! Das ist die Hälfte unseres Mittagessens." wies John ihn lachend an.
"Wie geht es deinem Auge?", fragte John zwei Tage später beim Frühstück, während er die Zeitung las. die komplette linke Augenpartie nebst Wangenknochen hatte eine bunte Färbung angenommen.
"Es tut noch weh. Zumindest ist die Schwellung zurückgegangen und ich kann wieder ein bisschen damit sehen. Was ich allerdings nie verstehen werde, warum man sich widerliches rohes Fleisch auf ein blaues Auge legt."
"Weil es hilft, Bernard." lachte John.
"Das hier wird dich vielleicht ein wenig aufmuntern." meinte er und begann ihm aus der Zeitung vorzulesen.
"Geist der Verstorbenen spukt bei den O'Brians! Augenzeugen berichten in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober den Geist von Mary O'Brian auf dem Anwesen der Familie gesichtet zu haben. Die Chronik des Clans erzählt von ähnlichen Fällen, in denen Mordopfer der Familie, durch einen Todesfluch geweckt, nach ihrem Tod erschienen sind. Drei Nächte, die in ihrem Leben eine Bedeutung hatten, suchten sie den Ort ihres Todes auf, um ihrem Mörder sein Ende anzukündigen. Darf man den Legenden Glauben schenken, stirbt dieser in der dritten Nacht einen mysteriösen Tod. Wurde Mary O'Brian ermordet, oder starb sie wie bekundet an Herzversagen? Warum ist sie in der Nacht ihrer ersten Verabredung mit ihrem Mann erschienen? Wer sprach den Todesfluch und wird das Opfer ihren Mörder holen? Oder sind es nur Geistergeschichten. Wir werden es herausfinden. Bleiben sie dran!"
"Welches Schmierblatt ist denn das?", fragte Bernard.
"Och, ich würde sagen eines, das du noch nie gerne gelesen hast." John schmunzelte ihn über den Rand der Zeitung hinweg an.
"Gut, dann will ich es auch nicht wissen." erwiderte Bernard.
"Chroniken und Familienlegenden besitzen immer einen wahren Kern, auch wenn man diesen erst einmal entdecken muss, mein Freund."
"Trotzdem finde ich es nicht gut, eine ganze Familie so erscheinen zu lassen, als gäbe es nur Mörder unter ihnen. Genau das tut dieser Artikel. Vollkommen ohne Beweise aufgestellte Behauptungen. Das grenzt schwer an Rufmord, John." wandte er ein. "Mary O'Brian hatte von Geburt an einen Herzfehler. Der Arzt hat Herzversagen im Totenschein bestätigt. Auch wenn der Tod einer Frau von fünfunddreißig Jahren ein bedauernswerter Fall ist, so glaube ich doch nicht an Mord."
"Nun, vielleicht gibt es noch keinen Mord, Herr Anwalt. Aber irgendetwas sagt mir, dass es einen Mörder gibt. Nenne es Intuition oder Bauchgefühl."
"Du glaubst nicht, wer heute in meiner Kanzlei war." begann Bernard, als er die Wohnung betrat.
"Der Geist von Mary O'Brian?", scherzte John.
"Nein. Oder vielleicht so ähnlich. James O'Brian."
"Und was wollte James O'Brian von dir?", erkundigte sich John.
"Zunächst hat er sich bei mir entschuldigt. Dann aber hat er ein paar sehr seltsame Andeutungen über Marys Tod gemacht." John wurde hellhörig.
"Seltsame Andeutungen?", wiederholte er interessiert.
"Ja, seltsame Andeutungen. Zum Beispiel meinte er, es gäbe schon einen Grund, warum der Geist seiner Frau gesehen worden wäre."
"Inwiefern?"
"Das hat er mir nicht gesagt. Nur, wie überraschend es gekommen wäre, das Mary gestorben sei. Zudem erkundigte er sich über die möglichen Vorgehensweisen, wenn jemand den Verdacht hätte, jemand anderes sei ein Mörder."
"Was hast du geantwortet?" Auf der Chaiselongue aufgerichtet lauschte John interessiert Bernards Worten.
"Ich habe ihn zur Polizei geschickt." erwiderte er.
"Du hast ihn zur Polizei geschickt." wiederholte John feststellend. "Was auch sonst."
"Ja, ganz recht. Was auch sonst?"
"Wahrhaftig der Rat eines Anwaltes." Der Detektiv schüttelte ungläubig den Kopf. "Hat er wenigstens noch erwähnt, wen er in Verdacht hat und um welchen Mord es sich handelt?"
"John, was soll das? Es gibt keinen Mord. Nur einen zurück gelassenen, trauernden Mann, der den Tod seiner Frau in dieser kurzen Zeit einfach noch nicht akzeptieren kann."
"Bernard, nur weil es keinen offiziell anerkannten Mord gibt, heißt das nicht, dass kein Mörder frei herumläuft."
"Ich hege den Verdacht, du beschäftigst dich im Moment mit sehr langweiligen Aufträgen." schlussfolgerte Bernard, womit er Recht behalten sollte. John schlug sich die letzten Monate mit untreuen Ehemännern herum, die zu beschatten immer das gleiche Ergebnis hatten. Weinende, schluchzende Ehefrauen, die unglücklich in seinem Büro saßen und ihm die Unterlagen einnässten. Die einen, weil es sie ernsthaft traf betrogen zu werden, die anderen, weil sie nicht betrogen wurden und deshalb über die eigene Schlechtigkeit losheulten, ihren Liebsten verdächtigt zu haben. Für all diese Frauen hatte John ein offenes Ohr und eine Großpackung Papiertaschentücher. Die einen schickte er zwei Türen weiter zu Bernard in die Kanzlei, die anderen nach Hause.
"Ja. Es stimmt. Meine Arbeit ist im Moment zwar sehr lukrativ, allerdings auch sehr eintönig." gab er zu.
"Ich könnte dir einen meiner Krimis ausleihen." Bernard lächelte ihn an.
"Nein Danke. Ich glaube nicht, dass sich ständig wiederholende Einfachschemata meinen Affinitätsbereich erobern werden."
"Diese hochgestochene Ausdrucksweise steht ihnen nicht, Mister Rickert." lachte Bernard.
"Wer beerbt eigentlich James O'Brian? Ich meine für den Fall, ihm würde etwas zustoßen?", fragte John, ohne weiter auf das Angebot weiter einzugehen.
"Nun, ich denke seine Familie. Brüder und Schwestern sofern vorhanden. Seine Frau und seine Eltern sind ja leider bereits tot. Soviel ich weiß hatte er auch keine Kinder, denen er etwas hinterlassen könnte."
"Würde auch Elisabeth Conner etwas erben?", hakte John weiter nach.
"Das kommt sehr auf die Formulierung seines Testaments an. Wenn er allerdings keines hat, geht sie leer aus. Dann tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft."
Der Notar, Samuel Wilson wusste um die Flatterhaftigkeit von James O'Brian, wenn es darum ging, das Testament zu ändern. Es reichte ihn zu verärgern und schon flog man aus der Erbfolge, um wenig später nach der Versöhnung wieder zu den Nutznießern seines Ablebens zu gehören. Doch dieses Mal war es anders. James bekam keinen seiner impulsiven Anfälle, als er Wilson seine Entscheidung mitteilte. Auch die sonst so explosive Erläuterung, mit der er üblicher Weise in solchen Fällen den Grund angab, fehlte an diesem Tag. James wirkte in sich gekehrt und verdächtig ruhig. Das komplette Gegenteil des Mannes, den er bei der Änderung seines letzten Willens gegenüber sitzen hatte.
"Darf ich fragen, warum sie ihre Schwester von der Erbfolge ausschließen wollen?"
"Das ist meine Sache." erwiderte James knapp.
Samuel druckte das neue Testament aus und schob es James zur Unterschrift hin. Ohne noch einmal inne zu halten unterschrieb er das Dokument mit einem verbitterten Gesichtsausdruck und verabschiedete sich rasch und kurz angebunden.
In seine Auffahrt einbiegend fiel James ein kleiner Bus vor seinem Haus auf. Der Schriftzug an den Seiten verriet ihm die Belagerung seines Hauses durch Reporter des 'Mystical Prophet'. Die Geistergeschichten über die Familienchronik der O'Brians, nebst alten Schauermärchen, die sich um das Anwesen rankten und Marys Tod hatten ihre Wirkung im Dorf nicht verfehlt. Kaum jemand redete noch mit ihm, dafür redete die versammelte Gesellschaft über ihn. Sie hielten ihn für den Mörder seiner eigenen Frau. Alles nur, weil diese alte Schachtel von nebenan behauptete, Marys Geist zwischen den Pappeln wandeln gesehen zu haben. In der Eingangshalle angekommen, vernahm er die Stimme seiner Haushälterin, die vehement verneinte Mary ebenfalls gesehen zu haben.
"Das hätte mir doch wohl auffallen müssen, wenn Mary O'Brian hier im Haus spuken würde. Schließlich wohne ich hier." verkündete ihre aufgeregte Stimme, bis in den Eingangsbereich des Hauses gut hörbar.
"Es gibt aber einen Augenzeugen, der den Geist der Verstorbenen gesehen hat." erwiderte ein Mann. James O'Brian kam langsam näher an die Quelle des Gespräches. Mit jedem Schritt steigerte sich sein Zorn.
"Celeste Brown ist ein altes, halb blindes Muttchen. Sie sieht kaum Dinge, die sich direkt vor ihrer Nase befinden. Wie zum Donner soll sie über einen halben Kilometer weit gesehen haben, was sich in unserem Garten bewegt?" Misses Kinley wurde wütend. Auch sie litt unter den neuerlichen Ereignissen. Kaum ein Tag war vergangen, an dem sie nicht auf die Geisterscheinung ihrer verstorbenen Arbeitgeberin angesprochen wurde.
"Woher wollen sie denn wissen, dass es sich bei der Augenzeugin um Celeste Brown handelt?", wollte der Mann von der Presse wissen.
"Weil es sonst niemanden gibt, der sich solch eine haarsträubende Geschichte ausdenken würde." konterte die Haushälterin.
"Die Vergangenheit dieses Hauses erzählt uns aber eine andere Geschichte, Misses Kinley. Es ist eine Tatsache, dass hier immer wieder mysteriöse Todesfälle passiert sind."
"Solche Geschichten werden sie beinahe über jedes größere Anwesen in ganz Irland finden, wenn sie nur tief genug graben."
James O'Brian betrat den Raum, in dem sich außer Misses Kinley und dem Redensführer noch ein weiterer Herr befand. Das Gesicht des Fragenstellers war jünger, als die Stimme es hätte vermuten lassen. Ein frecher, moderner Haarschnitt über einem frechen, jugendlichen Gesicht. Clubpullover und ausgewaschene Jeans, dazu nicht gerade saubere Turnschuhe. Der zweite Mann war wesentlich älter. Mit dem Anzug und der Krawatte wirkte er souverän. Genauso gut hätte er hinter dem Schalter einer Bank stehen können.
"Fragen wir doch ganz einfach den Hausherren." schwenkte der junge Mann das Gespräch auf James. "Was sagen sie, als Hauptfigur des Ganzen, zu den Vorwürfen?" Breit grinsend hielt er ihm das Diktiergerät unter die Nase, mit dem er zuvor schon Misses Kinley interviewt hatte. O'Brian stand mit geballten Fäusten vor dem Reporter. Er war blass und die Knöchel seiner Finger traten weiß hervor.
"Sie werden jetzt in den nächsten zehn Sekunden mein Haus verlassen." presste er aus zusammengebissenen Zähnen hervor.
"Würden sie uns sonst umbringen? So wie sie ihre Frau umgebracht haben?" Keck sah er Mister O'Brian direkt in die Augen. Das war zuviel für ihn. James O'Brians Geduld war zu Ende. Kurzerhand packte er den Reporter am Kragen und zog diesen unter heftigem Protest unsanft zur Haustür, wo er ihn hinausmanövrierte. Der Kollege des frechen, jungen Mannes folgte ihnen eilig. Er versuchte sich für das Benehmen seines Partners zu entschuldigen, der jetzt laut schimpfend auf dem Treppenabsatz stand.
"Es tut mir wirklich leid." versuchte er die Wogen zu glätten.
"Verschwinden sie!", brüllte James ihn an. "Verschwinden sie und lassen sie sich hier nie wieder blicken!" Mit lautem Krachen flog die Tür ins Schloss. Eine hitzige Debatte schien zwischen den Reportern loszubrechen. Der Streit entfernte sich von der Tür, an der James mit dem Rücken lehnte. Diese Aasgeier hatten einfach nicht den Anstand einen Trauernden in Ruhe zu lassen. Mary war noch keine vierundzwanzig Stunden unter der Erde und diese Menschen hatten nichts Besseres zu tun, als sich um Hirngespinste zu kümmern. Mary. Seine Mary. Ein tiefer Schmerz erfasste ihn. Weder den sich entfernenden Disput vor seiner Haustür, noch das Geräusch der Reifen auf dem Kies, welches der abfahrende Kleinbus verursachte, drangen in sein Bewusstsein. Auch die Frage der Haushälterin, ob sie den Lunch im Esszimmer servieren solle, ging an ihm vorüber. Tief in schmerzliche Gedanken versunken schritt er an ihr vorbei in die Bibliothek.
Misses Kinley bereitete ihm ein paar Sandwichs und brachte sie zusammen mit einer Tasse schwarzen Tees in die Bibliothek. Sie stellte die Köstlichkeiten vor ihm auf dem niederen Tischchen ab.
"Mister O'Brian, auch wenn sie nicht mit mir reden wollen, essen müssen sie doch etwas." Sie sah ihm dabei fest in die Augen. Als er nach geschlagenen zwei Minuten immer noch nicht reagierte, drehte sie sich seufzend um und wollte gehen. An der Tür des Raumes drehte sie sich noch einmal zu ihm.
"Kann ich ihnen irgendwie sonst helfen?", fragte sie mit einem mütterlichen Unterton in der Stimme.
"Wo sind eigentlich die anderen?", fragte er.
"Ihre Schwester ist mit Tessa zum Bummeln gefahren. Ihr Bruder und Tobias sind Essen gegangen und Edward scheint eine Verabredung zum Lunch mit einer netten jungen Frau zu haben."
"Die Ratten verlassen das sinkende Schiff." murmelte er vor sich hin.
"Wie bitte?", fragte Misses Kinley nach. Sie hatte ihn nicht verstanden.
"Nichts. Sie können gehen. Nehmen sie sich für den Rest des Tages einfach frei. Ich brauche sie heute nicht mehr und wenn die anderen etwas wollen, dann können sie es auch selbst tun." Die Haushälterin verließ das Zimmer. James brütete weiter vor sich hin. Er überlegte, ob er das Richtige tat, wenn er diesen Detektiv einschaltete.
"Was liest du da?", fragte John und betrat die kleine Bibliothek.
"Etwas, das du nie lesen würdest." gab Bernard spitzbübisch zurück.
"Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Krimi von diesem furchtbaren Autor." zog John ihn auf.
"Nein, ist es nicht. Es ist ein Krimi von einer Autorin. Ganz neu auf dem Markt."
"Modern?", wollte John wissen.
"Nein, nicht wirklich. Ich würde sagen nostalgisch."
"Also eine nostalgische neue Krimiautorin." John schmunzelte und setzte sich auf die Chaiselongue. Er wartete darauf, dass Bernard ihm von der Geschichte erzählen würde, so wie immer. Früher oder später würde sein Freund an eine Stelle geraten, an der er ihn nach einem Tipp den Mörder betreffend fragen würde. Es reichte, wenn er einfach nur da saß und so tat, als würde es ihn nicht weiter interessieren. Plötzlich klappte Bernard das Buch zu und legte es mit Nachdruck auf den kleinen Abstelltisch neben dem Ohrensessel.
"Ich weiß genau worauf du wartest." sagte er zu John.
"Worauf warte ich denn?", fragte dieser mit gespielter Unwissenheit.
"Du wartest darauf, dass ich dir erzähle was in diesem Buch passiert. Aber dieses Mal nicht."
"Was meinst du mit dieses Mal nicht?"
"Dieses Mal wirst du mir nicht schon vorher sagen wer der Mörder ist. Dieses Mal werde ich das Buch einfach zu Ende lesen." konterte Bernard. Mit einem zufriedenen Lächeln sah er den Detektiv an.
"Du irrst dich." sagte John.
"Nein, John. Das tue ich nicht. Ich werde das Buch einfach dann lesen, wenn du nicht in der Nähe bist. Und ich werde dich erst dann fragen, wer der Mörder ist." erklärte er.
"Dann hast du die nächsten Stunden dazu Gelegenheit, denn ich werde in einer viertel Stunde nicht mehr im Haus sein." lachte John.
"Wieso? Wo willst du denn noch so spät hin? Es ist doch schon nach acht." erkundigte sich Bernard.
"Genau die richtige Zeit für einen Detektiv sich in Ermittlungsarbeiten zu stürzen." meinte er geheimnisvoll.
"Soll das heißen, du hast einen interessanteren Auftrag als einen untreuen Ehegatten?" Der Anwalt zog die Augenbrauen hoch.
"Ich weiß noch nicht, ob es mein Auftrag wird. Es hat sich interessant angehört."
"Darf man denn wissen worum es geht?"
"Ich sage es dir, wenn ich weiß wer der Mörder ist." scherzte John.
Die Meldungen über wandelnde Geister auf dem Anwesen der O'Brians waren nach einer Woche nicht mehr von Bedeutung. Die Revolverblätter brachten eine Sonderserie heraus, in der sie sich mit ungewöhnlichen Todesfällen aller größeren, älteren Hauser in Irland beschäftigten. Schlagzeilen über kopflose Reiter, eingemauerte Jungfrauen und mit Ketten rasselnden Gutsherren prangten über den Texten der Zeitungen und Journale. Nach weiteren drei Wochen erregte der Fall jedoch erneut das öffentliche Interesse. Die Nacht des dreißigsten Novembers war schicksalsträchtig für James O'Brian. Es war der Geburts- und zugleich der Todestag seines Sohnes. Damals hätte er auch Mary beinahe verloren, die schwer angeschlagen von den Anstrengungen der Geburt und des Todes des kleinen William, mehrere Wochen hatte das Bett hüten müssen. James schlief kaum in dieser Zeit, da es um Mary so schlecht gestanden hatte. Auch seit ihrem Tod schien er keinen Schlaf mehr zu brauchen. Nacht für Nacht saß er brütend in der Bibliothek. Ein Schatten seiner selbst, stark abgemagert und das Haus auch am Tag nur selten verlassend, saß er einfach da. Megan Lancaster, seine Schwester, betrat am nächsten Vormittag die Bibliothek mit der Zeitung in der Hand.
"Ich weiß, du willst es eigentlich nicht hören, aber die Schlagzeile alleine ist schon lachhaft." setzte sie mit einem breiten Lächeln an.
"Wenn du schon weißt, dass ich es nicht hören will, warum kommst du dann extra deswegen zu mir?", erwiderte James missmutig.
"Es könnte dich aufmuntern. Hör doch mal >Das Gespenst der O'Brians spukt auch in der Nachbarschaft. Eine Augenzeugin berichtet in der Nacht des dreißigsten November die verstorbene Mary O'Brian erneut gesichtet zu haben. Es scheint, als hätte sich der Geist verlaufen, da er nicht auf dem Anwesen der O'Brians, sondern in den Gärten der Nachbarschaft gesehen wurde. Nicht ausgeschlossen wird dabei, dass Mary O'Brians Geist auf der Suche nach ihrem Mörder die Gärten lediglich passiert hat. Die Erscheinung findet in der gemeinsamen Geschichte des Paares ihre Begründung in so fern, als sich in dieser Nacht vor sieben Jahren ein schwerer Schicksalsschlag ereignete. Der Tod, des nur wenige Stunden alten Erben des Anwesens, William O'Brian. Es stellt sich nunmehr die Frage nach dem Zeitpunkt der dritten Nacht. Wird Marys Geist noch einmal erscheinen? Was wird in dieser Nacht geschehen? Enthüllt ein mysteriöser Tod den Mörder der jungen Frau? < Was hältst du davon?" James hatte sich den Artikel angehört. Mit jedem Satz war mehr Wut in ihm empor gestiegen. Seine Finger krallten sich so fest in die Lehne des Sessels, dass der alte Stoff dem unsanften Griff hätte nachgeben müssen.
"Man sollte diesen verfluchten Schmierblattschreibern die Hände abhacken!"
Megan wich einen Schritt zurück. sie hatte nicht damit gerechnet, ihren Bruder derart mit dem Artikel aufzuregen. Sie selbst hatte ihn als witzig empfunden und war in besten Gedanken damit zu James gegangen.
"Rege dich doch nicht so auf." Erschrocken sah sie ihren Bruder an. Hart und stur war sein Blick auf die Bücherwand neben dem Kamin gerichtet.
"Verschinde." sagte er so leise, dass sie es beinahe nicht gehört hätte.
"Aber James, was kann ich denn für die Nachrichten in der Zeitung?", versuchte sie sich zu verteidigen.
"Verschwinde!", schrie er seine Schwester an. Er war aufgesprungen und funkelte sie mit einem Hass in seinen Augen an, den sie noch nie an ihm gesehen hatte. In eine der geballten Fäuste hatte er den Schürhaken des Kaninbestecks genommen. Krampfhaft umklammerte er den hölzernen Griff. Megan drehte sich verängstigt um und verließ hastig die Bibliothek. Auf dem kleinen Flur, der in die Einganshalle führte, stieß sie mit Oliver zusammen.
"Hey, langsam." Verdutzt über den hastigen Schritt seiner Schwester hielt er sie auf. "Was ist los mit dir?"
"Er ist verrückt geworden. Jetzt ist er auch noch verrückt geworden." stieß sie hervor.
"Wer ist verrückt geworden?"
"James."
"Ich denke du weißt, dass du Megan gerade einen derben Schrecken eingejagt hast." begann Oliver zu reden, als er die Bibliothek betrat. James schwieg. Sein Bruder setzte sich in den weniger bequemen Sessel an James Seite und rückte sich das runde Stickkissen zurecht. Immer noch umklammerten die Finger des Witwers den Schürhaken. "Ich weiß, es ist schlimm was mit Mary passiert ist. Und wir alle stehen dir bei. Wenn du reden willst, dann kannst du jederzeit zu mir kommen." James starrte immer noch auf das Bücherregal. Es war, als wäre er in einer fernen Welt versunken, in der ihn nichts und niemand erreichte. Oliver blieb noch eine Weile sitzen. Er war sich nicht sicher, dass er seine Worte überhaupt verstanden hatte. Lange betrachtete er ihn, bis er seinen stummen Bruder wieder verließ. Die Hoffnung, er würde doch noch eine Reaktion zeigen, löste sich in Luft auf. Wenn James in diesem Zustand war, dann ließ man ihn am besten in Ruhe. Schon als Kinder war Zeit das Einzige, was ihn aus dieser jähzornigen Erstarrung löste. James erschien nicht zum Lunch und auch nicht zum Tee. Den ganzen Nachmittag brütete er weiter in seinem grünen Sessel vor sich hin. Erst am frühen Abend wurde er wieder in seinen trüben Gedanken gestört und in die Gegenwart gerissen.
"Mister O'Brian?", meldete sich die Stimme von Misses Kinley an der Bibliothekstür an. "Da ist ein Mann gekommen, der sie sprechen möchte. Er sagt, er hätte einen Termin, wollte mir seinen Namen aber nicht nennen." James regte sich in seinem Domizil und streckte den Kopf neben der Rückenlehne hervor.
"Lassen sie ihn bitte eintreten."