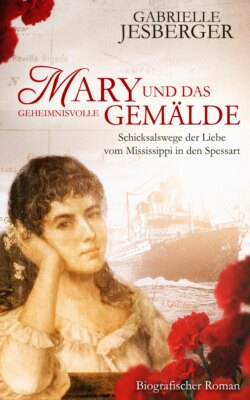Читать книгу Mary und das geheimnisvolle Gemälde - Gabrielle Jesberger - Страница 5
Prolog
ОглавлениеSeit ihrer Kindheit suchte Mary die Einsamkeit in der Natur, die Momente, wenn sich die Dinge um sie herum verdichteten zu Worten, zu Musik, zu Farben und Formen. Nur so erschien ihr das Geheimnis des Lebens, der Ausdruck des Göttlichen in der großen Leere und Ungewissheit des Raumes um sie herum verständlich. Den Zugang zum Schönen und Wahren in der Poesie, der Malerei, der Musik fand sie erst, wenn sie die Augen schloss, im Phosphoreszieren der Dinge, in dem die Farben erst sichtbar wurden, wenn alle lauten äußeren erloschen, die Töne erst hörbar wurden, wenn sie im Außen verklungen waren, die Worte erst zu ihr sprachen in der Stille.
Gleichzeitig war sie fasziniert von Gesichtern, von Menschen als den Akteuren auf der großen Bühne des Lebens. Mit ihrem liebevollen, einfühlsamen Wesen gelang es ihr, tiefer zu sehen, hinter die Fassade, um letztendlich mit unendlich zärtlichem Blick in die Herzen zu schauen. Ihren Charakter beim Malen zu erspüren und auf der Leinwand auszudrücken, nichts Geringeres suchte sie zu durchdringen, um das Verborgene, die Geheimnisse hinter dem Sichtbaren zu erfassen. Sie, deren Geist, Fantasie und Sinn für die Menschen und die Natur sich bis heute in ihren Gemälden, in den von ihr bevorzugten Klavierkompositionen sowie in ihren Briefen spiegeln und wie eine Wesensbeschreibung, ein Ausdrücken der Freiheit als Entwicklungsimpuls in die nächsten Generationen weitergetragen wird.
Teil 1
Sommer 1946 in Sommerau
Der kleine Udo wuchs mit seinem Bruder Wolfgang und später seinen zwei weiteren Geschwistern in der Villa seiner Großeltern und des Opapas auf. Seit Kriegsbeginn wohnte auch Tante Annemarie mit ihrer kleinen Tochter Inge zeitweise wieder bei ihren Eltern. Täglich tobte Udo um die Wette mit seinem drei Jahre älteren Bruder Wolfgang durch die Räume, immer im Kreis herum durch die hohen Flügeltüren, von einem Zimmer ins nächste, durch den Salon und wieder über die nächste Schwelle, bis sie atemlos keuchten und die Dielen begannen im Rhythmus zu schwingen dass auch der Flügel leise Töne hervorzauberte, als ob die Tasten von Geisterhand zart berührt würden.
„Pssst!“, zischte Mami und legte ihren Zeigefinger auf den Mund, als sie aus der Küche eilte. Sie hatte mit den Töpfen vom Mittagessen hantiert, ließ alles stehen und liegen, als sie den Lärm hörte, wischte sich die Hände an der Schürze ab und bemühte sich, eine ernste Miene zu machen. Zu sehen, wie der Dreijährige versuchte, den Großen einzuholen, der immer wieder einmal kurz stehenblieb, zurückschaute, aber schnell wieder losrannte, wenn sein kleiner Bruder ihn fast eingeholt hatte, war eine wohltuende Ablenkung ihrer sorgenvollen Gedanken.
„Ihr wisst doch, Opapa hält seinen Mittagsschlaf!“, ermahnte Mami ihre lebhaften Söhne. „Wollt ihr nicht runtergehen in den Garten, die Sonne scheint und außerdem haben die Ziegen sicher Hunger. Ingelein ist auch schon unten und wartet auf euch.“
Dass Opapa seit einigen Tagen auffallend wenig Appetit hatte, meist schweigend mit verlorenem Blick in seinem Lehnstuhl saß und ihm sogar seine geliebte bodenlange Pfeife nicht mehr schmecken wollte, stimmte Lilo nachdenklich. Erst gestern kam sie dazu, als er auf seinen Stock gestützt, versonnen vor der alten Vitrine stand und seinen Blick nicht mehr von der Urne mit der Asche seiner Frau wenden wollte, die dort nun seit mehr als sechsundzwanzig Jahren stand.
Nach Marys Tod 1920
Am schlimmsten waren die Nächte, die nicht enden wollenden Stunden ohne Mary an seiner Seite. Sie war der einzige Mensch in seinem Leben, der ihn rückhaltlos annahm; sie kannte ihn wie niemand sonst, nahm geduldig seine Rastlosigkeit oftmals sogar mit Humor hin, stellte seinen Patriotismus nie in Frage. Mary hatte ihm all seine Unsicherheiten genommen, die nun plötzlich wieder wie alte Gespenster in allen Ecken lauerten.
Immer noch waren überall im Haus Marys Spuren. In ihrem Schlafzimmer lag aufgeschlagen ihr Notizheft und das letzte Buch, das sie gerade gelesen hatte. An den Wänden hingen ihre Gemälde, er betrachtete sie stundenlang. Ihre Kleider waren im Schrank neben den seinen. Nie ging Richard zu Bett ohne ihr Kopfkissen in den Arm zu nehmen, das immer noch ihren unverkennbaren Duft verströmte. Mit einem tiefen Seufzer schloss er die Augen und drückte seine Lippen darauf.
Obwohl das Geschäft mit der Saya- und Korkproduktion gut lief, war Richard sehr niedergedrückt. Else beschrieb ihren Vater als „ungemütlich und anstrengend“. Seinen brillanten Humor hatte er offensichtlich vollständig verloren.
Wie sehr er sich verlassen fühlte seit dem Tod seiner Frau, entging der Tochter nicht, doch sie war in ihrer eigenen Trauer um die geliebte Mutter gefangen und es schien ihr, als stünde eine unsichtbare Wand seither zwischen ihnen. Else hatte erlebt, wie ihre Mutter in all den Jahren in unerschütterlicher Liebe und Treue bis zu ihrem viel zu frühen Tod an der Seite ihres Mannes stand. Ihren Vater nun mit einem Mal so hilflos zu sehen, tat weh und machte sie ratlos. Wie grau seine Haare geworden sind und wie schütter in den letzten Wochen, stellte sie fest. Er schien um Jahre gealtert. Ich bin sicher, dass er erst jetzt nach und nach erkennt, was unser liebes Mutterle für ihn war, schrieb sie an Tante Lucy in New York.
Von der jüngsten Tochter Hermine, die Richard nun sehr selten sah, weil sie öfter vor der erdrückend stillen Atmosphäre, in dem einst so fröhlichen Haus, zu einer Freundin nach Mainz floh, sprach er mit rührenden Worten, die sich Else täglich anhören musste. „Vater verhält sich wie ein Märtyrer, läuft mit leidender Miene umher, erwartet, dass ich ihm seine Wünsche von den Augen ablese, wie es zuvor seine Frau getan hatte!“, stöhnte sie.
Am Rande einer großen Erschöpfung stellte Else, die ihr viertes Kind erwartete und bereits mit den Aufgaben für ihre eigene Familie ausgelastet war, eine neue Haushaltshilfe ein. Das bedeutete zwar eine Entlastung, aber auch zusätzliche Ausgaben. Dafür war Else gerne bereit, von den 7000 Reichsmark, dem Erbe ihrer Mutter, etwas abzugeben.
Vater und Bruder Franz bemühten sich, Aufgaben zu übernehmen, die bisher die Mutter, wie so vieles andere, ganz selbstverständlich erledigt hatte. Else sah zumindest ihren guten Willen, wenn sie sich nun selbst täglich Feuer in ihrem Zimmer machten und den Aschekasten hinaustrugen. Insgeheim hoffte sie allerdings, dass Franz bald seine Theda heiraten würde. „Damit ich dann wenigstens seine Socken nicht mehr stopfen muss“, beklagte sie sich und bemühte sich dabei um einen humorvollen Unterton, der ihr nicht so recht gelingen wollte. Auch Franz läuft - wie Vater - seit Mutters Tod mit einem ernsten, fast strengen Blick umher, dass ich ihm aus dem Weg gehe, um ihm nicht so oft ins Gesicht schauen zu müssen, schrieb Else verzweifelt.
Sie gab sich doch alle Mühe, versuchte mit ihrer ganzen Kraft, die Mutter zu ersetzen. Warum sieht Papa das nicht?, fragte sie sich. Gleichzeitig war ihr bewusst, dass ihre Kinder und ihr Mann oft zu kurz kamen. Als Ludwig nach Kriegsende endlich zu ihr zurückgekommen war, äußerte er wieder seinen langgehegten Wunsch, irgendwo in der Nähe - ohne den ganzen Anhang - alleine mit seiner eigenen Familie zu wohnen. Nun konnte vom Wegziehen keine Rede mehr sein. Völlig selbstverständlich übernahm Else die Rolle, die die Mutter vorher ausgefüllt hatte. Ludwig musste wohl oder übel die neue Situation akzeptieren und fügte sich stillschweigend in das Unvermeidliche. Das Sanatorium wurde nun endgültig aufgelöst, so gab es wenigstens ausreichend Wohnraum für die junge Familie.
Der Tod der Mutter lag noch keine fünf Monate zurück, als kurz vor der Mittagszeit, am 7. Oktober 1920, der kleine Wolfgang Richard Georg geboren wurde. Mary war in großer Sorge gewesen, als sie im Frühjahr von der Schwangerschaft erfuhr. Der kleine Franzkarl war knapp zehn Monate und ihre Tochter hatte sich von der letzten Geburt noch nicht erholt, sie war sehr mager und auffallend blass. Zwar war ein Kindermädchen im Haus, doch ohne dass es abgesprochen werden musste, übernahm nun vor allem die große Schwester Lilo mit ihrer jüngeren Schwester Annemarie die Erziehung des Bruders Franzkarl. Obwohl er ein kleiner Wildfang war und sie nie wussten, was er gerade wieder ausheckte, war er doch bemüht, den älteren Schwestern nachzueifern. „Dickel“, riefen sie den pummeligen Knirps scherzhaft, was ihn anspornte, die Schwestern mit seinen Grimassen und Faxen zum Lachen zu bringen. „Du Spitzbub“, rief Lilo zärtlich, wenn sie versuchte ihn einzufangen, während er lachend davonlief, dabei Haken schlug wie ein Hase und seine große Schwester atemlos anfeuerte „krieg mich doch!“ Vor allem Opapa trieb gern seine Späße mit ihm, nannte ihn naseweis, weil er alles wissen wollte und ununterbrochen fragen konnte, und in seiner Stimme klang unverhohlener Stolz: „Der kleine Bursche ist halt einfach aus dem „Wehsarg-Holz“ geschnitzt!“
Das erste Weihnachtsfest 1920 ohne Mary war ein trauriges Familientreffen. Else hatte den Christbaum geschmückt, die Haushälterin die traditionelle Speise, wie an jedem Heiligen Abend, zubereitet. Der schwere ovale Tisch war festlich geschmückt, die gestärkten weißen Damast-Servietten lagen als Dreiecke gefaltet auf den goldumrandeten Tellern, die Kristallgläser funkelten im Schein der Kerzen. Franz, der zum Medizinstudium in Würzburg war, reiste an und auch Hermes, die gerade wiedermal eine Freundin in Mainz besucht hatte, kam leise herein und legte ein Gedicht - auf einem mit Blumen und Ornamenten verzierten Blatt - in einem schlichten Rahmen unter den Baum. Alle hatten sich auf das Wiedersehn gefreut und doch lag eine bedrückende Stimmung im Raum. Liselotte und die kleine Mie konnten nicht mehr stillsitzen, hüpften mit Franzkarl aufgeregt von einem Fuß auf den anderen durch das Wohnzimmer und konnten es kaum erwarten bis sie das Glöckchen vom Christkind hörten. Opapa hatte unten in seinem Zimmer durch die Decke das Getrappel der Kleinen gehört, kam mit schwerem Schritt die Treppe hoch, nahm Mie und Lilo, die den kleinen Franzkarl hinter sich herzog, an die Hand und führte sie in den kleinen Salon. „Schaut her, sagte er zu ihnen, „unser Christkind schläft zufrieden in seiner Wiege.“ Er kämpfte mit den aufsteigenden Tränen, als er lächelnd auf sein jüngstes Enkelkind sah. Wie sehr würde sich Mary jetzt mit ihm freuen.
Unter dem Arm hatte Richard ein kleines, in Zeitungspapier gewickeltes Päckchen und legte es unter den Lichterbaum. Als Else es auspackte, rief sie freudig überrascht: „Oh Papa, du malst wieder!“ Wie oft hatte sie an manchen Wochenenden gesehen, wie die Eltern gemeinsam an ihrer Staffelei saßen. Während Mary Federzeichnungen von Motiven aus dem Spessart oder Portraits mit Ölfarben schuf, begann Richard, die prächtigen Blumen, die im Park wuchsen und die idyllische Landschaft oder seine Jagdtrophäen mit Pastellfarben in seinen Stillleben festzuhalten. In den letzten Wochen hatte er wieder begonnen, mit Oskar Hagemann in seinem Atelier im Schlosspark zu malen, wo der Maler ihm einen eigenen Raum zur Verfügung stellte. Doch Richard war nicht mehr der Unterhaltsame und Humorvolle. Marys Tod hatte ihn bis ins Mark getroffen. Inzwischen planten Hagemanns ihre Rückkehr nach Karlsruhe. Die geselligen Abende im Hause Wehsarg gehörten der Vergangenheit an. Es gab nichts mehr, was das Künstlerpaar in Sommerau noch halten konnte.
Heute zeigte Richard sein neuestes Werk der Familie: die vollerblühten Sonnenblumen vom letzten Herbst in einem schmalen vergoldeten Rahmen hinter Glas. Else atmete auf. Ihr Vater war wieder zurückgekommen ins Leben.
Nach dem Essen ging Hermi zu Mutters Flügel und spielte Stille Nacht … Richard schloss die Augen und lauschte, er erkannte Marys Anschlag. Auch Hermes konnte dem schweren Instrument mit einer Sanftheit eine perlende Melodieführung entlocken, die alle tief berührte und sie begann zu singen, wie jedes Jahr am Heiligen Abend. Else stimmte ein und auch die Kleinen mit ihren glockenhellen Stimmen. Richard blieb stumm, die Erinnerung überfiel ihn, er war wehrlos. Alle sehnten sich nach der vertrauten Weihnachtsstimmung wie all die Jahre zuvor und hatten doch gleichzeitig nur einen Gedanken: Ma ist bei uns. Elses Stimme wurde von Tränen erstickt, nach und nach verstummten alle, bis die kleine Liselotte alleine mit ihrer zarten Stimme die erste Strophe beendete.
Hermes holte ihr Gedicht unter dem Baum hervor und begann zu lesen:
Einst zog sie jung und möwengleich
von weither übers Meer.
In ihr des Frühlings Hoffnungsreich;
sie liebte die Welt so sehr.
Dann war sie Amselsommersang,
kannte Liebe, Freud‘ und Leid,
sang zu der Abendglocken Klang
von Glück und Traurigkeit.
Früh kam der Herbst. Ein blinder Sturm
trug sie auf Schwingen fort,
stark wie der Falke auf dem Turm.
Wohin? An welchen Ort?
nach Irene Fischer
Wie sehr Mary ihnen allen fehlte, spürten sie gerade heute. Noch immer mangelte es ihnen an Zeitgefühl, doch der Kalender sagte ihnen, dass sie bereits seit sieben Monaten nicht mehr unter ihnen lebte. Sie war der Mittelpunkt der Familie gewesen. Nun war ihr Platz leer und doch ihre Anwesenheit immer noch in jedem Winkel des Hauses, im Garten und im Malepartus zu spüren. Else ertappte sich immer wieder, dass sie – mitten im Alltag - zum Flügel blickte und erwartete, wie seit ihrer Kindheit, dort die Mutter zu sehen; immer noch hörte sie die vertrauten Klänge, wie früher Tag für Tag, und summte mit. Mary fehlte ihnen allen so sehr, dass - trotz der Ablenkung durch die Kinder - der Schmerz ihre Lebensfreude immer wieder lähmte.
An manchen Tagen war es Else, als würde sie erst jetzt die Endgültigkeit erfassen und die Trauer ergriff erneut ihre Brust mit einer Heftigkeit, dass sie in Tränen ausbrach und die Sehnsucht nach der Mutter sie aufstöhnen ließ. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie mit ihr auch ihre einzige Freundin verloren hatte, dass es nun niemanden mehr gab, mit dem sie so offen über alles reden konnte, was sie bewegte, wie mit ihrer geliebten Ma.
Urplötzlich war eine Stille im Zimmer, man hätte das Fallen einer Stecknadel hören können. Und mit einem Mal war diese Andacht erfüllt vom Aroma des vertrauten Parfums mit dem dezenten Lavendelduft und einem Hauch Bergamotte, als ob die geliebte Mutter anwesend wäre. Else schloss die Augen, sie konnte es sich nicht erklären und wusste doch: Ma ist bei uns. Sie spürte ihre Arme, so wie nie ein Tag vergangen war ohne eine herzliche Umarmung von ihr und ohne ein paar liebevolle Worte.
Und ganz plötzlich war es wieder da, dieses Gefühl von einst, die Liebe der Mutter. Else hörte in ihrem Inneren die wohlklingende Stimme mit dem vertrauten amerikanischen Akzent, wenn sie - wie jedes Jahr - vom Wunder der Christnacht sprach, das in uns allen geschieht, wenn wir dazu bereit sind. Sie hörte, wie Ma mit ihrer sanften Stimme sagte: „Mein Elsle, das Leben in der Liebe geht weiter als der Tod.“ Else war sich sicher, Mutters Hand zu spüren, die ihr liebevoll und zärtlich die Wange streichelte. Sie legte eine Hand auf die Brust und atmete tief ein. Ja, dies war ihr Wunder dieser Christnacht. Sie würde den Geist dieses Hauses weiterpflegen, Marys Herzensgüte wie ein Vermächtnis bewahren und mit neuem Leben erfüllen. Else erhob sich, ging auf ihren Vater zu, umarmte ihn schweigend, zum allerersten Mal seit Mutters Tod, und ging mit dieser liebevollen Umarmung von einem zum anderen.
In der darauffolgenden Woche hatte Richard seine Praxistätigkeit wieder aufgenommen. Nach und nach fand er auch erneut Freude daran, Artikel und Kurzgeschichten, aus denen die Liebe zu seinen „Spessartern“ und ihrem kantig-herzlichen Naturell sprach, für die „Spessartzeitschrift“ zu verfassen. Unermüdlich war er wieder das Sprachrohr für die Sorgen um die wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Spessartbewohner. Als Arzt im Spessart, seiner Wahlheimat, trat er in all den Jahren immer nur für das Wohl „seiner Spessarter“ ein, war vertraut mit ihren Sorgen und Freuden, ihren Wäldern, ihren Feldern und Wiesen. Er kannte die Bauern, Köhler, Fuhrleute, Holzhauer, die er bei ihrer Arbeit beobachtet hatte. Und mit den Jahren erhellte nach dem Tod seiner geliebten Frau nun vor allem die Malerei mehr und mehr seinen Lebensabend.
Seine Jüngste, die erst 19-jährige Hermi, wohnte mittlerweile in Altona bei Onkel Franz, Marys Bruder, und sollte dort als Arzthelferin in seiner Praxis ausgebildet werden. Bevor sie abgereist war, hatten die beiden Schwestern begonnen, die schönen Kleider ihrer Mutter untereinander aufzuteilen und waren sich nicht immer einig. „Ich möchte so gerne Mas Ring nach Altona mitnehmen, damit ich etwas von ihr bei mir habe“, bat Hermi ihre Schwester. Schweren Herzens trat Else ihr den wertvollen Diamantring ab, den Mary schon vor ihrer Heirat besaß und den sie nie abgelegt hatte.
Die große Schwester war ein wenig neidisch auf die jüngere, die nun in Altona ein unabhängiges Leben führen konnte, wogegen sie selbst im Elternhaus blieb und - wie für alle selbstverständlich - die Aufgaben ihrer Mutter übernommen hatte. Trotz all ihrer Bemühungen wurde sie das Gefühl nie los, nicht genug zu tun, denn Papa und Bruder Franz, der regelmäßig heimkam, hatten ständig etwas auszusetzen. In Hermi sah Else das verwöhnte Nesthäkchen. Eine Bitte von Dir hat Pa noch nie abgeschlagen, wogegen er sich mir gegenüber oft als geizig zeigt!, beklagte Else sich im Brief an ihre Schwester. Sie selbst hatte keine Einnahmen und Ludwig verdiente noch nicht genug, um die Kosten für das Haus und die Angestellten übernehmen zu können. Die Haushaltsführung lag inzwischen in Elses Hand und es war ihr äußerst unangenehm, wenn sie ihren Vater nun um Geld bitten musste. „Er ist so knausrig, gibt mir immer nur kleine Summen, als ob er Sorge hätte, ich würde zu viel ausgeben“, klagte Else. „Papa ist immer noch genauso schweigsam wie früher. Ich weiß über die finanzielle Situation im Haus nicht Bescheid, zudem verschickt Vater seine Praxisrechnungen immer selbst.“
Richard, der es als seine väterliche Pflicht ansah, seine jüngste Tochter darin zu unterstützen, sich ein eigenständiges Leben aufzubauen, hatte dafür gesorgt, dass Marys Bruder sie in seine Familie aufnahm. Nun, da sie zum ersten Mal so weit von ihm weg war, vermisste er sie. In Hermles Gesicht fand er dasselbe Leuchten, wenn sie lächelte, wie bei seiner Frau. Es war Marys strahlendes Wesen, eine Anmut, die ihm vertraut war, wenn er nun sah, wie seine Jüngste auf Menschen zugehen und sie in den Bann ziehen konnte. Je mehr er erkannte, wie ähnlich sie ihrer Mutter war, umso mehr vermisste er sie und schrieb ihr schwermütige Briefe nach Altona. Die Tochter plagte im fernen Norden immer mehr das schlechte Gewissen, gerade jetzt nicht an Vaters Seite zu sein. Dass sie schon lange die Sehnsucht in sich trug, endlich einmal etwas von der Welt zu sehen, wussten die Eltern seit einiger Zeit. Nun hatte der Vater selbst eingesehen, dass ihr als jüngere Schwester an Elses Seite im Elternhaus kein eigenständiges Arbeiten möglich war.
Schon am 16. Januar 1921 war ein Brief an sein liebes Hermle unterwegs: Verzeih, wenn ich manchmal brummig war. Verzeih dem einsamen Vater, denn Du bist fort und er ist noch immer brummig. Mit Dir ist auch Frau Musika, Eurer lieben Mutter Freundin, aus dem Hause gezogen.
Seit Marys Tod stand der Flügel verlassen, wie ein vergessenes Möbelstück, im Speisezimmer. Es war, als hätte die Trauer im Haus nicht nur das Lachen der Menschen, sondern auch seinen Klang verstummen lassen. Trotz seiner Schwermut legte Richard der Tochter dringend ans Herz, weiterhin im Haus des Onkels zu bleiben: Und wenn Dich einmal Herz und Heimweh ruft, dann komm wieder zu uns. Vorderhand kann vom Fortgehen von Lu oder gar Else und den Kindern noch keine Rede sein. Gegebenenfalls würde das auch nicht von heute auf morgen gehen. Linus (der Knecht) ist ja jetzt nicht mehr bei uns und wird höchstens einmal auf 14 Tage kommen. Diese Kosten sind dann gespart und da es zweifelhaft, ob Lene (die Haushälterin), die fort möchte, also auch der Trauer entfliehen wird, noch länger bleibt, so haben wir auf Tante Linas Empfehlung hin ein Fräulein Wohlgemuth, vierzig Lenze zählend, im Sinne, anzunehmen. […] dann wäre doch jemand da, der sich ganz alleine verantwortlich der Hausführung widmen würde. Ich bin nicht optimistisch, sehe aber ein, dass ich so jemanden haben muss.
Gestern Abend war ich mit Else und Lu auf einem Konzert in Eschau, das der Musiklehrer Wolf am Klavier, begleitet von einem Cello und einer Sängerin, veranstaltete. Alle Größen waren vertreten und nach Schluss wurde bei Pfarrer Löffelholz weiter musiziert. Ich war zu trübe gestimmt, mir fehlte Euer Mutterle. Ich ging vorzeitig heim und las bis die anderen kamen. […] Ich muss ja jetzt doch die Stelle Eurer Mutter einnehmen und dabei die nötigen Briefe schreiben. So lang es geht, geht es, wie man sagt. Allmählich verkleinert sich ja auch der Kreis, um dann mit mir ganz aufzuhören …
Im fernen Altona litt Hermi immer mehr unter Heimweh. Im Haus des Onkels und der Tante fehlte die liebevolle Atmosphäre, die sie von ihrer Mutter kannte. Sie waren zwar freundlich zu ihr, aber distanziert. Auch das Arbeiten in der Arztpraxis erfüllte Hermes nicht. Einzig die Abende, an denen sie mit Onkel Franz musizieren konnte, machten die Zeit erträglich. Nach einem halben Jahr war sie erleichtert, wieder abreisen zu können. Doch ohne Ma war auch die Villa Elsava nicht mehr ihr Zuhause. Durch die Unterstützung ihrer Mainzer Freundin begann sie bald eine Ausbildung zur Korsettmacherin und konnte nach kurzer Zeit ein eigenes kleines Geschäft eröffnen. Es sprach sich schnell in Mainz herum, wie geschickt sie Mieder nach Maß anfertigen konnte und die Damen der gehobenen Gesellschaft wurden bald gute Kundinnen.
Frieden und Krieg
Am 24. Juni 1922 ging eine Eilmeldung durch die Presse: Außenminister Walter Rathenau auf dem Weg ins Auswärtige Amt ermordet! Am Abend zuvor hatte er noch bis in die frühen Morgenstunden bei einem Essen mit dem amerikanischen Botschafter Alanson Houghten den deutschen Standpunkt in der Reparationsfrage erläutert und über eine „Abkehr von der bisherigen Erfüllungspolitik“ diskutiert. Durch seine widerspruchsvolle politische Haltung wurde er von vielen Seiten angefeindet und hatte Mühe, Unterstützung zu finden für seine neue entspannungsfördernde Politik. Zwar war Berlin weit weg, doch die Erleichterung über den Frieden wurde allgemein getrübt durch den verlorenen Krieg und den erzwungenen Friedensvertrag von Versailles. Die tief empfundene Ungerechtigkeit heizte landesweit die Debatten im Volk an.
Am 31. Januar 1922 war Rathenau zum Außenminister ernannt worden, um Deutschland bei der Weltwirtschaftskonferenz in Genua zu vertreten. In der Reparationsfrage gelangen ihm keine Fortschritte, aber er fand sich unter Bedenken bereit, am 16. April 1922 mit Sowjetrussland einen bilateralen Sondervertrag abzuschließen, um Deutschland außenpolitisch mehr Handlungsspielraum zu verschaffen. Obwohl dieser Schritt von nationaler Seite begrüßt wurde, hielt es die Organisation Consul nicht davon ab, später ein Attentat auf Rathenau zu verüben. Er wurde als ältester Sohn des deutsch-jüdischen Industriellen Emil Rathenau (des späteren Gründers der AEG) in Berlin geboren. Rückblickend schrieb er über seine Jugendzeit: In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert: wenn ihm zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann. Die traumatisch erlebte Kluft zwischen Zugehörigkeit zur Elite und gleichzeitiger Diskriminierung begleitete ihn lebenslang und enthält vielleicht die Quintessenz der deutsch-jüdischen Geschichte, nämlich den - sich über Generationen hinstreckenden - Versuch, die jüdische und die deutsche Identität miteinander in Einklang zu bringen, ohne sich weder in der einen noch in der anderen wirklich zu Hause zu fühlen. Als Präsident der AEG reichte Rathenaus Einfluss weit über den Konzern hinaus. Er war überzeugt, eine Planwirtschaft wäre die notwendige Ergänzung zum Marktmechanismus und könne so dazu verhelfen, soziale Schieflagen und überzogene Profite zu vermeiden. Noch am Tag der Ermordung Rathenaus wurden die Funktionäre der rechtsextremen Organisation Consul festgenommen. Die O. C. war eine nationalistisch und antisemitisch gesinnte terroristische Vereinigung während der Weimarer Republik, eine paramilitärische Organisation, die als Geheimbund aufgebaut war. Sie verübte politische Morde mit dem Ziel, das demokratische System der jungen Republik zu destabilisieren, eine Militärdiktatur zu errichten und die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, insbesondere den Friedensvertrag von Versailles, zu revidieren. Bei der vorzeitigen Haftentlassung einer der Mörder Rathenaus wurde der Täter von einer Musikkapelle der paramilitärischen Wehr-Organisation „Stahlhelm“ begrüßt, dessen Ehrenmitglied Reichspräsident von Hindenburg war. Dies zeigte schon seine undemokratische, reaktionäre Einstellung. Im August 1921 wurde der bei den Rechten verhasste Zentrumspolitiker Matthias Erzberger im Schwarzwald von der O. C. ermordet. Der Mordversuch am 4. Juni 1922 an Philipp Scheidemann, der bereits 1883 in die verbotene SPD eingetreten war, scheiterte. Vermutlich war die Gruppe auch verantwortlich für die Ermordung von Karl Gareis, der überzeugter Sozialist und zuletzt als Lehrer in Aschaffenburg tätig war. Ihre etwa 5000 Mitglieder bestanden zum größten Teil aus ehemaligen Offizieren des Deutschen Heeres und der Kaiserlichen Marine sowie der Freikorps. Ihr Motto war die Bekämpfung alles Antinationalen und Internationalen, des Judentums, der Sozialdemokratie und der linksradikalen Parteien, mit dem Ziel, durch die Ermordung von exponierten Personen der Demokratie, die Republik zu beseitigen. Vor allem Politiker jüdischer Abstammung zählten dazu, aber auch Politiker der demokratischen Parteien der Mitte, der Linken sowie Pazifisten und Politiker, die an den Verhandlungen des Versailler Vertrages beteiligt waren. In einer Hetzschrift der Freikorps hieß es: Auch Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter. Knallt ab den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau.
Eines der bekanntesten O.-C.-Mitglieder war der Schriftsteller Ernst von Salomon, der als Rechtsterrorist (Für einige Historiker gilt er als Wegbereiter des Nationalsozialismus.) an der Vorbereitung von politischen Verbrechen, wie dem Mord an Rathenau, beteiligt war. Anfangs war die Organisation sogar von der Reichsregierung und der Reichswehrführung geduldet, da sie hofften, mit ihrer Unterstützung die Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages unterlaufen zu können. Salomon erreichte mit seinen Büchern „Dokumente vom Kampf um die Wiedergeburt der Nation“ etc. im Nationalsozialismus sehr hohe Auflagen. Auf der Grundlage des im Juli 1922 erlassenen Republikschutz-Gesetzes wurde die O. C. verboten. Als Nachfolgeorganisation wurde der Bund Wiking gegründet. In der Zeit des Dritten Reiches wurden die Mitglieder der O. C. der SS unterstellt.
Rathenau war lange Zeit einer beispiellosen antisemitischen Hetzkampagne ausgeliefert gewesen. Seine Aussage, wonach die Geschicke der Welt von etwa 300 mächtigen Männern geleitet würden, war zu der Denunziation umgedeutet worden, Rathenau selbst wäre einer der „300 Weisen von Zion“, die mit ihm an die Macht gelangt seien. 1920 wurde erstmals eine deutsche Fassung - der ursprünglich in Russland erschienenen - unter dem Titel „Die Geheimnisse der Weisen von Zion“ (von Ludwig Müller von Hausen) herausgegeben. Der Gründer und Vorsitzende des Verbandes gegen die „Überhebung des Judentums“ pflegte in Berlin intensive Kontakte zu rechtsextremen russischen Emigranten. Diese sogenannten Protokolle waren nur eine von vielen antisemitischen Veröffentlichungen, die das Land überschwemmten. Dennoch zeigte ihr publizistischer Erfolg, dass in der Weimarer Republik das Bedürfnis nach einem Sündenbock für den Sturz der Monarchie und für die Niederlage im Weltkrieg angesichts der eigenen rassischen Überlegenheit - die die völkische Bewegung immer verkündet hatte - groß war. Die „Protokolle“ vereinten eine Vielzahl von Klischees, die den antisemitischen Diskurs prägten. So wurden darin Juden grundsätzlich als Feinde der Christen dargestellt. Als Ziel der Juden wurde die weltweite Herrschaft - ihres Glaubens und des Glaubens an ihre „göttliche Auserwähltheit“ - in dem von ihnen beherrschten „Universalstaat“ dargestellt. Zudem wurden ihnen Ehrgeiz, Rachsucht und Hass auf die Christen unterstellt. Die Vorstellung, die Juden seien grundsätzlich feindlich gegen Christen eingestellt, wurzelt im Antijudaismus (seit Beginn des Christentums), der ihnen „verstockte“ Verweigerung von Bekehrung und Taufe, Gottesmord, Hostienschändung sowie angebliche Bündnisse mit dem Teufel vorwarf. Zweifel an der Echtheit der Protokolle kamen schon sehr früh auf. Es wurde vermutet, dass der gesamte Text ein böswilliges Phantasieprodukt war, wonach die Juden wegen ihrer angeblichen Rolle in der russischen Revolution 1905 verleumdet wurden.
Die NSDAP stützte sich in ihrer Propaganda stark auf diese „Protokolle“ und verbreitete deren „aufsehenerregenden Enthüllungen“ seit 1921 in auflagestarken Flugblättern. In „Mein Kampf“ schrieb Hitler: Die Protokolle der Weisen von Zion sollen auf einer Fälschung beruhen, stöhnt immer wieder die Frankfurter Zeitung in die Welt hinaus, der beste Beweis dafür, dass sie echt sind. Irgendein Beweis, dass die sog. Protokolle irgendwo und irgendwann von einem oder mehreren Juden im Auftrag einer geheimen „jüdischen Weltregierung“ ausgearbeitet, vorgetragen oder beraten worden sind, wurde nie erbracht. Die Nationalsozialisten solidarisierten sich noch während der Weimarer Republik mit den Attentätern, obwohl die Mörder Rathenaus eine monarchistische Gegenrevolution auslösen wollten und keine faschistische Nationalrevolution.
Nach 1945 wurde das Schlagwort von dem „ersten Opfer des Dritten Reiches“ populär. Rathenau sei sowohl ein erstes Opfer des Dritten, wie ein letztes Opfer des Zweiten Reiches gewesen. Die politischen Reaktionen auf das Attentat waren enorm. Es kam zu Tumulten, Millionen Deutsche demonstrierten in Protestkundgebungen und Trauerzügen gegen den konterrevolutionären Terror, aber der Bürgerkrieg, auf den die Terroristen gesetzt hatten, blieb aus. Die Reaktionen auf die Ermordung Rathenaus stärkten letztendlich die Weimarer Republik. Das Deutschlandlied wurde zur Nationalhymne erhoben. Die Bevölkerung sah die Ermordung ihres Außenministers als Opfer für die Demokratie.
Else und Ludwig hatten sich ihr Leben mit den Kindern nun endgültig in der Villa eingerichtet. Schweren Herzens musste Ludwig seine beruflichen Pläne aufgeben. Jetzt, nach Kriegsende, fand er den Anschluss an sein Philosophie-Studium nicht mehr. Dozent an einer Universität zu werden, war während der Kriegsjahre sein ersehntes Ziel gewesen.
Dennoch arbeitete Ludwig in Anlehnung an Platons Werk „Politeia“ an einer Abhandlung „Der Staatsmann“, die in einem Buch des „Leuchter“, einem Verlag für philosophische Schriften in Darmstadt, 1922 veröffentlicht wurde. Er ließ seine Frau nicht nur gerne teilhaben an seinen Gedanken, er diktierte ihr sogar den über zweihundert Seiten langen Text, den sie mit ihrer schönen Handschrift für den Verlag zu Papier brachte. Lu zitierte Platon, der Sokrates‘ Texte niederschrieb: Das wichtigste, was wir Menschen im Leben lernen müssen, ist nachzudenken. Er vertiefte sich in Nietzsches Werke und stimmte überein mit Hegel: Der Kampf der Vernunft besteht darin, dasjenige, was der Verstand fixiert hat, zu überwinden.
Else war durch eine unerwartete Schwangerschaft sehr erschöpft und die übernommene Verantwortung überforderte sie. Ihre Schwiegereltern und die Schwägerin boten ihr an, die siebenjährige Liselotte einige Zeit zu sich zu nehmen. In Rheinhessen konnte sie zur Schule gehen und erhielt die bestmögliche Förderung des Opas, der ihre musische Begabung erkannte und nach den Hausaufgaben täglich mit ihr am Klavier saß.
Am 19. Januar 1923 kam der kleine Wilhelm Otto Franz zur Welt. Die Geburt setzte sehr plötzlich und einige Wochen zu früh ein. Der zarte Junge war zu schwach und lebte nur einen Tag. Else war sehr geschwächt und erholte sich nur langsam.
Mie bemühte sich täglich, Opapa von seinem Heimweh nach Lisekind abzulenken, die inzwischen in Darmstadt ein Gymnasium mit Internat besuchte, und die beiden temperamentvollen Buben brachten ihn mit ihren Streichen zum Lachen.
Am Heiligen Abend 1935 überraschte Richard seine Tochter Else mit einem Bild, auf dem er einen Rosenstrauß in zarten Pastellfarben festhielt, den er erst einen Tag zuvor zusammengestellt hatte. Der sonnige Herbst war in einen außergewöhnlich milden Winter übergegangen. Kein Frost hatte die zarten Rosenblüten zerstört und Richard schnitt behutsam von Marys Rosenstock die letzten vollerblühten weißen Rosen. Viele Stunden hatte er sich mit Hingabe seinem Werk gewidmet, versunken in Erinnerungen der gemeinsamen Jahre. Bevor er das fertige Bild in den vergoldeten Rahmen legte, schrieb er Rosen zu Weihnachten 1935 darunter. Else wusste, Papa hatte die weißen Rosen für seine Frau gemalt und stellte das Bild neben Mutters Urne.
1933 war die Machtergreifung durch Adolf Hitler erfolgt. Am 11. September 1938 schrieb Else begeistert auf ihrer Ansichtskarte mit einem Foto vom Führer - neben B. von Schirach, dem Leiter der HJ, - in seiner Grußhaltung mit ausgestrecktem Arm (der stereotype „Deutsche Gruß“) beim Vorbeimarsch der Hitlerjugend unter dem Hakenkreuz: Hurra, den Führer gesehen! Tapfer erkämpft im drückendsten Gewimmel. Hoffe heute Abend wieder erleben zu dürfen, den Führer zu sehen. Innigst Eure Mutsch. Else und Lilo waren in Begleitung einer Freundin mit dem Fahrrad mehrere Tage unterwegs gewesen nach Nürnberg zum Reichsparteitag. Seit einigen Monaten leitete Else mit ihren beiden Töchtern für den BDM (Bund deutscher Mädchen) im Park ein fröhliches Beisammensein für junge Frauen im Dorf. Sie kamen gerne, denn die leichte Gymnastik und frohen Lieder waren wie eine Belohnung für die harte Arbeit zu Hause auf dem Bauernhof. Daneben war Else engagiertes Mitglied in der NS-Frauenschaft.
Nach einundzwanzig Jahren einer fragilen Friedenszeit und der Machtergreifung Hitlers brach 1939 erneut ein Krieg aus. Die Wunden des verlorenen Ersten Weltkrieges waren noch lange nicht verheilt. Eine ganze demoralisierte Generation ließ sich vom Hitler-Regime überzeugen, dass die Schmach des verlorenen Krieges nur durch einen grandiosen Sieg in einem erneuten Krieg zu vergelten wäre. Kaum einer im Land wollte nicht gerne den Versprechungen glauben.
Nach Hitlers Überfall auf Polen 1939 (ausgelöst durch eine von der SS inszenierten, angeblich polnischen Besetzung des Reichssenders Gleiwitz, Nähe Kattowitz) und der daraus resultierenden Kriegserklärung Englands und Frankreichs, aufgrund des Beistandspaktes mit Polen, war der Flächenbrand mitten im Herzen Europas entfacht und breitete sich als Zweiter Weltkrieg aus. Nach den schnellen Anfangssiegen, des sogenannten Blitzkrieges über Polen und Frankreich, gelang es Hitler, mit seinen Parolen und Versprechungen eines Endsieges, den Kampfgeist für das Vaterland bei vielen jungen Männern zu wecken.
Am Abend war Richard - wie am Ende jedes Tages - in Gedanken bei seiner geliebten Frau und erzählte ihr von den aktuellen Ereignissen. Vor allem lauschte er auf ihre vertraute Stimme, ihre warmherzigen Worte, die trotz der jahrelangen Trennung, nach wie vor nicht in ihm verklungen waren: Jetzt sah er wieder in ihre tränenfeuchten Augen, als sie vor Jahren zu ihm sagte: „Richard, ich denke gerade an die Worte von Hegel: ‚Alle großen weltgeschichtlichen Vorgänge ereignen sich zweimal.“ Hatte Mary den Zweiten Weltkrieg etwa vorausgeahnt?
Nach Kriegsende 1918 hatte Ludwig eine Stelle als Ausbilder im Werksunterricht der „Glanzstoff“ - die größte Firma im Umkreis für Kunstfaserprodukte - angetreten. Diese Aufgabe war allerdings nicht das, was er sich nach seinem Philosophie-Studium vorgestellt hatte und so sah er seine erneute Einberufung zum Militär als eine Herausforderung, die ihm Abwechslung brachte und auch neue Anerkennungen, mit denen er an seine Auszeichnungen während des Ersten Weltkrieges anknüpfen konnte. Im Mai 1940 hielt Ludwig sich bereits in Bad Orb als Hauptmann mit seiner Kompanie zur Ausbildung auf. Auch sein Sohn Richard hatte sich freiwillig gemeldet und war längst mit seinen Kameraden auf dem Weg nach Finnland.
Vereinzelt kamen die Meldungen von gefallenen Soldaten aus den Nachbarorten. Zu wissen, dass draußen der Kampf tobte, die Männer der Familie bis auf den alten Opapa und den neunzehnjährigen Franzkarl, den Dickel, noch zu Hause waren, machte die plötzliche Ruhe im Haus fast unerträglich.
Ende Mai 1940 meldeten die Nachrichten grandiose Erfolge, wie sie angeblich die Weltgeschichte noch nie erlebt hatte. Else schrieb euphorisch an Lu: Alles wird beseelt von dem einen Manne, der Deutschlands Glück und Hoffnung ist, und wie Du schreibst, die Weltgeschichte gestalten wird.
Franzl, als Kind der kleine Rebell in der Familie, von dem Opapa manchmal kopfschüttelnd sagte: „der Bub ist wie ein kleines Füllen, das um sich schlägt, wenn man ihm zu nah kommt“, wurde in letzter Zeit sehr still. Jetzt, wo auch Edgar, Annemaries Mann, eingezogen worden war und Willi, Liselottes Mann, bei den Luftlandetruppen kämpfte und bereits das Eiserne Kreuz erhalten hatte, fühlte sich auch Franzkarl mitgerissen von der Euphorie, die die Feldpostbriefe ins Haus brachten, war er doch mit seinem Bruder Richard durch ihre gemeinsame Zeit in der Hitlerjugend längst eingestimmt: „Meine Ehre heißt Treue“, klang es begeistert im Chor. „Auch Willi ist ein willensstarker, großartiger Kämpfer!“, rief Else anerkennend aus.
Franzkarl traute sich allerdings noch nicht, der Familie seine Pläne zu offenbaren, da er wusste, seine Schwester Lilo war dagegen. Wie in einer Vorahnung gab sie sich alle Mühe, ihren Bruder zurückzuhalten, sich bei der Luftwaffe zu melden.
Über das Grauen des Krieges, die Leiden der Soldaten, die Erschöpfung, wie sie es aushalten konnten, auf Menschen zu schießen, die Schmerzensschreie der Verwundeten und Sterbenden zu erleben, sprach keiner und auch in den Feldpostbriefen wurde nur von den Heldentaten berichtet. Selbst nach dem Krieg blieb diese Haltung unverändert und somit konnten die Traumata noch lange nicht aufgearbeitet und damit nicht geheilt werden. Aber es gab auch andere Stimmen, wie der Soldat Emil G. in einem authentischen Feldpostbrief am 24.06.41 über die verhungerten Kinder des Warschauer Ghettos schrieb, das er kurz gesehen hatte: Im letzten Krieg brachte das Ausland Bilder von abgehackten Kinderhänden. Und nun dies! Die Wahrheit ist schlimmer, grausamer, viehischer als alle Phantasie.
In der Wochenschau im Kino, zu der Franzl seine Mutter 1941 nach Aschaffenburg begleitete, sahen sie auf großer Leinwand den Einsatz des neuen Vormarsches. Ergriffen äußerte sich Else auf dem Weg zum Bahnhof: „Die Bilder waren so atemberaubend, gleichzeitig grauenvoll, aufregend, beinahe unfassbar und doch so überzeugend glaubhaft.“ Worauf Dickel erstaunt feststellte: „Warum haben unsere Soldaten denn noch keine Kriegsgefangenen?“ Immer noch tief bewegt von den Eindrücken gingen sie schweigend nebeneinander her bis Mutch die Stille unterbrach: „Franzl, meinst du nicht auch, die Leistungen unserer Soldaten grenzen ans Wunderhafte und doch sind bei allem die Opfer nicht allzu groß, man muss es gesehen haben!“ Für Franzkarl war dieser Satz seiner Mutter wie ein Weckruf. Bereits einige Wochen später befand er sich in der Kampffliegerschule Greifswald. Er hatte sich noch im Herbst 1941 freiwillig gemeldet. Was macht die kleine Schmütze (Inge) und Burschi, unser Wölflein (Wolfgang)? Jetzt können sie bald nicht mehr im Freien spielen. Na, unser Haus ist ja groß genug. Heil Hitler, Dein Franzkarl, schrieb er beschwingt an seine liebe Mutch, während er sich auf seinen ersten Flug mit der Messerschmitt freute.
Else begann nun wieder, wie fünfundzwanzig Jahre zuvor während des Ersten Weltkrieges, diesmal mit ihren Töchtern Lilo und Mie, ihren Männern Päckchen mit Lebensmitteln an die Front zu schicken. Die Familie zu Hause kam kaum vom Radio weg, bei jeder neuen Meldung wurde es laut aufgedreht, dass es durch das ganze Haus hallte. Die Zeitungen wurden verschlungen, die Siegesmeldungen verbreiteten eine euphorisches Stimmung und waren so wuchtig und gewaltig, dass keine Zweifel an einem baldigen Sieg aufkommen konnten.
Die Demütigung durch den verlorenen Ersten Weltkrieg gipfelte in Hitlers Versprechen, die er in einstudierten Parolen und Gesten verkündete. Die „Inszenierung von Massenerleben“ traf auf die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, dem Entkommen einer inneren Leere. Die Gesinnung in der Bevölkerung allerdings spaltete sich.
Wie deutsche Konzerne massiv vom Krieg und von Konzentrationslagern profitierten, zeigt das abschreckende Beispiel in einem Artikel des Handelsblattes: Der Konzern, der Hitler den Weltkrieg ermöglichte. Das dunkelste Kapitel der IG-Farben (u. a. Bayer) war wesentlich geprägt durch die Giftgas-Produktion und dem Bau der riesigen Buna-Fabrik mit dem eigenen KZ Auschwitz-Monowitz. Hier ließen Zehntausende KZ-Häftlinge ihr Leben. Was im benachbarten Vernichtungslager Birkenau passierte, dürfte den Verantwortlichen der IG-Farben mit Sicherheit bekannt gewesen sein, zumal das für die Vergasung verwendete Zyklon B von einer Tochterfirma der IG-Farben produziert wurde. Der Konzern lieferte einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau des Konzentrationslagers in eine industrialisierte Mordmaschinerie, in der etwa 1 ½ Millionen Menschen umgebracht wurden. […] Es ist die Geschichte von Firmenlenkern, die für den Profit die Ermordung von Zehntausenden Menschen duldeten - ja sogar anordneten. Sie wurden als Kriegsverbrecher (wegen Versklavung und Massenmord) verurteilt. Als sie aber wegen „guter Führung“ schon nach zwei Jahren das Gefängnis verließen, stand die Limousine schon bereit. Sie alle bekamen wieder gute Jobs und trafen sich im Februar 1959 zu einem glanzvollen Wiedersehensbankett […]. H. Bütefisch, SS-Obersturmbannführer (im Freundeskreis H. Himmlers), als Wehrwirtschaftsführer für Auschwitz zuständig und von Hitler mit dem Ritterkreuz dekoriert, bekam in der BRD später das Bundesverdienstkreuz verliehen. Auch der IG-Farben-Manager O. Ambros, Ritterkreuzträger, Schulfreund von H. Himmler und Hauptverantwortlicher für Auschwitz-Monowitz, machte ebenfalls wieder Karriere u. a. beim Contergan-Hersteller. Heute würden sie vom Kriegsverbrechertribunal Den Haag zu lebenslänglich verurteilt.
Das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte mussten jedoch Mary und ihre Eltern nicht mehr erleben.
Unser Führer gibt dem Volke doppelte Kräfte, Vertrauen und Stärke. Unsere Soldaten leisten wieder Übermenschliches. Richard ist seit Führers Geburtstag nun wie Franzkarl auch Obergefreiter, schrieb im Mai 1942 Else voller Stolz im Feldpostbrief an ihren Mann. Ihr Bruder Franz befand sich immer noch als Lazarett-Arzt an der Ostfront. Von den Russen wurden Flugblätter abgeworfen, die einige Mutige an sich nahmen, obwohl es unter Androhung der Todesstrafe streng verboten war:
Lesen und weitergeben! Ein neues Hitlerabenteuer gescheitert! Deutsche Soldaten! Hitlers Plan einer blitzartigen Zerschmetterung der Roten Armee ist gescheitert. Nicht allein, dass die deutschen Truppen nicht vorwärts kommen, die Gegenschläge der Roten Armee bringen ihnen gewaltige Verluste bei. Um das Scheitern seiner Pläne vor den Augen der Armee wettzumachen, hat Hitler Luftangriffe auf Moskau und Leningrad angeordnet. […] Wie ist dieses neue Abenteuer ausgegangen? Bisher wurde auf Leningrad keine einzige Bombe abgeworfen. […] Die deutsche Luftwaffe hat über Moskau bereits 150 Flugzeuge und ihre besten Flieger eingebüßt. Das sind die Resultate! Mit einem Fiasko endet jedes neue Abenteuer Hitlers! […] mit der Vernichtung Hitlers und seiner Bande, wird auch dieser ganze sinnlose und hoffnungslose Krieg gegen Sowjetrussland enden! Deutsche Soldaten! Denkt an Euch und Eure Familien! Denkt an das Schicksal Deutschlands, das einem Verbrecher und Abenteurer wie Hitler in die Hände gefallen ist! Macht Schluss mit dem Krieg! Geht über auf die Seite der Roten Armee!
Darunter war eingerahmt zu lesen: Dieses Flugblatt gilt als Passierschein zum Übergang auf die Seite der Roten Armee. Wer allerdings mit einem solchen Passierschein desertierte und dabei von seinen eigenen Leuten erwischt wurde, kam nicht lebend davon. Wie es einem deutschen Soldaten erging, wenn ihm der Übergang zur Roten Armee gelang, bleibt Spekulation.
Um Richard, der nach 50-jährigem Einsatz als Arzt im Spessart seine Tätigkeit aufgeben musste, weil er selber das Nachlassen seiner Kräfte spürte, war es immer stiller geworden. Die Zahl der Freunde, die ihn regelmäßig besuchten, wurde kleiner. Einer der wenigen, der immer noch gerne zu einem Gedankenaustausch bei einem Schoppen Wein vorbeikam, war Valentin Pfeifer. Der über die Landesgrenze bekannte Lehrer und Autor der „Spessartsagen“ sammelte alte Sagen der Region, schrieb sie nieder in seinem Buch und erhält sie damit für die Nachwelt. Valentin machte sich zunehmend Sorgen um seinen alten Kameraden. Doch Richard winkte lachend ab: „So schnell, alter Freund, wirst du nicht an meinem Grab stehen müssen. Es ist noch nie ein Wehsarg unter achtzig gestorben!“
Dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Reiches im Frühjahr 1945, von dem Richard sich als überzeugter Patriot so viel für sein geliebtes Vaterland versprochen hatte, folgte der völlige Rückzug des altgewordenen Doktors aus seiner bereits altersgemäß eingeschränkten Praxistätigkeit.
In ihm – wie in den meisten seiner Generation – lebte die Heimatliebe im Geist der alten Burschenschaften (im Liedtext von Hoffmann von Fallersleben 1839 geschildert) weiter:
Treue Liebe bis zum Grabe
schwör ich dir mit Herz und Hand;
was ich bin und was ich habe,
dank ich dir mein Vaterland!
Nicht in Worten, nur in Liedern
ist mein Herz zum Dank bereit,
mit der Tat will ich’s erwidern
dir in Not, in Kampf und Streit. […]
Die Härten des Krieges, von denen die Bevölkerung zwar auf dem Land in ihrem Alltag weitgehend verschont geblieben war, trafen auch seine Familie grausam. Sein hoffnungsvoller Enkel Franzkarl, der Spaßvogel der Familie, der wie er immer zu einem Scherz aufgelegt war, und den er so gerne um sich hatte, war als Kampfpilot 1944 mit seinem Jagdflugzeug über Le Havre abgeschossen worden. Er selbst hatte die Nachricht entgegengenommen. Bevor er das Bündel, das dem Schreiben an die Eltern, der Sohn sei im Kampf für das Vaterland gefallen, öffnete, nahm er es an sich, um am Abend, wenn Ruhe im Haus eingekehrt war, sich zuerst Lilo anzuvertrauen. Mit zitternden Händen, kein Wort kam über seine Lippen, übergab er ihr die Unterlagen.
Lilo ließ sich auf den nächsten Stuhl sinken und las:
An die Mutter
Der Tag ist geschwunden,
das Licht weicht der Nacht.
Vor dem Zelt wird ein Feuer entfacht.
Ich schau in die Flamme
und denke an dich.
All‘ was es gibt,
das bist du für mich.
Da taucht mir im Schimmer
dein Bild aus der Glut,
ganz wie du bist, so lieb und so gut.
Es ist so wie früher,
du redest zu mir.
Ich höre dir zu
und bin ganz bei dir.
Die Flamme wird kleiner,
sie ist fast verglimmt.
Ich merke, dass sie dein Bild von mir nimmt.
Nun trennen uns Länder.
Was macht es denn schon,
sind wir doch eins,
du und dein Sohn.
Er hatte das Gedicht auf dem Luftwaffenstützpunkt in Catania auf Sizilien verfasst und nun lag es bei dem Abschiedsbrief, den er, wie alle Soldaten, vor dem Einsatz schreiben musste für den Fall seines Todes. Wie sehr hatte Lilo - in Vorahnung des „Todeskommandos“ - ihren Bruder beschworen, sich nicht für die Luftwaffe, sondern für die Infanterie zu melden. Franzkarl war so jung, so euphorisch und fühlte sich nutzlos, nach dem Abitur nur zu Hause herumzusitzen, während sein jüngerer Bruder, sein Vater, sein Onkel und seine beiden Schwager ihm ein Vorbild waren, weil sie als „Helden im Einsatz für das Vaterland“ ihr Leben riskierten. Alle gutgemeinten Worte der Schwester hatten Franzl von seinem Vorhaben nicht mehr abbringen können. Sein jugendlicher Optimismus hatte alle aufkommenden Zweifel hinweggefegt.
Im Laufe des Krieges wurde Lilos Mann so schwer verwundet, dass er lange in Lebensgefahr schwebte und zuletzt nur - wegen noch nicht verfügbarer Antibiotika - durch die Amputation eines Beines gerettet werden konnte. Nach seinen vorhergehenden Verwundungen (Streifschuss im Genick, Gehörschädigung, Teillähmung der Hand) war er nun zu hundert Prozent kriegsversehrt. Seine Kameraden meinten scherzhaft, aber bewundernd, er sei wohl mit dem „Teufel im Bunde“, dass er dem Tode so oft entronnen sei. Die Zertrümmerung seiner beiden Knie war seine fünfte Verwundung, die die Amputation des linken Beines bis über das Knie zur Folge hatte. Nun wurde Willi als Oberstleutnant zum Kompanie-Chef der ersten Panzergrenadier-Ausbildung ernannt und als Hauptmann mit seiner Kompanie in der Kampfgruppe Schwarzrock bei Forst an der Neiße zur Abwehr der Russen eingesetzt. Dort wurde er schon am zweiten Tag beim Überfahren einer Panzermine verwundet, die irrtümlich von einer Panzer-Abwehr-Kompanie verlegt worden war. Er kam in ein Lazarett in Schleswig und von dort in die englische Gefangenschaft, wo er nach drei Monaten wieder entlassen wurde. Im Mai 1942 wurde ihm das Deutsche Kreuz in Gold und einen Monat später das Verwundeten-Abzeichen in Gold verliehen.
Das Brüderchen des dreijährigen Wolfgang kam zur Welt, während ihr Papi zur gleichen Zeit schwer verwundet im Städtischen Krankenhaus in Aschaffenburg lag. Beinahe jede Nacht mussten beim Fliegeralarm eiligst die Patienten in den Luftschutzkeller transportiert werden. Die Einschläge und die Erschütterungen waren bis in den Schutzraum zu spüren. Udo, der neue Erdenbürger, lag beschützt in Mamis Arm, die im Rollstuhl in Sicherheit gebracht wurde.
Der Sommer 1944 brachte eine weitere Schreckensnachricht: Annemaries Mann Edgar war gefallen, die kleine Tochter Inge war gerade erst fünf Jahre alt.
Kurz darauf reiste Lilo mit dem einjährigen Udo zu ihrem Mann nach Cottbus, der sich trotz seiner schweren Verletzungen wieder zum Einsatz als Ausbilder einer Kompanie gemeldet hatte. Lilo war in großer Sorge um seine Gesundheit. Die Mutter und Schwester unterstützten ihren Entschluss. Den vierjährigen Wolfgang wusste sie gut behütet im Elternhaus. Mit der kleinen Inge konnte er unbeschwert von den Kriegsereignissen im Haus und im Garten spielen.
In Cottbus war Willi in Wartestellung mit seinen Männern für den Einsatz. Neben der Kaserne stand eine Wohnung für den Kompanieführer zur Verfügung. Durch die liebevolle Pflege seiner Frau erholte sich Willi zusehends und die Freude über den kleinen Sohn, den er nun täglich sehen konnte, trug mit zu seiner Genesung bei.
Bei den täglichen Übungen und Märschen war die Kompanie unvermutet auf eine große Herausforderung gestoßen: Lilo stand in der Küche am Herd. Der kleine Udo saß zufrieden in seinem Laufställchen (ein Gitter ohne Boden) im Schatten eines Baumes im Garten und spielte mit Bauklötzen. Frei laufen konnte er noch nicht, aber das Hochziehen und sich auf diese Weise - mit seiner „Gehhilfe“ – Schritt für Schritt fortzubewegen, machte ihm sichtlich Vergnügen. Seine Mami lief zum Fenster, als sie das laute Kommando hörte: „Kompanie halt!“ Mit offenem Mund stand ihr kleiner Sohn mit seinen Händchen am Laufgitter mitten auf dem Weg und versperrte so den Marsch. Aus der kurzen Hose hing um die nackten Beinchen - ausgerechnet jetzt - die vom Inhalt verschmierte Windel. Mit großen Augen sah Udo zu den Männern auf und bewegte sich keinen Millimeter weiter. Mit eiserner Disziplin bemühten sich die Soldaten, eine ernste Miene zu behalten, als der erste aus den Reihen trat und den Kleinen samt seinem Laufställchen auf die Seite hob und in der Wiese absetzte. Mit hochrotem Gesicht lief Lilo hinaus, um rasch ihren Sohn zu holen.
Regelmäßig in der Nacht - manchmal sogar mehrmals - schreckte ein Fliegeralarm die Schlafenden aus ihrer Nachtruhe. Lilo holte den voller Angst schreienden Udo aus seinem Bettchen und eilte mit ihm in den Luftschutzkeller. Dass sie hier als einzige Frau mit ihrem Kind im Arm unter einer Kompanie Soldaten saß, war für die Männer ein tröstlicher Anblick. Wenn Udo an Mamis Brust trinken durfte, beruhigte er sich wieder und schlief bald weiter. An Heiligabend packte Lilo kleine Päckchen mit ein paar selbstgebackenen Plätzchen und Nüssen. Den Soldaten, die doch alle nur sehnsuchtsvoll an ihre Familien dachten, die jetzt ohne sie zu Hause unter dem Christbaum saßen, erschien die Frau ihres Hauptmannes wie ein Engel, als sie ihnen mit einem Händedruck und einem aufmunternden Lächeln die kleinen Geschenke überreichte.
Als im Frühjahr 1945 die Nachricht kam, dass die Rote Armee näher rücke, musste Lilo mit dem kleinen Udo aus dem Osten fliehen. Willi wollte sie in Sicherheit bringen und fand eine Gelegenheit, mit anderen Flüchtlingen auf der Transportfläche eines Lastwagens Richtung Westen zu fahren. In der ersten Nacht kamen die Flüchtenden alle in einem Lager unter. Lilo war erleichtert, dass sie Udo immer noch stillen konnte und hoffte inständig, ihre Milch würde nicht versiegen. Sie hatte sich mit ausreichend Proviant für die Reise versorgt, den sie unter der Matratze des Kinderwagens deponiert hatte. Am nächsten Tag ging‘s mit der Eisenbahn weiter. Die Gruppe war gerade eine Stunde unterwegs, als sie die tief heranfliegenden Flugzeuge hörten. Die Bremsen quietschten und die Wucht schüttelte die Fahrgäste, dass sie übereinander purzelten. Hastig mussten sie aussteigen, das Gepäck zurücklassen, ins Gelände eilen und sich unter Büschen und in den Straßengräben verstecken. Udo lag beschützt eng an die Brust seiner Mami gedrückt unter ihrem Mantel. Sie hielt ihm die Ohren zu, er sollte den Einschlag nicht hören. Dass ihr Herz vor Angst raste, konnte sie ihm nicht verbergen. Im letzten Augenblick hatte ein Mitreisender den Kinderwagen herausgezerrt. Der Zug wurde getroffen und nun mussten alle zu Fuß weiterziehen. Ein kalter Märzwind schlug ihnen ins Gesicht. Im Kinderwagen lag der kleine Udo warm gebettet im weichen Nerzcape seiner Mami. Es war ein Weihnachtsgeschenk von Willi aus seiner Zeit während des Kriegseinsatzes in Frankreich.
Lilo dachte an ihren Sohn zu Hause. Wie gut, dass wenigstens mein kleiner Wolfgang in Sicherheit ist. Er wird hoffentlich nicht aufgeschreckt werden durch die Sirenen in der Nacht … Mit solchen Gedanken versuchte Lilo, sich Trost zuzusprechen und sammelte alle Kräfte für die weitere Flucht. Nach fünf kräftezehrenden Tagen und Nächten kam sie endlich im Spessart an. Ein Lastwagen hatte sie völlig erschöpft mit dem Rest der Gruppe regelrecht von der Straße aufgelesen. Die Gewissheit, dem Zuhause so nah zu sein, gab ihr jetzt neue Kraft. Das Wetter hatte sich gebessert. Lilo atmete Heimatluft, spürte die ersten Sonnenstrahlen in ihrem Gesicht und schob - in der Vorfreude auf das Wiedersehen zu Hause - beschwingt den Kinderwagen. Sie hatte es geschafft! Erleichtert lächelte sie ihrem Sohn zu, der laut jauchzte, das Gesicht seiner Mutter so fröhlich zu sehen. Noch nie hatte Lilo einen Fußweg in einer solchen Stimmung erlebt: Tränen liefen über ihre Wangen; Dankbarkeit, Glücksgefühle und Freude ließen sie laut jubeln. Die Überraschung war groß, als sie nach etwa vier Stunden an die Haustüre klopfte. Sie fiel der Mutter in die Arme, die sie mit feuchten Augen auffing. Erst jetzt spürte Lilo, wie ihre Knie weich wurden. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Annemarie kam mit der kleinen Inge im Arm herbeigeeilt und Opapa, von Freude und Dankbarkeit so überwältigt, dass er sich unbeholfen ein paar Tränen aus den Augenwinkeln wischen musste, hielt sich einen Moment am Türrahmen fest. Endlich konnte Lilo auch ihren so sehr vermissten kleinen Wolfgang, der sie mit großen Augen anschaute, wieder in die Arme schließen. Und endlich ließ sie auch ihren Tränen freien Lauf.
Als 1945, noch kurz vor Ende des Krieges, Bomben auf Aschaffenburg, Darmstadt und Würzburg fielen, waren die Erschütterungen so gewaltig, dass in den Sommerauer Häusern die Möbel und Lampen an der Decke wackelten. Das Donnern der Bomber, die am Abend des 15. März über das Dorf flogen, verbreitete großen Schrecken. Der Angriff auf Würzburg zerstörte die Gebäude zu 90 Prozent. Die brennende Stadt färbte weithin den Nachthimmel rot. Etwa fünftausend Menschen kamen um und Tausende wurden obdachlos.
Wenn die Sirenen aufheulten, flüchteten in Sommerau alle in die Keller. Der ohrenbetäubende Lärm des Alarms sollte unvergesslich bleiben, löste noch viele Jahre bei späteren Feuerwehr-Übungsalarmen Beklemmungen aus und ließ die alten Ängste wieder lebendig werden.
Das Dorf blieb verschont, bis im April 1945 die Nachricht im Eilfeuer durchs Dorf ging, dass die Amerikaner bereits vom Main herauf unterwegs waren. Zwar wurden sie als Retter vor den bösen Russen und als Bollwerk gegen den drohenden Kommunismus erwartet, doch die Angst, dass nun der Krieg sich vor ihrer Haustüre befinden könnte, löste eine Panik aus. Da sich einige SS-Soldaten in einem Waldgebiet zwischen Eschau und Wildenstein verschanzt hatten und von dort auf die Angreifer schossen, lenkten sie den Gegenangriff auf sich. Beinahe gleichzeitig waren die Schüsse der Amerikaner von der anderen Seite, von Eichelsbach her, zu hören. Einige Häuser im Dorf wurden getroffen, ein Schuss traf den Malepartus. Der Schafhof vor dem Ortseingang brannte ab. Vor vielen Häusern flatterten - als Zeichen der Kapitulation - weiße Fahnen, eilig aus Betttüchern gefertigt. Viele Einwohner brachen in Todesangst zu Fuß auf in das etwa acht Kilometer entfernte Wildensee, wo sie sich sicher fühlten. Ganze Karawanen - auch Udo im Kinderwagen mit Mutter und Bruder Wolfgang - waren bergauf unterwegs, andere mit Leiterwagen und Fahrrädern in Begleitung ihrer Hunde. Sie mussten vorbei am Waldstück Wolf, wo sich die SS versteckt hielt und riskierten, von den Amerikanern beschossen zu werden. Das furchterregende Donnern der einfahrenden Panzer trieb die verbliebenen Einwohner in ihre Verstecke in den Kellern.
Zwei Soldaten hämmerten mit ihren Gewehrkolben an die Haustüre. Beherzt öffnete Opapa ihnen. Er wurde auf die Straße kommandiert und in gebrochenem Deutsch und barschem Ton fuhr ein Sergeant ihn schroff an. Opapa hörte immer wieder das Wort „Nazi“ bis er verstand, dass ein Sommerauer den durch die Straße fahrenden Jeeps zugerufen hatte: „Hier wohnt ein Nazi!“ Richard sprach sehr gut englisch und als der Amerikaner erfuhr, dass er einen alten erfahrenen Arzt vor sich hatte, nutzte er die Gelegenheit, seinen medizinischen Rat einzuholen. Zuletzt stellte sich noch heraus, dass der GI, ebenso wie Mary, in St. Louis geboren war. Die Situation entspannte sich und zur Erleichterung aller verlief dieser Tag glimpflich.
Nach außen hin war die Familie zwar bemüht, das Bild der Helden in der Familie, Edgar und Franzkarl, die für Vaterland und Führer im Kampf fielen und Willi, dem zu hundert Prozent Kriegsversehrten, aufrechtzuhalten. Sie alle waren überzeugt gewesen - wie viele andere - ihre patriotische Pflicht für die Ehre des Vaterlandes zu erfüllen. Ihre jugendliche Begeisterungsfähigkeit sah Richard nun schamlos ausgenutzt und geopfert. Doch wenn er in der Dämmerung alleine im Garten saß - es waren auch nach fünfundzwanzig Jahren noch die Stunden im vertrauten Gespräch mit seiner verstorbenen Frau am Ende jedes Tages - wurden der Schmerz und die Trauer so groß, dass er begann zu ahnen, welchem Wahn auch er - wie viele andere - verfallen war. Hitlers Parolen, mit denen er die Massen verführte: „Ihr seid das wahre Herrenvolk! Ich verspreche euch goldene Zeiten!“, klangen jetzt nur noch wie Hohn in seinen Ohren. Wie alle Gewaltherrscher hatte auch Hitler nur so lange vom Frieden für das Vaterland gesprochen bis er seine Armeen aufgerüstet wusste. Und die Dimension der schier unfassbaren Schreckensbilder der Schlachten, der Leiden der Soldaten, der Opfer unter der Zivilbevölkerung, der traumatisierten Rückkehrer und der Familien, denen der Krieg die Söhne, Väter und Ehemänner geraubt hatte, schien unfassbar. Dass zudem mehr und mehr die Gräueltaten der Nazis an der jüdischen Bevölkerung ans Licht kamen, hatte ihn tief getroffen. Zum ersten Mal hörte er Wörter wie Gaskammern, Sonderkommandos, Krematorien. Wenn er in die fröhlichen Gesichter seiner Urenkelkinder schaute, blickte er in Millionen unschuldiger Kinderaugen. Der Mord an diesen Kindern, auch den vielen ungeborenen ließ ihn nicht mehr los. Die Bilder kreisten unablässig in seinem Kopf bis er glaubte, den Verstand zu verlieren.
Bis zum letzten Augenblick war der Glaube an den verheißenen „Endsieg“ wie ein Dogma, niemand in der Familie hatte gewagt, es anzuzweifeln. Der Blick auf die ganze Dimension dieses Krieges, die millionenfachen Verbrechen, die erst nach und nach bekannt wurden, u. a. im Gesprächsaustausch mit dem befreundeten Schlossers Leo (mein Vater), der den verbotenen englischen Sender BBC heimlich abhörte, erschütterten schlagartig sein Bild vom Nationalsozialismus. Die quälenden Gedanken, die ihn keinen Schlaf mehr finden ließen in der Nacht, verfolgten ihn. Was wird nun werden aus meinem geliebten Vaterland? Wer wird Rechenschaft ablegen für diese Verbrechen? Wie werden unsere Kinder und Enkelkinder mit diesem Trauma ihr Leben gestalten können, dem Gefühl der Scham, der Hypothek, die wie eine „Erbsünde“ auf ihnen lasten wird? Er fand nicht mehr die Kraft über die Gedanken, die ihn bewegten und bedrückten, mit seinen Kindern zu reden, nicht einmal mit seinen Freunden, die er immer seltener sah, weil er sich mehr und mehr zurückgezogen hatte. Richard war ein Greis, vom eigenen Schatten verfolgt. Wie in ihm breitete sich in einer ganzen Generation ein Schweigen über den pervertierten Nationalismus aus, das das Grauen unter einem dicken Nebelschleier verbarg, unwissend, dass dieses Schweigen - wie eine Verewigung des Verbrechens - die Türe vor der Wahrheit verschloss und sie aufreißen kann zu einer Neuauflage. Jahrzehntelang war es, als wäre für die meisten der Faden des Gedächtnisses gerissen und das Grauen hinterließ eine ganze traumatisierte Generation.
Martin Luther, der große Reformator des Christentums galt als zentrale Persönlichkeit seit Richards Kindheit in der Familie. Sein markantes Portrait hing an der Wand des Arbeitszimmers seines Vaters, wie seines Großvaters, der ebenso Pastor war, und wenn der Vater ihn zitierte, war es für den kleinen Richard, als kämen die Worte aus Luthers Mund selbst. Er sah die Fehlentwicklungen in der Kirche und wollte sie beseitigen, diese in ihrem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Entgegen seiner Absicht war es zu einer Kirchenspaltung gekommen. Luthers Bibelübersetzung gilt bis heute als große Leistung. Die spätere Neuorientierung der politischen Verhältnisse Deutschlands und Europas wären ohne die Reformation nicht zu erklären.
Luthers antisemitische Haltung basiert auf seiner Theologie und nicht auf rassistischen Einstellungen. Seine ablehnende Haltung dem jüdischen Volk gegenüber stand in direktem Zusammenhang mit der Legende, die seit zweitausend Jahren von höchsten moralischen Autoritäten gepredigt wurde: Die Juden trügen die Schuld, dass Jesus gekreuzigt worden sei. Der Vorwurf, einen „Gottesmord“ begangen zu haben, sollte als Rechtfertigung dienen für die Hetzjagd und schließlich die Ermordung der Juden. Dass die Römer die Verantwortung für den Tod des Mannes aus Nazareth tragen, hätten die Historiker und Theologen allerdings von Anfang an wissen können, wenn sie die Passionsgeschichten kritischer auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft hätten. So räumte auch Luther nicht dieses Missverständnis aus.
Die Verdrehungen der geschichtlichen Abläufe bis zur Hinrichtung Jesu am Kreuz hatten bereits durch die Aufzeichnungen der vier Evangelisten begonnen, die nicht ahnen konnten, welche verheerenden Auswirkungen dies haben sollte. Wer sich die Botschaften Jesu, die er uns durch sein Beispiel hinterlassen hat, zu Herzen nimmt, wird erkennen, dass er die Nächstenliebe, die alle Lebewesen, die ganze Natur einschließt, furchtlos über alle irdischen Gesetze an die erste Stelle unseres Menschseins gestellt hat.
Bereits in der Kindheit hatte Richard von den „Lügen der Juden“ und antijüdische Äußerungen gehört, über die Luther eine Schrift herausgegeben hatte. Von seinem Vater wusste er, dass Luther ursprünglich sich mit den Juden gegen die Katholiken verbünden wollte. Seine Bemühungen, die Juden zu bekehren, scheiterten. Er wollte ihnen die unsinnige Narrheit des jüdischen Glaubens beweisen und ließ ihnen nur die Wahl zwischen Taufe und Vertreibung. Zunächst beschrieb Luther den Hochmut der Juden. Sie hielten sich aufgrund ihrer Abstammung für Gottes auserwähltes Volk, obwohl sie doch, wie alle Menschen, als Sünder unter Gottes Zorn stünden. Die Juden seien blutdürstig, rachsüchtig, das geldgierigste Volk, leibhaftige Teufel, verstockt. Ihre verdammten Rabbiner verführten die christliche Jugend, sich vom wahren Glauben abzuwenden. Luther zitierte das Neue Testament Mt 12,34: Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Gutes tun sie aus Eigennutz, nicht aus Liebe […]. - Sie lassen uns in unserem eigenen Land gefangen und lassen uns arbeiten […] sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Er appellierte an den Sozialneid der Bevölkerung, um die „Schutzgeldzahlungen“ der Juden zu beenden. Dazu forderte er, ihre Synagogen niederzubrennen, ihre Häuser zu zerstören etc. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass es den Christen verboten sei, die Juden zu verfluchen und persönlich anzugreifen obwohl er sie gerne eigenhändig erwürgen würde. Falls sich seine sieben Schritte nicht durchführen ließen, so bleibe nur, die Juden aus den evangelischen Ländern wie tolle Hunde zu verjagen. Damit sprach Luther den Juden die Menschenwürde ab, die er ihnen noch 1523 zugebilligt hatte. Er wies die evangelischen Pfarrer und Prediger an, seine Ratschläge unabhängig vom Verhalten der Obrigkeit zu befolgen, ihre Gemeinden vor jedem Kontakt mit Juden und jeder Nachbarschaftshilfe für sie zu warnen und verlangte die Weitergabe und ständige Aktualisierung seiner antijüdischen Schriften.
1931 gab Karl-Otto v. d. Bach die Schrift „Luther als Judenfeind“ heraus, in der er in judenfeindlichen Lutherzitaten eine völkische Bedeutung der Reformation gegen die jüdische Plage sah. Diese Ansichten wurden Gemeingut in völkischen und rassistischen Teilen des Protestantismus.
Adolf Hitler stilisierte Luther beim NSDAP-Parteitag 1923 für den geplanten Hitlerputsch zum Vorbild des Führerprinzips: Er habe seinen Kampf gegen „eine Welt von Feinden“ damals ohne jede Stütze gewagt. Dieses Wagnis zeichne einen echten heldischen Staatsmann und Diktator aus. Das NSDAP-Blatt „Der Stürmer“ vereinnahmte ab 1923 oft ausgewählte isolierte Zitate aus dem Neuen Testament und von christlichen Autoren, darunter Luther.
Aber es gab auch andere Stimmen: Pastor Hermann Steinlein (Innere Mission Nürnberg) erklärte, Luther sei keine unfehlbare Autorität. Eduard Lamparter erklärte 1928 für den Verein zur Abwehr des Antisemitismus, Luther sei parteipolitisch zum Kronzeugen des modernen Antisemitismus vereinnahmt worden und sei 1523, auf dem Höhepunkt seines reformatorischen Wirkens, für die Unterdrückten, Verachteten und Verfemten in so warmen Worten eingetreten und hätte der Christenheit die Nächstenliebe als die vornehmste Pflicht auch gegenüber den Juden eindringlich ans Herz gelegt. Prominente evangelische Theologen empfahlen allen Pastoren, die Erklärung als maßgebende Position der evangelischen Kirche zu verlesen: Antisemitismus sei eine Sünde gegen Christus und mit dem christlichen Glauben unvereinbar.
Der Deutsche Evangelische Kirchenbund begrüßte dennoch die Machtergreifung des NS-Regimes am 30. Januar 1933 mit großer Begeisterung. Vertreter, wie Otto Dibelius - als glühender Monarchist, Antidemokrat und Antisemit - lobten beim „Tag von Potsdam“, am 21. März 1933, die Beseitigung der Weimarer Verfassung als „neue Reformation“ und stilisierte Hitler zum gottgesandten Retter des deutschen Volkes. Dieser Tag ging in die Geschichte ein, da in der Garnisonskirche der erste Reichstag nach der Machtübernahme eröffnet wurde und der neue Reichskanzler Adolf Hitler sich vor Reichspräsident Hindenburg verneigte.
In der NS-Zeit wurden Luthers Judentexte neu herausgegeben. 1937 und 38 bekräftigten zwei Artikel im „Stürmer“, Luther müsse als unerbittlicher und rücksichtsloser Antisemit gelten und die evangelischen Pastoren müssten dies viel stärker predigen. Im November 1937 beim „Rezitationsabend“ im Residenztheater in München zur Propaganda-Ausstellung „Der ewige Jude“ wurden zuerst Auszüge aus Luthers Schriften verlesen. Gegen die November-Pogrome protestierte keine Kirchenleitung. Landesbischof Walther Schultz forderte alle Pastoren Mecklenburgs in einem „Mahnwort zur Judenfrage“ am 16. November 1938 auf, Luthers „Vermächtnis“ zu erfüllen, damit die „deutsche Seele“ nun keinen Schaden erleide und die Deutschen […] alles daran setzten, eine Wiederholung der Zersetzung des deutschen Reiches durch den jüdischen Ungeist von innen her für alle Zeiten unmöglich zu machen. Adolf Hitler, nicht „der Jude“ habe am deutschen Volk Barmherzigkeit getan, so dass ihm und seinem – dem deutschen Volk aufgetragenen - Kampf gegen die Juden, die Nächstenliebe, Treue und Gefolgschaft der Christen zu gelten habe. Bischof Martin Sasse stellte in seinem weit verbreiteten Pamphlet Martin Luther über die Juden: Weg mit ihnen! am 23. November 1938 ausgewählte Lutherzitate so zusammen, dass die nationalsozialistische Judenverfolgung als direkte Erfüllung von Luthers Forderungen erschien. Die von elf evangelischen Landeskirchen unterzeichneten „Leitlinien“ vom März 1939 behaupteten, der artgemäße Nationalsozialismus setze Luthers Reformen politisch fort. Der Theologe Theodor Pauls forderte, die Kirche müsse mit dem Evangelium für das deutsche Lebensgesetz gegen die jüdische Macht des Verderbens eintreten, der Staat müsse dieses Lebensgesetz durchsetzen und Gottes Zorn gegen die Juden vollstrecken und untermauerte dies mit Luther-Zitaten. Am 17. Dezember 1941 erklärten sieben evangelische Landeskirchen, der Judenstern entspreche Luthers Forderung, schärfste Maßnahmen gegen die Juden zu ergreifen und sie aus deutschen Landen auszuweisen.
Die evangelischen Kirchenführer ließen sich in vorauseilendem Gehorsam bereitwillig zu Helfershelfern der Nazis instrumentalisieren, tauschten das Neue Testament mit der Bergpredigt gegen „Mein Kampf“. Der frühere US-Präsident Wilson, der sich mehrmals während des Ersten Weltkrieges für Friedensverhandlungen eingesetzt hatte, wäre als herausragendes Vorbild für eine christlich orientierte Politik gewesen.
Luthers Antisemitismus war in klerikalen Kreisen kein Einzelfall. Der ehemalige Zisterzienser-Mönch und Landsmann von Adolf Hitler, Adolf J. Lanz aus Wien (Hochstapler Jörg Lanz von Liebenfels), gründete 1900 einen Zusammenschluss rassistischer Deutsch-Österreicher, den religiösen „Neutempler-Orden“, der die arische Rasse - als die von Gott auserwählten Herrenmenschen - glorifizierte. Als glühender Antisemit fühlte er sich den „Alldeutschen“ verbunden. Lanz legte den Sündenfall des Alten Testamentes so aus, dass die ursprünglich göttlichen Arier sich mit Tieren vermischt hätten und daraus minderwertige Rassen hervorgegangen seien, die zur Reinhaltung des Blutes zu eliminieren wären (Eugenik). Sein menschenverachtendes Frauenbild drückte sich darin aus, dass arische Frauen nur als „Zuchtmütter“ wertvoll seien. Inwieweit sich Hitler von Lanz inspirieren ließ, ist unter Historikern umstritten. Bei SS-Chef Heinrich Himmler dürften neben dem Rassenwahn auch die okkulten Thesen von Lanz auf besonders fruchtbaren Boden gefallen sein (er glaubte die Reinkarnation König Heinrichs zu sein, suchte nach dem Heiligen Gral, gründete die „SS-Herrenmenschen-Zuchtstation Lebensborn“, baute die Wewelsburg zu einer rituellen SS-Hochburg aus) und konnte in diesem Wahn skrupellos den millionenfachen Massenmord organisieren. Wie schizophren, barbarisch und menschenverachtend Himmler war, zeigt eine Rede vor seinen Mordschergen der Sonderkommandos am 4. Oktober 43 in Posen: „Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. ‚Das jüdische Volk wird ausgerottet‘ sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm Ausschaltung der Juden; Ausrottung machen wir. Und dann kommen sie alle an, die braven 80 Millionen Deutschen und jeder hat seinen anständigen Juden. Es ist klar, die anderen sind Schweine, aber dieser ist ein prima Jude. Von allen die so reden, hat keiner zugesehen und durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100, 500 oder 1000 Leichen daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche, ‚anständig‘ geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes Ruhmesblatt unserer Geschichte“. Dass Himmler mit diesen Zahlen untertrieben hat, zeigt stellvertretend das Massaker in der Schlucht von Babyn Yar, Nähe Kiew, bei dem - mit „logistischer“ Unterstützung der Wehrmacht - innerhalb 36 Stunden 33.000 Juden (Männer, Frauen und Kinder) von seinen Schergen erschossen wurden.
Einzelne Vertreter verschiedener Kirchen prangerten in ihren Predigten die Judenverfolgung oder Konzentrationslager an und erhielten daraufhin Rede- und Schreibverbot oder wurden selbst in Konzentrationslagern inhaftiert. Einige Theologen, wie Niemöller und Bonhoeffer, leisteten aktiven und passiven Widerstand. Die Württembergische Pfarrhauskette, organisiert durch Theodor Dipper, war eine Untergrundorganisation evangelischer Pfarrer zur Rettung von Juden. Die Mitglieder der Weißen Rose (Scholl, Probst, Graf, Schmorell) druckten und verteilten im Juni 1942 bis zum Februar 43 Flugblätter. Sie handelten nach eigener Aussage aus christlicher Überzeugung und wurden ebenso wie Bonhoeffer hingerichtet. Doch allen Gruppen des Widerstandes war bewusst, dass sie eine verschwindend kleine Minderheit der Bevölkerung darstellten. Sie besaßen keine realistische Chance, das System grundlegend zu ändern. Eine Unterstützung durch die Alliierten erhielt der deutsche Widerstand nicht, vielmehr führte die Forderung einer bedingungslosen Kapitulation zu einer Solidarisierung mit der Führung und gab dem Widerstand keine Möglichkeit, durch eine Machtübernahme die Friedensbedingungen zu verbessern.
Fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf der Synode von Weißensee 1950 leitete die Evangelische Kirche in Deutschland einen Bruch mit dem Antijudaismus ein, schwieg aber lange zu Luthers Judenaussagen. 1969 nahm der Lutherische Weltbund erstmals offiziell Stellung zu Luthers Judentexten: Er habe Juden darin auf grausame und gefährliche Weise angegriffen und damit seiner Kreuzestheologie widersprochen. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum sollte sich die Evangelische Kirche der Klärung von Luthers antijüdischer Grundhaltung stellen. „Das weitreichende Versagen der Evangelischen Kirche gegenüber dem jüdischen Volk erfüllt uns mit Trauer und Scham.“ Der Wissenschaftliche Beirat der EKD erklärte in seiner Orientierungsschrift: Völkische Antisemiten hätten Luthers antijüdische Schriften mit ihrem rassenbiologischen Programm verbunden und für die nationalsozialistische Judenpolitik benutzt. Daran hätten sich „je länger, je mehr“ auch evangelische Theologen beteiligt. Heute gelten Luthers Judenschriften als schlechterdings unvereinbar mit seiner eigenen Theologie und dem Neuen Testament.
Dass sich nicht nur in Deutschland über mehrere Generationen ein tiefsitzender Groll gegen jüdische Bürger aufgebaut hatte, sah Richard bestätigt durch seine eigenen unfreiwilligen Beobachtungen in den letzten Jahren während seiner Hausbesuche im Spessart. Er hatte nicht nur einmal gesehen, wie ein jüdischer Kaufmann in ein Haus ging, das mehr einer Hütte glich, während kurz darauf der Besitzer durch die Hintertüre verschwand. Richard wusste, dies war nicht nur für einen einzigen Schuldner die letzte Möglichkeit, durch seine Ehefrau den angelaufenen Zinsen zu entkommen. Sich Geld zu leihen gegen einen Schuldschein war manchmal in der Not die Rettung vor dem Verhungern. Und wenn einige Juden Zinsen verlangten, die die Schuldner nicht begleichen konnten, wuchs der Unmut. Es hieß, die Zinsen seien für die Juden wie für die Bauern die Egge und der Pflug. Betrügereien durch Deutsche - wie legalisierter Diebstahl jüdischen Eigentums in der NS-Zeit - wurden dagegen verdrängt, da dies nicht in das Bild des angeblich „ehrlichen und aufrechten Deutschen“ passte.
Seit vielen Jahren hatte sich ein Neid-Antisemitismus in einigen Teilen der Bevölkerung entwickelt, der sich ausgebreitet hatte. Die von Hitler angekündigte „Juden-Vernichtung“ nahm kaum jemand wörtlich, wie auch die Reichstagsrede vom 30. Januar 39: „Wenn es dem internationalen Finanzjudentum gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ - und im Jahre 1941/42 über die Endlösung: „Wenn wir diese Pest ausrotten, so vollbringen wir eine Tat für die Menschheit […] Wir werden gesund, wenn wir den Juden eliminieren.“
Kaum jemand war in der Lage, sich das Grauen des beginnenden Holocaust vorzustellen. Propagandafilme der Nazis zeigten demonstrativ Filmaufnahmen vom Lager Theresienstadt, in denen der Tagesablauf der jüdischen Familien wie in einem Ferienlager, sogar mit eigenem Gemüsegarten und Sportprogramm, zu sehen war. Die Bilder sollten die Bevölkerung, die mehrheitlich das Aussiedeln der Juden aus Deutschland begrüßten, täuschen und von der grausamen Wahrheit ablenken. Im krassen Gegensatz dazu wurden filmisch auf perfide Weise die grauenhaften Verhältnisse im Warschauer Ghetto für ein verfälschtes Bild „des Juden“ ausgeschlachtet, mit dem Tenor, er sei ein parasitärer, verlauster, schmutziger und unkultivierter Untermensch. Dieser hätte damit, nach der Lesart des angeblich zivilisierten arischen Herrenmenschen, in einem neuen Großdeutschen Reich kein Lebensrecht mehr. Für diese sog. „Parasiten des Deutschen Reichs“ blieb als logische Konsequenz nur die Endlösung mit Zyklon B.
Auch die Kirche war informiert, wie ein Appell vom 16. Juli 43 des Bischofs Wurm - der schon 1940 gegen das Euthanasie-Programm protestierte - an Hitler beweist: […] Die Liebe zu meinem Volk, dessen Geschicke ich als 75-Jähriger seit vielen Jahrzehnten mit innerster Anteilnahme verfolge und für das ich im engsten Familienkreis schwere Opfer gebracht habe, drängt mich aber dazu, es noch einmal mit einem offenen Wort zu versuchen. […] Für die lebenden, wie für die gefallenen evangelischen Christen Deutschlands wende ich mich als ältester evangelischer Bischof, des Einverständnisses weiter Kreise in der evangelischen Kirche gewiss, an den Führer und die Regierung des Deutschen Reiches. Nachdem die dem deutschen Zugriff unterliegenden Nichtarier in größtem Umfang „beseitigt“ worden sind, muss befürchtet werden, dass nunmehr auch die bisher noch verschont gebliebenen „privilegierten Nichtarier“ erneut in Gefahr sind, in gleicher Weise behandelt zu werden. Insbesondere erheben wir eindringlichen Widerspruch gegen solche Maßnahmen, die die eheliche Gemeinschaft in rechtlich unantastbaren Familien und die aus diesen Ehen hervorgegangenen Kinder bedrohen. Diese Absichten stehen, ebenso wie die gegen die anderen ergriffenen Vernichtungsmaßnahmen, im schärfsten Widerspruch zu dem Gebot Gottes und verletzen das Fundament alles abendländischen Denkens und Lebens: Das gottgegebene Urrecht menschlichen Daseins und menschlicher Würde überhaupt. In der Berufung auf dieses göttliche Urrecht des Menschen schlechthin erheben wir feierlich die Stimme, auch gegen zahlreiche Maßnahmen in den besetzten Gebieten. Vorgänge, die in der Heimat bekannt geworden sind und viel besprochen werden, belasten das Gewissen und die Kraft unzähliger Männer und Frauen im deutschen Volk auf das schwerste; sie leiden unter manchen Maßnahmen mehr, als unter den Opfern, die sie jeden Tag bringen. Und in einem weiteren Appell im Dezember 1943: […] dass wir als Christen diese Vernichtungspolitik gegen das Judentum als ein schweres und für das deutsche Volk verhängnisvolles Unrecht empfinden. Das Töten ohne Kriegsnotwendigkeit und ohne Urteilsspruch widerspricht auch dann dem Gebote Gottes, wenn es von der Obrigkeit angeordnet wird, und wie jedes bewusste Übertreten von Gottes Geboten rächt sich auch dies früher oder später. Diese Appelle wurden von Hitler nicht beantwortet und blieben vorerst ohne Folgen, da sie nicht in den Kirchen verkündet wurden. 1944 erhielt Bischof Wurm allerdings Schreib- und Redeverbot. Über den Rundfunksender London wurden die Appelle jedoch in norwegischer Sprache verbreitet. (Der Originalbrief kann im Internet unter „evangelischer Widerstand“ nachgelesen werden.)
Dass viele Deutsche den späteren Verschwörungstheorien der Holocaustleugnung gerne Glauben schenkten, ist aus psychologischer Sicht nicht verwunderlich. Damit konnte man den unvorstellbaren Vorwurf, Hitler sei ein millionenfacher Massen- und Kindesmörder gewesen, als Lüge der Siegermächte darstellen und sein eigenes Gewissen beruhigen, Hitler als von Gott gesandten Retter der deutschen Nation stilisiert zu haben und ihm bedingungslos gefolgt zu sein. („In Auschwitz wurde niemand vergast“, Friedrich-Ebert-Stiftung, entlarvt sechzig häufige Lügen, s. Literaturverzeichnis.)
In Abwandlung des Songtextes von Marlene Dietrich "Sag mir, wo die Blumen sind ...", wird die Frage nach dem Verbleib der Juden gestellt: "Sag mir, wo die Juden sind, wo sind sie geblieben? Über Gräber weht der Wind. Wann wird man je versteh'n?"
Die Nazis hatten eine "doppelte Buchführung" in Form eines eigenen Registers. Ihre Namen müssten in den weltweiten Datenbanken oder in den Opferdatenbanken zu finden sein.
Jeder einzelne unserer Generation muss sich allerdings die Frage stellen, ob er selbst der Verführung widerstanden hätte. Ein weiterer Versuch, das eigene Gewissen zu entlasten ist der Verweis auf Kriegsverbrechen anderer Völker. Der Angriffs- und Vernichtungskrieg gegen Russland forderte den höchsten „Blutzoll des Zweiten Weltkrieges“ mit mindestens zwanzig Millionen Toten in der Sowjetunion (gegenüber sechs Millionen Deutscher). Dieser Zusammenhang als Ursache für russische Racheakte wurde und wird einfach unter den Teppich gekehrt und nur von den „bösen“ Russen gesprochen.
Der alte Spessartdoktor
Wie eine gefällte Eiche, deren Blätter und Zweige kraftlos wurden und langsam verdorrten, schwand Richards Vitalität. Ihm war, als ob ein Mühlstein auf seiner Brust läge. Gebeugt und mit schwerem Schritt stützte er sich auf seinen Stock. Er, der zeitlebens vor Ideen und Humor gesprüht und meist mehrere Projekte gleichzeitig verfolgt hatte, wurde immer schweigsamer, als fehlten ihm auf einmal die passenden Worte. Immer öfter fand Else ihren Vater gedankenverloren in seinem Lehnstuhl sitzend, den Kopf auf seine Hand gestützt, als ob er ihm durch all die verwirrenden Gedanken zu schwer geworden wäre. Sein langer Bart war weiß geworden wie sein schütteres Haar. Seine hellen blauen Augen hatten ihren Glanz verloren. Er, der immer so gerne Konversationen geführt, dem man in geselliger Runde gerne zugehört hatte, wurde immer stiller. Er, der von einer plötzlichen Inspiration, selbst von jedem neuen Gedankenblitz so berauscht schien, dass er nie an seinem Erfolg gezweifelt hatte und dem es so mühelos gelungen war, seine Umgebung damit in den Bann zu ziehen, dass es der eigenen Familie manchmal sogar zu anstrengend wurde, ihm in seinen Gedankengängen zu folgen, wurde mit einem Mal bei alltäglichen Dingen unsicher. Richards Sprachlosigkeit wurde mehr und mehr zu einem Gefängnis, in das die Familie kaum noch eindringen konnte.
Dem Zusammenbruch seines Weltbildes, der Richard in seinen Grundfesten erschütterte, folgte ein Rückzug, in dem er sich immer häufiger nur noch danach sehnte, die quälenden Gedanken vergessen zu können. Wie gut, dass Mary diese Schreckenszeit nicht mehr erleben musste. Nach und nach legte sich der besänftigende Schleier des Vergessens über seine Verzweiflung und erlöste mit der Zeit die quälende Unruhe in ihm.
Durch die Dominanz der väterlichen Pastorenfamilie mit dem lutherischen Antisemitismus und der evangelischen Erziehung seiner eigenen Kinder stand dieser Geist der Familie Wehsarg in der Villa Elsava im Vordergrund. Im Dritten Reich wurde die gegensätzliche liberal-demokratisch katholische Einstellung der Familie Wagner verschwiegen. Sie passte nicht in den Zeitgeist und wurde den nachfolgenden Generationen so lange nicht vermittelt, bis die Familiengeschichte des Dr. Franz Wagner ans Licht geholt wurde.
Annemarie bemerkte als erste, dass Opapa auffällig oft rastlos mit hängendem Kopf durch die hohen Räume der Villa ging, als ob er etwas suchen würde. Auf ihre Frage schüttelte er nur stumm den Kopf und schaute zu Boden. Ein andermal redete er zusammenhanglos von der Eisenbahn und als Mie auf ihn einging, sich bei ihm einhakte und ihn auf dem Weg „zur Bahn“ begleitete, indem sie die „Reise nach Jerusalem“ mit ihm spielte, mehrmals mit ihm im Salon um den großen Tisch ging, um sich dann - wie im Abteil des Zuges - auf zwei nebeneinander stehende Stühle zu setzen, drückte er mit einem glücklichen Lächeln wortlos die Hand seiner Enkeltochter. Sie wusste, jetzt fuhr er in seiner geliebten Spessarteisenbahn.
Bevor Lilo zurückging in die Küche schaute sie durch das hohe Fenster zum Park und konnte gerade noch sehen, wie Wolfgang eine Ziege an der Leine führte, die jüngere trottete hinterher und Udo versuchte sie mit lautem „Maxi“-Rufen und einem Stock in die richtige Richtung zu treiben. Sie ließen sich nicht die Zeit, ihre Schuhe anzuziehen und liefen barfuß auf die Wiese zu, die hinter dem Park lag. Ein Anblick, an dem sich Lilo gar nicht sattsehen konnte. Wie gut, dass die beiden heute ihre robusten kurzen Lederhosen angezogen haben! Inge, die gerade eben noch mit der kleinen Katze gespielt hatte, bemühte sich, sie einzuholen.
Rechtzeitig zum Abendessen kamen die drei mit einem Mordshunger zurück. Schweigend, wie von Papi gefordert, saßen sie am Tisch. Ihre Ungeduld konnten sie allerdings kaum zügeln. Udo baumelte so heftig mit den Beinen unter dem Tisch, dass er an die Stuhlbeine schlug und ein lautes rhythmisches Stakkato die Stille unterbrach. Inge half ihrer Mutter und Tante Lilo in der Küche. Wolfgang rutschte auf seinem Platz hin und her, bis Papi einen strafenden Blick über den Tisch schickte und mit energischem Blick erwartungsvoll in Richtung Küche schaute. Wo blieb Lilo nur mit dem Abendessen?
Opapa, der sich nach seinem Mittagsschlaf regelmäßig in den Malepartus zurückzog, um ungestört seine Pfeife mit dem eigenen Tabak zu genießen, den er selbst im Garten angepflanzt hatte und der zum Trocknen auf einer langen Leine im Speicher hing, war noch nicht zurückgekommen, obwohl es schon dunkel wurde. Seine Tochter fand ihn gedankenversunken im Lehnstuhl am Fenster. Sanft berührte sie ihn an der Schulter: „Papa, hast du noch keinen Hunger? Komm, lass uns ins Haus gehen!“ Als er aufschaute, schien sein Blick ins Leere zu wandern. „Ich warte noch auf mein Knüddelchen“, flüsterte er kaum hörbar. Else erschrak. Wurde ihr Vater jetzt noch verwirrter? Dann fasste sie sich, half ihm auf, hakte sich bei ihm unter und bemühte sich, heiter zu wirken: „Du weißt doch, Papa, wo sie ist, wir gehen zu ihr!“ Seit dem Tod ihrer Mutter vor nun bereits sechsundzwanzig Jahren ging ihr Vater nie schlafen ohne zuvor an die Vitrine zu treten, auf der die Urne mit der Asche seiner verstorbenen Frau auf einem zarten Spitzendeckchen stand. Heute stützte er sich schwer mit einer Hand auf seinen Stock und der anderen auf dem tischhohen Sockel ab. Nachdenklich beobachtete Else, wie ihr Vater sehr lange seinen Blick auf dem Selbstportrait seiner Frau ruhen ließ.
Bevor sie am Abend zu Bett ging, öffnete sie leise die Türe zum Zimmer ihres Vaters. Sie war besorgt, weil er keinen Appetit hatte und das Abendessen stehenließ. Lisbeth, das Hausmädchen hatte eigens einen Grießbrei gekocht, den er so gerne aß, aber an diesem Abend schien ihn auch der feine Zimtduft, der sich aus der Küche verbreitete, nicht zu locken. Im Lichtschein des Flures sah Else, dass ihr Vater mit offenen Augen und wie zum Gebet verschränkten Händen im Bett lag. Vorsichtig trat sie zu ihm und strich ihm über die Schulter: „Geht es dir besser, Papa?“ Sie war nicht sicher, ob er sie überhaupt hörte. Er schien mit seinen Gedanken weit weg zu sein. Else setzte sich auf die Bettkante und wartete. Richard hatte die Augen geschlossen und nach ein paar Atemzügen, die ihm sichtlich Mühe machten, hörte sie ihn flüstern: „Ich komm‘ bald zu dir, mein Liebes!“
Noch vor ein paar Wochen hatte Opapa mitgeholfen beim Aufstapeln des Holzes für den Heizvorrat im Winter. Trotz seiner Beinamputation und der anderen - noch lange nicht verheilten - Kriegsverletzungen bemühte sich Willi, einen ganzen Ster Holz mit dem Beil in entsprechende Scheite zu hauen. Hochdekoriert war er vom Krieg zurückgekommen. Doch nun war er nur einer von vielen Kriegsinvaliden, ein junger Mann, kurz vor seinem einunddreißigsten Geburtstag, der die letzten Kräfte mobilisierte, um für seine Familie da zu sein. Doch der so sehnlich Erwartete, der endlich Heimgekehrte, schien oft nur körperlich anwesend zu sein. Lilo konnte es an seinen Augen ablesen, dass er das Erleben im Krieg noch nicht hinter sich gelassen hatte. Sie spürte seine stumme Ablehnung, wagte nicht weiter zu fragen, wenn er nur von der Verbundenheit mit seiner Kompanie und seinem Burschen berichtete. Seine aufkommenden Gedanken, erst jetzt, wo der Krieg beendet war, die Szenen, die ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf aufschrecken ließen, quälten ihn erbarmungslos. Wie es ihm möglich war, auf Menschen zu schießen, obwohl er wusste, das vorsätzliche Töten ist Mord und durch den Krieg war es mit einem Mal in Heldentum verwandelt, erschütterte ihn bis ins Mark. Schweißgebadet lag er Nacht für Nacht auf seinem Kissen. Seine Schweigsamkeit, seine Ungeduld, sein Jähzorn waren für Lilo und die beiden Söhne erschreckend. Willi war als Fremder zurückgekommen.
Nach dem Rausch des Wiedersehens bestimmten rasch die Sorgen um die Nahrung den Alltag. Lilo war täglich mit Wolfgang bei Bauern auf dem Kartoffelacker, um den Jahresvorrat anzulegen. Auch nach der Ernte waren die beiden nochmal unterwegs zum „Stoppeln“. Willi sortierte jeweils aus, was sie mitbrachten und sorgte für die angemessene Lagerung, damit keine Fäule entstehen konnte. Es musste Heu gemacht werden für die Ziegen, damit sie für die Kinder genügend Milch (nach Opapas Anweisung, der sie für nahrhafter und bekömmlicher hielt als Kuhmilch) geben konnten. Die neuen Hühner entpuppten sich als Hähne und so war die Sorge groß, überhaupt genügend Eier zu bekommen. Willi bat seine Schwester, zwei Hähne gegen Hühner einzutauschen. Von ihr hatte er auch eine junge Ziege und drei Hasen bekommen. Von denen allerdings schon bald zwei geschlachtet werden mussten, noch bevor sie Fleisch ansetzen konnten, weil sie durch eine Unverträglichkeit des Futters plötzlich gefährlich aufgebläht waren.
Als am Morgen alle zum Frühstück am Tisch saßen, aber Opapa fehlte, meinte Else halblaut mehr zu sich selbst: „Heute schläft Papa aber sehr lange, hoffentlich geht es ihm besser. Ich werde mal nach ihm schauen.“ Vorsichtig drückte sie die Klinke herunter und lugte leise durch den Türspalt in die Schlafstube ihres Vaters. Die Vorhänge waren noch zugezogen. Das Morgenlicht legte sanfte Schatten auf das Bett, in dem er ganz still, wie in einem tiefen Schlaf, zu liegen schien. Mit vorsichtigem Schritt - die Dielen knarrten leise unter ihren Füßen -, um ihn nicht zu wecken, ging sie näher. Ihr Vater lag noch so - mit verschränkten Fingern auf der Bettdecke -, wie sie ihn am Abend zuvor verlassen hatte, aber sein Gesicht war verändert. Als ob er gerade in einen schönen Traum versunken wäre, waren seine, in letzter Zeit so starr gewordenen, Gesichtszüge nun von einem sanften Lächeln erlöst. Abrupt blieb Else vor dem Bett stehen, augenblicklich wusste sie, ihr Vater war sanft eingeschlafen, er war von dieser Welt gegangen. Erschrocken wagte sie nicht, sich zu rühren. Das Mysterium des Todes ergriff sie. Nach einiger Zeit strich sie ihm schweigend über die Hände und erschrak über die Kälte, die bereits von ihnen ausging. Plötzlich standen Lilo und Annemarie neben ihr, ihre Ahnung hatte sich bewahrheitet. Obwohl sie alle auf seinen Tod vorbereitet waren, kam er nun doch ganz plötzlich und brachte die ganze Familie aus dem Gleichgewicht. Jetzt erst wurde ihnen bewusst, wie oft Opapa sie in den letzten Jahren unterstützen konnte durch seine reichen Erfahrungen, sein großes Wissen und seine guten Ratschläge, die ihm nie ausgegangen waren.
Gemeinsam mit Lisbeth, die Erfahrung darin hatte, Verstorbene auf ihre letzte Reise vorzubereiten, bahrten Else, Lilo und Mie ihren Vater und Opa auf, damit die ganze Familie, Freunde und Nachbarn sich von ihm verabschieden konnten. Willi und Ludwig hielten die Totenwache und wechselten sich ab mit Franz, der inzwischen von Aachen gekommen war. Am Abend begann das Kommen und Gehen. Es brach nicht ab in den nächsten beiden Tagen. Die unzähligen Beileidsbekundungen waren begleitet vom Dank und der Anerkennung für diesen großen Mann und Wohltäter des Spessarts. Wie ein Lauffeuer ging es durch die ganze Region: „Unser Spessartdoktor ist nicht mehr!“
An einem sonnigen Herbsttag war der kleine Friedhof am Hang hinter der alten Laurentiuskirche voll von Trauergästen, die ihm die letzte Ehre erwiesen. Die tief empfundenen Abschiedsworte am Grab wollten nicht enden. Mit seinem natürlichen selbstlosen Wesen hatte Richard die Herzen der Spessarter gewonnen und wird in ihren dankbaren Erzählungen auch in den nächsten Generationen noch weiterleben. Allen gemeinsam war der Dank und das Versprechen, dass sein segensreiches Wirken im ganzen Spessart unvergessen bleiben würde.
Nur die Familie wusste, die geliebte Frau an seiner Seite, die ihn in allem bis zu ihrem Tod rückhaltlos unterstützt hatte, hielt er nun mit den sterblichen Überresten in der Urne im Arm und wurde mit ihm der Erde zur letzten Ruhe übergeben. So bescheiden und selbstlos wie Mary an seiner Seite in seiner Wahlheimat lebte, hatte sie auch das letzte Abschiednehmen ihrer sterblichen Hülle von dieser Welt alleine ihrem geliebten Mann überlassen.