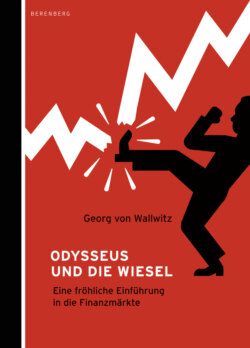Читать книгу Odysseus und die Wiesel - Georg von Wallwitz - Страница 7
1. DAS BÜHNENBILD
ОглавлениеDie Geschichte Hollands ist sehr viel weniger blutig und grausam
als die von irgendeinem der umliegenden Länder. Nicht umsonst
hat Erasmus jene Eigenschaften als echt niederländisch gepriesen,
die wir auch echt erasmisch nennen könnten: Sanftmut, Wohlwollen,
Mäßigung und eine allgemein verbreitete mittlere Bildung.
Keine romantischen Tugenden, wenn man so will.
Sind sie darum weniger heilsam?*
Die modernen Finanzmärkte haben einen breiten, mit vielen Schleifen und Verästelungen durchsetzten Quellgrund, ein fein geädertes System von kleinen, sich ständig verschiebenden Rinnsalen, von denen sich schwer sagen lässt, ob sie überhaupt genug Wasser führen oder bald wieder versickern.
Der Beginn des neuzeitlichen Finanzwesens lässt sich nur willkürlich bestimmen, aber ein guter Kandidat ist das Jahr 1602, als in Amsterdam die Aktiengesellschaft erfunden wurde. Im 16. Jahrhundert initiieren einzelne Handelshäuser immer längere Reisen nach Asien, die mit hohen Kosten und Risiken verbunden sind. Um die Wende zum 17. Jahrhundert ergibt sich für die niederländischen Kaufleute aber die Gelegenheit, ihren Asienhandel nochmals dramatisch auszuweiten. Durch den Niedergang Portugals während der Herrschaft der spanischen Habsburger und die Vernichtung der Armada durch die Engländer im Jahr 1588 ist es ein Leichtes, die iberischen Handelsniederlassungen in Asien zu übernehmen. Dafür bedarf es einer militärischen und kaufmännischen Infrastruktur, die über die Möglichkeiten der einzelnen Kaufleute hinausgeht. Die Lösung finden die Handelsherren von Amsterdam und Zeeland in einem Zusammenschluss ihrer Häuser zur Vereinigten Ostindischen Kompanie, die vom Staat gegen eine Zahlung von 25.000 Gulden für 21 Jahre mit einem Monopol auf den Handel östlich des Kaps der Guten Hoffnung und westlich der Magellanstraße ausgestattet wird. Zum Handelsmonopol kommen noch eine Reihe souveräner Rechte, wie das Recht zur Ernennung von Gouverneuren, das Recht, neben der Flotte auch noch eine Armee zu betreiben, sowie die Ermächtigung, völkerrechtlich bindende Verträge abzuschließen.
Zur Finanzierung eines so langfristig angelegten Unternehmens bedarf es eines festen Kapitalstocks. Mit Krediten oder Anleihen, die immer wieder fällig werden und deren Verlängerung unsicher ist, lassen sich nur zeitlich überschaubare Projekte bezahlen. So kommt es zur Ausgabe von zunächst nicht-rückzahlbaren Anteilsscheinen, Aktien genannt, im Gegenwert von 6,5 Millionen Gulden, einer damals stattlichen Summe. Die Aktionäre sind nicht Gläubiger, sondern Inhaber des Unternehmens. Sie sind über Dividendenzahlungen an den Gewinnen beteiligt, müssen aber den Verlust von Kapital hinnehmen, wenn die Ware verdirbt oder die Handelsposten von den Iberern überfallen und geplündert werden. Während Inhaber einer Anleihe (wie jeder Kreditgeber) einen fest vereinbarten Zins und am Ende der Laufzeit das geliehene Geld zurückerhalten, leben Aktionäre vom Unternehmensgewinn, der weniger sicher ist als eine Zinszahlung, dafür aber potentiell sehr viel höher.
Die Ostindische Kompanie wird ein voller Erfolg und sorgt dafür, dass die Amsterdamer Börse bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts das Finanzzentrum Europas bleibt. Von Jakarta aus, das die Niederländer Batavia nennen, gelingt es, nach und nach, einen immer größeren Teil des Asienhandels zu kontrollieren. Im Jahr 1641 wird das portugiesische Malakka erobert und damit die Kontrolle über die Straße von Malakka an der Westküste Malaysias. 1667 fällt die letzte nennenswerte Niederlassung der Portugiesen an die Ostindische Kompanie, die damit ein faktisches Monopol auf den Handel zwischen Asien und Europa hat. Hinzu kommt eine immer stärkere Rolle im innerasiatischen Handel. Die Ostindische Kompanie erhält vom Shogun das Privileg, als einzige ausländische Macht mit Japan Handel zu treiben.
Die finanziellen Möglichkeiten der Ostindischen Kompanie gehen weit über alles hinaus, was vor ihrer Gründung denkbar schien. Die East India Company, die etwa zeitgleich in London gegründet wird, ist lange keine Konkurrenz für die Niederländer, weil ihr das finanzielle Rückgrat fehlt. In den zwei Jahrhunderten ihres Bestehens hat die Ostindische Kompanie 4.700 Schiffe unter Segel und transportiert etwa eine Million Menschen. Die Aktiengesellschaft ist die wirtschaftliche Organisationsstruktur, die Voraussetzung ist für den sagenhaften Aufschwung der Niederlande in ihrem Goldenen Jahrhundert. Durch eine eher unscheinbare Idee ist es einem eher unscheinbaren Volk zwischen Ijsselmeer und Zeeland gelungen, zu einer Großmacht zu werden. Niederländische Schiffe beherrschen einen großen Teil der Weltmeere. Um 1670 verfügen die Niederlande über 15.000 Schiffe, fünfmal so viele wie unter englischer Flagge. Über ihre Handelsstationen, die sich zu Städten wie New York oder Jakarta ausweiten, üben die Kaufleute auch bis tief ins Landesinnere beträchtliche Macht aus.
Der Niedergang der Ostindischen Kompanie hat, wie ihr Aufstieg, sowohl militärische als auch wirtschaftliche Gründe. Den Engländern gelingt es immer besser, den Ärmelkanal zu kontrollieren und damit die entscheidende Seeroute für den Asienhandel der Niederländer. Im vierten Englisch-Niederländischen Krieg (1780–1784) kommt der niederländische Handel mit Asien völlig zum Erliegen, die Warenhäuser bleiben leer, und es finden keine Auktionen mehr statt. Hinzu kommt, dass die finanzielle Substanz der Ostindischen Kompanie weit weniger stark ist, als sie es hätte sein können. Über die Jahre ist Korruption ein immer Problem geworden Problem geworden größeres Problem geworden. Die Gouverneure in den fernen überseeischen Besitzungen sind oft genug Abenteurer, die zielstrebig in die eigene Tasche wirtschaften und am Wohlergehen der Aktionäre nur ein beiläufiges Interesse haben. Dieses Problem ist der Aktiengesellschaft bis heute geblieben und hat die Existenz der Ostindischen Kompanie überlebt, die im Jahr 1798 am Ende ist und verstaatlicht wird.
Das Konzept der Aktiengesellschaft ist aber nie wieder versickert. Es ist schnell nicht nur ein ordentlicher Bach daraus geworden, sondern ein breiter Strom. Der finanzielle Erfindungsreichtum der Niederländer bleibt nicht auf den Fernhandel beschränkt. Hugo Grotius verfasst 1605 ein Rechtsgutachten für die Ostindische Kompanie, worin er die Freiheit der Meere proklamiert und den entscheidenden Schritt zur Grundlegung des Völkerrechts tut. Im Jahr 1609 wird die Amsterdamer Wechselbank gegründet, die ihren Kunden den bargeldlosen Ausgleich zwischen verschiedenen Konten anbietet und damit das Buchgeld erfindet. Sie ist die erste Zentralbank der Geschichte. Zwei Jahre später kommt die Amsterdamer Warenbörse hinzu, wo ab 1612 der Wertpapierhandel aufgenommen wird. Die Erfindung der Aktiengesellschaft ist eine Art Urknall, aus dem sich die folgenden Innovationen fast selbstverständlich entwickeln. Der Auf- und Ausbau der finanziellen Institutionen geht, sobald der Knoten einmal geplatzt ist, extrem schnell. Die Niederländer bauen ein System, in dem sich effizient Geld verdienen lässt. Als Calvinisten wissen sie, dass Reichtum zwar ein äußeres, dafür aber zuverlässiges Zeichen von Gottes Segen ist. Das spornt an. In diesem System dominiert, jedenfalls in der Anfangsphase, die Rationalität der Kaufleute wie nie zuvor in der Geschichte.
Die Niederlande erleben nicht nur aufgrund ihrer finanziellen Phantasie ein Goldenes Zeitalter. Frömmigkeit, Fleiß, Wagemut, Kunstsinn, Tinte und der Geschmack an der Piraterie spielen eine ebenso große Rolle. Rembrandt und Vermeer sind auch ohne die Ostindische Kompanie genial, aber der Reichtum und die Offenheit, die über deren Handel in die Niederlande kommen, sind eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Entfaltung ihrer Kunst. Das alles gehört zusammen. Kein Kulturkreis hat jemals einen bemerkenswerten künstlerischen Aufschwung genommen ohne ein wirtschaftliches Fundament. Es ist kein Zufall, dass in den Niederlanden die künstlerische und geistige Revolution mit der finanziellen einhergeht. Ein Land, das Descartes und Spinoza anlockt, ist auch genial genug, um mit Tulpen zu spekulieren und dabei den Gewinn aus ungezählten Asienfahrten zu pulverisieren. Nicht nur die Not, auch die Freiheit und das Geld machen erfinderisch. Finanziers und Künstler sind nicht aufeinander angewiesen, aber sie gedeihen unter denselben Bedingungen und haben meist, aus sehr unterschiedlichen Motiven, ein lebhaftes Interesse aneinander.
Das Beispiel der Niederlande ist in gewisser Weise irreführend. Selten kann sich wirtschaftliche Rationalität so mühelos entfalten wie unter den Amsterdamer Kaufleuten des 17. Jahrhunderts. Das Wirtschaftssystem, die politische Ordnung und die Religion sind auf die Mehrung des persönlichen Wohlstands der Bürger hin berechnet. Es herrscht ein beinahe ideales Klima wirtschaftlicher Effizienz und Offenheit. Der Idealzustand ist die Ausnahme, und er kann nicht dauern, weil der Mensch nicht ideal ist. Er ist nie lange kühl berechnend und damit selbst berechenbar. Daher gelingen finanzielle Innovationen nur sehr selten so reibungslos wie in Amsterdam um 1600. In der Regel ist der Quellgrund einer finanziellen Idee über eine weite Strecke sumpfig, bevor sich ein Fluss entwickelt. Wenn ihre Zeit sie noch nicht trägt, können Ideen wie Rinnsale wieder in der Erde verschwinden, aus der sie gekommen sind.
Die Entstehung der neuzeitlichen Finanzmärkte ist gespickt mit Fehlversuchen. Das liegt daran, dass die Akteure an diesen Märkten (Finanziers, Investoren, Spekulanten) nicht dem Ideal eines klugen, geduldigen, listenreichen, verständigen und berechnenden Menschen entsprechen, der eigentlich nötig wäre, damit wirtschaftliche Rationalität sich entfalten kann. Jeder Unternehmer versucht, dem Ideal zu entsprechen, aber keiner rechnet ernsthaft damit, es zu erreichen.
Als Gründungsmythos für das Zeitalter der modernen Finanzmärkte taugt daher vielleicht am ehesten der Versuch von John Law, die französischen Staatsfinanzen zu sanieren. An Law zeigen sich die Licht- und Schattenseiten finanzieller Phantasie; wie eine gute Idee kurz aufscheint und dann wieder versickert, weil sie das Kind eines Hasardeurs ist und nicht eines frommen und vernünftigen Handelsherren.
John Law wird 1671 als Sohn eines schottischen Goldschmieds und Geldverleihers in Edinburgh geboren. Er geht früh nach London, um das Handwerk des Bankiers zu erlernen, verbringt dort aber die meiste Zeit beim Glücksspiel. Als Spieler verliert er viel Geld, lernt aber, mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Bereits 1694 muss er seine Ausbildung unterbrechen, da er bei einem Duell dem Gegner ein Schwert in den Bauch rammt und wegen Mordes zum Tode verurteilt wird. Mit Hilfe einflussreicher Mitspieler kann er aber aus dem Gefängnis ausbrechen, bevor das Urteil rechtskräftig wird.
Er flieht nach Amsterdam, das zu dieser Zeit noch immer der Nabel der Welt ist. Dort sieht er nicht nur die Segnungen des Buchgeldes, sondern auch die Nachteile des Münzgeldes. Um ihre Vorräte zu halten, benötigen die Händler Geld. Gibt es nur Münzgeld, so ist die Geldmenge durch die Menge des verfügbaren Goldes und Silbers beschränkt. Es kann nur so viel Handel getrieben werden, wie Edelmetalle in Form von Münzen frei zur Verfügung stehen. In guten Zeiten bedeutet das einen deutlichen Dämpfer für jede wirtschaftliche Aktivität. Nur den Geldverleihern geht es dann richtig gut, denn sie können hohe Zinsen verlangen.
Law sieht, dass der Handel noch viel lebhafter sein könnte, wenn die Menge des Geldes Problem geworden Problem geworden größer wäre. Also schlägt er den Handelsherren einen großartigen Gedanken vor: Er will eine Bank gründen, die nichtrückzahlbare Noten ausgibt, die nicht nur mit Edelmetallen, sondern auch mit Land besichert sind. Solche Banknoten nennt man Papiergeld.
In Amsterdam sind die Kaufleute klug genug, sich nicht auf Laws Geschäftsmodell einzulassen. Papiergeld lebt von der Vertrauenswürdigkeit der Menschen, die es herausgeben, und da hat Law ein Defizit, das nicht schwer zu erkennen ist. In Paris hingegen hat man nicht viel Erfahrung und die Not ist größer. Ludwig XIV. hat durch permanente Kriegsführung und den falschen Glauben, Versailles sei der Nabel der Welt, erhebliche Schulden angehäuft. Schulden wirken bei Staaten ähnlich wie Schokolade bei Kindern: Sie wissen immer erst hinterher, ob sie des Guten zu viel hatten. Die Währung ist seit 1690 vierzigmal abgewertet worden. Dass Frankreich überschuldet ist, weiß ganz Europa.
Hier sieht John Law seine Chance. Er schlägt sein Konzept einer nicht durch Edelmetalle gedeckten Währung im Jahr 1708 dem König vor, der aber ablehnt, weil Law kein Katholik ist. Nach dem Tod des Sonnenkönigs richtet er seinen Vorschlag noch einmal an den Regenten, den Herzog von Orléans, der Atheist ist und den er Gerüchten zufolge in einer Spielhölle kennengelernt hatte. Der Regent, der für jede Art von Ausschweifung zu haben ist, sieht sich vor der Alternative, entweder eisern zu sparen oder Papiergeld auszugeben. Er entscheidet sich für die damals noch unorthodoxe Variante. Am 2. Mai 1716 gründet Law mit einem Kapital von sechs Millionen Pfund eine Bank, die später unter dem Namen Banque Royale firmiert. Sie hat das Recht, Banknoten herauszugeben. Diese Banknoten sind eigentlich Quittungen für eingezahltes Gold und Silber und können prinzipiell jederzeit in Edelmetall getauscht werden. Die Pariser Oberschicht erkennt schnell die praktischen Vorteile der Banknoten gegenüber den herkömmlichen Louis d’Or. Bald werden die Banknoten allgemein akzeptiert.
Das eingenommene Gold wird aber nicht in der Bank verwahrt, sondern zur Tilgung der Staatsschuld und zur Finanzierung der laufenden Staatsausgaben verwendet. Um gar nicht erst den Gedanken aufkommen zu lassen, die Währung könnte nicht gedeckt sein, organisiert Law die Compagnie de la Louisiane ou d’Occident (auch bekannt unter dem
Namen Compagnie du Mississippi), die zahlreiche Monopole auf den Handel mit den französischen Besitzungen in Übersee erhält. Dieses Unternehmen verspricht durch die Ausbeutung der angeblich gewaltigen Goldvorkommen in Louisiana große Gewinne. Indem der Staat Aktien der Compagnie d’Occident verkauft, kann er heute Geld einnehmen, welches durch zukünftige (Gold-)Einnahmen gedeckt ist. Das verbessert das Ansehen der Banknoten, denn die Banque Royale nimmt viel Geld ein durch den Verkauf von Aktien und kann auf die nach wie vor im eigenen Bestand gehaltenen Papiere als zusätzliche Sicherheit verweisen. Es wäre ja auch eine Sicherheit gewesen, wenn es tatsächlich Gold am Mississippi gegeben hätte und die Aktien (und damit das Vermögen der Bank) etwas wert gewesen wären. Für den Moment jedenfalls schien hinter den Banknoten eine fast unerschöpfliche Menge Goldes zu stehen.
John Law gelingt es, eine gewaltige Hausse anzuheizen. Durch zeitweise künstliche Angebotsverknappung treibt er den Kurs der Compagnie d’Occident in die Höhe. Sobald die Kurse gestiegen sind, verkauft er neue Aktien. Das auf diese Weise eingenommene Geld wird aber nicht in die Goldsuche in Louisiana gesteckt – das ist vernünftig, denn es gibt dort kein Gold –, sondern in die Sanierung des Staatshaushalts. Law wird Finanzminister und zum mächtigsten Mann nach dem Regenten.
Durch die dramatisch steigenden Kurse entstehen plötzlich unglaubliche Reichtümer. Das löst eine Kaufpanik aus. Es kommt zu Tumulten an der alten Börse, sodass der Handel bald unter freiem Himmel stattfindet, auf der Place Vendôme und in der Nähe des Hôtel de Soissons. Dort müssen Wachen dafür sorgen, dass der Handel wenigstens in der Nacht ruht. Mit immer neuen Versprechungen über immer neues Gold in Louisiana schafft es Law, das Interesse immer breiterer Käuferschichten zu wecken und immer mehr Aktien zu immer höheren Kursen zu verkaufen. Das neue Geld ist ein Segen für die französischen Staatsfinanzen. Die Wirtschaft, die zuvor an Geldmangel litt, ist plötzlich bestens mit Liquidität versorgt. Das billige Geld lässt die Zinsen sinken und das Land erlebt einen wunderbaren Aufschwung. Allerdings dauern solche Glückszustände nie lange an, und ein finanziell versierter Beobachter wie Voltaire bemerkte schon 1719 korrekt, dass der Boom mehr mit Phantasie als mit Realität zu tun hat und dass »in Paris alle verrückt geworden sind«.
Skepsis ist immer angebracht, wenn der Anfang und das Ende unklar sind und die Mitte in ständiger Bewegung. 1720 bricht das System zusammen. Der Prinz von Conti ist verärgert, weil er Schwierigkeiten hat, Aktien zu kaufen. Daher schickt er einen Pferdewagen los, um seine Banknoten in der Banque Royale in Gold zurückzutauschen. Law ordnet zwar an, das Gold an Conti auszuzahlen, aber der Herzog von Orléans interveniert zu Gunsten der Staatskasse. Das ist keine gute Idee, denn der Regent bringt damit tout Paris auf den Gedanken, die Banknoten und Aktien wieder loswerden zu wollen. Die Panik bricht nun in die andere Richtung aus. Plötzlich sieht jeder, dass die Banque Royale ihr Versprechen nicht halten kann, bei Bedarf Papier gegen Gold zu wechseln. Es kommt zu immer neuen Abwertungen der Papiere. Zwischen September 1719 und Dezember 1720 wird der offizielle Goldkurs 28-mal geändert. Dadurch wird das Papiergeld nicht beliebter und die Lage immer prekärer. Im Juli 1720 kommt es zu schweren Ausschreitungen. Fünfzehn Menschen kommen beim Versuch der Erstürmung der Banque Royale ums Leben.
John Law ist ein Hasardeur und ein Gauner, der es zum Finanzminister gebracht hat. Er hat die Chuzpe, eine Illusion mit gewaltigen realen Auswirkungen aufzuziehen. Die Welt verdankt ihm das Papiergeld, das während seiner Amtszeit im Jahre 1717 in Frankreich als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wird. Law bezahlt Schulden mit Schulden (Banknoten), die wiederum durch Versprechungen (Gold in Louisiana!) gedeckt sind. In dieser Geschichte von unbezahlbaren Verpflichtungen, finanzieller Phantasie und blinder Gier entsteht das Papiergeld als Ausweg für den Staat, seine ursprünglich in Gold aufgenommenen Schulden lediglich mit einer Fiktion zurückzahlen zu müssen.
Die Beobachtung, dass eine zu knappe Geldmenge die Wirtschaft abwürgt, und die Idee, dem Mangel durch die Ausgabe von Papiergeld abzuhelfen, ist durchaus richtig. Aus heutiger Sicht erscheint aber der Versuch naiv, Papiergeld akzeptabel zu machen, indem man es mit hoffnungslos inflationierten Aktien besichert. Papiergeld wird nur dann als Zahlungsmittel akzeptiert, wenn das Vertrauen besteht, dass davon nicht zu viel ausgegeben wird. Für eine disziplinierte Umsetzung des Übergangs vom Gold zum Papier ist Law sicher der falsche Finanzminister und Philippe von Orléans ganz sicher der falsche Regent. Law hat nicht die Skepsis, nicht den kühl berechnenden Verstand, nicht die Bescheidenheit, die in der Welt der Finanzen ebenso wichtig sind wie die Kühnheit, von der er zu viel mitbringt.
So versickert seine Idee schnell wieder im Quellgrund. Es gibt immer wieder Versuche, Papiergeld einzuführen, aber sie nehmen fast ausnahmslos eine schlimme Wendung: Irgendwann werden mehr Quittungen ausgestellt, als Edelmetall vorhanden ist. Kaum eine Institution kann dieser Versuchung widerstehen. Erst 250 Jahre später lösen die Zentralbanken endgültig den Zusammenhang von Gold und Geld. So lange dauert es, eine gute Idee wieder salonfähig zu machen, die durch eine finanzielle Katastrophe diskreditiert wurde. Heute ist das ungedeckte Geld nicht mehr wegzudenken.
Den bislang letzten Versuch, Papiergeld zu einem festgelegten Kurs gegen Gold zu tauschen, unternehmen ironischerweise die Franzosen, als sie im Jahr 1971 realisieren, dass die Amerikaner zur Finanzierung des Vietnamkrieges zu viele Dollars drucken und ihr Versprechen, den Dollar jederzeit in Gold zu tauschen, noch weniger halten können als zuvor. Da die Franzosen gern die Amerikaner ärgern, verlangen sie die Erfüllung des Versprechens. Aus ihrer eigenen Geschichte wissen sie zwar, dass sie damit nicht an die Goldvorräte der Amerikaner kommen, aber wenigstens haben sie ihren Spaß bei der Demütigung ihres besten Verbündeten. Die Amerikaner reagieren auf die französische Forderung wie einst der Herzog von Orléans auf den Pferdewagen des Prinzen von Conti. Sie weigern sich, ihr Gold gegen Dollars einzutauschen, und gehen zu einer reinen Papierwährung über.
Die Niederlande waren ein gut regiertes Gemeinwesen. Die Handelsherren waren sittenstreng, ohne borniert zu sein, selbstbewusst und dennoch weltoffen, und sie hatten Sinn für Geld und für Kunst. Frankreich war ein innerlich zerfallender Staat. Die von Richelieu geschaffene absolute Macht des Königtums hatte äußerlich jeder gesellschaftlichen Entwicklung ein Ende gesetzt. Was sich in Holland nach 1602 und in Frankreich nach 1716 an den Börsen entwickelt, spiegelt nichts anderes als die Verfassung, in der diese Gemeinwesen damals waren. Sie sind wie ein Sittengemälde, dessen Medium das Geld ist.
Verständlicherweise sehnt sich die Finanzwelt nach ihren Amsterdamer Wurzeln wie nach einem verlorenen Paradies. Die idealen Zustände von damals müssten doch eigentlich als Ausgangspunkt erhalten werden können. Die Geschichte der Finanzmärkte sieht aber anders aus und ist voll von aufquellenden und versickernden Ideen, denn Geld beflügelt die Phantasie und macht anfällig für Illusionen. Wie in der Politik, der Kunst, der Pädagogik – kurz: wie in allen menschlichen Angelegenheiten – kann in der Finanzwelt, was heute noch unmöglich ist, morgen bereits der letzte Schrei und die einzige Lösung sein, bloß um übermorgen als rückständig und eigentlich absurd zu gelten. Die Umstände ändern sich und mit ihnen die Moden und Leidenschaften, welche die Ideen tragen oder nicht.
Dennoch klammert sich die Finanzwelt bis heute an ihr vernünftiges niederländisches Ideal. So ist sie auf die heroische Idee gekommen, sich der Mathematik zu bedienen, um ein Modell menschlichen Handelns zu entwerfen. Und gibt es nicht immer wieder Kaufleute und Investoren, für deren Erfolg eine emotionslos vorausschauende Methodik ausschlaggebend ist?Listenreich und wagemutig sind viele, aber bei den Erfolgreichen kommt noch die Kunst der Berechnung hinzu. Leute vom Schlage eines John Law kommen glücklicherweise nicht oft in eine Position, von der aus sie ein ganzes Land aus der Bahn werfen können, und der Normalzustand der Menschen ist vernünftig genug, um ihn berechenbar zu nennen.
Aufgeklärte Menschen sehen überall die Vernunft am Werk, auch wenn sie es in der Realität mit Menschen zu tun haben, die dem Ideal keineswegs entsprechen und deren tiefste Motive nicht nur der Nutzen, sondern auch die Furcht und der Ehrgeiz sind. Unter diesen Bedingungen hat die Wirtschaftswissenschaft Erstaunliches geleistet bei der vernünftigen Beschreibung eines oft unvernünftigen Wesens. So ist es ihr nachzusehen, wenn sie manchmal über das Ziel hinausschießt und den Menschen zu ernst nimmt. Aus einem meist vernünftigen Wesen macht sie ein immervernünftiges. Dem Spiel stellt sie die Spieltheorie zur Seite. Sie unterschätzt die Häufigkeit und den Effekt von exzentrischen Erscheinungen wie John Law und glaubt manchmal, Amsterdam sei überall.
*J. Huizinga, Erasmus. Basel 1936, S. 231.