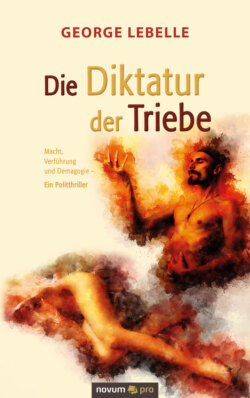Читать книгу Die Diktatur der Triebe - George Lebelle - Страница 13
Kampfroboter Karl-Friedrich und Inge Bornheim hatten im Offiziersheim der Kaserne Potsdam ein kleines Appartement bezogen. Als Folge der erotischen Entbehrungen in den letzten Wochen waren sie nach dem Abendessen im Kasino ins Bett gegangen. Drei Mal musste das Bett die wütenden Bewegungen der Liebenden ertragen, bis sie um elf Uhr das Licht löschten. Um halb vier summte das kaserneninterne Telefon und Kurt Eisner, der Heeresinspekteur, meldete sich. „Moin, lieber Bornheim. Soeben habe ich eine alarmierende Nachricht von einem zuverlässigen Offizier des militärischen Geheimdienstes erhalten.“ „Ja“, murmelte Bornheim schläfrig. „In Hamburg wurden etwa tausend Kampfroboter aus den USA ausgeladen und in vier großen Hallen gelagert. Wahrscheinlich werden sie dort programmiert und sind in ein bis zwei Tagen einsatzbereit.“ KFB war sofort hellwach. „Kann die Luftwaffe diese Hallen kurz vor Sonnenaufgang bombardieren?“ „Ja, natürlich. Aber diese Roboter sind sehr widerstandfähig. Und sie schießen zurück.“ „Dann setzen die eben Napalm oder so etwas ein, um die Elektronik abzufackeln.“ „Einverstanden.“ KFB wollte das Gespräch beenden, aber der General wollte noch etwas sagen. „Bornheim, es kommt noch schlimmer. In Bremerhaven sind Transportschiffe mit Panzern, Raketen, Flugzeugen und Lastwagen eingetroffen. Sie werden zurzeit entladen und in einen Marinestützpunkt östlich von Bremen überführt. Das wird zwar einige Tage dauern. Aber dann werden wir mit dieser Kampfkraft der Marine ein Problem haben. Wir wissen aber noch nicht, wie viele Panzer und Flugzeuge angelandet worden sind.“ „Ja, aber warum versenkt ihr nicht die Schiffe und bombardiert die Hallen?“ „Sie müssen das entscheiden, lieber Bornheim. Wir haben Sie als Oberbefehlshaber gewählt. Das war immer die Aufgabe der politischen Führung. Ihr Politiker wolltet doch, die Politik sollte den Vorrang haben, den Primat der Politik, sozusagen.“ „Ich habe verstanden. Also befehle ich: Zerstören Sie alle Roboter und lassen Sie ermitteln, ob in anderen Häfen Roboter entladen worden sind. Diese sind ebenfalls zu eliminieren. Zweitens: Die Transportschiffe in Bremerhaven müssen versenkt werden, egal, welche Flagge sie tragen. Alle Stützpunkte der Marine um Bremerhaven und Bremen sind überfallartig auszulöschen. Verstanden?“ „Sehr wohl, Oberbefehlshaber.“ Karl-Friedrich drückte die Ende-Taste. Inge kicherte. „Na, dem hast du es aber gezeigt.“ Nachdem ihr Mann wieder in das Doppelbett gestiegen war, schlief er sofort wieder ein. Inge hatte Angst. Wenn dieser gefährliche Putschversuch scheiterte, würden sie beide erschossen, im schlimmsten Fall zu Tode gefoltert werden. Die Bande, die Kanzler Piepgen um sich geschart hatte, wäre jeder sadistischen Prozedur fähig. Inge lag darüber noch lange wach. Als die Bomber der Luftwaffe im Morgengrauen Hamburg erreichten, waren die Roboter bereits ausgeladen und hatten sich in Marsch gesetzt. Plangemäß setzten sich in Hamburg, Travemünde und Rostock um zwei Uhr 1500 Roboter nach Süden in Bewegung nach Berlin. Die Straßen waren um diese Uhrzeit natürlich leer. Den wenigen Autofahrern fielen die zwei Meter hohen, gedrungenen, menschenähnlichen Maschinen nicht auf, weil sie matt-grau gestrichen waren und nur einzeln marschierten. Kurz vor drei Uhr brauste ein Lastwagen des Heeres auf der Autobahn von Lübeck nach Osten. Es war vollkommen dunkel. Die beiden Soldaten im Fahrerhaus hatten sich bis vor Kurzem unterhalten. Aber nun war der Beifahrer eingeschlafen. Sie hatten den Auftrag, Munitionskisten zum Heeresstandort bei Rostock zu bringen. Sie waren sich einig, dass ein derartiger Transport Blödsinn sei, denn da gebe es ja den Marinestützpunkt, und die hätten genug Munition. Die Autobahn war leer und der Fahrer kämpfte mit der Müdigkeit und der Langeweile. In gut dreihundert Metern Entfernung reflektierte etwas das Scheinwerferlicht. Und da bewegte sich etwas. Der Fahrer sah nun ein seltsames Objekt auf der Überholspur. Das Ding näherte sich auf dem linken Fahrstreifen. Instinktiv trat er auf die Bremse. Aber es war schon zu spät. Ein Blitzstrahl schoss aus dem Ding und zerstörte die Fahrerkabine. Der Fahrer war sofort tot. Der Armeelastwagen schleuderte und krachte in die rechte Leitplanke. Der Beifahrer verlor das Bewusstsein. Der Roboter registrierte den LKW als zerstört und marschierte weiter. Erst zwei Stunden später stoppte ein Auto an der Unfallstelle und meldete der Autobahnpolizei den Unfall. Da waren die Roboter schon 60 bis 80 km weiter nach Süden vorgedrungen. Wenige Minuten nach vier stiegen von den Stützpunkten der Luftwaffe in Norddeutschland zwanzig tief fliegende Jagdbomber auf, um die Luftabwehr der Marine auszuschalten. Wenig später verließen dreißig Kampfbomber ihre Hangars in Emden, Wilhelmshaven und Harburg, starteten und steuerten Bremerhaven an. Der Befehl des Luftwaffeninspekteurs lautete: Schiffe versenken, Schwertransporter und LKWs der Marine zerstören, Marinestützpunkte auslöschen. Der Aufgabe entsprechend waren die Kampfbomber mit schweren Bombenkalibern, Raketen und Torpedos beladen. Die Inspekteure des Heeres und der Luftwaffe hatten sich abgestimmt, dass zunächst die Luftwaffe „reinen Tisch“ machen solle und danach Bodentruppen die letzten Marinestützpunkte erobern sollten. Um die Roboter aufzuspüren, wurden ab vier Uhr, es war noch vollkommen dunkel, 55 Kampfhubschrauber aus Hamburg eingesetzt. Die Piloten fanden schnell heraus, dass die Roboter die Lagerhallen bereits verlassen hatten und nach Südosten marschierten. Die Roboter hatten gelernt, Hubschrauber anhand ihres Wärmebildes auf drei Kilometer Entfernung zu erkennen und sie durch Beschuss mit Kleinstraketen oder durch Ausschaltung der Bordelektronik durch harte Hochfrequenzimpulse zum Absturz zu bringen. Nachdem vier Hubschrauber auf diese Weise abgestürzt waren, hielten die Piloten ausreichenden Abstand und nutzten Geländesenken zur Deckung. Die Inspekteure Eisner und Brandt unterrichteten dem Oberbefehlshaber KFB ab sechs Uhr halbstündlich über die Lage. Als dieser nach der Meldung um halb sieben wieder einschlafen wollte, presste sich Inge an ihn und wichste seinen Schwanz steif. In diesem halbschlafenden Zustand konnte sie sich sehr lange auf ihm austoben, bevor er spritzte. So war es auch dieses Mal. Hoch befriedigt sank sie von ihm, als wieder das Telefon summte. Luftwaffenchef Brandt meldete, die Aktion „Schiffe versenken“ sei erfolgreich abgeschlossen. „Wahrscheinlich hat kein Panzer, kein Flugzeug oder ein anderes Waffensystem der Alliierten die Schiffe verlassen.“ „Das ist ja ganz ausgezeichnet, hervorragend!“ „Danke, Oberbefehlshaber. Aber es gibt ein großes Problem mit diesen verdammten Robotern. Die müssen schon um zwei Uhr losmarschiert sein. Außerdem haben unsere Agenten vom Militärgeheimdienst berichtet, dass sich nicht nur von Hamburg Roboter nach Süden bewegen, sondern auch von Travemünde und Rostock. Vielleicht sind es mehr als 2000, wir wissen es noch nicht. Deren Zahl erscheint niedrig, aber Sie müssen berücksichtigen, dass denen eine Kampfkraft von gut 20.000 Soldaten entspricht.“ „Ach, du großer Schreck! Kann man die nicht mit Raketen oder Napalmbomben ausschalten?“ „Im Prinzip ja. Aber die erkennen unsere Hubschrauber und Flugzeuge, bevor diese überhaupt etwas abfeuern können. Wenn wir realistisch bleiben, ist es möglich, dass die Hälfte dieser Dinger Berlin erreicht. Bis dahin werden wir die Wachmannschaften am Abschirmring um Berlin weder verstärkt noch mit roboterbekämpfenden Waffen ausgestattet haben.“ „Dann werden wir uns aus Berlin verabschieden müssen. Und Piepgen hat gesiegt.“ „Ja.“ Nach Beendigung des Gesprächs räusperte sich Inge. „Nimm es doch nicht so schwer, Liebling. Die Hauptsache ist doch, wir sind zusammen, wir lieben uns und wir werden noch etwas leben.“ Sie wusste, dass er noch „einen Schuss draufhatte“. Kanzler Piepgen erfuhr an diesem frühen Morgen sexuelle Freuden. Weil er im Morgengrauen immer einen Ständer hatte, sorgte Lafontaine zuverlässig dafür, dass ein Weib neben ihm lag und er sich an ihr befriedigen konnte. Lydia, eine schöne Hure aus Weißrussland, hatte ihn fünf Mal abspritzen lassen, eine Leistung, für die Piepgen sich selbst bewunderte und Lydia bewog, ihn anzuhimmeln. Um halb acht wurde Piepgen durch Lafontaines Telefonanruf geweckt. „Meister, es gibt eine gute und eine sehr schlechte Nachricht. Was wollen Sie zuerst hören?“ „Scheiße, schon keine ausreichende Nachtruhe. Was gibt es? Ach ja, zuerst die schlechte Nachricht.“ „Alle Schiffe der Allianz und alle Waffensysteme an Land sind zerstört worden. Vorher ist unsere Luftabwehr ausgeschaltet worden. Vorerst wird es keine Unterstützung durch die Alliierten mehr geben. Es sei denn, Sie rufen deren Truppen herbei.“ „Dann müsste ich ja die Macht mit denen teilen. Kommt nicht infrage. Was ist denn die gute Nachricht?“ „Die Roboter sind auf dem Vormarsch. Einer ist verbrannt worden. Aber die haben vier Hubschrauber des Heeres abgeschossen. Die Roboter marschieren nun nicht mehr auf Autobahnen und breiten Straßen, wo sie von Weitem erkennbare Ziele wären, sondern vornehmlich auf Feldwegen und Landstraßen, Bäume und Häuser als Deckung nutzend. Das sind wirklich tolle Maschinen.“ „Wann treffen die in Berlin ein und greifen die Militärringe an?“ „Das hängt davon ab, auf wie viel Widerstand sie stoßen. Ich schätze, etwa morgen früh.“ „Sehr gut. Und schicke mir heute Abend wieder Lydia.“ „Sehr wohl, mein Führer!“ Tatsächlich hatten die Kampfbomber in Bremerhaven und in der östlichen Umgebung von Bremen alles zerstört, was irgendwie nach wehrtechnischem Material aussah. Um fünf Uhr früh beschwerte sich der dortige US-Konsul beim Außenministerium in Berlin über die Bombardierung und Versenkung von Schiffen unter der Flagge der USA und drohte mit Vergeltung. Außenminister Steinmüller versuchte, den Konsul zu beruhigen. Es seien schon Maßnahmen gegen die „Aufständischen“ mit dem US-Botschafter besprochen und eingeleitet worden. Davon war lediglich wahr, dass sich der Außenminister beim US-Botschafter für die brüderliche Hilfe in Form der Kampfroboter bedankt hatte. Auch bei den Regierungen der sieben weiteren Mitgliedstaaten der „Allianz gegen linken Terrorismus“ hatten sich er und der „Herr Reichskanzler“ begeistert für die Waffenlieferung bedankt. Die Mitglieder dieser Allianz waren allesamt rechtsradikale bis faschistische Regierungen in Europa, Nord- und Südamerika. In Potsdam sahen sich KFB, seine Frau Inge und die Generäle Bilder des Militärgeheimdienstes aus Bremerhaven und dem Gebiet um Bremen an. „Das sieht ja aus wie in einem Krieg.“ KFB zeigte sich entsetzt. Die gesamte Kaianlage für Überseeschiffe samt Kränen, Schienen, Containerlagern und Hafenbecken glich einem Haufen von Schutt und Schrott inmitten von Wasserlöchern. Die zerschossenen, zerfetzten und ausgebrannten Schiffe glichen Skeletten aus Stahl, aber nicht mehr Seefahrzeugen. Zum Teil ragten nur noch Masten oder Kommandobrücken aus dem Wasser, zum anderen Teil waren die Schiffskörper zerbrochen oder auf die Seite gekippt. Andere wiederum waren durch die explodierte oder in Brand gesetzte Munition zu skurrilen Figuren zerschmolzen. Die Schneise der Verwüstung zog sich bis auf die offene See hinaus. „Mein Gott, das müssen ja fast hundert Schiffe gewesen sein.“ Inge war erschüttert. „Was hätten diese Waffen in der Hand der Marine für uns bedeutet? Den sicheren Tod.“ Weitere Fotos zeigten auf den Straßen von Bremerhaven nach Süden zerstörte Kolonnen von LKWs und Schwertransportern mit Panzern, dem Erdboden gleichgemachte Lagerhallen und vernichtete Stützpunkte und Kasernen der Marine. In Zukunft müssen wir verhindern, dass Teile der Armee gegeneinander kämpfen können oder gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden, dachte Inge. Dazu müssten sich in einer derartigen Lage die Befehlsstränge gegenseitig blockieren. Das werde sie ihrem Karl-Friedrich, dem „Oberbefehlshaberchen“, in einer stillen Stunde beibringen. Fast einhundert Kilometer westlich von Berlin, nämlich in der Kleinstadt Braunlage, bekamen der Stadtrat, der Bürgermeister und die Einwohner nichts von den militärischen Wirren mit. Am späten Nachmittag hatte der Stadtrat mit einfacher Mehrheit beschlossen, dass sich Bürger und insbesondere die städtischen Angestellten und Beamten von nun an mit dem „Führergruß“ zu grüßen hätten, also mit der rechten Hand waagerecht zum Handkantenschlag nach rechts ausholend. „Im nächsten Monat wird das kontrolliert. Wer das nach zwei Monaten nicht kapiert hat oder sich gar widersetzt“, der Bürgermeister lachte laut, „na, der bekommt eine Ordnungsstrafe von einem Monatslohn. Diese Abweichler werden registriert. Und was wird den später erwarten?“ Alle Stadträte von CDP, LDP, PDS und NSU lachten, fast alle. Von den zwanzig Stadträten gehörte nur einer der Opposition an, nämlich Karl Löbel von der Linksfraktion. Aber der hielt aus gutem Grund den Mund. Den Abend zuvor hatten ihn Jungmitglieder der CDP zusammengeschlagen. Seine Nase war gebrochen und rot geschwollen, die Lippen blutverkrustet und sein Unterleib schmerzte wegen der Tritte mit den harten Stiefeln. Er konnte kaum reden und hielt die Schnauze. Als jedoch der Tagesordnungspunkt „Privatisierung der Polizei und der Steuerbehörden“ aufgerufen wurde, meldete er sich als Erster zu Wort. Zähneknirschend erteilte ihm der Vorsteher des Stadtrates das Wort. Der Bürgermeister bekam einen Wutanfall. „Nachdem mir eure Leute gestern die Fresse poliert haben, sozusagen als sachliche Auseinandersetzung mit politischen Argumenten, muss ich hier und jetzt nur noch die Ermordung durch eure wohlgeratene Jugend fürchten. So weit ist dieser Staat gekommen! Die Polizei soll durch die Mafia ersetzt werden. Vor zwei Wochen kamen vier gepflegte junge Männer in die örtlichen Polizeistationen und unterwarfen sie ihren Befehlen, mit einer Vollmacht des Bundeskanzlers Piepgen.“ Der Stadtverordnetenvorsteher brüllte: „Herr Abgeordneter, ich fordere Sie auf, den Amtstitel „Reichskanzler des Vierten Reiches“ zu verwenden. Andernfalls schließe ich Sie von der Sitzung aus.“ Der einzige Oppositionsabgeordnete fuhr fort. „Diese vier Männer gehören der russischen Mafia von Sergej Tscherwinski an. Das wollen Sie aber nicht wissen. Für Sie sind die Befehle aus Berlin das A und O. Viel schlimmer ist es, dass Sie auch nicht bemerkt haben wollen, dass sich vier weitere Kerle in das Finanzamt eingeschlichen haben, und zwar von derselben Mafiaorganisation. Diese Leute haben die Erlaubnis, Steuern einzunehmen und die Bürger auch mit Gewalt zu Steuerzahlungen zu zwingen. Das ist doch Mittelalter! Diese Bande kann auch völlig neue Steuern festlegen und einnehmen, zum Beispiel eine Fenster- oder eine Obstbaumsteuer. Das ist doch Anarchie! Wollen wir das in Braunlage?“ „Herr Abgeordneter Löbel! Wegen defätistischer und staatsfeindlicher Äußerungen sehe ich mich gezwungen, Ihnen das Wort zu entziehen und Sie von der Sitzung auszuschließen.“ Der Gemeindediener führte den Stadtrat Löbel aus dem Saal, ihn ruppig am Ärmel des Jacketts ziehend. Als die Saaltür hinter den beiden zuschlug, trat ein Abgeordneter der CDP neben den Bürgermeister und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Bürgermeister nickte. Am übernächsten Morgen trat Stadtrat Löbel aus dem Haus, machte ein paar Schritte durch den kleinen Vorgarten und atmete tief ein. Plötzlich nahm er ein leises Sirren in der Luft wahr. Er schaute hoch, sah aber nichts. Als er die Gartenpforte öffnen wollte, sank er zusammen und stürzte auf den gepflasterten Weg. Er schrie um Hilfe. Nach wenigen Sekunden erlosch seine Stimme. Der von den Nachbarn herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Geschickt ließ er das kleine, spitze Geschoss, das im Hals des Stadtrates steckte, unter seiner linken Hand und dann im Ärmel verschwinden. Die drei um ihn stehenden alten Leute bemerkten nichts von seinem Trick. Zwei Tage später erfuhr der Bürgermeister offiziell vom Tod des Stadtrates. Die zehn Mitarbeiter der Geheimen Staatspolizei in Braunlage hatten eine perfekte Arbeit geleistet. Der Notarzt musste schweigen. Er ließ eine Todesanzeige in der einzigen und ihm gehörenden Tageszeitung erscheinen, in der er „den schmerzlichen Verlust für das Gemeinwohl, die ganze Stadt und den Stadtrat betrauerte“. In der folgenden Sitzung des Stadtrates mussten sich die Abgeordneten zu einer stummen Trauerminute erheben. „Nachdem wir nun unter uns sind und daher offen reden können“, eröffnete der Bürgermeister die Sitzung, „wollen wir einmal prüfen, was uns die jüngste Steuerreform aus Berlin gebracht hat. Herr Kämmerer, Sie haben das Wort.“ Der neue Stadtkämmerer war erst seit zwei Wochen im Amt, trat aber auf, als wäre er Finanzminister. Er hatte sein Handwerk bei einem Finanzamt und danach bei der Gesellschaft Black&WhiteWater für Finanzinvestoren gelernt. So sah er auch aus: dunkelblauer Anzug, fein gestreiftes Hemd mit reinweißem Kragen, lila-grau-silbern gestreifte Krawatte und schwarze Lackschuhe, Alter 35, die Haare schwarz gefärbt und gegelt. Alle im Saal wussten, dass der neue Kämmerer auch der neue Chef des Finanzamtes war. Sie wussten jedoch nicht, dass der junge Mann von einer Gesellschaft zur Rekrutierung von Steuer- und Finanzspezialisten nach Braunlage beordert worden war. Diese Gesellschaft mit dem vielgepriesenen Namen „Treue, Ehre, Vaterland“ gehörte zu gleichen Teilen dem Rechtsanwalt Müller-Lüdenscheid II und dem Kanzlerassistenten Lafontaine. Die beiden hatten sich das ausgedacht, weil die Mafiaorganisationen nicht das erforderliche Fachpersonal für die Finanzämter stellen konnten. Ihr bisher erfolgreicher Plan war es, skrupellose Jungmanager aus den Beratungs- und Investmentfirmen abzuwerben, nicht nur durch hohe Gehälter, sondern vor allem mit der Aussicht auf üppige Gewinnbeteiligungen. Damit waren die Mafiosi überhaupt nicht einverstanden. Sie wollten fünfzig Prozent der Steuereinnahmen, wie vom Kanzler versprochen. Der Rechtsanwalt und Lafontaine mussten klein beigeben und vereinbarten, nach einem halben Jahr sollten die Gehälter und die Boni der Jungmanager halbiert werden. Wer das nicht akzeptierte, würde entlassen. Eine Chance auf die Rückkehr auf ihre alten Jobs hätte niemand. Denn ihre Positionen hätten bereits andere karrieresüchtige Leute eingenommen. „Das haben wir doch toll geregelt“, freute sich Lafontaine. „Hoffen wir bloß, dass die nicht nach der Halbierung des Gehaltes zur Opposition wechseln.“ „Ach, was, die sind unpolitisch, nur geldgierig. Und die lassen sich prima von den Familien einsetzen. Da fehlte es ja oft an versierten Geldwäschern, Investorenberatern und Lobbyisten. Außerdem wird es bald keine Opposition mehr geben.“ Der neue Kämmerer trat ans Rednerpult und ließ den großen Bildschirm aufleuchten, um seine Zahlen präsentieren zu können. „Insgesamt sind die Steuereinnahmen in den letzten zwei Monaten um 12 % gestiegen. Das mag an der guten Wirtschaftslage liegen und lässt sich wahrscheinlich nicht mit Maßnahmen der Regierung begründen.“ In den Seminaren der Gesellschaft „Treue, Ehre, Vaterland“ war er gedrillt worden, eine „volksnahe Sprache zu sprechen“, „Fremdwörter und Fachchinesisch zu vermeiden“ und „die Menschen nicht intellektuell zu überfordern“, gerade auch bei Gemeinderäten und anderen Parlamentariern. Anfangs hatte er verflucht, auf was er sich da eingelassen hatte. Sein elitäres Bewusstsein, der absolut perfekte Investmentexperte zu sein und die Kunden gekonnt zu seinem eigenen Vorteil beraten zu können, bekam zunächst einen Dämpfer, weil Stadträte auch unbequeme Fragen stellten, vor allem die von der Linksfraktion. Aber die gab es in Braunlage nicht mehr. „Sehr geehrte Volksdeutsche“, sprach er die Stadtverordneten zu deren Erstaunen an. Das kam nicht so gut an, denn einige Stadträte murmelten oder posaunten ihre Meinung heraus. „Sehr geehrte Stadtverordnete“, korrigierte sich der Kämmerer, „wir schätzen, dass sich bis April nächsten Jahres die Steuereinnahmen verdoppelt haben werden. Von da ab werden 50 % der Steuern an unsere Gesellschaft überwiesen. Sie, liebe Stadträte, wissen wohl, auf welche Weise wir dieses Ziel zu erreichen gedenken. Als erste Maßnahme werden unsere Fachleute die Steuerpflichtigen an ihrem Arbeitsplatz und zu Hause aufsuchen. Wenn der Steuerpflichtige nicht 50 % mehr Steuern zahlt, rücken ihm zwei kräftige Mitarbeiter unserer Gesellschaft auf den Leib, enthalten sich aber jeglicher körperlicher Gewalt. Wenn das erfolglos bleibt, übernimmt die gemeinsame Jugendorganisation von CDP und NSU, die „Junge Morgenröte“, die weitere Behandlung. Sie können mir glauben, dann wird der Delinquent zahlen.“ Er machte eine Pause, um die Wirkung seiner Worte zu prüfen. Die Stadträte hörten ihm aufmerksam zu. Gut reden kann der, dachte so mancher. „Dabei interessiert uns nicht, wie viel der Bürger bereits zahlt. Jeder muss 50 % mehr zahlen. Natürlich werden wir die einflussreichen Bürger schonen. Wir können ja nicht die Kuh umbringen, die uns Milch gibt.“ Er lachte, die Stadträte feixten. Sie nahmen selbstverständlich an, sie gehörten zu den Einflussreichen. „Aber“, den Arm hochhebend, dämpfte er die ausgelassene Stimmung, „aber wir müssen uns auch neue Einnahmequellen ausdenken, mit denen wir den Kampf gegen die Aufständischen und Landesverräter finanzieren können. Dabei geht es nicht um eine Apfelbaum- oder Fenstersteuer, wie der zu unserem grööößten Bedauern verstorbene Abgeordnete Karl Löbel unterstellt hat“, er grinste breit, und die Stadträte johlten, „sondern um politische Steuern für die Regierung. Dazu gehören Abgaben, die die finanziellen Möglichkeiten der Unterschicht noch weiter einschränken, also höhere Steuern auf Strom, Gas und Benzin, aber auch auf den Eisenbahn-, Bus- und Straßenbahnverkehr, vor allem aber die Erhöhung der Steuern auf Lebensmittel auf 40 %. Die müssen schon am 20. eines Monats nur noch Geld zur Ernährung übrig haben. Dann kommen auch keine Gedanken mehr nach Revolution auf. Für höhere Mieten hat ja der sogenannte Markt schon früher gesorgt, hahaha. Sie sehen, liebe Abgeordnete, alles ist im Fluss und auf dem besten Wege. Jetzt müssen wir beten, dass die Terroristen, bestehend aus Linken, Gewerkschaften, Heer und Luftwaffe, geschlagen werden. Wir Finanzexperten werden unseren Teil dazu beitragen, so wahr uns Gott und Allah helfe!“ Seine Rede wurde mit heftigem Trampeln und Faustschlägen auf die Tische bedacht. Eine Diskussion war nicht vorgesehen. Man beschloss, im Ratskeller ausgiebig zu Mittag zu essen und danach die Stadtratssitzung fortzusetzen. Das Menü bestand aus Zwiebelsuppe, Grünkohl mit Schweinebauch, Bratwurst, Blutwurst und Kassler und danach Pflaumen in Rotwein. „So ein Quatsch, einmal in der Woche ein Gemüsegericht ohne Fleisch vorschreiben zu wollen. Der Mensch ist, was er isst. Da wachsen dem die Tomaten auf dem Kopf und aus den Ohren sprießt der Schnittlauch. Hahaha!“ Der Abgeordnete haute sich auf die Schenkel. Das gemeinsame Mittagessen erwies sich nicht nur als sehr gemütlich, sondern auch als politisch und effizient. Denn es wurden sechzig halbe Liter Bier getrunken, begleitet von zwanzig großen Korn. Am Abend wusste der Stadtverordnetenvorsteher seiner Frau zu erzählen, man habe wichtige politische Entscheidungen getroffen: „Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3. Punkt 4 habe ich vergessen. Aber alle waren dafür.“ Torkelnd war er seinem Auto entstiegen. Er wusste, dass die Polizei andere Aufgaben hatte, als brave Bürger an ihrer „freien Fahrt für freie Bürger“ zu hindern. Um halb zehn lag er im Bett und schnarchte. Seine Frau, die sich eine Quizsendung im Fernsehen anschaute, war wieder einmal enttäuscht von ihrem Mann. Sie schaltete auf einen Pornosender um und griff sich zwischen die Schenkel. An dem Fenster, das bis zum Boden reichte, schob sie Vorhang und Gardine beiseite und zog Rock und Schlüpfer aus. Sie setzte sich mit weit gespreizten Schenkeln auf das Sofa. Sie wusste, dass man sie von der gegenüberliegenden Straßenseite gut erkennen konnte. Der Gedanke, jemand würde sie bei ihrem schamlosen Tun beobachten, machte sie hemmungslos lüstern. Als sie Schritte auf dem gegenüberliegenden Trottoir hörte, richtete sie den Lichtkegel der Stehlampe auf ihren nackten Unterleib. Nun waren zwei langsam gehende, eher schlendernde Männer zu sehen, die sich offensichtlich unterhielten. Der eine nahm das Licht im Wohnzimmer des Stadtverordneten wahr. Er stieß seinen Kumpel an. Sie sahen eine Frau, die mit der rechten Hand die Schamlippen auseinander spreizte und mit dem linken Zeigefinger immer wieder in ihr Loch stieß. Die Frau hoffte, die beiden würden bei ihr klingeln. Sie würde sie hereinlassen und so leer melken, dass sie zwei Wochen nicht ejakulieren könnten. Sie keuchte vor Lust. Aber die beiden Männer gingen weiter. Sie stellte sich vor, die beiden würden sie jeden Tag besuchen, wenn ihr Mann in der Sitzung des Stadtrats weilte. Aufgeheizt durch die zahlreichen Kopulationen in dem Film, war ihr Geschlecht angeschwollen und gerötet. Sie rieb und schlug heftig darauf und stöhnte. In dem Film sah sie, wie ein riesiges Glied zwischen nass glänzende Schamlippen fuhr. Sie kreischte und spritzte. Ihr Blick war glasig und sie atmete schwer. Plötzlich riss sie die Augen auf, weil sich auf der Straße etwas Seltsames bewegte. Sie stürzte zum Fenster und sah eine merkwürdige olivgraue Maschine mit menschenähnlichem Körper marschieren. Die Maschine drehte den Kopf in alle Richtungen, so als ob sie sich sichern wollte. Aufgeregt rannte sie in das Schlafzimmer und weckte ihren Mann, indem sie ihn anschrie, er müsse sehen, was da auf der Straße vor sich gehe. Grummelnd erhob er sich aus dem Bett, noch im Anzug und mit den Schuhen an den Füßen, und schritt rülpsend an das Fenster. „Oje, wat is dat dann“, lallte er. Aus dem Schrank im Flur nahm er sein Jagdgewehr, obwohl ihn seine Frau anflehte, er solle wieder ins Bett gehen, er sei ja immer noch betrunken. Sie konnte „das besoffene Stück“ nicht daran hindern, auf die Straße zu treten und mit dem Gewehr auf die Maschine zu zielen. Der Roboter erfasste die Situation schneller, als der Betrunkene das Gewehr abfeuern konnte. Die Frau des Stadtverordneten sah, wie aus dem rechten Arm des Roboters ein weißer Blitz schoss und ihren Mann niederstreckte. Für den Roboter war das Zielobjekt Gewehr mit dem Sturz des Gewehrträgers eliminiert. Er marschierte weiter in Richtung Heidegrundkaserne, die seit Piepgens Amtsantritt Walhalla-Kaserne hieß. Die Frau des getöteten Stadtverordnetenvorstehers fühlte sie sich leer, nachdem sie die Leiche ihres Mannes, erledigt durch eine komische Maschine, in den Vorgarten gezogen hatte. Sie bestellte den Notarzt, der sich insgeheim wunderte, dass keine Giftpfeile den Stadtrat erledigt hatten, sondern massive Verbrennungen im Bereich des Herzens und der Lunge. Weder der Notarzt, noch die herbeigerufenen Polizisten sahen eine Notwendigkeit, die Todesursache näher zu analysieren. Sie hielten die Aussage der Witwe für „Geschwätz“. Mittlerweile war es kurz nach drei Uhr in der Nacht und der Roboter war nur noch zwei Kilometer von der Heidegrundkaserne des Heeres entfernt. Am Ortsausgang von Braunlage lud er an einer Tankstelle seine Batterien auf und füllte seine Benzintanks in den Beinen. Mit leicht schaukelndem Gang bewegte er sich auf der Zufahrtsstraße in Richtung des Haupttores. Die aus sechs Soldaten bestehende Nachtwache saß vor den Monitoren, deren Kameras die unmittelbare Umgebung des großen Kasernengeländes abtasteten. Der Zufahrtsstraße schenkten sie keine Beachtung. Wer würde sich so exponieren? „So ein Scheiß, dass wir jetzt zu sechst Nachtwache schieben müssen. Früher haben doch zwei Mann gereicht.“ „Der Major wird schon seine Gründe haben. Das hängt wohl mit den Kämpfen zwischen der Marine und dem Heer und der Luftwaffe zusammen. Vielleicht plant die Marine einen Angriff auf unsere Kaserne.“ „Was? So weit im Binnenland? Das wagen die nie.“ „Seht mal, was ist das denn da draußen?“ „Sieht aus wie ein Roboter.“ „Wie im Film.“ „Die Amis sollen so etwas haben.“ „Wir gehen mal raus und sehen nach, wie das Ding reagiert.“ „Seid vorsichtig, diese Dinger sollen sehr gefährlich sein.“ Die beiden anderen Soldaten lachten und packten ihre Schnellfeuergewehre. Als sie neben das Wachhäuschen traten, sahen die vier in der Pförtnerloge gebliebenen Soldaten, wie aus dem rechten und dem linken Arm des Roboters je ein Blitz aufleuchtete. Die beiden waffentragenden Soldaten waren sofort tot. Die vier in der Pförtnerloge warfen sich auf den Boden. Einer von ihnen konnte noch die Alarmtaste drücken und sein Kollege unter „besondere Vorkommnisse: Roboter greift an“ in das digitale Wachbuch eintippen. Sirenen heulten auf, plötzlich war das Kasernengelände taghell erleuchtet. Aus den Baracken stürzte die Kompanie der Alarmbereitschaft. Die gut fünfzig Soldaten in Kampfmontur waren mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Der kommandierende Hauptmann ließ das Funktelefon in der Wache klingeln und erfuhr, dass ein Kampfroboter zwei Soldaten getötet habe und vermutlich in die Kaserne eindringen werde. Wahrscheinlich sei er mit Hochleistungslasern ausgerüstet. Der Hauptmann ließ die Soldaten Deckung nehmen, informierte sie über die Lage und versorgte sie mit Flammenwerfern und Panzerabwehrraketen. „Diese Sachen werden ihn wohl umbringen.“ Er hielt die Situation für so gefährlich, dass die 50 Mann von der Alarmbereitschaft mit dem Roboter nicht fertig werden würden, und löste Großalarm für alle anderen 400 Soldaten aus. Der befehlshabende Major teilte die Lagebeurteilung des Hauptmanns. Er ließ alle Scheinwerfer ausschalten, denn seine Männer wären bei dieser Helligkeit zu leicht zu erkennen. Man sagte, die Infrarotbilder des Roboters wären nicht so scharf und kontrastreich wie Aufnahmen mit sichtbarem Licht. Vermutlich traf das auf diese neue Robotergeneration zu. Zusätzlich zu den optischen hatten sie auch feinste akustische Sensoren und konnten außerdem Gerüche wahrnehmen, alles zusammen viel besser als ein Mensch. Leider waren die 18 Panzer an diesem Standort nicht einsatzbereit. Die müssten erst noch betankt und mit Munition versorgt werden. Inzwischen hatte der Roboter mit einer Ladung Plastiksprengstoff das Haupttor in Stücke gerissen. Da es sein Auftrag war, die Panzer, LKWs und Munitionslager am Standort Heidegrund zu zerstören, ignorierte er das Wachgebäude und die Wohnbaracken und schwenkte nach rechts zu den Lagerhallen. An den Hallenecken, auf den Hallendächern und hinter den im Gelände verstreuten Betonsperren warteten die Soldaten „auf den Feind“. Natürlich erkannte der Roboter die hin und her huschenden Soldaten, aber er hatte Prioritäten zu setzen. Er schoss zwei Nebelgranaten ab, um die Soldaten zu verwirren. Das Tor zu der riesigen Panzerhalle hatte er schnell zerstört. Der Major kauerte gegenüber der Panzerhalle auf dem Boden und bedeutete den fünf Mann mit den Panzerabwehrraketen, auf den Roboter zu feuern. Der Roboter liquidierte zuerst die vier Soldaten auf dem Dach, die auf ihn zielten. Er sah die Raketen auf sich zurasen, sprang seitwärts und erschoss den Major und die fünf Soldaten mit sechs simultanen Laserimpulsen. Wenn der Roboter hätte lächeln können, so hätte er jetzt gelächelt, denn die an ihm vorbeifliegenden Panzerabwehrraketen setzten drei Panzer in Brand. Innerhalb einer halben Minute verschoss er seine gesamte panzerbrechende Munition. Die Hallendecke wurde glühend heiß, die senkrechten tragenden Säulen zerbrachen und die Geschützrohre der Panzer wurden weich und schlaff. Dann stürzte die Hallendecke in ein Flammeninferno. Aufgabe 1 erledigt, registrierte sein Arbeitsspeicher. Einhundertfünfzig Meter vor sich erkannte er eine Phalanx von Flammenwerfern und Panzerabwehrkanonen und aktivierte sofort sein Sprunggelenk, das ihn auf das Dach der nächsten Halle katapultierte. Bevor die Soldaten überhaupt die Ortsveränderung des Roboters wahrgenommen hatten, wurden sie alle durch eine Phosphorbombe verbrannt. Der Hauptmann, der erkannt hatte, worauf es dem Roboter ankam, wollte ihm den Weg zum Munitionsbunker versperren. Soldaten versuchten, ihre Flammenwerfer einzusetzen. Aber der Roboter war schneller. Alle Soldaten des Kommandos wurden eliminiert. Der Roboter legte um das Munitionslager ein Kabel, erschoss zwischendurch einige auf ihn lauernde Soldaten und befestigte an geeigneten Stellen Brandbomben. Er zerschnitt den Kasernenzaun, zündete die Sprengsätze und kauerte sich tief in eine Bodensenke. Die Explosion war so gewaltig, dass im entfernten Braunlage um fünf Uhr ein heller Blitz zu sehen war. Einige Sekunden nach der Explosion zerstörte der Roboter sämtliche Armeelastwagen durch Brandsätze. Damit waren seine Aufgaben erledigt und er machte sich auf den Weg nach Berlin, genauso wie mehr als 1400 andere Kampfroboter. Dort hatten sie den militärischen Ring des Heeres um Berlin auszuschalten. Karl-Friedrich Bornheim, seine Frau Inge und die drei Generäle Baudissin, Brandt und Eisner sprachen über die Lage. Es war früh am Morgen, gerade einmal halb sieben. Die Bedienung räumte das Frühstücksgeschirr und die Reste der Mahlzeit vom Tisch und vom Büffet. Brandt: „Unsere Luftaufklärung meldet zwei Konvois mit 120 Transportschiffen im Nordatlantik, etwa vier Tage von Bremerhaven entfernt.“ Inge Bornheim: „Wahrscheinlich weitere Lieferungen von Panzern, Raketen, Flugzeugen und Munition.“ Brandt: „Ja, sehr wahrscheinlich. Aber dieses Mal sind sie in Begleitung von 50 Kriegsschiffen, darunter zwei Flugzeug- und ein Hubschrauberträger. Die werden wir kaum versenken können.“ Bornheim (KFB): „Die werden damit rechnen, in Bremerhaven wieder angegriffen zu werden. Kann man die nicht schon jetzt angreifen?“ Baudissin: „Mit U-Booten vielleicht, aber die hat nur die Marine. Mit Flugzeugen kaum. Die werden abgeschossen, sobald sie in Reichweite sind.“ Inge Bornheim: „Und wenn die Flugzeuge Raketen aus großer Entfernung abschießen, zumindest auf die Flugzeugträger und größeren Kampfschiffe.“ Brandt: „Ja, dazu brauchen wir mindestens hundert Jagdbomber mit je vier großkalibrigen Raketen. Die haben wir.“ Luftwaffeninspekteur Peter Brandt rannte aus dem Besprechungszimmer. Bis die Flugzeuge betankt und mit den Raketen bewaffnet wären, würde mindestens eine Viertelstunde vergehen. Mit dem altmodischen analogen Funknetz, das weder die Geheimdienste noch die Marine abhören konnten, hatte er in wenigen Minuten die Einsatzbefehle an alle Luftwaffenstützpunkte und an die Satellitenaufklärung verteilt. Fünf Minuten später blinkten in den Flugplatzkasernen die Alarmampeln. General Brandt kehrte in den Besprechungsraum zurück. „Ich hoffe, in zehn Minuten sind die Maschinen in der Luft. Zwei Flugzeuge mit je vier Raketen für jedes Schiff. Vierhundert Raketen für 170 Schiffe, das müsste klappen.“ „Das bedeutet, wir treten in einen Krieg mit den USA ein“, wandte Inge ein. „Sicher. Aber sehen Sie eine andere Lösung? Krieg bedeutet erst einmal Bürgerkrieg in Deutschland. Es ist die Frage, ob sich die USA darin verwickeln lassen wollen.“ „Wenn Piepgen denen was zu bieten hat, nach seinem Sieg im Bürgerkrieg, dann werden die sich einmischen. Militärstützpunkte, ungehemmte Industriespionage, Börsenmanipulationen, Aufkäufe von Unternehmen.“ „Damit beraubt er sich ja seiner Macht.“ „Das ist dem doch egal. Hauptsache, er bleibt Kanzler, kann Luxus fressen und saufen, und vor allem luxusficken.“ „Aber Inge, deine Ausdrucksweise!“ „Ist doch wahr.“ Sie schwieg kurz. „Es scheint ja, dass Großbritannien und Russland nach der Versenkung ihrer Schiffe keinen weiteren Nachschub mehr entsenden. Die haben wohl genug Schiffe verloren.“ „Zum Glück für uns. Wie viele Kampfroboter sind eigentlich auf dem Weg nach Berlin?“, wollte KFB wissen. „Die sehe ich als größte Gefahr für unseren Belagerungsring um Berlin.“ Brandt zog die Schultern hoch. „Die Luftaufklärung spricht von 44 durch unsere Hubschrauber zerstörten Robotern. Wir haben allerdings auch 25 Hubschrauber verloren. Diese Dinger sind wirklich höchst gefährlich. Tage später haben wir durch hoch fliegende Jagdflugzeuge weitere 60 Roboter zerstört, danach keinen mehr. Denn die haben sich auf nächtliche Aktionen und Märsche umgestellt. Ich wüsste gerne, wie diese Dinger programmiert sind. Wir müssten ein paar von denen unbeschädigt in unsere Gewalt bekommen, sozusagen gefangen nehmen.“ „Aber wie? Ich schlage vor, dass sich der Technische Geheimdienst MTSS sofort damit befasst“, meinte Baudissin. Alle nickten. „Die haben alle Mittel dazu, sollte man meinen, jedenfalls nach dem Geld zu urteilen, das die bisher gekostet haben.“ „Habt ihr euch überlegt, wie die USA reagieren werden, wenn wir deren kleine Kriegsflotte und die Transportschiffe angreifen und vielleicht versenken?“ Inge Bornheim wartete einen Augenblick. „Die haben in Deutschland noch 15.000 Soldaten stationiert. Und etliche Kernwaffen in Büchel in der Eifel. Und vor allen Dingen Standorte ihrer Geheimdienste an der Nordseeküste, im Frankfurter Raum und in Baden-Württemberg, mit tausenden Agenten und Militärpolizei. Was werden die also tun? Uns weiter machen lassen?“ Ihr Mann nickte. „Da stimme ich dir zu. Was können wir gegen die Reaktion der US-Regierung tun?“ Kurt Eisner, Inspekteur des Heeres, hatte bisher geschwiegen, auch weil er die geplanten Angriffe der Luftwaffe nicht akzeptierte. „Die scheißen doch auf Verbündete. Wahrscheinlich setzen sie ihr Militär gegen uns ein, Heer, Luftwaffe und Polizei, notfalls auch mit Kernwaffen, falls sie zu schwach sind. Oder sie erpressen und drohen uns mit deren Einsatz. Deshalb schlage ich Aktionen in folgender Reihenfolge vor:
Оглавление1 Neutralisierung der US-Kernwaffen in Deutschland
2 Umzingelung der US-Kasernen und -Stützpunkte
3 Ausschaltung der US-Geheimdienstzentralen“