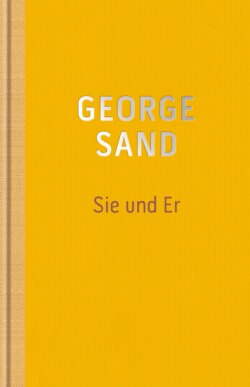Читать книгу Sie und Er - George Sand - Страница 3
Оглавление1.
Schon auf den ersten Blick verstand Thérèse nur allzu gut, dass Verdruss und Eifersucht diesen Brief diktiert hatten.
»Und doch«, sagte sie sich, »ist er nicht in mich verliebt. O nein! Er wird bestimmt niemals in irgendjemanden verliebt sein, und in mich schon gar nicht.«
Und während sie den Brief noch einmal durchlas und vor sich hin träumte, fürchtete Thérèse, sie könne sich selbst belügen, wenn sie sich einzureden versuchte, Laurent drohe in ihrer Nähe keine Gefahr.
»Ach was! Welche Gefahr denn schon«, sprach sie weiter zu sich selbst: »leiden an einer verliebten Laune? Kann man denn überhaupt an einer verliebten Laune sehr leiden? Ich weiß das einfach nicht. Ich habe nie eine gehabt!«
Doch da schlug die Wanduhr fünf Uhr nachmittags.
Nachdem Thérèse den Brief in ihre Tasche gesteckt hatte, verlangte sie nach ihrem Hut, schickte ihren Diener für vierundzwanzig Stunden auf Urlaub, gab ihrer getreuen Catherine noch einige Anweisungen und bestieg eine Droschke. Zwei Stunden später kam sie mit einer kleinen zarten Frau zurück, die leicht vornübergebeugt und tief verschleiert war, so dass nicht einmal der Kutscher ihr Gesicht zu sehen bekam. Sie schloss sich mit dieser geheimnisvollen Person ein, und Catherine trug ihnen ein kleines, aber sehr schmackhaftes Mahl auf. Thérèse umsorgte und bediente ihre Besucherin, die sie voller Entzücken und mit solcher Begeisterung anschaute, dass sie kaum essen konnte.
Laurent seinerseits bereitete sich auf die angekündigte Lustbarkeit vor; doch als Prinz D*** ihn mit seinem Wagen abholen wollte, sagte ihm Laurent, eine unvorhergesehene Angelegenheit halte ihn leider noch für zwei Stunden in Paris fest, er werde aber im Laufe des Abends in das Landhaus des Prinzen nachkommen.
Laurent hatte jedoch überhaupt nichts zu erledigen. In fieberhafter Eile hatte er sich angekleidet und mit besonderer Sorgfalt frisieren lassen. Dann warf er seinen Rock auf einen Sessel und fuhr mit der Hand durch seine viel zu symmetrisch angeordneten Locken, ohne daran zu denken, wie er nun wohl aussehen mochte. Er ging in seinem Atelier auf und ab, bald schneller, bald langsamer. Als Prinz D*** weggegangen war, nachdem er ihm zehnmal das Versprechen abgenommen hatte, sich mit der Abfahrt zu beeilen, stürzte Laurent auf die Treppe hinaus, um den Prinzen zu bitten, er solle doch auf ihn warten, und um ihm zu sagen, er lasse die Angelegenheit fallen und könne doch gleich mitfahren; aber er rief ihn nicht zurück und begab sich in sein Zimmer, wo er sich auf sein Bett warf.
›Warum verschließt sie mir für zwei Tage ihre Türe? Da steckt etwas dahinter. Und wenn sie mich schließlich für den dritten Tag bestellt, dann nur, damit ich bei ihr einen Engländer oder Amerikaner treffe, den ich gar nicht kenne! Sie dagegen, sie kennt diesen Palmer sehr wohl, den sie bei seinem Kosenamen nennt! Wieso hat er mich dann um ihre Anschrift gebeten? Um mir etwas vorzumachen? Warum sollte Thérèse mir etwas vormachen? Ich bin nicht ihr Geliebter, ich habe keinerlei Anrecht auf sie! Der Geliebte von Thérèse! Das werde ich bestimmt nie sein. Gott bewahre mich davor! Eine Frau, die fünf Jahre älter ist als ich, vielleicht sogar mehr! Wer kennt schon das Alter einer Frau, und noch dazu dieser Frau, von der niemand etwas weiß! Hinter einer so geheimnisvollen Vergangenheit muss sich irgendeine Riesendummheit verbergen, vielleicht eine handfeste Schande. Und zu alledem gibt sie sich spröde oder fromm oder philosophisch, wer weiß das schon? Über alles spricht sie so unvoreingenommen oder so tolerant, so unbefangen … Weiß man denn, was sie wirklich denkt, was sie will, was sie liebt, und ob sie überhaupt fähig ist zu lieben?‹
Da platzte Mercourt herein, ein junger Kritiker, ein Freund von Laurent.
»Ich weiß«, sagte er zu ihm, »Sie wollen nach Montmorency rausfahren. Ich komme auch nur auf einen Sprung, ich mochte Sie lediglich um eine Adresse bitten, und zwar um die von Fräulein Jacques.«
Laurent fuhr zusammen.
»Und was zum Teufel wollen Sie von Fräulein Jacques?«, antwortete er und tat so, als suche er Papier, um sich eine Zigarette zu drehen.
»Ich? Nichts … das heißt, doch! Ich möchte sie gern kennenlernen; ich kenne sie nur vom Sehen und Hörensagen; nach der Anschrift aber frage ich für jemanden, der sich gern malen lassen möchte.«
»Sie kennen Fräulein Jacques vom Sehen?«
»Und ob! Sie ist doch jetzt ganz berühmt, und wem wäre sie wohl nicht aufgefallen? Sie ist wie geschaffen dafür.«
»Finden Sie?«
»Nun ja! Sie etwa nicht?«
»Ich? Ich weiß nicht. Ich habe sie sehr gern, ich bin da nicht ganz unbefangen.«
»Sie haben sie sehr gern?«
»Ja, wie Sie sehen, spreche ich das sogar aus, was wiederum beweist, dass ich ihr nicht den Hof mache.«
»Sehen Sie sie häufig?«
»Ab und an.«
»Dann sind Sie also ihr Freund … ernsthaft?«
»Na schön, ja, ein wenig … Warum lachen Sie?«
»Weil ich kein Wort davon glaube; mit vierundzwanzig ist man nicht der ernsthafte Freund einer Frau, die … jung und schön ist!«
»Unsinn! Weder ist sie so jung noch so schön, wie Sie sagen. Sie ist eine gute Freundin, recht angenehm anzuschauen, weiter nichts. Dennoch gehört sie zu einem Typ, den ich gar nicht schätze; und ich muss mich zwingen, ihr nachzusehen, dass sie blond ist. Blondinen mag ich nur in der Malerei.«
»So blond ist sie nun auch wieder nicht! Sie hat sanfte schwarze Augen, ihr Haar ist weder braun noch blond, und sie versteht sich darauf, es in ganz besonderer Weise zu frisieren. Übrigens steht ihr das, sie sieht aus wie eine gutmütige Sphinx.«
»Das ist ein hübsches Wort; aber … Sie persönlich, mögen Sie denn große Frauen?«
»Sie ist nicht sehr groß, sie hat kleine Füße und kleine Hände. Sie ist eine richtige Frau. Ich habe sie mir genau angeschaut, weil ich in sie verliebt bin.«
»Sieh mal einer an, wie kommen Sie denn dazu?«
»Ihnen macht das doch wohl nichts aus, da sie Ihnen als Frau nicht besonders gefällt?«
»Mein Lieber, und wenn sie mir gefiele, es wäre genau dasselbe. In diesem Fall würde ich es vorziehen, mich mit ihr besser zu stellen als augenblicklich; aber verliebt wäre ich nicht, das ist ein Zustand, von dem ich nichts halte; folglich wäre ich auch nicht eifersüchtig. Führen Sie Ihren Vorsatz unverdrossen aus, wenn es Ihnen denn so beliebt.«
»Ich? Ja, wenn sich die Gelegenheit bietet; aber ich habe keine Zeit, sie zu suchen; und im Grunde bin ich wie Sie, Laurent, und neige durchaus zu Geduld, da ich ja in einem Alter bin und in einer Welt lebe, wo es an Vergnügungen und Freuden nicht mangelt … Doch da wir schon von dieser Frau sprechen und Sie sie kennen … so sagen Sie mir doch … und das ist meinerseits reine Neugier, was ich Ihnen hiermit ausdrücklich versichere … ob sie nun Witwe ist oder …«.
»Oder was?«
»Ich wollte sagen, ob sie die Witwe eines Liebhabers ist oder die eines Ehemannes.«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Nicht möglich!«
»Ehrenwort! Ich habe sie nie danach gefragt. Das ist mir auch völlig gleichgültig!«
»Wissen Sie, was über sie geredet wird?«
»Nein, darum kümmere ich mich überhaupt nicht. Was wird denn geredet?«
»Sehen Sie, nun kümmern Sie sich doch darum! Es heißt, sie sei mit einem reichen Mann von Stand verheiratet gewesen.«
»Verheiratet …«.
»Richtiggehend verheiratet, vor dem Standesbeamten und dem Priester.«
»Dummes Zeug! Sie würde seinen Namen und seinen Titel tragen.«
»Ach!, das ist es ja eben. Dahinter steckt ein Geheimnis. Wenn ich Zeit habe, werde ich versuchen, das herauszubekommen, und es Ihnen dann mitteilen. Es heißt, sie habe – soweit bekannt – keinen Liebhaber, obwohl sie ein sehr freies Leben führt. Übrigens müssten Sie das doch am besten wissen?«
»Darüber weiß ich gar nichts. Nein, so was! Nun hören Sie mir mal zu. Glauben Sie womöglich, ich brächte meine Tage damit zu, die Frauen zu beobachten und auszuhorchen? Schließlich bummle ich für meine Person nicht so viel herum wie Sie! Ich finde, das Leben ist sehr kurz, will man leben und arbeiten.«
»Leben … da will ich nichts sagen. Sie scheinen in vollen Zügen zu leben. Was das Arbeiten anlangt … so heißt es, Sie arbeiteten nicht genug. Sieh mal an, was haben Sie denn dort? Lassen Sie mal sehen!«
»Nein, das ist nichts, ich habe nichts Neues angefangen.«
»Aber gewiss doch, dieser Kopf dort … sehr schön, Teufel nochmal! Nun lassen Sie mich schon sehen, oder Sie kommen in der nächsten Kunstausstellung schlecht weg.«
»Dazu sind Sie durchaus imstande.«
»Ja, wenn Sie es darauf anlegen; aber dieser Kopf da, der ist einfach ganz herrlich und verdient unbedingt Bewunderung. Was soll das geben?«
»Weiß ich es?«
»Soll ich es Ihnen sagen?«
»Sie würden mir einen Gefallen tun.«
»Machen Sie daraus eine Sibylle. Sie putzen sie fein heraus, ganz wie Sie wollen. Das verpflichtet zu nichts.«
»Sieh mal einer an. Das ist eine Idee.«
»Außerdem wird diejenige, der sie ähnelt, nicht kompromittiert.«
»Das soll jemandem ähneln?«
»Wahrhaftig! Sie Witzbold! Glauben Sie vielleicht, ich würde sie nicht erkennen? Nun hören Sie aber auf, mein Lieber, Sie wollen sich wohl über mich lustig machen, wenn Sie alles abstreiten, selbst die klarsten Dinge. Sie sind der Liebhaber jener Gestalt dort!«
»Zum Beweis, dass dem nicht so ist, fahre ich jetzt nach Montmorency«, sagte Laurent kühl und nahm seinen Hut.
»Das beweist noch gar nichts!«, entgegnete Mercourt.
Laurent verließ das Haus, und Mercourt, der mit ihm die Treppe hinuntergegangen war, sah ihn noch in eine Mietdroschke steigen; doch Laurent ließ sich in den Bois de Boulogne fahren, wo er ganz allein in einem kleinen Café zu Abend aß und von wo er bei einbrechender Dunkelheit zurückkehrte, zu Fuß und ganz in seine Träume versunken.
Zu jener Zeit war der Bois de Boulogne noch nicht das, was er heute ist. Er wirkte kleiner, nicht so gepflegt, ärmlicher, geheimnisvoller und ländlicher; dort konnte man träumen.
An den Champs-Élysées, die weniger prunkvoll und nicht so bewohnt waren wie heute, gab es neue Viertel, in denen kleine Häuser mit winzigen, aber sehr lauschigen Gärten noch zu niedrigen Preisen vermietet wurden. Dort konnte man leben und arbeiten.
In einem dieser weißen schmucken Häuschen, inmitten von blühendem Flieder, verborgen hinter einer hohen Weißdornhecke, die von einer grün gestrichenen Gartentüre abgeschlossen wurde, wohnte Thérèse. Es war im Monat Mai. Das Wetter war herrlich. Laurent selbst hätte wohl nur schwerlich erklären können, wie er abends um neun Uhr hinter diese Hecke in der ausgestorbenen und noch nicht fertigen Straße geraten war, wo noch keine Laternen aufgestellt waren und Brennnesseln und Unkraut auf der Böschung wuchsen.
Die Hecke war sehr dicht, und Laurent ging einmal ganz leise rundherum und entdeckte nichts als Blätter, leicht vergoldet von einem Licht, das – wie er vermutete – auf dem kleinen Tisch im Garten stand, an dem er zu rauchen pflegte, wenn er den Abend bei Thérèse verbrachte. Also wurde im Garten geraucht? Oder Tee getrunken, was auch zuweilen vorkam?
Thérèse hatte Laurent angekündigt, sie erwarte eine ganze Familie aus der Provinz, doch er konnte nur das geheimnisvolle Flüstern zweier Stimmen ausmachen, von denen ihm die eine die von Thérèse zu sein schien. Die andere sprach ganz tief: war es die Stimme eines Mannes?
Laurent lauschte und lauschte, dass ihm die Ohren sausten, bis er zuletzt Thérèse die folgenden Worte sagen hörte oder zu hören meinte: »Was bedeutet mir das alles schon? Ich liebe auf der Welt nur noch einen Menschen, und das sind Sie!«
Hals über Kopf stürzte Laurent aus der kleinen ruhigen Seitenstraße auf die belebten Champs-Élysées und sagte zu sich selbst: ›Nun kann ich völlig unbesorgt sein. Sie hat einen Liebhaber! Im Grunde war sie nicht verpflichtet, mir das anzuvertrauen! … Nur hätte sie nicht bei jeder Gelegenheit so reden dürfen, dass sie mich glauben machte, sie gehöre keinem und wolle keinem gehören. Sie ist eine Frau wie alle anderen auch: Lügen geht ihr über alles. Was macht mir das schon aus? Und doch hätte ich es nicht gedacht. Und irgendwie muss sie mir sogar ein bisschen den Kopf verdreht haben, ohne dass ich es mir eingestehen wollte, denn ich habe dort auf der Lauer gestanden und mich höchst schändlich, wenn nicht gar wie ein Eifersüchtiger aufgeführt! Aber eigentlich brauche ich es nicht zu bereuen, denn das bewahrt mich vor einem großen Unglück und einer großen Torheit: nämlich eine Frau zu begehren, die nicht begehrenswerter ist als jede andere auch, ja noch nicht einmal aufrichtig!‹
Laurent hielt eine vorbeifahrende leere Droschke an und begab sich nach Montmorency. Er nahm sich fest vor, eine Woche dort zu bleiben und frühestens in vierzehn Tagen wieder zu Thérèse zu gehen. Er blieb jedoch nur achtundvierzig Stunden auf dem Land und stand am dritten Abend vor Thérèses Türe, genau im gleichen Augenblick wie Herr Richard Palmer.
»Oh!«, meinte der Amerikaner und reichte ihm die Hand. »Ich bin froh, Sie hier zu sehen!«
Laurent musste ihm wohl oder übel auch die Hand geben, doch konnte er es sich nicht verkneifen, Herrn Palmer zu fragen, warum er denn so froh sei, ihn zu treffen.
Der Fremde überhörte den reichlich unverschämten Ton des Malers.
»Ich bin froh, weil ich mag Sie«, erwiderte er mit entwaffnender Herzlichkeit, »und ich mag Sie, weil ich bewundere Sie sehr!«
»Was! Sie hier?«, sagte Thérèse erstaunt zu Laurent. »Heute Abend habe ich nicht mehr mit Ihnen gerechnet.«
Und der junge Mann meinte aus diesen einfachen Worten einen ungewohnt kühlen Ton herauszuhören.
»Ach!«, antwortete er ihr ganz leise, »Sie hätten sich schnell damit abgefunden, und ich glaube, ich störe hier ein reizendes Tête-à-Tête.«
»Umso grausamer von Ihnen«, erwiderte sie im gleichen scherzhaften Ton, »zumal Sie mir ja ganz offenbar dazu verhelfen wollten.«
»Sie haben sich darauf verlassen, da Sie doch nicht abgesagt haben! Soll ich wieder gehen?«
»Nein, bleiben Sie. Ich nehme es auf mich, Sie zu ertragen.«
Nachdem der Amerikaner Thérèse begrüßt hatte, öffnete er seine Brieftasche und entnahm ihr einen Brief, den er Thérèse überbringen sollte. Mit undurchdringlicher Miene überflog Thérèse das Geschriebene, ohne die geringste Bemerkung zu machen.
»Wenn Sie antworten wollen«, sagte Palmer, »ich habe eine Postgelegenheit nach Havanna.«
»Danke«, antwortete Thérèse und öffnete die Schublade einer kleinen Kommode, neben der sie gerade stand. »Ich werde nicht antworten.«
Aufmerksam verfolgte Laurent alle ihre Bewegungen und sah, wie sie diesen Brief zu vielen anderen legte, von denen einer durch die Form und die Unterschrift ihm sozusagen in die Augen sprang. Es war der Brief, den er zwei Tage zuvor an Thérèse geschrieben hatte. Ich weiß nicht, warum er zutiefst betroffen war, seinen Brief mit dem zusammenliegen zu sehen, den Herr Palmer ihr übergeben hatte.
›Sie legt mich dort in buntem Durcheinander mit ihren ausgedienten Liebhabern ab. Ich habe aber keinen Anspruch auf solche Ehre. Über Liebe habe ich mit ihr nie gesprochen.
Thérèse fing an, über das Porträt von Herrn Palmer zu reden. Laurent ließ sich sehr bitten und beobachtete genau die geringfügigsten Blicke und die leisesten Schwankungen in den Stimmen seiner Gesprächspartner; jeden Augenblick meinte er, bei ihnen eine heimliche Angst zu entdecken, er könne nachgeben; doch ihr Drängen war so aufrichtig, dass er sich beruhigte und sich über seinen Argwohn ärgerte. Wenn Thérèse, eine Frau, die so frei und selbstständig lebte, keinem etwas schuldig zu sein schien und sich auch niemals darum kümmerte, was über sie geredet werden könnte, nun wirklich Beziehungen zu diesem Ausländer hatte, dann brauchte sie wohl nicht den Vorwand eines Porträts, um das Objekt ihrer Liebe oder ihrer Träume oft und lange bei sich zu empfangen?
Sobald sich Laurent beruhigt fühlte, hielt ihn kein Schamgefühl mehr davon ab, seine Neugier offen kundzutun.
»Sie sind also Amerikanerin?«, sagte er zu Thérèse, die hin und wieder Herrn Palmer die Antworten, die er nicht ganz verstand, ins Englische übersetzte.
»Ich?«, antwortete Thérèse, »habe ich Ihnen denn nicht gesagt, dass ich die Ehre habe, eine Landsmännin von Ihnen zu sein?«
»Ja, nur weil Sie so gut Englisch sprechen.«
»Sie können nicht beurteilen, ob ich es gut spreche, da Sie es gar nicht verstehen. Aber ich merke schon, worauf Sie hinauswollen, denn ich weiß, dass Sie neugierig sind. Sie möchten wissen, ob ich Dick Palmer seit gestern oder schon seit Langem kenne. Na schön, fragen Sie ihn doch selbst.«
Palmer wartete die Frage, die Laurent ihm von sich aus nicht gern gestellt hätte, gar nicht erst ab. Er antwortete, es sei nicht das erste Mal, dass er nach Frankreich komme, und er habe Thérèse schon bei ihren Eltern gekannt, als sie noch sehr jung war. Wer die Eltern waren, wurde nicht gesagt. Thérèse pflegte zu erzählen, sie habe weder ihren Vater noch ihre Mutter gekannt.
George Sand, gezeichnet von Alfred de Musset
Die Vergangenheit von Fräulein Jacques war ein undurchdringliches Geheimnis für die Leute der Gesellschaft, die sich von ihr malen ließen, und für die kleine Zahl von Künstlern, die sie privat bei sich zu Hause empfing. Sie war nach Paris gekommen, keiner wusste woher, wann und mit wem. Man kannte sie erst seit zwei oder drei Jahren, nachdem ein von ihr gemaltes Porträt bei Kunstkennern große Beachtung gefunden hatte und überraschend zum Meisterwerk erklärt worden war. So kam es, dass mit einem Mal aus ihrer eher bescheidenen Existenz und etwas obskuren Kundschaft ein sehr guter Ruf als Malerin und ein wohlhabendes Leben wurden; doch an ihren stillen Neigungen, ihrem Hang zur Unabhängigkeit und an der heiteren Strenge ihrer Lebensweise änderte sich nichts. Sie spielte sich nie auf und sprach von sich selbst immer nur, um ihre Ansichten und Gefühle mit großer Offenheit und viel Mut zu äußern. Was ihre eigenen Lebensumstände betraf, so hatte sie eine ganz bestimmte Art, Fragen zu umgehen und ihnen auszuweichen, die ihr jede Antwort ersparte. Wenn es jemandem gelang, darauf zu beharren, so pflegte sie stets nach einigen undeutlichen Worten zu sagen:
»Es geht hier nicht um mich. Ich habe nichts Interessantes von mir zu berichten, und wenn ich Kummer und Gram erlebt habe, so erinnere ich mich nicht mehr daran, weil mir die Zeit fehlt, darüber nachzudenken. Ich bin jetzt sehr glücklich, ich habe meine Arbeit, und diese Arbeit liebe ich über alles.«
Durch einen reinen Zufall, dank der Beziehungen, die Künstler des gleichen Fachs untereinander pflegen, hatte Laurent die Bekanntschaft von Fräulein Jacques gemacht. Herr de Fauvel war als Mann von Adel und hervorragender Künstler in eine doppelbödige Gesellschaft eingeführt worden, und mit seinen vierundzwanzig Jahren waren ihm Lebenserfahrungen vertraut, die so mancher mit vierzig noch nicht erworben hat. Mal bildete er sich etwas darauf ein, und dann wieder war er betrübt darüber, doch besaß er keineswegs die nötige Herzensbildung, die sich im Laster und in der Ausschweifung nicht erlernen lässt. Aufgrund seiner Skepsis, die er nie verhehlte, stand für ihn zunächst fest, dass alle diejenigen, die Thérèse als Freunde behandelte, auch ihre Liebhaber sein mussten. Erst als sie samt und sonders die Lauterkeit ihrer Beziehungen zu ihr betont und bewiesen hatten, kam er zu dem Schluss, Thérèse sei eine Frau, die vielleicht leidenschaftliche Liebe erlebt, aber keine Liebeleien gehabt haben konnte.
Von nun an brannte er vor Neugier, den Hintergrund dieses ungewöhnlichen Falls zu erkunden: eine junge, schöne, intelligente, völlig unabhängige Frau, die aus freiem Willen allein lebte. Er besuchte sie immer häufiger und mit der Zeit fast täglich, zunächst noch unter allerlei Vorwänden, bis er sich schließlich als unwichtigen Freund ausgab, der zu sehr Lebemann war, als dass er es nötig gehabt hätte, einer ernsthaften Frau etwas vorzugaukeln, der aber trotz allem noch zu idealistisch war, als dass er nicht der Zuneigung bedurft und den Wert selbstloser Freundschaft zu schätzen gewusst hätte.
Eigentlich entsprach das grundsätzlich der Wahrheit; doch die Liebe hatte sich in das Herz des jungen Mannes eingeschlichen, und wir haben gesehen, dass Laurent sich gegen die Macht eines Gefühls sträubte, das er vor Thérèse und vor sich selbst noch verborgen halten wollte, umso mehr, als er es zum ersten Mal in seinem Leben empfand.
»Und trotzdem«, sagte er, nachdem er Herrn Palmer versprochen hatte, sich an seinem Porträt zu versuchen, »warum zum Teufel bestehen Sie so hartnäckig auf einer Sache, die womöglich gar nicht gut wird, obwohl Sie Fräulein Jacques kennen, die das bestimmt nicht ablehnen und ganz gewiss etwas Ausgezeichnetes daraus machen würde?«
»Sie schlägt es mir ab«, sagte Palmer völlig unbefangen, »und ich weiß nicht warum. Meiner Mutter, die eine Schwäche für mich hat und mich für schön hält, habe ich ein Porträt von Meisterhand versprochen, und wenn es zu wirklichkeitsnah ist, wird sie niemals finden, es sei gut getroffen. Und aus diesem Grunde habe ich mich an Sie gewandt als an einen idealistischen Meister. Wenn Sie ablehnen, dann bleibt mir der Kummer, meiner Mutter keine Freude bereiten zu können, oder aber die Mühe, weiter suchen zu müssen.«
»Da brauchen Sie nicht lange zu suchen; es gibt so viele, die befähigter sind als ich! …«.
»Das kann ich nicht finden; doch selbst wenn dem so wäre, so ist damit noch nicht gesagt, dass jemand sofort Zeit dafür hat, und ich habe Eile, das Porträt loszuschicken. Es ist für meinen Geburtstag in vier Monaten gedacht, und der Transport allein dauert ungefähr zwei Monate.«
»Das heißt also, Laurent«, fügte Thérèse hinzu, »dass Sie dieses Porträt spätestens in sechs Wochen fertig haben müssen, und da ich weiß, wie lange Sie brauchen, sollten Sie morgen damit anfangen. Wohlan! Abgemacht, versprochen, nicht wahr?«
Herr Palmer reichte Laurent die Hand und sagte:
»Damit ist der Vertrag geschlossen. Über Geld rede ich nicht. Die Bedingungen setzt Fräulein Jacques fest; ich mische mich da nicht ein. Wann passt es Ihnen morgen?«
Nachdem die Uhrzeit vereinbart war, nahm Palmer seinen Hut, und aus Rücksicht auf Thérèse hielt sich Laurent für verpflichtet, das Gleiche zu tun; doch Palmer beachtete ihn gar nicht, er verabschiedete sich von Fräulein Jacques, indem er ihr die Hand schüttelte, ohne sie jedoch zu küssen.
»Soll ich nicht auch gehen?«, sagte Laurent.
»Das ist nicht notwendig«, antwortete sie; »alle Leute, die mich abends besuchen, kennen mich gut. Aber heute verlassen Sie mich um zehn Uhr, denn in letzter Zeit habe ich mich dazu verleiten lassen, mit Ihnen bis kurz vor Mitternacht zu plaudern, und da ich nicht länger als bis fünf Uhr morgens schlafen kann, habe ich mich am andern Tag stets sehr zerschlagen gefühlt.«
»Und Sie haben mich nicht hinausgeworfen?«
»Nein, daran habe ich nicht gedacht.«
»Wenn ich eingebildet wäre, könnte ich ganz schön stolz darauf sein!«
»Aber Sie sind nicht eingebildet, Gott sei Dank! Das überlassen Sie denen, die dumm sind. Im Ernst, trotz des Kompliments, Meister Laurent, muss ich mit Ihnen schimpfen. Wie ich höre, arbeiten Sie nicht.«
»Und um mich zum Arbeiten zu zwingen, haben Sie mir also das Porträt von Palmer wie eine Pistole auf die Brust gesetzt?«
»Na schön, warum auch nicht?«
»Thérèse, Sie sind gütig, das weiß ich; Sie wollen mich gegen meinen Willen dazu bringen, dass ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene.«
»Um Ihr Einkommen kümmere ich mich nicht, dazu habe ich kein Recht. Ich habe nicht das Glück … oder das Unglück, Ihre Mutter zu sein; aber ich bin Ihre Schwester … ›in Apoll‹, wie unser Klassiker Bernard sagt, und es ist mir unmöglich, mir über Ihre Anwandlungen von Faulheit keine Sorgen zu machen.«
»Aber was kann Ihnen das schon bedeuten«, rief Laurent in einer Mischung von Freude und Verärgerung aus, die Thérèse spürte und die sie dazu bewog, ihm in aller Offenheit zu antworten.
»Hören Sie, mein lieber Laurent«, sagte sie zu ihm, »wir wollen offen miteinander sprechen. Ich empfinde große Freundschaft für Sie.«
»Darauf bin ich sehr stolz, aber ich weiß nicht warum! … Ich tauge nicht einmal zum guten Freund, Thérèse! An die Freundschaft glaube ich so wenig wie an die Liebe zwischen einer Frau und einem Mann.«
»Das haben Sie mir schon gesagt, und es ist mir höchst gleichgültig, woran Sie nicht glauben. Ich aber glaube an das, was ich fühle, und ich empfinde für Sie Anteilnahme und Zuneigung. So bin ich nun einmal; ich kann es nicht ertragen, in meiner Nähe irgendeinen Menschen zu wissen, ohne mich ihm verbunden zu fühlen und mir zu wünschen, dass er glücklich ist. Dafür pflege ich mein Möglichstes zu tun, und ich kümmere mich nicht darum, ob man es mir dankt. Nun sind Sie auch nicht irgendjemand; Sie sind ein Mann von Genie, und was noch mehr ist, ich hoffe, Sie sind ein Mann mit Herz.«
»Ich, ein Mann mit Herz? Ja doch, wenn Sie das so meinen, wie alle Welt es versteht. Ich kann mich im Duell schlagen, weiß meine Schulden zu bezahlen und werde stets die Frau verteidigen, der ich gerade den Arm reiche, wer sie auch sein mag! Doch wenn Sie glauben, ich hätte ein empfindsames, liebevolles, naives Herz …«
»Ich weiß, Sie bilden sich etwas darauf ein, alt, verbraucht und verderbt zu sein. Aber was Sie sich einbilden, macht auf mich überhaupt keinen Eindruck. Heutzutage ist das eine weitverbreitete Mode. Bei Ihnen jedoch ist es eine echte und schmerzvolle Krankheit, die aber vorübergehen wird, sobald Sie nur selbst wollen. Sie sind ein Mann mit Herz; und zwar genau deshalb, weil Sie an der Leere Ihres Herzens leiden; es wird eine Frau kommen, die es erfüllt und ausfüllt, wenn sie sich darauf versteht und Sie sie gewähren lassen. Aber das gehört nicht zu meinem Thema: Ich spreche zu dem Künstler; der Mensch in Ihnen ist nur deshalb unglücklich, weil der Künstler mit sich selbst nicht zufrieden ist.«
»Gut und schön, aber Sie täuschen sich, Thérèse«, antwortete Laurent heftig. »Das Gegenteil von dem, was Sie sagen, trifft zu! Der Mensch leidet an dem Künstler und erstickt ihn. Ich weiß nichts mit mir anzufangen, verstehen Sie? Langeweile und Sehnsucht bringen mich um. Sehnsucht wonach?, werden Sie fragen. Sehnsucht nach allem! Ich bringe es nicht fertig, aufmerksam und ruhig sechs Stunden lang zu arbeiten, wie Sie dann einen Gang durch den Garten zu machen und den Spatzen Brotkrumen hinzustreuen, abermals vier Stunden zu arbeiten und schließlich am Abend zwei oder drei Störenfrieden zuzulächeln, wie ich zum Beispiel einer bin, bis es Schlafenszeit ist. Was meinen Schlaf angeht, so ist er schlecht, meine Spaziergänge sind ruhelos, meine Arbeit ist fieberhaft. Der schöpferische Einfall verwirrt mich und lässt mich erzittern; während der Ausführung, die mir stets viel zu lange dauert, habe ich entsetzliches Herzklopfen; ich weine und unterdrücke mein Schreien, wenn ich eine Idee ausbrüte, die mich trunken macht; doch schon am nächsten Morgen schäme ich mich ihrer, und sie langweilt mich zu Tode. Ändere ich sie ab, so wird es noch schlimmer, sie verlässt mich; es ist besser, ich vergesse sie und warte auf eine andere; aber diese andere erreicht mich so verworren und so gewaltsam, dass ich armes Geschöpf sie nicht zu fassen vermag. Sie bedrängt und quält mich, bis sie durchführbare Dimensionen angenommen hat, und nun beginnt die neue Qual, die Qual nämlich, dieser Idee Gestalt zu verleihen, ein echtes körperliches Leiden, das ich nicht näher zu beschreiben vermag. Und so bringe ich mein Leben zu, wenn ich mich von diesem Riesendämon Künstler beherrschen lasse, der in mir steckt und dem der arme Mann, der hier mit Ihnen spricht, mit der Geburtszange seines Willens Stück für Stück halbtote Mäuse entreißt! Thérèse, also ist es doch viel besser, ich lebe das Leben so, wie ich es mir vorgestellt und eingerichtet habe, gebe mich einfach allen möglichen Ausschweifungen hin und töte diesen bohrenden Wurm in mir ab, den andere bescheiden ihre Eingebung nennen und der für mich ganz einfach mein Gebrechen ist.«
»Dann ist es also beschlossene Sache«, sagte Thérèse lächelnd, »dass Sie am Selbstmord Ihres Verstandes arbeiten? Na gut, ich glaube nicht ein Wort von alledem. Böte man Ihnen morgen an, Sie sollten Prinz D*** oder Graf S*** sein, mitsamt den Millionen des einen und den schönen Reitpferden des anderen, Sie würden nach Ihrer armen, ach so verachteten Palette verlangen und sagen: ›Gebt mir meinen Liebling wieder.‹«
»Meine verachtete Palette? Sie verstehen mich nicht, Thérèse! Sie ist ein Instrument des Ruhms, das weiß ich nur zu gut, und was man als Ruhm bezeichnet, das ist so etwas wie Ehrfurcht vor einem Talent, reiner und köstlicher als die Hochachtung, die man Titeln oder Vermögen entgegenbringt. Es ist also ein sehr großer Vorzug und eine echte Freude für mich, dass ich mir sagen kann: ›Ich bin zwar nur ein ganz kleiner Edelmann ohne jedes Vermögen; die Leute meinesgleichen, sofern sie nicht aus ihrem Stand ausgebrochen sind, leben als Förster, und ihr ganzer Besitz sind die Holzsammlerinnen, die sie mit Reisigbündeln bezahlen. Ich aber, ich bin ausgebrochen, ich habe einen Beruf ergriffen, und wenn ich mit meinen vierundzwanzig Jahren auf einem einfachen Leihpferd unter den Allerreichsten und den Allervornehmsten von Paris, die auf Zehntausend-Franken-Pferden sitzen, heute dahergeritten komme, so geschieht es eben, dass mich die Gaffer auf den Champs-Élysées – sofern ein Mann mit Kunstverstand oder eine Frau von Geist unter ihnen ist – bestaunen und beim Namen rufen, nicht aber die anderen. Sie lachen! Halten Sie mich für sehr eitel?«
»Nein, aber für ein großes Kind, Gott sei Dank! Sie werden sich nicht umbringen.«
»Aber ich will mich ja gar nicht umbringen! Ich liebe mich ganz genauso wie andere auch, ich liebe mich von ganzem Herzen, das schwöre ich Ihnen! Doch meine ich, dass meine Palette, das Werkzeug meines Ruhms, auch das Instrument meiner Folterqualen ist, da ich nicht zu arbeiten vermag, ohne zu leiden. Deshalb suche ich in der Ausschweifung nicht etwa den Tod meines Körpers oder meines Geistes, sondern den Verschleiß und die Beschwichtigung meiner Nerven. Das ist alles, Thérèse. Was soll daran so unvernünftig sein? Nur wenn ich vor Müdigkeit fast umfalle, kann ich einigermaßen ordentlich arbeiten.«
»Das stimmt«, sagte Thérèse, »das ist mir auch schon aufgefallen, und es erschreckt mich beinahe wie etwas Widernatürliches; ich mache mir Sorgen, dass diese Art und Weise des Schaffens Sie vollends zugrunde richtet, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders kommen wird. Ja, da ist noch etwas, beantworten Sie mir eine Frage: Haben Sie Ihr Leben mit Arbeit und Enthaltsamkeit begonnen und erst danach das Bedürfnis verspürt, sich zu betäuben, um auszuruhen?«
»Nein, genau umgekehrt. Als ich das Gymnasium verließ, liebte ich die Malerei, glaubte jedoch nicht, ich würde jemals gezwungen sein zu malen. Ich hielt mich für reich. Mein Vater starb und hinterließ mir nur einige dreißigtausend Franken, und ich hatte nichts Besseres zu tun, als sie ganz rasch aufzubrauchen, um wenigstens ein Jahr lang mein Leben im Wohlstand zu genießen. Als ich dann restlos blank war, griff ich zum Pinsel; ich wurde furchtbar verrissen und dann wieder über den grünen Klee gelobt, was heutzutage größten Erfolg bedeutet, und nun ergebe ich mich einige Monate oder Wochen dem Luxus und dem Vergnügen, solange das Geld reicht. Wenn ich nichts mehr habe, dann ist das für mich nur umso besser, denn ich bin gleichzeitig am Ende meiner Kräfte wie meiner Mußezeit. Dann nehme ich die Arbeit wieder auf, voller Leidenschaft, Schmerz und Begeisterung, und wenn die Arbeit vollendet ist, beginnen Muße und Verschwendung von Neuem.«
»Führen Sie dieses Leben schon lange?«
»In meinem Alter kann es ja noch nicht so lange sein. Seit drei Jahren!«
»Eben! Für Ihr Alter ist das viel! Und zudem haben Sie falsch angefangen: Sie haben Ihre Lebensgeister in Brand gesteckt, ehe sie sich überhaupt entfalten konnten; Sie haben Essig getrunken, um zu verhindern, dass Sie noch wachsen. Ihr Kopf ist gleichwohl dicker geworden, und die Begabung hat sich dort trotz allem entwickelt, doch vielleicht ist Ihr Herz dabei verkümmert, vielleicht werden Sie niemals ein vollkommener Mensch und Künstler sein.«
Diese Worte von Thérèse, in ruhigem und traurigem Ton gesprochen, irritierten Laurent.
»Also verachten Sie mich?«, entgegnete er und erhob sich.
»Nein«, antwortete sie und reichte ihm ihre Hand, »ich bedaure Sie!«
Und Laurent sah zwei dicke Tränen langsam über die Wangen von Thérèse rollen.
Diese Tränen lösten in ihm eine heftige Reaktion aus: eine wahre Tränenflut überschwemmte sein Gesicht, und er warf sich Thérèse zu Füßen, nicht wie ein Liebender, der sich erklären will, sondern wie ein Kind, das etwas zu beichten hat:
»Ach! Meine arme liebe Freundin!«, rief er aus und ergriff ihre Hände, »Sie tun recht daran, Mitleid mit mir zu haben, denn ich brauche es. Ich bin unglücklich, sehen Sie, so unglücklich, dass ich mich scheue, es auszusprechen! Dieses unbestimmte Etwas, das ich an der Stelle des Herzens in meiner Brust habe, verlangt unaufhörlich nach irgendeinem anderen Etwas; und ich, ich weiß nicht, was ich ihm geben soll, um es zu beschwichtigen. Ich liebe Gott, und ich glaube nicht an ihn. Ich liebe alle Frauen, und ich verachte sie allesamt! Ihnen kann ich das sagen, Ihnen, meiner Gefährtin und meinem Freund! Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich eine Kurtisane anbete, während ich bei einem Engel womöglich kälter wäre als Marmor. Meine Vorstellungen sind völlig gestört, vielleicht sind meine Instinkte alle verkümmert. Wenn ich Ihnen sage, dass ich selbst im Wein keine heiteren Gedanken mehr finden kann! Ja, meine Trunkenheit ist traurig, wie es scheint, und bei dieser Orgie vorgestern in Montmorency soll ich tragische Passagen mit einem ebenso schrecklichen wie lächerlichen Pathos vorgetragen haben. Was wird bloß aus mir werden, Thérèse, wenn Sie kein Mitleid mit mir haben?«
»Gewiss doch, ich habe Mitleid, mein armes Kind«, sagte Thérèse und trocknete ihm die Augen mit ihrem Taschentuch; »doch was nützt Ihnen das schon?«
»Wenn Sie mich lieben könnten, Thérèse! Entziehen Sie mir nicht Ihre Hände! Haben Sie mir nicht erlaubt, Ihnen so etwas wie ein Freund zu sein?«
»Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Sie liebe; Sie haben mir geantwortet, an die Freundschaft einer Frau könnten Sie nicht glauben.«
»Vielleicht könnte ich an die Ihre doch glauben; Sie müssen das Herz eines Mannes haben, da Sie Kraft und Talent wie ein Mann haben. Geben Sie mir Ihre Freundschaft zurück.«
»Ich habe Sie Ihnen nicht entzogen, und ich will gern versuchen, für Sie ein Mann zu sein«, antwortete sie; »doch weiß ich nicht so recht, wie ich das anfangen soll. Die Freundschaft eines Mannes muss viel mehr Strenge und Autorität haben, als ich aufzubringen vermöchte. Gegen meinen Willen werde ich Sie mehr bedauern als schelten. Da haben wir es ja schon! Ich hatte mir fest vorgenommen, Sie heute zu kränken, Sie gegen mich und gegen sich selbst zu erzürnen; stattdessen weine ich hier mit Ihnen, was gar nichts nützt.«
»Doch! Doch!«, schrie Laurent laut auf. »Diese Tränen tun mir gut, sie haben die ausgetrocknete Stelle benetzt; vielleicht wird mein Herz dort wieder wachsen und schlagen. Ach! Thérèse, Sie haben mir schon einmal gesagt, ich prahlte vor Ihnen mit Dingen, die mich erröten lassen müssten, ich sei wie eine Gefängnismauer. Dabei haben Sie nur eins vergessen: und zwar dass hinter dieser Mauer ein Gefangener sitzt! Wenn ich fähig wäre, die Türe zu öffnen, könnten Sie ihn sehen; doch das Tor ist verschlossen, es ist eine eherne Mauer, und weder mein Wille noch mein Glaube oder mein überströmendes Herz, auch nicht mein Wort vermögen sie zu durchdringen. Werde ich denn so leben und sterben müssen? Was hilft es mir, frage ich Sie, dass ich die Mauern meines Gefängnisses mit phantastischen Malereien beschmiert habe, wenn doch nirgends das Wort ›lieben‹ steht!«
»Wenn ich Sie richtig verstehe«, sagte Thérèse verträumt, »so meinen Sie, Ihr Werk müsse durch das Gefühl befeuert werden.«
»Meinen Sie das nicht auch? Ist es nicht genau das, was Sie mir mit allen Ihren Vorhaltungen sagen wollen?«
»Gerade das nicht! In Ihrer Darstellungsweise ist schon viel zu viel Feuer, und das eben macht Ihnen die Kritik zum Vorwurf. Ich selbst stehe von jeher voller Ehrfurcht vor solchem Überschwang an Jugend, der die großen Künstler hervorbringt und dessen schöne Züge jeden Begeisterungsfähigen daran hindern, nach Fehlern und Mängeln zu suchen. Ich bin weit davon entfernt, Ihre Arbeiten für kalt und hochtrabend zu halten, vielmehr wirken sie auf mich feurig und leidenschaftlich; doch suchte ich immer, wo diese Leidenschaft ihre Wurzeln in Ihnen hat. Jetzt sehe ich es, sie steckt im Verlangen Ihrer Seele. Ja, gewiss«, fügte sie immer noch verträumt hinzu, als ob sie versuchte, die Schleier ihrer eigenen Gedanken zu durchbrechen, »das Verlangen kann eine Leidenschaft sein.«
»Nun, woran denken Sie?«, sagte Laurent, während er ihren nachdenklich versunkenen Blicken folgte.
»Ich frage mich, ob ich diese Kraft, die in Ihnen steckt, bekämpfen soll, und ob man Ihnen nicht das heilige Feuer raubt, wenn man Sie dazu überredet, glücklich und ruhig zu sein. Und dennoch … ich meine, das Verlangen kann für den Geist kein Dauerzustand sein, und wenn es sich in der Zeitspanne seines Fieberns hell und deutlich offenbart hat, muss es entweder von selbst fallen oder uns zerbrechen. Was sagen Sie dazu? Hat nicht jedes Alter seine eigene Kraft und besondere Ausdrucksform? Was man unter den verschiedenen Malweisen der Meister versteht, ist das nicht der Ausdruck für die fortgesetzten Wandlungen ihres Wesens? Wird es Ihnen mit dreißig Jahren noch erlaubt sein, nach allem verlangt, ohne irgend etwas festgehalten zu haben? Werden Sie nicht gezwungen sein, über irgendeinen Punkt Gewissheit zu erlangen? Sie sind in dem Alter der Phantasie, doch bald kommen Sie in das Alter der Einsicht. Wollen Sie keine Fortschritte machen?«
»Liegt es an mir, ob ich welche mache?«
»Ja, wenn Sie nicht weiter daran arbeiten, das Gleichgewicht Ihrer Fähigkeiten zu stören. Sie werden mich nicht davon überzeugen, dass die Erschöpfung das Heilmittel gegen das Fieber ist; sie ist die unvermeidliche Folge davon.«
»Welches Fiebermittel empfehlen Sie mir also?«
»Ich weiß nicht: vielleicht die Ehe.«
»Entsetzlich!«, rief Laurent aus und lachte schallend.
Und während er noch lachte, fügte er hinzu – ohne so recht zu wissen, wieso ihm diese Erwiderung einfiel:
»Es sei denn mit Ihnen, Thérèse! Das ist mir eine Idee!«
»Reizend«, antwortete sie, »aber vollkommen unmöglich.«
Die Antwort Thérèses überraschte Laurent durch ihre endgültige, keinen Widerspruch duldende Ruhe, und was er gerade noch als witzigen Einfall gemeint hatte, schien ihm plötzlich ein begrabener Traum zu sein, so als hätte sich dieser in seinem Kopf festgesetzt. Dieser starke und unglückliche Geist war so beschaffen, dass das Wort »unmöglich« genügte, damit er sich etwas wünschte, und eben dieses Wort hatte Thérèse gerade ausgesprochen.
Alsbald fielen ihm seine Liebesanwandlungen für sie wieder ein und im selben Augenblick auch sein Verdacht, seine Eifersucht und sein Zorn. Bis jetzt hatte ihn der Zauber solcher Freundschaft betäubt und beinahe trunken gemacht; plötzlich wurde er bitter und eisig.
»Ach! Ja, richtig«, sagte er, griff nach seinem Hut und wollte weggehen. »Das ist das Wort meines Lebens, das sich bei jeder passenden Gelegenheit wieder einstellt, am Ende eines Scherzes genauso wie am Ende einer ernsten Angelegenheit: »unmöglich«. Diesen Feind kennen Sie nicht, Thérèse. Sie lieben still und ruhig. Sie haben einen Liebhaber oder Freund, der nicht eifersüchtig ist, weil er Sie als kalt oder vernünftig kennt! Dabei fällt mir auf, dass die Zeit vergeht und dass draußen vielleicht zahllose ›Vettern‹ stehen und darauf warten, dass ich gehe.«
»Was sagen Sie da bloß?«, fragte ihn Thérèse bestürzt. »Was für Ideen befallen Sie? Haben Sie Anfälle von Wahnsinn?«
»Zuweilen«, antwortete er und ging. »Sie müssen sie mir verzeihen.«