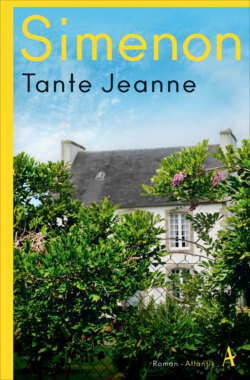Читать книгу Tante Jeanne - Georges Simenon - Страница 3
1
ОглавлениеAuf dem Bahnhof von Poitiers, wo sie umsteigen musste, hatte sie nicht mehr widerstehen können. Ein Dutzend Mal war sie am Bahnhofsbuffet vorbeigegangen, hatte ihren Koffer hinter sich hergeschleift und die Vorübergehenden angerempelt. Sie spürte eine Beklemmung, und die machte ihr Angst. Je näher sie ihrem Ziel kam, desto häufiger spürte sie diesen Druck. Es war wie eine große Luftblase – bestimmt so groß wie eine ihrer Brüste –, die unterhalb der Kehle saß, ihre Organe zusammendrückte und einen Ausweg suchte, während Jeanne unbeweglich wartete und Todesängste ausstand.
Sie würde einen Kaffee trinken. Sie hatte sich fest vorgenommen, nur einen Kaffee zu trinken. Als sie dann aber an der Theke vor dem Kellner stand, der mit aufgekrempelten Ärmeln die Gläser spülte, hatte sie gestottert und gespürt, wie ihr die Röte in die Wangen stieg.
»Ein kleiner Cognac dazu würde mir bestimmt guttun. Ich fühle mich nicht gut, sicher wegen der Hitze.«
Es war tatsächlich ein ungewöhnlich heißer Augusttag. Die großen Ferien hatten begonnen, und der Schnellzug, mit dem sie aus Paris angereist war, hatte die vielen Urlaubsreisenden fast nicht aufnehmen können.
Verlegen stammelte sie, während sie in ihrer Handtasche nach Geld kramte:
»Geben Sie mir noch einen.«
Dies war bestimmt nicht der Grund, weshalb die Leute sie anstarrten. Schon zuvor hatte sie diesen Eindruck gehabt. Ein kleiner Junge, der in Begleitung seiner Eltern mit ihr im Zug saß, hatte sie so lange nicht aus den Augen gelassen, dass es ihr wie eine Ewigkeit vorkam, dass sie immer nervöser geworden und schließlich ganz außer sich geraten war.
Es lag an ihrer Erschöpfung. Das war alles. Aber auch am Alter. Nicht nur am Alter, sondern auch daran, dass sie wie ausgelaugt war. Sie kam sich vor wie ein altes Tier. Aber sie hatte nicht den Mut, es den Tieren gleichzutun und sich zum Sterben in einen Winkel zu verkriechen.
Es waren noch andere alte Frauen mit ihr im Zug gewesen, älter als sie, die ohne Hemmungen ihren Rücken und einen Teil ihres Busens zur Schau stellten und sich wahrscheinlich am Strand ziemlich kindisch aufführen würden.
Den Bummelzug von früher gab es nicht mehr. Der Anschlusszug fuhr zwar noch vom selben Gleis ab, das wie ein Abstellgleis ganz hinten am letzten Bahnsteig lag, aber anstelle der alten Waggons von früher wartete jetzt ein silberner Schnelltriebwagen, der geräuschlos durch die Landschaft raste und von Zeit zu Zeit einen kurzen Signalpfiff ausstieß.
Sie hatte gehofft, bei Einbruch der Dunkelheit anzukommen, es wäre dann einfacher für sie gewesen, schnell in die Hauptstraße und dort dicht an den Häusern entlangzulaufen. Aber wegen der Sommerzeit war der Himmel um sieben Uhr abends noch von leuchtendem Blau, welches das Licht der untergehenden Sonne in rötliches Zwielicht verwandelte. Die Kühe auf den Weiden warfen dunkelblaue Schatten, und ein blendender Widerschein ließ die Fenster der Bauernhäuser wie Feuer aufleuchten.
Schon als kleines Mädchen hatte sie sich vor dieser Stunde gefürchtet, sie wie eine Bedrohung aus dem Nichts oder aus der Ewigkeit empfunden, vergleichbar dem Fegefeuer aus ihrem Katechismus. Sie erinnerte sich auch noch an das reglose Laub der Linde vor ihrem Zimmerfenster. Wie auf einem Kupferstich hatte sich jedes einzelne Blatt abgezeichnet. Sie erinnerte sich an die Geräusche im Haus, die durch die Stille ringsum verstärkt wurden, sodass ein Knacken des gebohnerten Parkettbodens zu einer Explosion wurde.
Sie lutschte ein Pfefferminzbonbon, um die Alkoholfahne zu überdecken, und hatte auf einmal wieder das Bedürfnis – zum dritten Mal seit ihrer Abreise aus Paris –, sich ihre Wangen mit einem Taschentuch abzureiben, um die letzten Spuren von Rouge zu beseitigen. Erst hatte sie vorgehabt, sich überhaupt nicht zu schminken, aber im letzten Moment, als sie fertig angekleidet vor dem Spiegel stand, hatte sie sich doch wegen ihrer fahlen Blässe geschämt. Sie wollte auf keinen Fall wie ein Schreckgespenst daherkommen und gleich bei ihrer Ankunft den Eindruck einer Todkranken erwecken.
Das einfache Kleid stand ihr gut, auch ihr Hut zeugte von Geschmack, soweit das bei einem billigen Hut möglich war. Den leichten Mantel hatte sie sich über den Arm gelegt.
Im Zug hatte sie niemanden gekannt, allerdings auch kaum gewagt, die Leute anzusehen, weil sie sich die Möglichkeit zu einem Rückzieher offenlassen wollte.
»Wenn das Hôtel de l’Anneau d’Or nicht mehr existiert, nehme ich noch heute Abend den Zug zurück.«
Und dann, weil es Samstagabend und alle Welt unterwegs war:
»Wenn kein Zimmer mehr frei ist, werde ich es auch nicht woanders probieren.«
Jetzt, wo sie gleich ankommen würde, beengte sie die Luftblase in ihrer Brust nur noch mehr. Als der Zug in dem kleinen Bahnhof hielt, der sich wenig verändert hatte, wagte sie kaum aufzustehen, weil sie wieder diese Todesangst überfiel. Aber dann stand sie doch auf dem Bahnsteig. Die Lampen brannten, obwohl es noch taghell war, und ein Mann mit einer Mütze mit hellem Schirm deutete auf ihren Koffer und fragte:
»Taxi?«
Sie war verwirrt, alles ging viel zu schnell. Früher hatte es hier keine Taxis gegeben und auch nicht diese vielen Privatautos, die auf dem Platz herumstanden.
»Zum Hôtel de l’Anneau d’Or.«
Die Wagentür schlug zu. Sie fuhren an Häusern vorbei, die ihr winzig vorkamen, und schon bogen sie in eine kurze Straße ein, an deren Ende die Brücke war.
»Haben Sie noch größeres Gepäck aus der Aufbewahrung zu holen?«
Sie hatte es eilig, ins schützende Innere des Hotels zu kommen, und hielt den Kopf gesenkt, damit die Vorübergehenden ihr nicht ins Gesicht sehen konnten. Es war eigentlich nicht denkbar, dass immer noch die alten Besitzer, Monsieur und Madame Loiseau, da waren (Madame Loiseau, Mathilde, trug eine Perücke). Sie waren mindestens siebzig gewesen, als Jeanne von hier fortgezogen war. Sie entdeckte auf der rechten Seite ein neues Gebäude, einen Flügel, den man kürzlich angebaut haben musste, und es kam ihr so vor, als stünden auf der Terrasse auch mehr Eisentische zwischen den Lorbeerkästen als früher.
»Ein Einzelzimmer?«
»Ja, ein Einzelzimmer.«
»Eine Nacht oder mehrere?«
»Vielleicht mehrere.«
Sie wusste es noch nicht. Allerdings war es unwahrscheinlich, dass sie mehr als eine Nacht im Hotel logieren würde. Es war eigentlich fast undenkbar, aber sie glaubte, durch diese kleine Mogelei dem Schicksal ein Schnippchen schlagen zu können.
»Ist die Siebzehn frei, Martine?«
»Der Gast ist abgereist, aber ich weiß nicht, ob das Zimmer schon gemacht ist.«
Es waren junge Leute, die noch nicht lange verheiratet sein konnten und die hier Monsieur und Madame Hotelbesitzer spielten.
»Olga, ist die Siebzehn fertig?«, rief die Hotelbesitzerin ins Treppenhaus.
»Ja, Madame.«
Jeanne trug sich in den Meldezettel ein, unter dem Namen Martineau selbstverständlich, Jeanne Martineau, siebenundfünfzig Jahre, geboren … Geboren: Hier! Nicht im Hôtel de l’Anneau d’Or, aber keine hundert Meter weiter, auf der anderen Seite der Brücke. Beim Überqueren der Straße hatte sie einen Blick in diese Richtung vermieden. Ob ihr Zimmer wohl zum Fluss hin liegen würde? Wahrscheinlich nicht, nicht als Einzelzimmer, und vor allem nicht an einem Samstag im August.
Die alten Loiseaus, auch Philemon und Baucis genannt, hätten sich bestimmt nicht vorstellen können, dass in ihrem Hotel dereinst Frauen, die noch dazu Kinder dabeihatten, mit nichts weiter auf dem Leib als einem winzigen Leinenhöschen und einer Art Büstenhalter herumlaufen würden, oder gar ein Mann mit völlig nacktem behaartem Oberkörper und einem Sonnenbrand auf den Schultern.
»In einer Viertelstunde gibt’s Abendessen«, verkündete der Besitzer (oder der Verwalter).
In dem allgemeinen Trubel vergaßen sie, ihr den Koffer hinauftragen zu lassen, sie bestand jedoch nicht darauf und schleppte ihn selbst bis zur zweiten Etage, erleichtert, auf diese Weise unbemerkt geblieben zu sein. Selbst das Zimmermädchen Olga hatte ihre Ankunft nicht mitbekommen, denn sie kam ihr nicht entgegen, um ihr tragen zu helfen.
Zimmer siebzehn lag zum Hof, in dem früher die Stallungen untergebracht waren, die man zu Garagen umfunktioniert hatte. Die Luft verfärbte sich blau, kondensierte zu dunstigen Schwaden. Weshalb sollte sie sich eigentlich nicht gleich hinlegen? Mit drei oder vier Tabletten würde sie sicher schnell einschlafen können.
Aus Gewohnheit packte sie zuerst ihren Koffer aus und ordnete den Inhalt in Schrank und Wandschrank, dann sprengte sie sich etwas Wasser ins Gesicht und setzte sich schließlich, ohne Licht zu machen, auf den einzigen Sessel, der hart und schmal war und mit seinem grellen Blau an einen Sessel im Schaufenster eines Kaufhauses erinnerte.
Die Zeit verstrich, unmerklich brach die Nacht herein, und unmerklich wurden auch die Geräusche immer deutlicher, vor allem die aus dem Speisesaal, dessen Fenster weit offen standen und wo man begonnen hatte, das Abendessen zu servieren. Gemurmel auch von der Terrasse, auf der noch einige Gäste vor ihren Getränken in der Abendkühle saßen. Türen schlugen, eine ungeduldige Mutter brachte ihr Kind zu Bett und drohte ihm mit schriller Stimme Gott weiß was an, wenn es nicht sofort einschlafen würde. Aber dann nahm Jeanne durch das Quietschen und Hupen der Autos auf der Straße hindurch mit einem Mal das leise, hellere Rauschen des Flusses wahr und ein liebliches Plätschern von der Brücke her, wo das Wasser sich am Pfeiler teilte.
»Ich bin so müde!«, sagte sie laut.
Sie horchte dem Klang ihrer Stimme nach und wiederholte voll Selbstmitleid:
»Mein Gott, wie müde ich bin!«
Todmüde! So müde, dass sie sich am liebsten irgendwo vor einer Haustür, auf der Straße, auf dem Bahnsteig hingesetzt und den Dingen ihren Lauf gelassen hätte.
Sie war dick. Sie fühlte sich entsetzlich dick. Sie musste all dieses weiche Fleisch mit sich herumschleppen, vor dem sie sich ekelte und das sie nicht als ihr eigenes empfand.
Die dicke Jeannie!
Nein! Nicht dieses Wort. Sie durfte nicht mehr an dieses Wort denken, sonst verlor sie jeglichen Mut.
Dunkle Schwaden schwappten durchs Fenster ins Zimmer und bedrängten sie, doch sie hatte nicht die Kraft, aufzustehen und Licht zu machen. Wie zerschlagen blieb sie im Dunkeln sitzen, versuchte, sich in ihren Schmerz einzulullen, wie wenn man einen kranken Zahn hat und daran herumspielt. Sie hasste sich nicht nur wegen der zwei Cognacs, die sie in Poitiers getrunken hatte. Sie schämte sich, wieder hier zu sein, zurückgekommen zu sein. Was erwartete, erhoffte sie denn?
Wegen des beklemmenden Drucks auf ihrem Herzen presste sie die Hand auf ihre linke Brust. Ein gutes, warmes, fast wollüstiges Gefühl durchströmte sie. Hinter ihren geschlossenen Lidern füllten sich ihre Augen mit Tränen, und sie wiederholte mit veränderter Stimme und einem Gesichtsausdruck, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen:
»Was bin ich nur so müde!«
Sie hatte im Sessel geschlafen, ohne Tabletten, und als sie plötzlich aufwachte, waren die Geräusche im Haus dumpfer. Sie knipste die grelle Glühbirne an und sah auf die Armbanduhr.
Es war zehn Minuten nach neun. Sie hatte Hunger, einen solchen Bärenhunger, dass sie endlich zögernd und mit schlechtem Gewissen die Treppe hinunterstieg und sich in den Speisesaal schlich, wo nur noch die Hälfte der Lampen brannte und zwei Frauen die Tische für das Frühstück am nächsten Morgen deckten.
Sie ging geräuschlos, weil sie es so gewohnt war, weil sie trotz ihres massigen Körpers leichtfüßig geblieben war, aber auch aus Verlegenheit. Sie näherte sich einer der Serviererinnen in weißer Schürze und schwarzem Kleid, die zusammenzuckte und sich umdrehte; einen Moment starrte sie sie einfach nur an, dann rief sie:
»Jeanne!«
Und fügte mit Nachdruck hinzu:
»Jeanne Martineau!«
Sie sahen sich an, als ob sie sich verstecken müssten, als ob, wie damals im Kloster, jeden Augenblick eine Nonne auftauchen und sie auseinanderscheuchen könnte.
»Du hast mich erkannt?«
»Sofort, ja. Warum? Hast du mich denn nicht wiedererkannt?«
»Doch, die Tochter von Hotu. Aber ich weiß deinen Vornamen nicht mehr.«
»Dabei habt ihr mich so oft damit aufgezogen. Désirée! – Was tust du hier? Besuchst du deinen Bruder?«
Sie wagte nicht zu fragen:
»Lebt er noch?«
Stattdessen sagte sie:
»Ist er zu Hause?«
»Natürlich. Vor kurzem wäre er beinahe Bürgermeister geworden. Ich weiß nicht, was da im letzten Augenblick für Gerüchte aufgetaucht sind …«
Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie beide im Speisesaal standen, die eine als Gast, die andere als Serviererin.
»Hast du hier irgendwas gesucht? Wohnst du im Hotel?«
»Ja. Ich habe noch kein Abendbrot gegessen. Ich habe Hunger.«
»Lass mich nur machen. Für ein ganzes Menü ist es zu spät, und sie werden dir das Abendessen wahrscheinlich à la carte berechnen. Würde dir das was ausmachen?«
»Nein.«
»Setz dich lieber mal hin! – Die Chefin ist ein Drachen. Die Leute stammen aus Paris, sie haben gerade erst das Haus übernommen. Man merkt ihnen an, dass sie Anfänger sind. – Was möchtest du essen?«
»Was da ist.«
»Roastbeef ist keines mehr übrig, aber ich kann dir Schinken und Kartoffelsalat bringen. Wenn du zuvor eine Suppe möchtest … Aber ich sage dir gleich, die ist nicht besonders. – Hast du von Juliens Unfall gehört?«
Beinahe hätte sie den Namen verständnislos wiederholt. Dann fiel ihr ein, dass einer ihrer Neffen so hieß, dessen Vornamen sie vergessen hatte und der inzwischen erwachsen sein musste.
»Armer Junge«, fuhr Désirée fort. »Er war von allen noch der Beste. Oh, Entschuldigung …«
»Sprich nur weiter!«
»Auf so dumme Weise ums Leben zu kommen! An einer Stelle, die er genau gekannt hat! Kein Monat vergeht, ohne dass dort ein Unfall passiert … An der Loup-Pendu-Kurve, du weißt schon, gleich hinter der Mühle! … Und seine Frau saß mit im Auto … Dass sie keine Fehlgeburt hatte, ist ein Wunder … Das Kind kam ein paar Wochen zu früh, aber die Ärzte in Poitiers konnten es retten … Wusstest du das denn nicht?«
»Nein … Doch.«
»Ich bin gleich wieder da …«
Das war vor … Moment! … Sie war jetzt siebenundfünfzig … Sie hatte das Kloster kurz nach ihrem siebzehnten Geburtstag verlassen … Hatte sie Désirée Hotu danach noch einmal getroffen? Vielleicht zufällig zwei- oder dreimal in den darauffolgenden Jahren. Jeanne war nicht ganz sicher, denn der Bauernhof der Hotus lag ziemlich weit außerhalb, und Désirée hatte nie zu ihren engen Freundinnen gehört. Das war also, grob gerechnet, vierzig Jahre her.
Immerhin hatten sie sich gegenseitig wiedererkannt. Jeanne hätte geschworen, dass die Stimme ihrer ehemaligen Mitschülerin und ihre Art zu sprechen unverändert geblieben waren. Sie hatten sich ganz unbewusst geduzt, als ob sie sich nie aus den Augen verloren hätten.
Sie war nicht einmal neugierig darauf gewesen, von Désirée zu erfahren, wie es kam, dass sie jetzt als Serviererin im Anneau d’Or arbeitete, wo die Hotus früher doch reiche Bauern gewesen waren.
»Ich habe ein paar Sardinen und einige Radieschen aufgetrieben, damit kannst du erst mal anfangen. Möchtest du Wein? Roten? Weißen? Der kommt wahrscheinlich von deinem Bruder.«
Désirée wirkte nicht unglücklich. Sie war dünn, hatte einen flachen Busen und so gut wie keine Hüften unter ihrer Schürze. Das war eigenartig, denn im Kloster war sie so ziemlich das dickste Mädchen der Klasse gewesen und hatte sich wegen ihrer rundlichen Arme und ihrer stämmigen Beine geschämt.
»Bleibst du länger?«
»Ich weiß es noch nicht. Ich glaube nicht.«
»Hast du Kinder?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Verzeih! Ich hatte drei, zwei habe ich verloren.«
Sie sagte das beiläufig, wie man etwas Belangloses mitteilt.
»Meine Tochter lebt mit ihrem Mann in Algerien. Ein braver Junge, Arbeiter, ich bin sicher, sie werden es noch zu etwas bringen. Ich will jetzt erst mal die Tische fertigdecken, dann komm ich wieder, und wir können reden.«
Das konnte sie dann wohl doch nicht, und Jeanne war erleichtert, obwohl sie eigentlich nicht wusste, weshalb. Zehn Minuten aß sie schweigend und ohne Appetit, trotz ihres großen Hungers, und beobachtete die beiden Serviererinnen, die in der spärlichen Beleuchtung ihrer Arbeit nachgingen. Von Zeit zu Zeit drehte sich Désirée nach ihr um und zwinkerte ihr zu. Als sie Jeanne den Schinken brachte, sagte sie halblaut:
»Iss schnell! Es braucht niemand zu sehen, dass ich dir drei Scheiben abgeschnitten habe.«
Etwas später erschien der Drachen, wie Désirée ihre Chefin nannte, im Türrahmen.
»Sind Sie fertig, Désirée?«
»Sofort, Madame. Ich muss nur noch das Dessert und den Kaffee servieren.«
»Das kann Emma machen. Oscar braucht Sie im Büro.«
Bevor sie ging, flüsterte Désirée Jeanne noch zu:
»Sie erinnert mich an unsere Mutter Oberin. Weißt du noch? Wir sehen uns später.«
Nebenan im Schankraum, dessen Tür die Chefin angelehnt ließ, waren die aneinanderstoßenden Billardkugeln und die Stimmen der Kartenspieler zu hören. Der Rauch der Pfeifen und Zigarren stieg zu den Lampen auf und vermischte sich mit dem Geruch von Bier und Schnaps.
Es war dieser Geruch, der Jeanne in Versuchung führte, obwohl sie diesmal keine Beklemmung spürte. Sie kämpfte nicht dagegen an. Sie hätte zwar nicht gewagt, ihre alte Freundin darum zu bitten, aber die zweite Serviererin, die sie jetzt bediente, war jung und ihr unbekannt.
»Könnte ich wohl einen kleinen Cognac haben?«
»Ich schicke Ihnen den Kellner.«
Sie drehte sich zu der halb geöffneten Tür und rief:
»Raphaël! Einen Cognac!«
Er brachte die Flasche. Auch er war jung, hatte blonde Locken und wirkte noch etwas linkisch in seiner zu weiten Weste, die vor ihm ein Mann mit Bauch getragen haben musste.
»Einen Moment, junger Mann!«, sagte Jeanne mit gleichgültiger gedämpfter Stimme wie nebenbei, leerte das Glas in einem Zug und setzte dann, indem sie es ihm entgegenhielt, in vertraulichem Ton hinzu:
»Noch einen! Auf einem Bein kann man nicht stehen!«
Sie sagte das mit einem kleinen ordinären Lachen, für das sie sich schämte, sodass sie, obschon sie inzwischen allein im bereits fürs Frühstück gedeckten leeren Speisesaal saß, dieses zweite Glas nicht anrühren wollte. Sie erhob sich, fest entschlossen, diesmal zu widerstehen, doch im letzten Moment beugte sie sich zum Glas auf dem Tisch hinunter und schüttete den Inhalt in sich hinein.
Sie hörte es zur Messe läuten und erkannte die Glocken der beiden Kirchen und die des Altersheims mit dem dünnen Gebimmel. Ein emsiges Zimmermädchen hatte ihr das Frühstück auf einem Tablett aufs Zimmer gebracht. Von überall waren Türenschlagen, Wasserrauschen und der Lärm der Klosettspülung zu hören.
Das Tageslicht, das in ihr gelb getünchtes Zimmer drang, machte sie mutlos. Sie konnte sich lange nicht dazu aufraffen aufzustehen und ließ sich mit ihrer Toilette viel Zeit.
Ob Désirée wohl auch im Hotel schlief, in einem der kleinen Zimmer über den Garagen? Ob sie sie wohl bitten konnte, bei ihr vorbeizuschauen?
Von Désirée hatte sie erfahren, dass Julien tot war, dass er verheiratet gewesen war und ein Kind hatte. Aber sie hatte von niemandem sonst gesprochen. Sie nahm selbstverständlich an, dass ihre Freundin Bescheid wusste. Aber Jeanne hatte keine Ahnung. Am Vorabend hatte sie ja noch nicht einmal gewusst, ob ihr Bruder noch lebte.
Zu der Zeit, als sie mit ihrer Familie noch in Briefkontakt stand, hatte sie nur erfahren, dass ihr Bruder sich mit Louise, der Tochter von Doktor Taillefer, verheiratet hatte, die ein paar Klassen unter ihr in die Klosterschule gegangen war. Sie erinnerte sich nur noch an ein kleines Mädchen mit langen Zöpfen, eine Schwarzhaarige, wenn sie sich nicht irrte, mit einer Stupsnase und vorwitzigen Augen.
Wie würde sie wohl jetzt aussehen? Sie musste wie Robert die fünfzig überschritten haben. Robert war sicher auch in die Breite gegangen. Er hatte schon als junger Mann zu Fettleibigkeit geneigt.
Jeanne legte Puder auf, wischte ihn wieder ab und puderte sich erneut, und als sie ihr wachsbleiches Gesicht im Spiegel sah, verrieb sie etwas Rouge auf ihren Wangen. Es wirkte lila. Sie wusste nicht, warum. Sie hatte schon alle Arten von Rouge auf ihrem Gesicht ausprobiert, aber alle wirkten lila.
»Alter Hanswurst!«, sagte sie in den Spiegel.
Es hätte keinen Sinn gehabt, den Tag verstreichen zu lassen und zu versuchen, sich Mut zu machen. Sie war mehrere Tausend Kilometer gereist, um hierherzukommen. Nun war sie da. Sie brauchte nur über die Brücke zu gehen, direkt auf das Tor zu, in das eine kleine Tür eingelassen war. Früher waren die beiden Torflügel ebenso wie die Fensterläden dunkelgrün gestrichen gewesen. Flaschengrün, hatte ihr Vater gesagt. Das Haus war weiß getüncht gewesen, gelblich weiß, was es wärmer und reicher erscheinen ließ als die anderen Häuser mit ihrem grellen Weiß. Sie würde den kupfernen Türklopfer betätigen, und der Ton würde wie ein Glockenschlag in der Torwölbung widerhallen.
Sie würde Schritte hören. Männerschritte? Frauenschritte? Dumme Frage! Wahrscheinlich die Schritte eines Dienstmädchens, das sie, wenn es entsprechend instruiert war, fragen würde:
»Wen darf ich melden?«
Jetzt war sie da. Sie hatte den Weg in einem Schwung hinter sich gebracht. Sie stand auf der anderen Seite der Brücke. Der Türklopfer hatte links hinter dem Haus angeschlagen. Auf der langen weiß verputzten Mauer des Lagerhauses las sie in schwarzen Buchstaben: Robert Martineau, Weingroßhandel. Und wie damals standen auch jetzt leere Fässer auf dem Trottoir. Nur der Vorname hatte sich geändert, früher war es der ihres Vaters gewesen: Louis. Und es gab auch immer noch den Hinweis: Zettel ankleben verboten.
Im Innern des Hauses ertönte eine Stimme:
»Es hat jemand geklopft, Alice!«
»Ich weiß! Ich kann jetzt nicht runterkommen!«
Kleine, eilige Schritte, ein Riegel, der aufgezogen wurde, eine schlanke, ganz in Schwarz gekleidete Frau mit Hut und Handschuhen, ein Gesangbuch in der Hand.
»Wollten Sie ausgehen?«, fragte Jeanne unwillkürlich.
»Nein. Ich komme gerade von der Messe. Was gibt’s denn?«
Sie war aufgeregt, nervös, vielleicht beunruhigt. Sie nahm sich gar nicht die Zeit, die Besucherin genauer anzusehen.
»Sind Sie Madame Martineau, die Frau von Robert?«
»Ja.«
»Da habe ich Sie doch gleich wiedererkannt. Wir waren zusammen im Kloster, obwohl Sie jünger sind als ich.«
Die andere schien gar nicht hinzuhören, in Gedanken mit etwas anderem beschäftigt.
»Ich bin Jeanne Lauer.«
»Aha!«
Sie wirkte unschlüssig, wie jemand, der nicht weiß, wo er mit einer sperrigen Last hinsoll.
»Kommen Sie herein! Sie werden das Haus nicht gerade in einem vorbildlichen Zustand finden. Das Mädchen hat uns gestern ohne Vorwarnung verlassen. Heute Morgen sollte sich eine Neue vorstellen, aber bisher ist niemand gekommen. Wo Robert steckt, weiß ich auch nicht. Seit fünf Minuten suche ich ihn überall.«
Sie stieß eine Tür auf und rief:
»Robert! Robert! Deine Schwester Jeanne ist da!«
Dann, als fiele es ihr eben erst ein:
»Ist Ihr Mann nicht mitgekommen?«
»Mein Mann ist seit fünfzehn Jahren tot.«
»Oh! Julien ist auch tot. Wussten Sie das?«
»Ich habe es gestern erfahren.«
»Sie sind schon seit gestern hier?«
»Seit gestern Abend, ja. Es war schon spät, da wollte ich nicht stören.«
Ihre Schwägerin ging darüber hinweg. Sie zog die Handschuhe aus, legte den Hut ab und lief durch die Zimmer, die Jeanne nicht wiedererkannte, die verändert und anders möbliert waren und mit ihrem früheren Aussehen auch den Geruch von damals verloren hatten.
»Ich möchte bloß wissen, wo Robert steckt. Als ich zur Messe ging, war er noch hier. Ich hatte ihn gebeten, das neue Mädchen zu empfangen, wenn es kommt, um sich vorzustellen. Ich hatte eine Agentur in Poitiers beauftragt, weil es so dringend war, und sie hatten mir versprochen, heute früh mit dem ersten Zug jemanden zu schicken. Sie müsste längst hier sein. – Robert! Robert! … Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit … Ich hänge völlig in der Luft, und ich möchte wissen, ob ich da jemals wieder …«
Eine junge Frau, ebenfalls in Schwarz, beugte sich in der ersten Etage über das Geländer.
»Wer ist denn da?«, fragte sie, ohne Jeanne zu sehen.
»Roberts Schwester. Deine Tante Jeanne, die in Südamerika gelebt hat. Es war doch Südamerika, Jeanne? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon so lange her … Hör mal, Alice, hast du Robert gesehen? Ich war im Büro, aber dort ist er auch nicht …«
»Ist das Büro immer noch hinten im Hof?«, fragte Jeanne.
»Ja. Warum? Hast du ihn weggehen hören, Alice?«
»Er ist bestimmt nicht weggegangen. Ich hätte die Tür gehört. Ich glaube, er ist nach oben gegangen. Na, wunderbar! Jetzt geht das wieder los …«
Aus einem Zimmer in der ersten Etage ertönte schrilles Babygeschrei, und in Louises Gesicht zuckte es nervös.
»Seien Sie mir nicht böse, Jeanne. Sie müssen mich für verrückt halten. Aber ja! Ich weiß das! Ich frage mich manchmal selbst, ob wir nicht alle ziemlich verrückt sind. Aber wie soll ich denn ganz allein mit diesem großen Haus fertigwerden? Ein Mädchen nach dem anderen verlässt uns. Die Letzte hat es nicht einmal für nötig gehalten, uns zu sagen, dass sie geht. Gestern, nach dem Mittagessen, als weder das Geschirr abgewaschen noch der Tisch abgedeckt war, habe ich gemerkt, dass ihre Sachen aus ihrem Zimmer verschwunden waren und sie sich verdrückt hatte. Das Kind schreit, als wollte es mich um den Verstand bringen, aber trotzdem wird seine Mutter gleich unter dem Vorwand verschwinden, sie sei noch nicht in dem Alter, in dem man zu Hause herumhockt. Da sitze ich dann mit dem Kind auf dem Arm. Wo meine Tochter ist, weiß ich auch nicht, und Henri ist gestern Abend mit dem Wagen weggefahren. Wenn wenigstens Robert …«
Es stand ihr ins Gesicht geschrieben, dass sie gleich in Tränen ausbrechen und auf den nächsten Stuhl sinken würde, aber sie fing sich wieder – klein und angespannt, wie sie war –, lief die Treppe hinauf und rief »Robert! Robert!« durch das riesige Haus.
Ihre Schwiegertochter öffnete eine Tür und herrschte sie mit spitzer Stimme an:
»Wie soll der Kleine denn schlafen, wenn Sie dermaßen schreien?«
»Hören Sie, Jeanne? Ich bin es, die schreit! Immer ich! Meine Güte, ich habe Ihnen ja noch gar nichts zu essen oder zu trinken angeboten. Merkwürdig, dass Robert nicht antwortet. Er kann nicht weggegangen sein, er verlässt das Haus nie ohne Kopfbedeckung, und ich habe seinen Hut in der Garderobe gesehen. Er ist nicht im Büro, und im Lager ist er auch nicht. Sonntags gibt es da ja auch nichts zu tun. Kommen Sie doch mit mir nach oben, Jeanne. Sie können sich in meinem Badezimmer frisch machen …«
Sogar die Treppenstufen waren erneuert worden und knarrten nicht mehr. Die Türen, vormals dunkel und lackiert, hatten jetzt einen weißen Anstrich. Die Wände waren hell. Alles war hell. Nirgendwo gab es dunkle Farben. Louise warf ihren Hut, den sie bis jetzt in der Hand behalten hatte, auf das ungemachte Bett und hob einen Männerschlafanzug vom Teppich auf.
»Ich schäme mich, aber ich kann nichts dafür. Es gibt Augenblicke wie jetzt gerade, da hat sich alles gegen mich verschworen, und manchmal dauert das Wochen, Monate. Wenn ich bloß wüsste, wo Robert …«
Sie lief zur Treppe, die in die zweite Etage führte, wo sich früher die Kinderzimmer und der Speicher, der zugleich Spielzimmer war, befunden hatten. Man hörte ihre eiligen Schritte, wie sie eine Tür nach der anderen öffnete, »Robert!« rief, die Tür wieder schloss und zur nächsten lief.
Dann erreichte sie den Dachboden am Ende des Ganges, öffnete die Tür und schrie plötzlich gellend auf:
»Robert!«
Und, gleich darauf:
»Jeanne! … Alice! … Es soll jemand kommen! … Schnell!«
Sie lehnte ganz in sich zusammengesunken und mit eingezogenem Kopf in ihrem schwarzen Kleid an der weißen Wand, eine Hand vor den Mund gepresst.
Wie früher fiel Licht durch ein großes schräges Dachfenster, das man mit Hilfe einer herabhängenden Stange öffnen und schließen konnte.
Es hatte eine Zeit gegeben, da musste Jeanne auf eine Kiste steigen, um diese Stange mit den Fingerspitzen berühren zu können. Etwas später hatte es gereicht, wenn sie sich auf die Fußspitzen stellte. Oberhalb des Fensters war ein Haken von der Größe eines Fleischerhakens angebracht worden, von dem niemand hätte sagen können, wozu er je gedient hatte.
An diesem Haken hatte Robert einen Strick befestigt und sich daran erhängt.
Er war wie seine Schwester sehr dick, vielleicht sogar noch dicker als sie. Er trug einen Anzug aus feiner Wolle, hatte aber noch seine Pantoffeln an. Einer war ihm vom Fuß gerutscht.
Ein leerer Kasten, den er als Schemel benutzt hatte, lag umgestoßen auf dem Fußboden und dicht daneben ein Zettel, auf dem mit Tinte geschrieben ein einziges Wort stand:
»Verzeihung.«
Louise presste ihre Hand noch fester an den Mund und wurde ganz blau im Gesicht, als ob sie gleich ersticken würde. Von unten ertönte die Stimme von Alice:
»Was ist denn los? … Soll ich hochkommen?«
»Ja. Bringen Sie ein großes Glas kaltes Wasser mit!«, antwortete Jeanne und erschrak über den Klang ihrer eigenen Stimme.
»Und ein Messer … Oder eine große Schere … Schnell! …«, setzte sie einen Moment später hinzu.
Das Kind hatte wieder zu schreien angefangen. Louise sah ihre Schwägerin mit den verängstigten Augen eines Tieres an.
Robert schaukelte sanft am Ende des Seils hin und her. Ein Sonnenstrahl fiel auf seine sonderbar verrenkte Schulter und malte ein leuchtendes Viereck auf ein Schaukelpferd mit herausgerissener Mähne, das den Toten unverwandt aus seinen Porzellanaugen anstarrte.