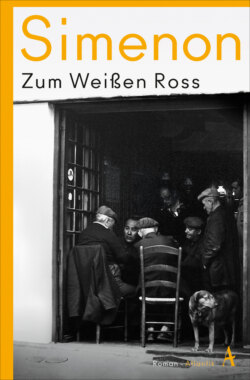Читать книгу Zum Weißen Ross - Georges Simenon - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеDie Begegnung mit Arbelet hatte für Félix weder etwas am üblichen Verlauf der Nacht noch an seiner Laune geändert. Er hatte Besen und Putzlumpen aus dem Schrank geholt und ohne Eile den Fußboden gesäubert. Dabei brummte er:
»Eine Scheiße ist das!«
Doch damit meinte er nicht seine augenblickliche Tätigkeit. Er dachte weder an seinen Neffen noch sonst an etwas Bestimmtes.
Wenn er mit sich selbst sprach – oft kaute er auf einem Satzfetzen oder auf einzelnen Wörtern herum, bis sie unverständlich wurden –, meinte Félix niemals einen bestimmten Menschen oder eine bestimmte Sache.
Er sagte ganz allgemein:
»Eine Scheiße ist das!«
Um ihn zu verstehen, hätte man in seiner Haut stecken, erlebt haben müssen, was er erlebt hatte; Nachtwächter sein, krank und angefault in jeder Faser seines Körpers, stinken, dass man es selbst merkt, sich beim Schlafenlegen jedes Mal fragen, ob das alte Gerippe morgen früh noch imstande sein würde, sich wieder zu erheben.
»Eine Scheiße ist das!«
Kein bestimmter Mensch. Vielleicht nicht einmal die Menschen im Allgemeinen. Aber zum Beispiel er selber! Er, Félix, und alles, was ihm zustieß. Das Leben! Oder das Schicksal! Oder auch …
Oft, fast jede Nacht, besonders wenn die Geschäftsreisenden ihn aus dem ersten Schlaf rissen, schimpfte er auch:
»Ich bring noch mal einen um …«
Der Wirt hatte es mehrmals gehört, Thérèse auch und sogar die kleine Rose. Er machte kein Geheimnis daraus. Er meinte es auch nicht scherzhaft. Er brummte es vor sich hin, während er seine Arbeit tat, und war überzeugt, dass es eines Tages so kommen würde.
Unterdessen putzte er den Fußboden sauber und ging dann ins Café, um auf der Wanduhr, die er mit seiner Taschenlampe anleuchtete, nach der Zeit zu sehen.
Zehn Minuten vor eins. Sogar das Zifferblatt einer Uhr, zwei Zeiger in einem bestimmten Winkel zueinander, hatte für ihn nicht die gleiche Bedeutung wie für die anderen.
Zehn Minuten vor eins, das hieß, dass es sich nicht mehr lohnte, sich noch einmal auf das rötlich braune Sofa im Korridor zu legen. Ein neuer Abschnitt der Nacht begann, denn jetzt bestand keine Gefahr mehr, dass Gäste eintreffen würden.
Immerhin ließ Félix für diesen unwahrscheinlichen Fall die Hintertür, die auf den Hof ging, offen. Jedes Mal wenn er sie aufmachte, traf ihn der gleiche feuchtkalte Lufthauch, und rechts, wo der Hund sich in der Hundehütte rührte, war ein leises Kettenrasseln zu hören.
Félix zündete seine Pfeife an. Wenn er sich umdrehte, erblickte er manchmal ein beleuchtetes Fenster: ein Gast, der krank war oder nicht schlafen konnte und las.
Das konnte ihm egal sein. Er ging durch den Hof bis zum einstigen Pferdestall, aus dem man eine Garage gemacht hatte. Neben der Tür fand er die alten Gummistiefel, die er mit Schlauchstücken geflickt hatte. Er drehte den Schalter, und eine klägliche Glühbirne, fünfundzwanzig Watt, glomm in dem verschwommenen Grau auf.
Der Hund hatte sich wieder in seiner Hütte hingelegt. Félix bewegte sich sehr langsam, erstens, weil es keinen Zweck hatte, sich zu beeilen, und dann, weil ihm mehr oder weniger alles weh tat.
Er näherte sich den dunklen Umrissen, die sich von dem Halbdunkel abhoben. Das waren die Autos der Gäste, meistens Serienwagen, doch manchmal war auch ein Luxusmodell darunter.
Das Weitere hing davon ab, wie viele er zu waschen hatte, eins, zwei oder drei. Das Wasser war eisig, auch im Sommer. Es gab einen alten Gartenschlauch, aber der Wasserstrahl war nicht stark genug, um den eingetrockneten Schmutz von den Karosserien und besonders von den Rädern zu lösen.
»Ich bring noch mal einen um …«
Das sagte er, während er die Autos wusch. Manchmal irrte er sich auch und sagte:
»Ich bring noch mal eine um …«
Und wenn man es genau bedachte, so konnte er damit eigentlich keine Frau meinen, sondern eine dieser Bestien, denn für ihn waren die Autos dreckige Bestien, mit ihren heimtückischen Schmutzwinkeln, mit ihren blanken Flächen, auf denen der Schwamm Streifen hinterlässt, wenn man ihn nicht oft genug ausspült – dreckige Bestien mit ihren harten, scharfen Kanten, die extra dazu da sind, einem die Haut aufzuscheuern.
Die Zigarettenkippen im Inneren nicht vergessen! Die Gäste ließen nie den Zündschlüssel stecken, sodass Félix die Wagen selber herumschieben musste, wobei er das Lenkrad durch das offene Fenster drehte.
Eine Scheiße war das! Alles miteinander! Wenn es nur zwei Wagen zu waschen gab, war er um vier Uhr früh fertig, gerade wenn man die ersten Lastwagen zum Markt von Nevers fahren hörte.
Félix suchte sich einen der frischgewaschenen Wagen aus, den größten, und machte es sich auf dem Rücksitz bequem. Anderthalb Stunden konnte er noch schlafen.
Unangenehm war die Geschichte für seinen Neffen, nicht für ihn. Er hatte schließlich auch kaum darüber nachgedacht, eigentlich überhaupt nicht, bis auf den Augenblick, in dem er sich seine Nichte im Bett vorgestellt hatte. Und das war ganz mechanisch geschehen …
Jetzt war es hell, und der Hofhund zerrte an seiner Kette. Félix kletterte mühsam aus seinem Auto und begab sich ins Café.
Alles war auf die Minute eingeteilt. Das war noch das Beste im Leben. Man muss wissen, wohin man geht und was einen an jeder Wegbiegung erwartet.
Hinter der Theke gab es einen kleinen einflammigen Gaskocher mit einem roten Gummischlauch. Man roch das Gas eine ganze Weile, ehe es sich mit dem immer gleichen Puffen entzündete, und Félix füllte den Topf am Wasserhahn.
Er brauchte nicht besonders hinzuhorchen. Ein anderer hätte vermutlich überhaupt nichts gehört, aber verdorben, wie er war, entging ihm nicht der leiseste Laut. Er hätte gehört, wie am anderen Ende des Hotels eine Ratte in ihr Loch schlüpfte.
Das ging niemanden etwas an, so war er eben. Und was er hörte, sah er auch – so deutlich, als wäre er dabei! Drei Zimmer weiter im ersten Stock, just über dem Kronleuchter im Speisesaal, stand jetzt der Patron auf. Der Kronleuchter vibrierte kaum. Man merkte es nur, wenn man es wusste, aber er merkte es!
Der Patron hätte keineswegs so früh aufstehen müssen. Er ging nicht auf den Markt einkaufen, Fleisch, Fisch und Gemüse wurden ihm ins Haus geliefert. Und der Kaffee, den die Gäste vor acht Uhr vorgesetzt bekamen, war aufgewärmt, auf dem Gaskocher von Félix.
Trotzdem stand der Patron schon auf.
Er hatte keine Lust dazu! Er war noch so schläfrig! Er war immer schläfrig, von früh bis spät. Er war müde, hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, dunkle Ringe um die Augen, keinen Appetit.
Doch er stand auf, möglichst leise, um seine Frau nicht zu wecken. Er griff nach seiner Hose, stopfte das Nachthemd hinein, fuhr in seine Pantoffeln und stürmte auf den Korridor hinaus.
Und alles wegen Rose! Wenn Rose nicht da gewesen wäre, hätte es genauso gut eine andere sein können. So war der Patron eben. Er passte ja auch jeden Tag den Augenblick ab, in dem Thérèse in den Weinkeller ging, um hinter ihr herzurennen – und Thérèse war alles andere als schön und hatte immer ihren fünfjährigen Bengel an den Röcken hängen.
Félix wusste alles. Alles, was im Haus vorging! Was ein jeder trieb und wie ein jeder sich wusch!
Er nahm sich gerade genug Zeit, den Kaffee hinunterzustürzen, den er sich gekocht und mit drei Stück Zucker gesüßt hatte. Auch gerade genug Zeit, um zu hören oder vielmehr zu erraten, dass am anderen Ende des Hauses, in der Dachkammer im zweiten Stock, Thérèses Wecker klingelte.
Er durchquerte den Hof und ging wieder in die Garage, wo es kaum heller war als nachts. Nur durch die offene Tür kam etwas Tageslicht herein.
Hier gab es Hühner, allerlei Werkzeug und Geräte, Kisten, Fässer, und in der Höhe eines normalen ersten Stockwerks verlief eine Art Galerie, zu der man über eine Leiter gelangte. An einer Stelle dieser Galerie bildeten Säcke und ein Stück Zeltleinwand einen Verschlag und verhinderten, dass man von unten eine eiserne Bettstatt und einen Wasserkrug sehen konnte. Dieses Interieur bildete die Behausung von Félix.
Häufig kamen im Laufe des Tages Gäste in die Garage, um sich ihre Angelegenheiten zu erzählen, weil sie glaubten, dass niemand sie hier höre. Keiner hätte geahnt, dass der Alte genau über ihnen lag und nur den Kopf zu senken brauchte, um sie durch die Löcher in seinen Wandbehängen zu sehen!
Das war aber nicht alles! Félix stieg auf zwei aufeinanderstehende Kisten. Vielleicht würde er einmal von diesem wackligen Gerüst stürzen und sich zwischen den Autos unten das Genick brechen. Aber vorerst hievte er sich jeden Morgen auf die Kisten. Von hier konnte er durch eine Luke hinaussehen, die keine richtige Dachluke war, sondern vor zweihundert oder vierhundert Jahren Gott weiß welchen Raum erhellt hatte. Wurde nicht behauptet, dass die Garage einst das Hauptgebäude gewesen war?
Direkt gegenüber war das Fenster von Roses Kammer, und da dieses Fenster nur auf ein Dach hinausging, besaß es keinen Vorhang. Meist stand es offen, und wenn seine Luke nicht mit Kitt abgedichtet gewesen wäre, hätte Félix auch alles hören können.
Täglich die gleiche Komödie, seit es vor drei Monaten zum ersten Mal passiert war! Vorher hatte Thérèse in dieser Kammer gewohnt, und mit ihr war es ganz anders abgelaufen, weil sie Erfahrung hatte.
Als Rose ihren Dienst antrat, war Monsieur Jean, wie man den Patron nannte, in der ersten Zeit immer um sie herumgestrichen. Er lachte so komisch und erfand alle möglichen Vorwände, um in irgendeiner Ecke mit ihr allein zu sein. Das ging so weit, dass er ihr das Schuhputzen beibrachte, weil das immer in der Waschküche gemacht wurde!
Dann hatte Félix ihn eines Morgens hineingehen sehen, als die Kleine nur ihre Unterhose am Leibe hatte, und sie hatte sich das Handtuch vor die Brust gehalten.
Jetzt stellte sie sich bis zum letzten Moment schlafend. Fünf Minuten später war alles vorbei, und der Patron ging wieder. Als hätte er das Bedürfnis, sich tüchtig zu schütteln, sah man ihn dann unten hin- und herlaufen, den Ofen schüren, die Fensterläden aufstoßen, auf die Straße hinaustreten, im Hof Umschau halten.
Félix blieb inzwischen noch auf seinem Posten und sah Rose zu, die sich träge ankleidete.
»Eine Sch…«
Nein! Er sagte eher:
»Ich bring noch mal einen um …«
Warum nicht:
»Wenn ich einmal eine erwische …«
Niemand wusste, dass er da war! Niemand kannte ihn! Alle, so wie sie waren, sogar Madame Fernande, die Patronne, die zwei Fenster weiter wohnte, kamen und gingen, ohne zu ahnen, dass er ihre intimsten Handlungen belauschte.
Für Madame Fernande war es noch zu früh am Morgen. Sie stand erst nach acht auf und beendete ihre Toilette nicht vor zehn. Allein für ihre Frisur und die Fingernägel brauchte sie eine Stunde.
Im Grunde hatte der Patron also drei, ohne die anderen, die Gelegentlichen, zu zählen, und diejenigen, die er in Nevers oder La Charité besuchte.
»Was machen Sie denn da?«
Fast wäre er von seinem Ausguck hinuntergepurzelt, nicht aus Angst, sondern weil er überrascht worden war. Aber es war nichts Besonderes, nur Thérèse, die mit ihren vierundzwanzig Jahren schon ganz abgelebt und verblüht war. Sie war schmutzig und boshaft. Ihr Mann war ein Pole, der im Steinbruch von Tracy, fünfzehn Kilometer entfernt, arbeitete und sie nur besuchte, wenn er besoffen war.
»Lassen Sie mich auch sehen, Sie altes Schwein …«
Ohne abzuwarten, dass er ihr den Platz überließ, schwang sie sich zu ihm herauf und besah sich die Szene.
»Na ja …«
Der Patron war noch in Roses Kammer, und Thérèse bemerkte:
»Wenn man denkt, dass er den ganzen Tag scharf darauf ist! … Aber was wollte ich eigentlich? … Ach ja! Nummer drei reist ab, Sie sollen den Wagen auftanken …«
Minute um Minute, Schritt für Schritt, Feld um Feld setzte sich das Haus in Bewegung, die Räder griffen ineinander.
Die schon hoch stehende Sonne brannte heiß. Sie verscheuchte den leichten Dunst über der Loire und trocknete die Straße, wo die Nacht große, feuchte Flecken hinterlassen hatte.
»Hast du Frühstück bestellt?«
Maurice Arbelet war fast fertig. Er stand am offenen Fenster, während seine Frau Christian anzog, der wie jeden Morgen eine halbe Stunde brauchte, um richtig wach zu werden.
»Glaubst du, man muss das Frühstück hier nehmen?«
Wieder eine Geldfrage! Émile beeilte sich zu erklären:
»Ich habe Hunger …«
Worauf seine Mutter erwiderte:
»Wir kaufen uns beim Bäcker frische Croissants und essen sie unterwegs …«
Warum sollte man auch sechs Franc für ein Frühstück bezahlen, das aus Kaffee und zwei Croissants bestand?
»Meinst du nicht, dass die Kinder zu müde sind, um zu Fuß weiterzugehen?«
Müde war Arbelet selbst, aber das traute er sich nicht zu sagen. Er fühlte sich flau, der Kopf tat ihm weh.
Man hörte, wie Thérèse die Café-Terrasse in Ordnung brachte und ein paar Eimer Wasser über das Pflaster schüttete. Vor irgendeiner Haustür redeten Leute mit erhobener Stimme. Der Tag war noch fast neu.
»Gehen wir erst einmal ein paar Kilometer. Den Bus können wir dann überall nehmen, dazu ist immer noch Zeit …«
Maman trocknete die Zahnbürsten ab, packte die Seife in ein Stück Papier, rollte ein Handtuch zusammen und verstaute alles in der großen Handtasche, die für diese Ausflüge diente.
Sie vergaß zuerst den Kamm, dachte aber noch rechtzeitig daran. Arbelet sagte:
»Ich gehe schon hinunter …«
Émile rief natürlich gleich:
»Ich auch!«
»Nein, du bleibst bei mir …«, befahl Mutter, die an Onkel Félix dachte.
Und ihr Mann, der ebenfalls an ihn dachte, warf ihr einen Blick des Einverständnisses zu.
Sollte man mit dem Onkel reden oder lieber nicht? Auf jeden Fall durften die Kinder nicht erfahren, dass ein Familienmitglied auf der Stufenleiter der Lebewesen so tief gesunken war.
Die erste Person, der Arbelet beim Hinuntergehen begegnete, war Rose, die nach Seife roch und es sehr eilig hatte.
»Pardon, Monsieur …«
»Aber, bitte!«
Sie setzte in großen Sprüngen die Treppe hinunter. Sie war sicher kaum sechzehn!
»Frühstück für Sechs und Sieben, schnell!«, rief ihr der Wirt entgegen, als sie das Café betrat.
Nummer sechs und sieben, das war die Familie Arbelet, und Maurice griff ein.
»Lassen Sie nur … Wir nehmen kein Frühstück …«
»Keinen Kaffee?«
»Nein, nicht so früh am Morgen, danke …«
Arbelet spürte, dass er rot wurde, wie immer, wenn es um Geld ging, und ärgerte sich darüber.
»Machen Sie mir bitte die Rechnung fertig …«
»Das ist schnell geschehen … Vierzig und dreißig – siebzig Franc.«
Das war natürlich mehr, als Arbelet erwartet hatte! Es war immer mehr!
»Und dann noch die Getränke von gestern Abend … Sie hatten eine Runde, nicht wahr? … Dazu ein Glas Marc, zwei Grenadine, einen Aperitif …«
Maman kam die Treppe herunter, und Arbelet beeilte sich zu zahlen, um den Wirt zum Schweigen zu bringen.
Er hörte, dass jemand im Hof die Benzinpumpe betätigte, wusste aber nicht, dass es Onkel Félix war. Ein Gast trat ein, einer der Kartenspieler am Abend vorher. Am Ende würde der auch noch von den Runden anfangen!
»Wir gehen schon vor«, verkündete Maman.
In diesem Moment hieß das:
»Ich gehe mit den Kindern zum Bäcker, Croissants kaufen.«
»Gut! … Ich zahle nur noch und komme gleich nach.«
Er hatte Lust auf eine Tasse Kaffee. Es war lächerlich, so große Lust auf Kaffee zu haben und daraus eine Gewissensfrage zu machen, aber so war es. Er winkte Rose herbei und fühlte sich schon schuldig, weil er sie auf eine bestimmte Art ansah.
»Mademoiselle … Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee …«
Er sah, wie seine Familie, Maman mit einem Kind an jeder Hand, die Straße überquerte. Man hätte meinen können, dass die Natur schon schwitzte, die Stadt roch nach Sommer, und als Rose sich vorbeugte, um ihm den Kaffee hinzustellen, ertappte er sich dabei, dass er tief einatmete, um ihren persönlichen Geruch aus allen anderen Morgengerüchen heraus zu erkennen.
»Mit Schnaps?«
Er verstand nicht sofort.
»Nein! Danke … Nur ein Stück Zucker …«
Warum spähte er durch die offenen Türen? Warum hatte er kein reines Gewissen? Doch nicht wegen des Onkels! Und sicher auch nicht wegen der Partie Belote und der drei Gläschen Marc!
Er konnte in die Küche sehen, wo in einer Ecke eine sehr dicke alte Frau saß und Gemüse putzte. Draußen wischte Thérèse tief gebückt den Randstein mit einem feuchten Tuch auf, und ihr Kleid schob sich hoch über die nackten Beine hinauf.
Hinter der Theke betrachtete der Wirt versonnen eine Speisekarte, die er noch nicht geschrieben hatte, und Arbelet staunte plötzlich, dass er keine zweiunddreißig Jahre alt war.
Warum staunte er? Was war an diesem Haus so merkwürdig? Inwiefern war das Los des Wirtes vom Weißen Ross beneidenswerter als das eines beliebigen anderen Menschen?
»Rose! … Sieh nach, wie viele Hühner noch im Kühlschrank sind …«
Die Arbelets hatten keinen Kühlschrank, gedachten aber einen zu kaufen. Huhn aßen sie nur selten. In ihrem Haus gab es keine Überraschungen hinter offenen Türen, keinen Hof, in dem ein Automotor brummte, keine Schnellstraße vor der Tür, keinen Metzger gegenüber, keine Lorbeerbäumchen in grünen Kübeln …
Keine …
Er gab zehn Franc Trinkgeld, mit schlechtem Gewissen, denn er hätte es seiner Frau nicht zu sagen gewagt. Er hörte, wie hundert Meter weiter die Ladenglocke der Bäckerei anschlug, in die seine Familie soeben eintrat.
Beschämt stürzte er seinen Kaffee hinunter. Er wäre gerne noch geblieben, ohne besonderen Grund, aber er riss sich vom Weißen Ross los und ging mit großen Schritten vor der Bäckerei auf und ab. Die Bäckerin griff mit der Hand in das Glasgefäß mit den roten und grünen Bonbons, um die Christian wahrscheinlich gebettelt hatte.
Maman zählte das Geld sorgsam Stück für Stück auf die Marmorplatte. Arbelet hörte sie beim Hinausgehen sagen:
»Nicht auf der Straße … Das gehört sich nicht …«
Sie durften die Croissants nicht essen, solange sie noch in der Stadt waren. Eins stand jetzt schon fest: Sie würden alle Durst haben! Besonders Émile, der ständig durstig war!
»Im nächsten Dorf …«, versprach Maman.
Und der Junge würde alle hundert Meter fragen:
»Kommt das nächste Dorf bald?«
»Schau nur immer geradeaus, dann geht’s schneller …«
War es der Gedanke an die vertraute Mahnung, der bewirkte, dass Arbelet seinem Wunsch zurückzublicken nicht länger widerstand?
Fühlte er sich dermaßen schuldig, dass er sich verpflichtet glaubte zu sagen:
»Ich habe versucht, ihm noch einmal zu begegnen …«
»Hast du ihn gesehen?«
»Nein … Wir müssten wirklich etwas für ihn tun …«
»Meinst du nicht, dass wir schon genug getan haben?«
Christian mit dem großen Kopf auf dem rundlichen kleinen Körper stolperte schon bei jedem Schritt, weil er zu weit nach vorne sah, über die sichtbaren Dinge hinaus. Émile stieß einen Stein mit dem Fuß vor sich her und wunderte sich, dass er nicht ermahnt wurde, seine Schuhe zu schonen.
»Man kann ihn doch nicht in dieser Situation lassen«, sagte der Vater.
»Wer ist denn schuld daran?«, erwiderte die Mutter. Und da Émile den Kopf hob, fügte sie hastig hinzu:
»Sprechen wir jetzt nicht davon …«
»Wer ist das, Maman?«
»Wer?«
»Der Mann in der Situation …«
Sie verließen die Straße und bogen rechts in einen Feldweg ein, der zur Loire hinunterführte.
»Gib ihnen die Croissants …«
Auf den Brennnesseln am Wegrand lag noch Tau, und in dem eingetrockneten Schlamm am Boden waren die Hufspuren einer Kuhherde zu erkennen.
Mutter seufzte wie immer:
»Wie das duftet! …«
Arbelet hätte gerne noch einmal zurückgeblickt. Er war traurig. Nein: griesgrämig. Beides! Und vielleicht irgendwie beunruhigt …
Madame Fernande, die Wirtin vom Weißen Ross, eine schöne dreißigjährige Frau mit vollen, weichen Formen und einem ebenmäßigen, sanften Gesicht, öffnete ihr Fenster der Morgensonne, und Millionen von Staubkörnchen entschlüpften dem Bett, um in die leuchtende Natur hinauszuschweben.
Einige Meter weiter gab es das Garagendach mit den alten Ziegeln und in diesem Dach eine trübe Luke, an die niemand je gedacht hatte.
Erst gegen zehn Uhr, als Madame Fernande zur Kasse hinunterging, konnte sich der alte Félix auf seinem Eisenbett ausstrecken und sich, gleichgültig gegenüber den Geräuschen und Bildern des Hauses, in den schweren Schlaf eines kranken Tieres versenken.
»Isst du es nicht mehr?«, fragte Madame Arbelet ihren Mann und deutete dabei auf das letzte Croissant.
Sie teilte es zwischen den beiden Kindern auf.