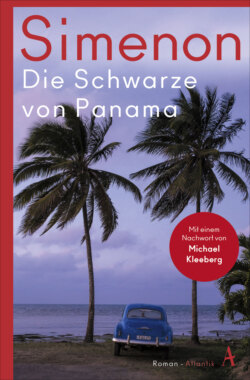Читать книгу Die Schwarze von Panama - Georges Simenon - Страница 4
2
ОглавлениеHätte jemand zu Dupuche gesagt, dass er träume, so hätte er erwidert:
»Donnerwetter! Ich hab’s doch gewusst …«
Es war aber kein Traum. Er stand auf dem Gehsteig neben dem Auto der Brüder Eugène und Fernand Monti. Es war ihm allerdings noch nicht klar, ob Eugène der größere grauhaarige Mann war oder aber der kleinere mit der infolge einer Kriegsverletzung gelähmten Hand.
Die Sonne stand schon tief. Die ihr zugewandten Holzhäuser waren von rötlichem Licht übergossen, während die gegenüberliegende Häuserzeile aschgrau wirkte.
»Zuerst das Bett … Heb an! …«
Die Brüder Monti kümmerten sich nicht um ihn. Sie luden das Auto ab, mit dem sie hergekommen waren und auf dessen Dach sie ein Bett und einen Tisch gebunden hatten.
»Komm mal her, du!«, rief einer von ihnen dem Neger zu, der ihnen untätig zusah. »Bring diesen Tisch in den ersten Stock …«
Dupuche hatte wieder getrunken. Er war nicht betrunken, aber seinen Eindrücken fehlte es an Schärfe. Über der Haustür bemerkte er die Aufschrift:
Émile Bonaventure – Schneidermeister
Er ging durch den Laden, das heißt einen Raum, in dem es nach Stoffen und spanischem Pfeffer roch. In einer Ecke hatte man eine nackte Kleiderpuppe aufgestellt. Ein großer, schwarz gekleideter Neger mit einer Stahlbrille auf der Nase sah ihm schweigend nach.
Dupuche stieg die Treppe hinauf. Einer der beiden Montis rief:
»Hier entlang!«
Dann stand er auch schon im Zimmer. An den Wänden prangten Tapeten mit rosarotem Blumenmuster.
»Dann bis morgen …«
Die Brüder drückten ihm die Hand und verließen ihn. Da er nicht einmal einen Stuhl hatte, musste er sich auf das Eisenbett setzen.
An jenem ersten Morgen im Hôtel de la Cathédrale war er mit der Erinnerung an einen Namen aufgewacht, ohne dass er hätte sagen können, zu welchem Gesicht er gehörte: Monsieur Philippe.
Erst im Laufe des Tages hatte er in Erfahrung gebracht, dass Monsieur Philippe kein anderer war als der ruhige, zurückhaltende alte Herr, der sich im Hotel seiner angenommen hatte und der Südamerika so genau kannte.
Jetzt wusste er viel mehr über ihn. Man hatte ihm die Lebensgeschichte von Monsieur Philippe erzählt. Lange Jahre war er der Generalvertreter der French Line in Amerika gewesen und hatte allein durch Fehlspekulationen auf einen Schlag Millionen verloren.
Tsé-Tsé hatte ihn in sein Hotel aufgenommen, wo er als Geschäftsführer fungierte.
War es nicht merkwürdig, dass alle Welt den reichen Hotelbesitzer einfach Tsé-Tsé und seinen Geschäftsführer respektvoll Monsieur Philippe nannte? Da waren noch andere Gesichter, die er schemenhaft vor sich sah und denen er gern einen festen Platz zugewiesen hätte. Aber er war müde und schleppte sich auf die Veranda, die sich über die gesamte Vorderfront zog. Unvermittelt stand er vor einer alten Negerin, die emsig Kartoffeln schälte.
Aber natürlich! Der erste Stock umfasste drei Zimmer, und die Veranda hatte hier genau dieselbe Funktion wie der Hinterhof für die Bewohner eines Mietshauses. Ein sonderbares Haus und eine nicht minder sonderbare Geschichte, denn eigentlich wusste er selbst nicht mehr, wie er in diesem Haus mitten im Negerviertel gestrandet war.
Übrigens hatte ihn auch niemand nach seiner Meinung gefragt. Man hatte ihn hier abgesetzt, zusammen mit einem Bett und einem Tisch, und er hatte keine Ahnung, wie man in die Stadt gelangte.
Immerhin vernahm er von irgendwoher den Lärm der Straßenbahn, und er sagte sich, dass er ja nur dem Geräusch nachzugehen brauche.
Die ungepflasterten Straßen hatten fünfzig Zentimeter tiefe Löcher. Man sah nur Farbige, die sich im Freien aufhielten, sie saßen auf den Türschwellen oder auch auf Stühlen, die sie gegen die Mauern gestellt hatten.
Welche Gedanken gingen Dupuche eigentlich so durch den Kopf? Natürlich, an Tsé-Tsé dachte er … Und immer wieder an den ersten Morgen. Beim Aufstehen hatte er Germaine angekündigt:
»Ich muss dem Hotelbesitzer Bescheid sagen …«
Und er war hinuntergegangen, hatte sich an die alte Dame an der Kasse gewandt:
»Madame, ich möchte mit dem Chef sprechen.«
»Warten Sie einen Moment in der Halle … Mein Mann wird gleich unten sein …«
Er hatte ihn kommen sehen … Ein kleiner gedrungener Mann mit kurzen Beinen, einem dicken Kopf, plumpen Gesichtszügen und buschigen Augenbrauen. Er war bestimmt schon fünfundsechzig.
»Sie möchten mich sprechen?«
Dass er Korse war, hörte man sofort. Er musterte Dupuche, bedeutete ihm dann, ihm ins Café zu folgen.
»Hier lässt es sich besser reden … Sie sind also derjenige, der mit einer jungen Frau hier ist?«
»Mit meiner Frau …«
»Das läuft auf dasselbe hinaus.«
Der Barkeeper war schon auf seinem Posten, ebenso der kleine Schuhputzer, den der Wirt anfuhr:
»Geh spielen!«
»Die Sache ist die … Ich bin der Direktor der S.A.M.É.«
»Die bankrott ist«, fiel der Korse ein.
»Woher wissen Sie das?«
»Weil ich Freunde in Guayaquil habe.«
»Ich selbst war davon nicht unterrichtet … Ich war auf dem Weg dorthin, um meine Stelle anzutreten … In Panama hätte man mir einen Kreditbrief über zwanzigtausend Franc ausbezahlen sollen …«
»Ja …«
»Wie meinen Sie das?«
»Ach nichts, sprechen Sie nur weiter … Bob, schalte die Ventilatoren ein!«
Er schien sich nicht sonderlich für Dupuche zu interessieren. Er blickte durchs Fenster, rief einen Boy herbei, um ihm eine Anweisung zu geben.
»Reden Sie weiter …«
»Ich hielt es für richtiger, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass ich kein Geld mehr habe, und …«
»Hast du die Montis nicht gesehen?«, fragte der Wirt den Barkeeper.
»Monsieur Eugène ist beim Friseur …«
»In Ordnung … Warten Sie hier, Monsieur … Wie ist übrigens Ihr Name?«
»Dupuche …«
»Gedulden Sie sich bitte ein paar Minuten … Trinken Sie inzwischen etwas …«
Und Dupuche hatte wieder einen Pernod bestellt, ohne zu wissen, warum.
Seither waren zwei Tage vergangen, und jetzt war er besser im Bilde. Er wusste zum Beispiel, dass François Colombani, den man Tsé-Tsé nannte, ohne einen Heller nach Südamerika gekommen war und dass ihm jetzt das ganze Hotel gehörte. In Cristobal, am anderen Ende des Kanals, hatte er einen Weingroßhandel, den sein ältester Sohn Gaston leitete.
Er war an anderen Firmen beteiligt, an Autowerkstätten, an Parfümimporten und an der Perlenfischerei.
Dupuche hatte Germaine auf dem Gehsteig gesehen und war zu ihr hinausgetreten.
»Geh noch ein paar Minuten spazieren … Ich soll hier eine Weile warten …«
Während über sein Schicksal verhandelt wurde, sah er sie auf dem Platz umherirren, sich hin und wieder auf eine Bank setzen.
Es wurde ein wahrer Kriegsrat abgehalten. Die beiden Montis waren gekommen. Der eine Bruder roch noch nach dem Friseurladen. Dann hatte sich Tsé-Tsé zu ihnen gesetzt, begleitet von Monsieur Philippe, der den Mund nicht auftat.
»Nun«, hatte Tsé-Tsé erklärt, »dieser Herr ist in Schwierigkeiten, denn er hat kein Geld. Er ist Ingenieur und ein Landsmann …«
Die anderen blickten Dupuche prüfend an, als wollten sie herausfinden, was in ihm steckte.
»Wollen Sie denn nicht nach Frankreich zurückkehren?«, fragte der größere Bruder – es war wohl Eugène.
»Ich habe nicht die Mittel, um unsere Rückreise zu bezahlen.«
»An Ihre Familie können Sie sich nicht wenden?«
Über ihren Köpfen brummte der Ventilator. Der Barkeeper spülte die Gläser, wischte über die Flaschen. Draußen brannte die Sonne auf den Gehsteig, wo der kleine Schuhputzer herumlungerte.
»Ich habe nur noch meine Mutter, und es ist eher an mir, zu ihrem Unterhalt beizusteuern …«
»Und Ihre Frau?«
»Ihr Vater hat einen hohen Posten in der Postverwaltung, aber um eine so hohe Summe mag ich ihn nicht bitten … Sie verstehen doch …«
Monsieur Philippe blickte ihn nicht an. Tsé-Tsé schnitt sich mit einem Reklamemesser die Fingernägel.
»Ich möchte lieber hier eine Stelle annehmen, solange ich warte … Wenn es in diesem Land Bergwerke gibt …«
»Goldminen gibt es, aber sie sind in englischer Hand …«
»Kümmerst du dich um ihn?«, fragte Tsé-Tsé und sah dabei Eugène Monti an.
»Mal sehen, was sich machen lässt.«
Und die beiden Männer zogen sich in einen Winkel zurück, flüsterten miteinander, während Dupuche auf den Bruder mit der Kriegsverletzung einredete, ihm die heikle Situation darlegte, in der er sich befand, und …
Dupuche nahm zusammen mit seiner Frau das Mittagessen im großen Speisesaal ein. Sie wagten nicht, sich etwas zu trinken zu bestellen, da sie kein Geld hatten.
Tsé-Tsé und seine Frau aßen an einem Ecktisch, sie wirkten wie ein liebes altes Ehepaar.
»Was haben sie gesagt?«, fragte Germaine.
»Um drei Uhr holt mich Monti mit seinem Wagen ab …«
»Wozu?«
»Ich weiß es nicht …«
Genau so war es. Diese Leute redeten wenig, und er hatte Hemmungen, ihnen Fragen zu stellen. Dazu kam noch, dass er nicht so recht wusste, wer sie eigentlich waren und wovon sie lebten.
Germaine setzte ein hochmütiges Gesicht auf, als wollte sie sagen, dass sie sich an seiner Stelle schon besser durchgesetzt hätte.
»Hast du sie denn nicht gefragt?«
Sie war genau wie ihr Vater. Der hatte auch gesagt: »Ich an Ihrer Stelle hätte von Grenier verlangt …«
Aber Dupuche hätte ihn gern einmal gesehen, wenn er seinem eigenen Vorgesetzten gegenüberstand!
»Ich habe sie nichts gefragt, nichts verlangt, nein, das nicht! Es ist schon eine ganze Menge, dass sie sich die Mühe machen!«
Monti kam pünktlich zur Verabredung, und Dupuche stieg zu ihm in den Wagen.
»Wir fahren zu einem Freund, der vielleicht etwas für Sie tun kann …«
Fünf Minuten später betraten sie ein riesiges Warenhaus. Die meisten Verkäuferinnen grüßten Monti, der auf ein Büro im ersten Stock zusteuerte. Hier saß ein junger syrischer Jude, der ihnen die Hand schüttelte und sie aufforderte, Platz zu nehmen.
»Wie geht’s dir?«
»Nicht schlecht … Ich möchte dir einen Ingenieur vorstellen, einen Franzosen, der in der Klemme steckt … Er ist mit seiner Frau hier und völlig abgebrannt …«
Der junge Jude mit dichtem Kraushaar würdigte Dupuche keines Blickes.
»Hast du schon mit John geredet?«
»Noch nicht. Ich dachte, dass du vielleicht …«
»Du weißt ja, wie die Dinge hier stehen … Noch letzte Woche habe ich Leute entlassen …«
»Und seine Frau? Hättest du keine Stelle für sie? In Frankreich war sie beim Telefonamt beschäftigt.«
Es war nichts zu machen, sie mussten John aufsuchen.
»Gehst du Sonntag auf Hochseejagd?«
»Und du? Christian will uns auf seinem Boot zur Schwertfischjagd mitnehmen …«
Dupuche hörte zu, verfolgte jedes Wort, klammerte sich förmlich an seinen Mentor. Sie stiegen wieder in den Wagen, der am Gehsteig geparkt war, und fuhren einige Minuten, hielten vor einer Autowerkstatt.
»Ist John da?«
»Er ist in der Bar gegenüber.«
Eine italienische Bar, wo Parmaschinken, Salami und Nudeln verkauft wurden. Ein hochgewachsener, blonder junger Mann schüttelte Monti und auch Dupuche die Hand.
»Hast du keinen Job für meinen Kumpel? Er ist Ingenieur und eben aus Frankreich eingetroffen.«
John war Amerikaner.
»Nein, das weißt Du doch, alter Junge … Seit einem Monat habe ich keinen einzigen Wagen mehr verkauft …«
»Wäre bei deinen Freunden am Kanal nichts zu machen?«
»Sie dürfen keine Ausländer einstellen …«
Dupuche stützte sich mit den Ellbogen auf das Balkongeländer, zog die Augenbrauen zusammen und murmelte vor sich hin:
»Pat … Pat …«
Dieser Name schwirrte in seinem Kopf herum, und er versuchte sich zu erinnern, wo er ihn gehört hatte.
Sie hatten mit John einen Whisky getrunken.
»Wir fahren bei meinem Bruder vorbei …«, hatte Eugène Monti gesagt.
Und der Wagen war in das Negerviertel eingebogen, hatte an einer Straßenecke vor einem recht düsteren Café gehalten.
Fernand saß mit Christian, dem Sohn von Tsé-Tsé, an einem Tisch und spielte eine Runde Belote mit ihm.
»Was möchtet ihr trinken?«
Christian war fünfundzwanzig, und als Sohn der dritten Frau Colombanis, die an der Kasse saß, würde er wohl das gesamte Vermögen erben.
»Spielen Sie Belote?«
»Nein … Ich hab’s nie gelernt … Nur ein wenig Bridge …«
Die Brüder hatten außer Hörweite miteinander getuschelt, dann hatten sie mit Christian eine Partie gespielt, während Dupuche zusah.
»Wir werden uns anderswo umsehen …«, seufzte Eugène schließlich.
Als sie zum Auto gingen, zeigte er auf eine ganze Zeile mit Holzhäusern und erklärte:
»Sie gehören alle mir … Zur Zeit der Kanalarbeiten brachte jedes Haus jährlich mehrere tausend Franc ein. Heutzutage zahlen die Neger nicht …«
Sie nahmen eine steil ansteigende Straße und hielten vor einem großen Wirtshaus, wo junge Krokodile in einem Springbrunnen schwammen.
Jetzt erinnerte sich Dupuche wieder an Pat. Eugène hatte den Geschäftsführer rufen lassen und seinem Begleiter erklärt:
»Sie werden ihn gleich sehen … Er ist der Mann von Pat Paterson, der berühmten amerikanischen Flugzeugpilotin, die gleich nach Lindbergh über den Atlantik geflogen ist …«
Ein großer, hagerer Mann mit finsterem Gesichtsausdruck.
»Wie geht’s, Paterson?«
»Miserabel. Letzte Woche haben wir dreißigtausend weniger eingenommen als im Vorjahr um die gleiche Zeit.«
»Wüsstest du nichts für meinen Freund, einen Ingenieur, der eben aus Frankreich eingetroffen ist?«
Überall bot man ihnen zu trinken an: Bier, Whisky oder Pernod.
Was hatte Dupuche sonst noch gesehen?
Sie waren durch ein Viertel mit engen Gassen gekommen, in denen vor jeder Tür eine schwarze oder weiße Frau stand.
»Barillo-Rojo, das rote Viertel …«, hatte ihm Monti erklärt, der am Steuer saß. »Sie verstehen doch?«
Als sie ins Hotel zurückkehrten, trafen sie Tsé-Tsé in der Halle an, und Germaine saß mit der alten Dame an einem Tisch und trank Tee.
»Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen«, ließ sich der Korse vernehmen, der mit seinen Gedanken anderswo zu sein schien.
Drei- oder viermal musste er das Gespräch unterbrechen, sei es, dass er ans Telefon gerufen wurde, sei es, dass ihn ein Kunde, der das Hotel betrat oder verließ, in Beschlag nahm.
»Ich habe mich mit Ihrer Frau unterhalten … Eine großartige Person … Ich habe ihr angeboten, Madame Colombani stundenweise an der Kasse zu vertreten, und sie hat eingewilligt …«
Dupuche war wie vor den Kopf geschlagen. Er warf einen Blick auf Germaine, die ihn nicht beachtete.
»Sie bekommt hier freies Essen, ein Zimmer und dreißig Dollar pro Monat.«
Dupuche hatte den Eindruck, dass der Alte Eugène Monti zuzwinkerte.
»Ich möchte kein Ehepaar in meinem Personal … Aus Erfahrung weiß ich, dass dabei nichts Gutes herauskommt. Sie müssen halt sehen, dass Sie anderweitig unterkommen, und irgendeine Arbeit werden Sie schon noch finden.«
Und wiederum entfernten sich Eugène und der Hotelbesitzer, um zu beratschlagen. Als Eugène wieder zu ihm trat, verkündete er ihm:
»Ich stelle Ihnen kostenlos ein Zimmer in einem meiner Häuser zur Verfügung. Wir bringen ein Bett und einen Tisch hin … Wir werden schließlich auch noch eine Arbeit für Sie auftreiben …«
Germaine hatte nicht eine Träne vergossen. Als sie sich schlafen legte, hatte sie nur gesagt:
»Du hast schon wieder getrunken …«
»Ich kann dir versichern …«
»Oh! Du bist nicht total betrunken wie gestern, aber getrunken hast du doch … Was wird das erst geben, wenn ich nicht bei dir bin?«
»Germaine, ich schwöre dir …«
Aber er war zu müde, um ein langes Streitgespräch durchzustehen, ihm war übel vor Erschöpfung. Am nächsten Morgen hatte er im Halbschlaf gehört, wie sie sich ankleidete.
Wäre es nicht an ihr gewesen, ihm etwas Nettes zu sagen? Aber nein! Sie hatte sich eine Stelle verschafft! Sie hatte die Lage gerettet, im übrigen aber nur, weil die Alte Gefallen an ihr gefunden hatte.
»Du hast schon wieder getrunken!«
Nichts hatte sie begriffen. Erwartete sie etwa, dass er sich bei ihr bedankte?
Als er sich im leeren Zimmer rasierte, wo das rosa Nachthemd, das sie in ihrer Hochzeitsnacht getragen hatte, am Kleiderständer hing, schnitt er sich. Und er erinnerte sich, dass ihr Gesicht während dieser Hochzeitsnacht verschlossen, beinahe verächtlich zugeknöpft gewesen war, als hätte ihr die Angst im Nacken gesessen, sich vor ihm zu demütigen.
Konnte er ihr die Erlaubnis verweigern, die Stelle anzunehmen, die man ihr anbot, das bequeme Zimmer, die Mahlzeiten, und … Er ging erst sehr spät nach unten. Germaine saß an der Kasse neben Madame Colombani. Letztere sagte ihm:
»Eugène holt Sie gleich mit Ihren Sachen ab …«
Sicherlich waren ihm zahlreiche Einzelheiten entfallen, andere vermochte er nicht richtig einzuordnen. So hatte er zum Beispiel mit einem kahlgeschorenen Mann Tricktrack gespielt. Wo war das nur gewesen? Und wann?
Warum redete Monsieur Philippe nicht mehr mit ihm? Dupuche war ihm mehrmals in der Hotelhalle begegnet, wo er untätig herumstand. Er hatte ihm die Hand gegeben. Mit besorgter Miene hatte sich der andere sofort abgewandt.
Alles zerrann ihm unter den Händen. Nur ganz wenige Dinge standen unverrückbar fest, wie das weitläufige Hotel, das mit seinem Innenhof und den Galerien in jedem Stockwerk, mit dem Café rechter Hand, dem Speisesaal im rückwärtigen Teil und dem Ecktisch der Colombani einen mächtigen Block auf dem Platz bildete …
Nicht einmal in der Stadt kannte er sich aus, die er nur im Auto von Eugène Monti durchquert hatte.
Er hatte zu viele Menschen gesehen; alle hatten sich seiner angenommen, aber auf eine sonderbare Art. Für sie ging das Leben weiter. Man schleppte ihn zu Hinz und Kunz. Man traf dabei seine Bekannten. Über alles wurde geredet, über das Pferderennen am nächsten Sonntag, über ein baufälliges Kino, über die Frau eines Engländers, die Selbstmord begangen hatte. Schließlich flocht man nebenher die Frage ein:
»Übrigens, habt ihr nicht irgendetwas für unseren Freund Dupuche, einen ›französischen Ingenieur, der‹ …«
»Hast du schon Chavez Franco aufgesucht?«
»Nein, noch nicht …«
Eugène Monti wirkte nicht so, als würde er arbeiten. Dupuche wusste, dass er mit einer jungen Panamaerin verheiratet war, und einmal hatte er einen kurzen Blick auf ihre Wohnung im dritten Stock eines modernen Hochhauses werfen können.
Die Brüder Monti sprachen ein fehlerhaftes Französisch, hie und da entschlüpfte ihnen ein Ausdruck aus der Gaunersprache. Sobald sie aber das Wort an ihn richteten, schwang in ihrer Rede ein respektvoller Unterton mit.
»Ihre Gattin ist eine bemerkenswerte Frau … Tsé-Tsé ist von ihr sehr angetan, was selten vorkommt … Er hat nie jemanden anderen als seine Frau an die Kasse lassen wollen …«
Und was war mit ihm? Was tat man für ihn? Man hatte ihn einfach in ein Auto gepackt, auf dessen Dach man mit Stricken ein Bett, einen Tisch mit den Beinen nach oben, eine Waschschüssel und einen Eimer befestigt hatte.
Man hatte ihn durch den Laden des Schneiders Bonaventure geführt, und jetzt überließ man ihn in dem rosarot tapezierten Zimmer seinem Schicksal. Die alte Negerin, seine Nachbarin, war in ihr Zimmer getreten, um das Essen zuzubereiten. Nun hatten zwei Neger ihren Platz auf der Veranda eingenommen und sahen, das Kinn auf den gekreuzten Händen ruhend, den Kindern zu, die auf der Straße spielten.
In Amiens hätte Dupuche mit Leuten wie den Montis, ja nicht einmal mit Tsé-Tsé verkehrt.
»Du sollst nicht auf der Straße spielen …«, hatte er als kleiner Junge von seiner Mutter zu hören bekommen.
»Er hat die Tochter eines Kneipenwirts geheiratet«, hatte sein Vater abschätzig bemerkt, als sein Nachbar sich mit Marthe verehelichte, die tatsächlich aus dem Café an der Ecke stammte.
Wenn er zur Schule ging, musste er Handschuhe tragen, und seine Mutter wäre nie ohne Hut und Schleier, den man damals noch trug, auf den Markt gegangen, der nur hundert Meter von ihrem Haus entfernt war.
In seiner Welt war auch das Trinken verpönt. Zwar stand eine Karaffe Schnaps im Schrank, aber man brachte sie nur zwei- oder dreimal im Jahr auf den Tisch, wenn Onkel Guillaume aus Paris zu Besuch kam, der in der Nähe des Friedhofs Père-Lachaise ein Schirmgeschäft hatte.
Wovon mochten die Montis wohl in Frankreich gelebt haben? Was Tsé-Tsé betraf, so hatte er von sich selbst gesagt, dass er seine Laufbahn in Amerika als Kellner im Washington Hotel begonnen hatte.
Es wurde Abend, und der Purpurschein auf den gegenüberliegenden Häusern verblasste. Eigentlich gab es hier gar keine richtigen Zimmer, denn man hielt sich vor allem auf der Veranda auf, die man durch einen großen türlosen Durchgang betrat.
Man sah alles: einen alten Neger, der seinen verletzten Fuß verband, eine Frau, die ihre Wäsche in einem Eimer wusch, nackte Kinder, die am Boden herumkrabbelten …
Der Bahnhof musste sich zur Linken befinden, denn man hörte das Pfeifen der Züge, von der anderen Seite drang das Geratter der Straßenbahnen zu ihm.
Dupuche hatte schon immer große, überaus empfindliche Augen gehabt, die sich beim geringsten Luftzug röteten. Auch war er schon immer beim geringsten Anlass in Tränen ausgebrochen, und genau jetzt war ihm danach, während er auf die ungepflasterte Straße blickte, wo er der einzige Weiße war. ›Morgen trinke ich nicht mehr‹, sagte er sich. ›Ich werde mich anständig anziehen. Ich werde den französischen Gesandten aufsuchen und seinen Rat einholen.‹
Sobald die Montis, Tsé-Tsé und die anderen nicht in seiner Nähe waren, fühlte er sich verloren, und doch, kaum waren sie aus seinem Gesichtsfeld verschwunden, empfand er nur noch Verachtung für sie.
›Der Gesandte wird mich verstehen … Er wird mich mit Leuten aus unseren Kreisen bekannt machen …‹
Ein Negermädchen, das noch keine fünfzehn Jahre zählte, hatte sich unter die Veranda gesetzt. Sie war nackt unter ihrem grünen Kleid, hatte magere Beine, biegsame Lenden, und sie blätterte in einer Zeitschrift.
Ein seltsamer Geruch durchtränkte die Luft. Der Schneider saß in seinem Schaukelstuhl, den er auf den Gehsteig getragen hatte, und alle Vorübergehenden grüßten ihn.
»Sie haben mir da oben ein kleines Zimmer gegeben«, hatte Germaine ihm gesagt. »Es ist sehr sauber! Madame Colombani ist reizend zu mir …«
Er hatte es nicht gewagt, sie darum zu bitten, ihrem Vater ein Telegramm zu schicken, obwohl dieser Ersparnisse von mindestens zehntausend Franc besaß, die für die Überfahrt ausgereicht hätten.
Aber sein Schwiegervater mochte ihn nicht. Er hätte es lieber gesehen, wenn seine Tochter einen Beamten geheiratet hätte.
»Die haben wenigstens eine Pension …«, pflegte er oft zu sagen.
Ein junger Ingenieur aber hatte in Frankreich keine Aussichten, eine Anstellung zu finden, das hatte Dupuche am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Später hatte er sich in die Brust geworfen:
»Fünf Jahre werden wir in Ecuador verbringen. Da wir jährlich vierzigtausend Franc auf die hohe Kante legen, werden wir bei unserer Rückkehr über Kapital verfügen und …«
Er trat wieder in sein Zimmer, erbrach sich in den Eimer. Er vertrug das gewürzte Essen nicht. Seine Augenlider brannten mehr denn je. Sein Blick fiel auf das Bett, für das es keine Laken, nur eine Baumwolldecke gab.
Er war wütend auf Germaine, ohne genau sagen zu können, weswegen er ihr böse war. Oder doch! Er wusste es ganz genau! Bis zu ihrer Heirat, vor allem während ihrer Verlobungszeit, als er noch in Paris studierte, hatte sie ihn als den Stärkeren, den Intelligenteren angesehen …
Doch schon an Bord des Schiffes hatte sie angefangen, an ihm herumzunörgeln.
»Tu das nicht … Grüß den Kapitän … Du solltest nicht …«
Oder aber sie rechnete aus, wie viel Geld sie beim Wechseln bekommen sollten, ließ ihn wissen:
»Du vertust dich sonst wieder …«
Nun aber, da sie ihn einmal betrunken gesehen hatte, fühlte sie sich ihm noch überlegener.
»Komm ja nicht her, wenn du getrunken hast …«
Na und? Sei’s drum! Er brauchte jetzt einfach etwas zu trinken! Er hatte noch ein paar Münzen in der Tasche, so ging er hinunter, durchschritt den Schneiderladen, orientierte sich am Lärm der Straßenbahnen und erreichte die Hauptstraße des Negerviertels, das allgemein California genannt wurde.
Der Weg zu Fernand Montis Café war viel kürzer, als er gedacht hatte, denn er war noch nicht lange gegangen, als er schon davor stand. Die Lampen waren bereits angezündet, und die beiden Montis spielten mit ein paar Negern Karten.
Er überquerte die Straße, blickte in eine andere Richtung, bog in die Hauptstraße ein, und nun befand er sich in einem Menschenstrom, der ebenso dicht war wie im Faubourg Saint-Martin zum Beispiel, mit dem einzigen Unterschied, dass man hier nur Schwarze und Mulatten sah.
›Dem Gesandten werde ich sagen …‹
Tsé-Tsé saß im Aufsichtsrat mehrerer Goldminen, kleinerer Minen, die nur in Betrieb waren, wenn der Goldkurs hoch stand, denn sie waren nicht besonders ertragreich. Aber diese Leute hatten nie seinen Fähigkeiten als Ingenieur Rechnung getragen. Man hatte ihn in ein Warenhaus, eine Autowerkstatt, ein Wirtshaus gebracht …
Ohne lange zu überlegen, betrat er ein Kino, wo das andauernde Läuten ihn an die ersten französischen Lichtspielhäuser erinnerte. Der Saal war voll mit farbigen Menschen, die Hitze war unerträglich, der Geruch widerwärtig, und der Film, der gezeigt wurde, war ein zerschlissener Streifen in spanischer Sprache.
»Am ersten Tag kommst du besser nicht her …«, hatte Germaine ihm geraten. »Sonst meinen die Colombanis, dass du dauernd bei ihnen herumsitzt …«
Weiß Gott, sie war praktisch, seine Germaine! Sie war schließlich auch bequem in einem anständigen, ja luxuriösen Hotel untergebracht.
Schon allein das nahm er ihr übel. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn sie sich nicht so schnell zurechtfinden, sich nicht so gut mit der alten Madame Colombani verstehen würde.
Dupuche verließ das Kino, überlegte, ob er etwas trinken gehen sollte. Aber wo? Er sah, dass sich in den Bars lauter Neger drängten, und allein wagte er sich nicht hinein.
Unwillkürlich musste er an seine Regimentszeit denken, als er noch ein kleiner Rekrut gewesen war. Man hatte ihn wohl irrtümlicherweise der Kavallerie zugeteilt, denn er war noch nie mit Pferden in Berührung gekommen. Er war todunglücklich in seinen Holzschuhen und fürchtete sich davor, die Tiere zur Tränke zu führen, sich ihnen zu nähern, um sie zu striegeln. So kam es, dass er sich mit seinem Bettnachbarn anfreundete, einem Bauernknecht, der zwar fehlerhaftes Französisch sprach, ihm aber mit praktischen Ratschlägen zur Seite stand.
Immerhin wurde er zwei Monate darauf ins Schreibbüro der Kompanie versetzt, erhielt eine Phantasieuniform und musste keine schmutzige Arbeit mehr tun. Er wurde sogar damit betraut, die Urlaubsscheine zu verteilen.
Er würde den Gesandten aufsuchen … Das war das einzig Richtige. Er würde ihm erklären …
Aber im Augenblick fand er nicht einmal den Heimweg, und auf den Gehsteigen der dunklen Straßen drängten sich ganze Negerfamilien, sodass er sich scheute hindurchzugehen.
Tsé-Tsé verachtete ihn, sonst hätte er ihm doch in seinem Hotel mit den vierundachtzig Zimmern eines abtreten können. Dupuche hätte ihn später dafür entschädigt.
Aber nein! Sie alle behandelten ihn von oben herab. Man schleppte ihn durch die Stadt, machte ihn mit Hinz und Kunz bekannt.
»Haben Sie keine Verwendung für ihn? … ›Ein französischer Ingenieur, der‹ …«
Mit einem Mal erblickte Dupuche, nur wenige Schritte entfernt, den Schneidermeister in seinem Schaukelstuhl. Er betrat das Haus, ging durch den Laden, tastete nach einem Schalter. Hier gab es nicht einmal elektrisches Licht, und Monti hatte ihm keine Lampe dagelassen!
Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als sich wie ein Tier auf sein Lager zu werfen. Er fand allerdings keinen Schlaf, denn die Schwarzen saßen bis zu vorgerückter Stunde auf dem Balkon, ließen sich von der kühlen Nachtluft umfächeln und erzählten sich in einer unverständlichen Sprache Geschichten.
›Morgen suche ich den Gesandten auf und sage ihm …‹
Er war nicht betrunken. Er fühlte sich nur wie benommen. Sein ganzer Leib schmerzte ihn, vor allem sein Kopf.
Wenn ihn nur jemand kneifen würde, sodass er in einem richtigen Zimmer, in einem richtigen Bett erwachen würde, oder gar in einer Kajüte erster Klasse, wo Germaine im Nachthemd neben ihm läge:
›Wo sind wir?‹, würde er fragen.
›Du hast im Traum gesprochen …‹
›Ach! Ja, allerdings …‹
Aber so war es nicht.
Er träumte nicht, er befand sich in California, also im Negerviertel, er auf einem alten Eisenbett, das Eugène Monti, der größere der beiden Brüder, weiß Gott wo aufgetrieben hatte. Von Zeit zu Zeit huschte ein Schatten über die gemeinsame Veranda, streckte den Kopf ins Zimmer, um den Weißen schlafen zu sehen.
Ständig vernahm er leise Schritte auf dem Fußboden, Geflüster, unterdrücktes Kichern …
Schließlich aber hörte er nur noch das Getrappel eines Pferdes, das einen Wagen durch eine der anliegenden Straßen zog.
Dann das Zirpen der letzten Grillen, die mit der einbrechenden trockenen Jahreszeit aus der Stadt verschwinden würden.
Um neun Uhr morgens stand Dupuche, der nicht einmal am Hotel vorbeigegangen war, bereits vor der französischen Gesandtschaft, klingelte, reichte dem Portier, einem Mestizen, seine Visitenkarte und wurde in den Salon geführt, in dem sich französische Publikationen stapelten.
Obwohl er am Vorabend nicht getrunken hatte, fühlte er sich verkatert.
»Seine Exzellenz wird Sie in wenigen Minuten empfangen … Wenn Sie inzwischen Platz nehmen wollen …«
Er setzte sich nicht. Er wollte so schnell wie möglich mit dem Gesandten reden.