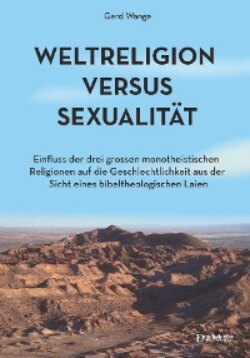Читать книгу Weltreligion versus Sexualität - Gerd Wange - Страница 8
PROLOG
ОглавлениеDies ist kein Buch gegen Priester, Päpste, Imane oder Rabbiner. Nicht gegen Religionen, sondern vielmehr gegen den Missbrauch der Macht und gegen die Umbarmherzigkeit zahlreicher religiöser Institutionen. Dabei beabsichtigt der Autor nicht, einen ganzen Stand zu diskreditieren. Im Gegenteil: Er teilt eine Grundhaltung des kritischen Respekts vor dem, was christliche, islamische und jüdische Einrichtungen sind und tun. Schließlich ist Religion die Grundlage unserer Kultur. Der Verfasser ist weder ordinierter Theologe, noch Laienprediger, versteht sich auch nicht als sachkundiger Kirchenexperte, verweigert nicht aus persönlichen Gründen den Glauben und ist auch kein „Kirchengeschädigter“. Er ist auch kein religionsfeindlicher Atheist oder Agnostiker, sondern vielmehr eine glaubensstarke Person sowie ein extrem kritischer Christ, wobei es unerheblich ist, ob es sich bei ihm um einen katholischen oder evangelischen Christen handelt. Er unterstellt einem Gottesdiener, dass er mehr über Gott weiß, schließlich hat er als Theologe seine Religion zum Beruf gemacht; er hat die Bibel nicht nur gelesen, sondern studiert. Der Verfasser versucht den Ursachen eines in dieser Größe noch nie da gewesenen Glaubensverlustes einiger Religionsgemeinschaften nachzugehen, wobei es bei den kritischen Betrachtungen dieses Werkes über Religion und Sexualität keine Rolle spielt, ob man sich in der Gefolgschaft des Papstes, Luthers, Mohammeds oder der Tora sieht. Die Kritik gilt den Lehren der christlichen Kirchen, Moscheen und Synagogen, will aber unter keinen Umständen eine betroffenheitsgetränkte Anklageschrift sein. Der Autor hat großen Respekt vor Glauben und Wertschätzung vor den Menschen, die an etwas glauben. Religiöser Glaube verlangt nach Akzeptanz. Respekt muss aber keineswegs Verzicht auf Kritik bedeuten. Glaube prägt eine Gesellschaft, bestimmt das Denken und das Handeln unzähliger Menschen. Denn Religion gründet sich nicht auf Wissen, sondern auf Glauben. „Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind“, lässt Goethe seinen Faust formulieren. Die einen sind wundersüchtig und die anderen wunderflüchtig. Vermutlich hält Glaube viele am Leben, hilft ihnen, sich in diesem schwierigen Leben zurechtzufinden, und sollte von den Nichtgläubigen mit Anteilnahme betrachtet werden. Der Glaube und die Bindung an eine Religion sollen für Halt, für Liebe, für Menschlichkeit, Wärme und Annahme stehen. Die Religion spendet zahlreichen Menschen Trost und Geborgenheit und fördert oftmals das Gemeinschaftsgefühl. Deshalb geht es hier keineswegs um eine Verunglimpfung geistlicher Würdenträger, sondern vielmehr darum, die Scheinheiligkeit und Doppelmoral einiger Religionen und ihren sakrosankten Stellvertretern auf Erden zu entlarven. Denn beim Thema Sexualität könnte die Kluft zwischen religiösen Lehren und dem echten Leben kaum tiefer sein. Sexualität spielt in allen Religionen eine markante Rolle.
Die Quellen der drei großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam, die ihren gemeinsamen Ursprung bei dem Patriarchen Abraham sehen, beinhalten in Bezug auf Sexualität ein Potenzial, das im Laufe der Geschichte immer wieder von ihren Anhängern instrumentalisiert wurde. In den gesellschaftlichen Diskussionen wird nicht selten eine direkte Beziehung zwischen Religion und Sexualität erörtert, die darauf zielt, die Religion schlechthin als Ursache der Probleme, die das Thema Sexualität hervorruft, anzuprangern. Religiöse wie sexuelle Erfahrungen werden oft mit denselben Begriffen beschrieben, mit Leidenschaft, Verzückung, Ekstase oder Seligkeit. Ob Sexualität als schöpferische Kraft, als geheimnisvolles Mittel der Fortpflanzung oder gar als dämonische Energie verstanden wird, hängt von anderen Dingen ab. Im Altertum glaubten viele Völker, dass Himmel und Erde durch einen Sexualakt geschaffen wurde. Auch die Sexualität der Frau und ihre sexuelle Lust wurde positiv gewertet. Man sagte, die Mitte der Frau ist die Klitoris. Das Wort Klitoris kommt vom griechischen Wort kleitos oder kleinos und heißt „berühmt, gepriesen“, was große Hochachtung ausdrückt, obwohl und vielleicht gerade deswegen die Klitoris nicht unmittelbar nur der Fortpflanzung dient, sondern auch dem Lustempfinden. Auch der männliche Geschlechtsteil galt vor allem im erregten Zustand als Garant von Kraft, Energie und Fruchtbarkeit. Der erigierte Penis – oft im Verhältnis zum Körper übertrieben vergrößert dargestellt – zierte Götterstatuen und Götterbilder.
Unsere Welt wird zunehmend säkularer. Für die meisten von uns ist der Gegensatz von Religion und säkularer Kultur heute selbstverständlich. Deutschland gewährt eine vorbehaltlose Religionsausübung. Artikel 4 unseres Grundgesetzes formuliert das mit prägnanter Klarheit: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet“.
In Deutschland herrscht keine Staatsreligion, wie dies beispielsweise der Islam in zahlreichen Ländern der arabischen Welt ist. Deutschland ist ein säkulares Land, trotz der vertraglichen Verbindungen zwischen Staat und den großen Kirchen. Die ungestörte Religionsausübung wird uneingeschränkt gewährleistet. Dennoch ist die christliche Botschaft eine geistige Grundlage unserer Gesellschaft. Indessen geraten immer mehr tiefgläubige Menschen in einschneidende Glaubenskrisen. Bei den Christen hadern immer mehr Gläubige mit den Moralvorstellungen des Vatikans. Schließlich leben wir in einer Zeit der sexuellen Freiheit und Selbstbestimmung. Unsere modernen Vorstellungen von Sexualität sind das Ergebnis eines tiefgreifenden historischen Wandels.
Noch halten sich die meisten jungen Gläubigen der großen Weltreligionen an die sexuellen Gebote ihrer Kultur und akzeptieren die Einschränkungen ihrer Freiheit. Mal mehr, mal weniger. Ein Balanceakt zwischen Moral und Lust. Doch müpfen immer mehr Jugendliche auf gegen eine oktroyierte altjüngferliche Sexualmoral, überlebtem Traditionalismus und eisernen, dogmatischen und starrsinnigen Regeln, die längst ihren Sinn verloren haben. Denn mit der Forderung, sich aus den Schlafzimmern ihrer Gläubigen herauszuhalten, haben zahlreiche Religionen immer noch ein Problem. Und nicht wenige sehen in der menschlichen Sexualität immer noch etwas Verwerfliches, Schmutziges, gar Teufelszeug. Es ist an der Zeit, dass sich die großen Religionen von ihrem metaphysischen Ballast befreien. Denn wenn Religionen zum Gesetz erstarren, bedrohen sie die Freiheit und die Liebe der Menschen. In vielen Fällen ist Religion der natürliche Feind des Denkens.
Aufs Ganze gesehen sind einige monotheistischen Religionen ein Hort des Patriarchats geblieben. Michel Houellebecq führt in seinem Roman „Unterwerfung“ drastisch vor Augen, wie Religion unter katholischem und vor allem islamischem Vorzeichen, zur Rückkehr des Patriarchats führen könnte. Der Mensch ist Gott unterworfen und die Frau dem Mann. Unterwerfung als entlastende Alternative zum Freiheitsprojekt der Aufklärung und des Humanismus folgt dem Diktat der Biologie: Wer die meisten Kinder zeugt, setzt auch seine Werte durch. Die Reproduktion der Werte folgt der biologischen Reproduktion. Weil das Patriarchat mehr Kinder hervorbringt, steht für Houellebecq der Feminismus demografisch auf der Verliererseite. Der massive Zustrom von Einwanderern mit traditionellem kulturellem Hintergrund bietet „die historische Chance für die moralische und familiäre Wiederaufrüstung Europas“. Diese verabscheut natürlich die Homo-Ehe. Wenn gegen diese in Frankreich schon die katholische Kirche Millionen zu mobilisieren vermochte, um wie viel mehr mobilisieren dann die islamischen Oberen?
Tief unten in den Kellern der Kirchengeschichte, verborgen selbst für die meisten Historiker, liegen jahrhundertealte Traditionen begraben, von denen die christlichen Kirchen heute nichts mehr wissen wollen. Hubert Wolf steigt in seinem Buch „Krypta“ mit archäologischem Spürsinn hinab in diesen konspirativen und geheimnisvollen Ort und enthüllt Vergessenes und Verdrängtes. Er entdeckt dort Frauen mit bischöflicher Vollmacht, Laien, die Sünden vergeben, eine Kirche der Armen – und andere Traditionen, die heute wieder aktuell werden könnten. Doch da die katholische Kirche auf lange und unabänderliche Tradition setzt, gelten grundlegende Reformen ihrer heute gültigen Einrichtungen und Regeln als Sakrileg. Päpste waren einmal in Gremien eingebunden, die sie kontrollierten, Frauen konnten Sünden vergeben, Laien hatten etwas zu sagen, Bischöfe wurden gewählt. Die katholische Kirche war lange ein breiter Strom mit vielen Nebenarmen, den der römische Zentralismus im 19. Jahrhundert kanalisierte. Dazu wurden Traditionen erfunden, an die bis heute selbst Historiker glauben.
Nach der traditionellen Sexualmoral ist in keiner der hier zur Sprache kommenden drei großen Weltreligionen Sex vor oder außerhalb der Ehe erlaubt. Außer für junge Protestanten, die müssen allerdings lernen, verantwortungsbewusst mit ihrer Freiheit umzugehen. Auch wenn die Bibel nicht explizit schreibt, dass Sex vor der Ehe verboten ist, geht sie doch auf Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ein und bezeichnet ihn als Unzucht. Trotz kultureller Unterschiede zwischen Europa und Asien oder der Türkei und Israel – in den Grundpfeilern ihres Sexualverständnisses unterscheiden sich alle diese Religionen erstaunlich wenig. Die Ehe ist im Judentum ebenso heilig wie im Christentum, Homosexualität verpönt der Islam genauso wie die katholische Kirsche. Und in den meisten Religionen soll die Sexualität ausschließlich der Fortpflanzung dienen und nicht der Lust. Katholische Priester, Mönche und Nonnen sollen ehelos leben; zölibatär. Sex und eine eigene Familie sind für sie tabu. Für diese Regel gibt es im Judentum und Islam keine Entsprechung. Evangelische Geistliche dürfen heiraten und eine Familie gründen.
Im ersten Jahr seiner Administration verschickte Papst Franziskus weltweit einen umfangreichen Fragenkatalog. Geistliche, aber auch Laien sollten sagen, was sie über kirchliche Familien- und Sexualethik wissen und wie sie dazu stehen. Der Fragebogen berührte einige der umstrittensten Standpunkte der katholischen Kirche, neben dem Verhütungsverbot auch das Verbot homosexueller Handlungen sowie den Ausschluss wiederverheirateter Geschiedener von den Sakramenten. Eine große Mehrheit der deutschen Katholiken lehnte fast sämtliche Verbote als unverständlich ab und bestätigte, dass sie in der Praxis wenig Beachtung fänden. Offensichtlich will man sich nicht mehr von der Institution Kirche sein Privatleben vorschreiben lassen. Allgemein wird die kirchliche Lehre als Verbotsmoral wahrgenommen, und als lebensfern. Dass die Kirche vielfach von „irregulären” Verhaltensweisen spricht, wirke auf die Menschen ausgrenzend und diskriminierend. Das Papier markiert einen Einschnitt im Verhältnis zwischen dem Vatikan und den Katholiken. Es belegt nicht nur, dass die Gläubigen zentrale Punkte der katholischen Lehre ablehnen, sondern überraschenderweise auch, dass einige deutsche Bischöfe diese Ablehnung verstehen und manche katholischen Aussagen offenbar selbst skeptisch sehen. Nun sieht die Deutsche Bischofskonferenz bei der kirchlichen Sexualethik Änderungsbedarf und setzt damit Papst Franziskus und seine vergreisten Kardinäle unter Reformdruck.
Die Zukunft der Christen in Europa wird davon abhängen, den Atheismus unserer Zeit nicht als ein unabwendbares Schicksal hinzunehmen. Diese zu ermutigen, ihren Glauben nicht wegzuwerfen und dem Leben seinen religiösen Sinn zurückzugeben, ist das Anliegen dieses Buches. Es ist denkbar, dass einige sehr religiös orientierte Leser sich womöglich ob mancher Äußerung brüskiert fühlen. Des Autors größtenteils negative Einstellung und seiner manchmal aggressiven Forderung nach Offenheit und Dialogfähigkeit und seinen oftmals ketzerischen Gedanken kann bei einigen Lesern Schmoll verursachen. Aber deshalb muss man ja nicht aufhören an Gott zu glauben, schließlich kann jeder Leser seine eigene Schlussfolgerung ziehen.