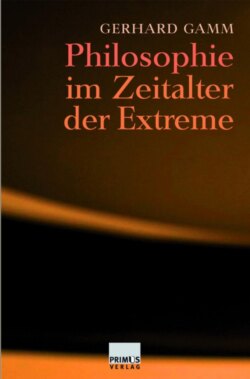Читать книгу Philosophie im Zeitalter der Extreme - Gerhard Gamm - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Krise des Humanismus
ОглавлениеVon J.-P. Sartre bis M. Foucault
Zuletzt handelt es sich gar nicht um
den Menschen: er soll überwunden werden.
F. Nietzsche
Die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben den Philosophen eine bislang gern beanspruchte Referenz fragwürdig gemacht: den Humanismus. In diesem Kapitel geht es um die wechselvolle Geschichte dieses Begriffs und darum, welche Rolle die Kritik am Humanismus in den neueren Diskussionen gespielt hat. Beteiligte Agenten sind Sartre, Heidegger, Lévi-Strauss und Foucault.
Ausgangspunkt ist ein kleiner Text von Jean-Paul Sartre (1905–1980), den er 1945 als Vortrag in Paris gehalten hat. Er dreht sich zunächst um die Frage des Humanismus und behandelt dann die Kritik, die dieser Begriff durch Heidegger und andere erfahren hat. Der Titel lautet: „Ist der Existenzialismus ein Humanismus?“19 Gegenstand dieses Vortrags waren Missverständnisse, die sich im Laufe der Zeit gegenüber dem Existenzialismus herausgebildet hatten. Diese Missverständnisse will Sartre aus dem Weg räumen, vor allem jenes, das sich, wie er glaubt, im Anschluss an sein erstes großes philosophisches Hauptwerk Das Sein und das Nichts (1943) entwickelt hat. Sartres Philosophie wird mit dem Vorwurf konfrontiert, der Existenzialismus sei ein Denken der Leere und des Nichts, ein Denken der Verzweiflung und der Untätigkeit. Mit dieser Kritik setzt er sich in dem Aufsatz auseinander. Damals, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, und vor allem in der Zeit danach war der Existenzialismus in Mode gekommen. Die junge Bundesrepublik rezipierte ihn in den 50er-Jahren.
Sartre unterscheidet, um dem genannten Einwand zu begegnen, zwei Formen oder Schulen des Existenzialismus: den christlichen und den atheistischen. Dem atheistischen Existenzialismus rechnet er seine eigene Lehre zu. Für diesen stellt er einen Hauptsatz auf, der lautet, dass beim Menschen die Existenz der Essenz vorausgehe. Mit „Existenz“ ist, wie bei Kierkegaard und Heidegger angesprochen, etwas anderes gemeint als eine abstrakte Definition über das Wesen des Menschen. Das Existieren oder der Vollzug seines Lebens, so Sartre, geht „dem Menschen“, d. h. seinem Wesen oder seiner Definition, voran, was meint: Der Mensch sei nicht durch seine, wie auch immer beschaffene „menschliche Natur“ vorherbestimmt. Seit der Antike hat man geglaubt, die menschliche Natur auf ein bestimmtes Wesen festlegen zu können, beispielsweise darauf, ein animal rationale (ein vernünftiges Lebewesen) oder ein zoon politikon (ein Gemeinschaftswesen) zu sein. Das sind Bestimmungen der menschlichen Natur, die den Menschen in seiner Existenz determinieren. Sartre dreht den Spieß – den platonischen Idealismus – um und sagt: Um etwas vom Menschen zu verstehen, muss man sein Existieren betrachten und zwar, mit Heidegger gesprochen, sein ganz konkretes In-der-Welt-Sein, sein jeweiliges In-bestimmten-Situationen-Sein. Der Mensch erschließt sich situativ, über das, was er in den besonderen Augenblicken seines Lebens tut, was er denkt, wovon er überzeugt ist, was er empfindet. Man darf nicht damit anfangen, abstrakte Definitionen über ihn zu verbreiten, sondern umgekehrt: Sein Existieren zu betrachten, ist der Königsweg, um den Menschen zu verstehen.
Hinzu kommt ein zweiter Hauptsatz: Der Mensch ist das, was er aus sich selbst macht. Wenn Sartre sagt, die Existenz gehe der Essenz oder dem Wesen voran, dann ist der letzte Satz direkt daran anzuschließen. Wie existiert er denn? Nämlich so, dass er das, was er ist, aus sich selbst heraus schaffen muss.
Auch Kant verweist in seiner Anthropologie hinsichtlich der Frage, was der Mensch sei, nicht auf das, was die vermeintliche Natur aus ihm macht, sondern auf das, was er, als frei handelndes Wesen, selbst aus sich machen kann. An diesem Punkt setzt Sartre ein: Vom Existieren lässt sich eigentlich nur sprechen im Blick darauf, dass der Mensch über seine Handlungen zum Urheber seiner selbst wird. Sich aus sich selbst heraus zu erschaffen, bedeutet aber, dass er in einem radikalen Sinne für sich selbst verantwortlich wird. Man versteht, warum manchmal gesagt wird, dass in Sartres Humanismus „der Mensch“ in die Stelle Gottes einrücke.
Das ist die entscheidende Pointe: Der Mensch steht vor der Aufgabe, aus sich selbst und aus sich heraus das Beste zu machen, er muss sich, wie Sartre sagt, selbst entwerfen. Vom Menschen als einem geworfenen Entwurf war bei Heidegger die Rede. Wenn er nicht nur in dem, was er über sich denkt (theoretisch), sondern auch im Blick darauf, wie er handelt (praktisch) sein eigener Entwurf ist, dann ist er auch für diesen Entwurf – seinen Selbstentwurf – verantwortlich. Die Stärke des Sartre’schen Entwurfs liegt dementsprechend in der Praxis, er besteht in einer Wiederaneignung der göttlichen Attribute, vor allem der allerkostbarsten: der schöpferischen, der Macht zu erschaffen, oder, wie Sartre sagt, „zu machen, daß eine Welt existiert“.
Aufgrund dieser ursprünglichen Wahl ist der Mensch nicht nur für sich, sondern auch für alle anderen verantwortlich. Dies sei die Grundsituation des Menschen: die Verantwortlichkeit für sich und für die anderen zu haben, eine Situation, die im selben Atemzug Angst auslöst. Die Existenz des Menschen ist so eingebettet in ein existenzielles Gefühl. Der Mensch ist ein sich ängstigendes oder geängstigtes Wesen. Die Angst ist da mit der Einsicht in diese Aufgabe, dass er für sich und für andere verantwortlich ist. Der Mensch weiß in gewisser Weise – unter dieser Bedingung der Verantwortung –, dass er sich und anderen in dem, was er tut, Gesetzgeber ist. Die Angst führt aber nicht, wie Sartres Kritiker geglaubt haben, zur Untätigkeit oder zum Rückzug, sondern zu einer vollen Verantwortung gerade für den, der – und dies in der Wendung gegen den christlichen Existenzialismus – die Existenz Gottes verneint. Gerade wenn es zu einer Verneinung der Existenz Gottes kommt, ist der Mensch auf eine totale Weise verantwortlich. Es gibt dann keine anderen Instanzen, mit Blick auf die er sich von seiner Verantwortung entlasten könnte.
Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein
Der nächste Hauptsatz in der Verteidigung des Existenzialismus Sartre’scher Prägung ist dann der: Es gibt auch keine allgemeingültige Moral mehr. Sartre lehnt eine allgemeine Gesetzesmoral, eine Sollensmoral, die für alle gilt, ab. Es gibt keine „höchsten Werte“, auf die man rekurrieren könnte. Was daraus folgt, ist ein weiterer zentraler Satz des Existenzialismus, der in seiner bekannten Formulierung lautet: „Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein.“ Er hat keine Chance, anders zu agieren, als unter dieser Bestimmung: frei zu sein. Das gilt für jeden Einzelnen, nicht nur für den Menschen als Gattungswesen, jeder Einzelne steht vor der Herausforderung, angesichts der freien Wahl seiner Handlungen, seiner Aufgaben, seiner Überzeugungen, für seine Intentionen und Wünsche die Verantwortung übernehmen zu müssen.
Sartre formuliert damit ein paradoxes Verhältnis: auf der einen Seite der Zufälligkeit des Lebens ausgeliefert zu sein und angesichts der realen Übermacht der äußeren Verhältnisse, der Institutionen, der Gesellschaft nur ganz wenig tun, ernsthaft tun zu können, um deren Missstände zu verändern; und andererseits trotz der geringen Möglichkeiten, die Dinge zu verändern, die totale Verantwortung übernehmen zu müssen. Aus dieser Spannung heraus sprechen der Geist und das Pathos des Existenzialismus. Die Verurteilung zur Freiheit geschieht im vollen Bewusstsein der äußeren Wirklichkeit, der gegenüber kaum Beeinflussungsmöglichkeiten bestehen – ganz so, wie es vor gar nicht langer Zeit an den Häuserwänden – im Bewusstsein von ‚no future‘ – geschrieben stand: „Du hast keine Chance, also nutze sie.“
Die Qual der Wahl
Insofern Sartre die Idee einer allgemeinen Moral ablehnt, ist der Mensch als Einzelner im Gegenzug dazu verurteilt, in einem radikalen Sinne wählen zu müssen. Der Mensch ist ununterbrochen vor Wahlsituationen gestellt. Wenn es keine allgemeine Moral gibt, nach der er sich richten, an der er sich orientieren kann, dann heißt das, immer wieder Wahlen treffen zu müssen, um ihre Richtigkeit zu erproben.
Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Wahlen, für die man dann aber auch zur Verantwortung gezogen wird, weil es keine allgemeinen übergeordneten Richtlinien oder Institutionen gibt, die einem die Wahl abnehmen. Die Wahlen richten sich in erster Linie nach den Erfordernissen der Situation, die von den Wählenden definiert werden müssen. Die Soziologen beschreiben das heute mit Begriffen wie dem der „Individualisierung“. Sie sehen in dem Individualisierungsprozess aber keine Aussage über das In-der-Welt-Sein des Menschen schlechthin, sondern eine historische Tatsache. Der Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse erlegt den Menschen den Zwang auf, ständig neu über ihren Arbeitsplatz und ihre Mobilität, über Gebrauchs- und Bildungsgüter, über Automaten und Pflegedienste entscheiden zu müssen.
Wenn es keine allgemeinen, übergreifenden ethischen Normen (mehr) gibt oder sie in einem rasanten gesellschaftlichen Wandel begriffen sind, dann muss im Prinzip jede Handlung von einigem Gewicht auf ihre soziale Angemessenheit und Legitimität befragt werden. Und das immer wieder neu. Dass unendlich viele Wahlen getroffen werden müssen, dass sich gleichsam nichts mehr von selbst versteht und jede Wahl auf den zurückfällt, der entscheidet, das ist das Sartre’sche Pathos. Wenn das so ist, wenn ich permanent vor Wahlentscheidungen stehe, dann kann ich mich selbst so verstehen, dass ich mich über diese Wahlen ununterbrochen selbst „erfinden“ oder selbst erschaffen, d. h. individuieren, muss. Man selbst ist dann die Summe dieser Wahlen, sie zeigen, wer man selbst ist. Man versteht sich, man entwirft oder antizipiert sich, man erschafft sich über die verschiedenen Wahlen, die man getroffen hat.
In dieser Situation werden zwei Einwände vorgebracht, der eine: Das ist doch idealistischer Solipsismus. Idealistisch deshalb, weil der Mensch total überfordert ist, in solch einer permanenten Wahlsituation zu sein und entsprechend die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Der Realismus würde sagen, um Gotteswillen, die Menschen sind nicht absolut frei, die Menschen sind in ihren Entscheidungen viel abhängiger, sie wählen sicherlich in dem einen oder anderen Fall, aber viel häufiger werden sie gewählt, sie werden zu dieser oder jener Wahl gedrängt. ‚Solipsismus‘ lautet der andere Vorwurf, der gegenüber den Existenzialisten immer wieder erhoben wird: dass jeder Einzelne in seinen Vorstellungen nur in/um sich kreist, dass jeder Einzelne in/mit dem, was er denkt und versteht, nur bei sich selbst ist. Das Krankheitsbild des Solipsismus ist der „Autismus“. Autisten kapseln sich von der Welt ab, jede Kontaktaufnahme gestaltet sich schwierig, wenn sie überhaupt zustande kommt. Selten wird z. B. durch Augenkontakt eine gemeinsame Basis für Kommunikation geschaffen. Der Film „Rain Man“ mit Dustin Hoffmann vermittelt einen Eindruck von dieser sozialen Beziehungsstörung. Philosophisch wird immer dann von Solipsismus gesprochen, wenn der Mensch als eine selbstbezogene und selbstgenügsame Monade konzipiert wird.
Ist das das übliche Szenario, in dem wir Entscheidungen treffen? Allein auf uns selbst gestellt? Abgekapselt gegenüber der übrigen Welt? Die Regel ist das nicht. Bei Sartre ist es der Einzelne, in seiner Einsamkeit, in seinem Allein- und Verlassensein, er ist gleichsam derjenige, der das gesamte Gewicht der Welt auf seinen Schultern tragen muss. Das hat auf der anderen Seite einen interessanten Zug. Wenn man für sich allein die Entscheidung fällt, dann äußert sich darin in gewisser Weise die Authentizität des Einzelnen. Der Einzelne, der in der Unterredung mit sich entscheidet, schöpft diese Entscheidung nur aus sich; darin ist er er selbst. Deshalb wird diese Philosophie von Sartre bis Heidegger immer wieder auch unter den Titel des Authentizitätsstrebens des Einzelnen gestellt.20 Heidegger spricht vom „Eigentlichen“, was ihm später den Spott Adornos zugezogen hat: „Jargon der Eigentlichkeit“.
Dem anderen Einwand, dass der Existenzialismus qua Überforderung regelmäßig in die Verzweiflung des Einzelnen führe und über die Verzweiflung zur Resignation, begegnet Sartre damit, dass er behauptet, es handele sich um das Gegenteil. Er predige keinen Pessimismus, sondern den Optimismus: Der Mensch halte in seinen Wahlen sein Schicksal in der eigenen Hand.
Der Existenzialismus ist ein Humanismus
Es kommt noch ein Punkt zum weltanschaulichen Hintergrund des Existenzialismus hinzu. Sartre hält an einer Position fest, die man den cartesischen Ausgangspunkt seines Denkens genannt hat: das cogito, das „ich denke“ (trotz seiner Analysen zum präreflexiven cogito). Das ist der Ausgangspunkt, in dessen Rahmen er sich selbst als Einzelnen entwirft. Und auch dort taucht wieder der Vorwurf des Solipsismus auf, wenn er diese cartesisch-kantische Tradition stark betont. Seine Entgegnung besteht in dem Hinweis, dass in diesem „ich denke“ jeder andere mit der gleichen Gewissheit entdeckt werde; ich unterstelle für jeden anderen die gleiche Ich-Gewissheit, und deswegen führe diese Selbstvergewisserung nicht in den Solipsismus. Was fraglich ist, mindestens wird der Gedanke der Intersubjektivität von Sartre nicht wirklich entwickelt.
Sartre resümierend: Der Existenzialismus ist ein Humanismus, nicht in dem Sinne, dass der Mensch als vorgegebener Zweck der höchste Wert ist, sondern im freien Entwurf über sich hinaus seine Selbstverwirklichung sucht. Dem Existenzialismus geht es nicht um die Verwirklichung eines allgemeinen Wesens des Menschen, sondern er schreibt dem Menschen die Chance zu, seine eigene Selbstverwirklichung anzustreben. Der Einzelne findet sich geradezu in diese Situation hineingeworfen, in der er seine Wahl treffen muss, er kann gar nicht anders als sich selbst zu ergreifen. Dieses Sich-selbst-Ergreifen nennt der Existenzialismus von Kierkegaard bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein Existieren.
1946, ein Jahr nach Sartres Humanismus-Vortrag, hat Heidegger in seinem „Brief über den Humanismus“ an Jean Beaufret auf Sartre und seinen Vortrag Bezug genommen und darin eine höchst folgenreiche Kritik entwickelt. Ich zitiere zunächst eine aufschlussreiche Passage darüber, wie Heidegger Sartre versteht und wiedergibt. Er schreibt: „Sartre spricht dagegen den Grundsatz des Existenzialismus so aus: die Existenz geht der Essenz voran. Er nimmt dabei existentia und essentia [Existieren und Wesen, G. G.] im Sinne der Metaphysik, die seit Platon sagt, die essentia geht der existentia voraus. Sartre kehrt diesen Satz einfach um. Aber die Umkehrung des metaphysischen Satzes ist und bleibt ein metaphysischer Satz. Als dieser Satz verharrt er mit der Metaphysik in der Vergessenheit der Wahrheit des Seins.“ Das ist zunächst eine ungemein abstrakte Formulierung des Vorwurfs, den Heidegger gegen Sartre erhebt. „Denn mag auch die Philosophie das Verhältnis von essentia und existentia im Sinne der Kontroversen des Mittelalters oder im Sinne von Leibniz oder anders bestimmen, vor all dem bleibt doch erst zu fragen, aus welchem Seinsgeschick diese Unterscheidung im Sein als esse-essentia und esse-existentia vor das Denken gelangt. Zu bedenken bleibt, weshalb die Frage nach diesem Seinsgeschick niemals gefragt wurde und deshalb sie nie gedacht werden konnte. Der Hauptsatz von Sartre über den Vorrang der existentia vor der essentia rechtfertigt indessen den Namen Existenzialismus als einen dieser Philosophie gemäßen Titel.“
Heidegger wehrt sich dagegen, dass seine Philosophie auch als Existenzialismus aufgefasst wird. Mit Sartre will er nichts zu tun haben. Mit dieser Deutung des menschlichen Wesens schon gar nicht. Für Heidegger ist der Mensch Ex-sistenz, Herausgestelltsein aus der Kette des Seienden. Der Mensch hat eine besondere Form des Existierens. „Durch diese Wesensbestimmung des Menschen werden die humanistischen Auslegungen des Menschen als animal rationale, als Person, als geistigseelisch-leibliches Wesen nicht einfach falsch und werden nicht verworfen, vielmehr ist der einzige Gedanke, daß die höchsten humanistischen Bestimmungen des Wesens des Menschen die eigentliche Würde des Menschen noch nicht erfahren.“ Mit den humanistischen Bestimmungen verfehlen wir noch immer die eigentliche Würde des Menschen, wir treffen sie auch nicht in dieser abstrakten Sartre’schen Umkehrung von essentia und existentia. Heidegger betont weiter, dass seine Kritik sich nicht etwa auf die Gegenseite des Humanum schlüge und nun das Inhumane oder das Unmenschliche befürworte. Gegen den Humanismus wird gedacht, weil er die Humanitas des Menschen noch nicht hoch genug einschätze. Heideggers Kritik in der Zusammenfassung: „Freilich beruht die Wesenshoheit des Menschen nicht darin, daß er die Substanz des Seienden als dessen ‚Subjekt‘ ist, um als Machthaber des Seins in der allzulaut gerühmten ‚Objektivität‘ zergehen zu lassen.“21
Nun, der Vorwurf lautet: Der Mensch versteht sich als Machthaber des Seins und müsste doch eigentlich – mit Heidegger gesprochen – der Hirte des Seins sein. In der Subjektvorstellung steckt von vornherein der Versuch einer Bemächtigung oder Beherrschung dessen, was der Mensch nicht (und auch) ist: der Natur, der anderen Menschen usw. In der Subjektstellung steckt von vornherein die Geste des Unterwerfenwollens. Das erregt Heideggers kritischen Sinn an den verschiedenen Vorstellungen des Subjekts, dass sie den Anderen und die Welt, in der wir sind und leben, stets unter den Begriffen des Vorstellens und des Herstellens denken. Dabei wird der oder das Andere immer in Form eines Objekts, eines Dings, eines Gegenstandes vor-gestellt. Und diese Metaphysik der Bemächtigung, meint Heidegger, stecke bereits in der philosophisch fundamentalen begrifflichen Achse von Subjekt und Objekt. Sie stelle keine neutrale Beschreibung von uns und der Welt dar, sondern unterstehe von Anfang an einem Herrschaftsanspruch. Und diesen habe Sartre so wenig wie die gesamte Philosophie vor ihm gesehen.
Der zweite Vorwurf, den Heidegger gegenüber Sartre lanciert, ist der, dass Sartres Denken das Ereignis nicht handhaben könne. In diesem Verhältnis von Subjekt und Objekt habe das Geschichtliche, das Zeitliche keine Stelle, und schon gar nicht das Ereignis, denn dies sei am wenigsten vorhersehbar und d. h.: zu beherrschen. Ein Ereignis entsteht überraschend an der Schnittstelle einer bestimmten Situation, an der wir zwar beteiligt sind, die wir aber nicht voll im Griff haben.22 Nur darüber, dass etwas sich ereignet, glaubt Heidegger, können wir verstehen, was Offenheit heißt. Der Mensch ist aber wesentlich durch „Offenheit“ charakterisiert. Offenheit ist keine Passivität; sie hat eine fast aktivische Form: Man muss sich positionieren, darauf einstellen, offen zu sein. Die Stellung des Menschen in der Welt ist über seine Offenheit zu beschreiben – nicht über das Subjekt-Objekt-Verhältnis.
Strukturalismus und Humanismus
Ich breche an dieser Stelle die Überlegungen zu Heidegger ab und komme zurück zum Humanismus und einer anderen Kritiklinie.
Claude Lévi-Strauss (1908–2009), französischer Geistesheros, Ethnologe und Sozialwissenschaftler, hat die wohl mächtigste und sehr weitreichende Kritik am Humanismus lanciert. Sie ruht auf der Basis einer anderen Großtheorie, dem Strukturalismus. Lévi-Strauss untersucht die Mythen fremder Völker. Er hat ein vierbändiges Werk geschrieben, Mythologica (1964–1971), in dem er versucht, die Mythen dieser Welt zu sammeln und zu ordnen, sie auf ihre immanenten Strukturen hin zu untersuchen. Er zeigt, dass mythische Erzählungen immer wieder vergleichbare Formen aufweisen, dass sie bei den verschiedenen Kulturen in ähnlicher Weise wiederkehren. Die Strukturen, die diesen Erzählungen zugrunde liegen, gleichen sich − daher der Begriff Strukturalismus. Ob man Mythen aus Südamerika oder aus Vorderasien nimmt, es zeigen sich vergleichbare (archetypische) Motive und Strukturen: die Geburt des Königssohns, das Ausgesetzt-Sein, die Erdmutter etc.
In der Zwischenzeit ist Sartres zweites Hauptwerk Die Kritik der dialektischen Vernunft (1960) erschienen. Lévi-Strauss stellt nun die zwei zentralen Begriffe des Sartre’schen Denkens infrage: den Humanismus und die Geschichte, wie das gleichlautende Kapitel aus seinem Buch Das wilde Denken (1962) heißt. Lévi-Strauss bekennt sich darin explizit zu einem Antihumanismus in dem Sinne, dass er das Subjekt auf einen Träger unbewusst wirksamer Strukturen reduziert. Wenn wir vom Subjekt sprechen, dann kann von der Individualität des einzelnen Menschen überhaupt keine Rede sein, weil die Menschen in ihrem Verhalten, in ihrem Sprechen und in ihrem Denken, in ihren Wünschen und Bedürfnissen usw. unbewusst bestimmten Denk- und Sprachstrukturen folgen, die ihnen ihre Lebensform oder ihr Weltbild oder ihre Mythen vorschreiben. Das zeigt sich an der Gleichheit der Mythen rund um den Erdball, an den Verwandtschaftsverhältnissen und den Erzählungen, über die sich die Menschen in den frühen Kulturen interpretieren und verstehen. Der Mensch oder das Subjekt ist nur der Träger unbewusst wirksamer Strukturen, die auf der kulturellen und sprachlichen Oberfläche größere oder kleinere Abwandlungen erfahren. Dabei bezieht Lévi-Strauss sich auf den linguistischen Strukturalismus Ferdinand de Saussures, von dem noch die Rede sein wird.23
Lévi-Strauss’ Einwand gegenüber dem existenzialistischen Humanismus lautet: Die Menschen glauben zwar, dass sie handeln, dass sie aufgrund bestimmter Überzeugungen und kraft ihrer Spontaneität über Dinge entscheiden oder sich an bestimmten Werten orientieren, aber im Grunde folgen sie durchgängig bestimmt den Vorgaben, die ihnen der interne Funktionsmechanismus ihres Geistes – realisiert in universellen Strukturen – vorschreibt. Die Sozialwissenschaften untersuchen diese Regelmäßigkeiten, diese Strukturen, die die Menschen in ihrem Verhalten (relativ) bewusstlos vollziehen.
Der zweite Angriff besteht in der Behauptung, dass dasselbe auch für die Geschichte gelte. Auch dort herrschten durchgängig bestimmte Muster und Strukturen. Aber die Kritik an Sartre trägt darüber hinaus noch einen spezifischen Zug. Sartre denke ethnozentristisch, genauer, eurozentristisch. Er unterscheide nämlich Völker, die eine Geschichte haben, von denen, die diese Vorstellung nicht kennen. Sartre nennt sie die „formlosen“ Völker und Lévi-Strauss kritisiert das als typisch eurozentristisch geprägten Blick. Es gibt viele sogenannter primitiver Kulturen, die eine Geschichte in unserem Sinne überhaupt nicht kennen. Sartre geht darüber hinweg wie ein Meisterdenker, indem er sagt: Wer es nicht mal zum Begriff der Geschichte gebracht hat, gehöre zu den Primitiven. Lévi-Strauss betont im Gegensatz dazu die Pluralität der Kulturen, er sieht in ihr, mit Ranke gesprochen, dass jede Kultur unmittelbar zu Gott steht, dass jede Kultur in sich einen Wert hat und nicht von anderen Kulturen her beurteilt, ab- oder aufgewertet werden kann. Im Grunde predigt Lévi-Strauss eine friedliche Koexistenz aller Kulturen aus dem Gedanken des Respekts vor ihrem jeweiligen Eigenwert.24
Die strukturale Anthropologie ist eine Archäologie des Vergangenen, eine Perspektive, die nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, vergangene und zerstörte Welten zu rekonstruieren – im Schatten der traurigen Tropen25, die in ihrer Trauer zugleich ein Urteil der Hoffnungslosigkeit über die eigene europäische Kultur verbreiten. Diese Archäologie zielt nicht auf eine einfache Wiederherstellung des Gewesenen – diese Welten sind unwiderruflich verloren –, sie öffnet den Blick für die Differenz von Kulturen, für die vielen Bilder möglichen Menschseins, wenngleich im Bewusstsein einer höheren, strukturanthropologisch gedeuteten Einheit.
Die Kritik an Sartre stützt sich auf eine Erfahrung, die angesichts der Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts die alteuropäische Einheit von Geschichte und Humanität auseinanderbrechen sieht. Allein ihre Aufkündigung macht eine (humane) Fortsetzung denkbar: „Man braucht nur zu erkennen, daß die Geschichtswissenschaft eine Methode ist, der kein genaues Objekt entspricht, und infolgedessen die Äquivalenz zwischen dem Begriff der Geschichte und dem der Menschheit zu verwerfen, die man uns mit dem uneingestandenen Ziel einzureden versucht, die Historizität zum letzten Refugium eines transzendentalen Humanismus zu machen: als ob die Menschen, wenn sie nur auf ein Ich verzichten, das schon allzu sehr an Konsistenz verloren hat, auf der Ebene des Wir die Illusion der Freiheit wiederfinden könnten.“26
Während Sartre daran festhält, die Geschichte als Selbsthervorbringung des Menschen zu begreifen, die ihren Zweck in der „Praxis“ hat, d. h. in der Herstellung von Freiheitsbedingungen, die sie an kollektive Bewegungen delegiert, besteht die strukturale Anthropologie darauf, „daß das letzte Ziel der Wissenschaften vom Menschen nicht das ist, den Menschen zu konstituieren, sondern […] ihn aufzulösen“.27
Lévi-Strauss hat, vor allem in Frankreich, d. h. dem Paris der 60er-Jahre, eine kurze, aber ungeheuer nachhaltige Wirkung gehabt. Man könnte fast sagen, durchgängig waren alle Kultur- und Humanwissenschaftler mit einem Schlag Strukturalisten. Die Marxisten, z. B. Louis Althusser, die Psychoanalytiker, wie Jacques Lacan, die Literaturtheoretiker (Roland Barthes), alle versuchten auf ihrem Feld diesen Gedanken zu verfolgen: Nicht die Menschen, nicht die Subjekte sprechen und agieren, sondern die Sprache spricht, und die gesellschaftlichen Verhältnisse determinieren strukturell und vorbewusst unser Handeln. Aber es dauert nicht lange, was passiert? Kurze Zeit später sind alle – dieselben Leute, wirklich dieselben – Poststrukturalisten. Lévi-Strauss wird zur Zielscheibe der Kritik (vgl. Kap. IV, S. 296 ff.).
Zunächst etabliert sich eine neue Konkurrenz. Wer vertritt den schärfsten Antihumanismus? Für die Marxisten wird der Humanismus zur „bürgerlichen Ideologie“ par excellence, für die Nietzscheaner ist „der Mensch“ ohnehin eine Ausgeburt des Nihilismus und des Ressentiments des modernen „reaktiven“ Menschen (Deleuze mit Nietzsche), die Strukturalisten wie Lévi-Strauss tragen die Absicht, „den Menschen aufzulösen“.
Technokratischer Humanismus
Michel Foucault (1926–1984) steht noch im Bann des Strukturalismus, als er ein Interview gibt, das höchst aufschlussreich ist, insofern es das Problem des Humanismus erneut aufwirft. Die Diskussion wird dabei nicht von Foucault, sondern von einem hartnäckigen Interviewer vorangetrieben, der provokativ fragt, warum man eigentlich kein Humanist mehr sein kann? Ob nicht auch die Kritik am Humanismus selbst noch humanistisch motiviert sei?
Foucault: „Sie wissen doch – und ich beziehe mich auf eine Landschaft, die sicherlich auch Sie gut kennen, da wir sie wahrscheinlich gemeinsam durchwandert haben, daß es gerade dieser Humanismus war, der in den Jahren nach dem Weltkrieg sowohl den Stalinismus wie die Hegemonie der christlich-demokratischen Parteien gerechtfertigt hat, daß es derselbe Humanismus ist, den wir bei Camus und im Existenzialismus Sartres finden usw. Zu guter Letzt ist dieser Humanismus doch der Prostituierte des ganzen Denkens, der ganzen Kultur, der ganzen Moral und Politik der letzten 20 Jahre gewesen: und wenn man ihn uns nun als Tugendbeispiel vorstellt, so halte ich das für eine Provokation.“
Interviewer: „Es handelt sich aber nicht darum, einen bestimmten Humanismus zum Tugendbold zu machen. Sie haben sich darauf beschränkt, einen Humanismus zu verurteilen, der im Widerspruch zu seinen eigenen Voraussetzungen steht, einen zweideutigen oder überholten Humanismus. Ich möchte jedoch, daß Sie mir erklären, wieso man heute überhaupt nicht mehr Humanist sein kann.“
„Darauf will ich folgendes antworten: ich glaube, die Humanwissenschaften [hier weicht Foucault zunächst aus, G. G.] führen uns überhaupt nicht zur Entdeckung des ,Menschlichen‘, der Wahrheit des Menschen, seiner Natur, seiner Entstehung, seiner Bestimmung. [Jetzt kommt eine richtige Diagnose, die aber nichts mit der Frage zu tun hat, G. G.] Dasjenige, mit dem sich die verschiedenen Humanwissenschaften wirklich beschäftigen, ist etwas vom Menschen Verschiedenes, das sind Systeme, Strukturen, Kombinatoriken, Formen usw. Wenn wir uns daher ernsthaft mit den Humanwissenschaften auseinandersetzen wollen, müssen wir uns vor allem der Illusion entledigen, es gelte, den Menschen zu suchen.“
„Das mag auf der Ebene der Wissenschaft, der Erkenntnis zutreffen; aber auf der Ebene der Moral …“
„Sagen wir: auf der Ebene der Politik. Ich behaupte nämlich, daß sich die Moral zur Gänze auf die Politik und auf die Sexualität reduzieren läßt, welche wiederum auf die Politik reduziert werden kann. Folglich ist die Moral Politik. […] In Wirklichkeit sind die Probleme, die sich einem Politiker stellen, Probleme etwa folgender Art: Soll man den Index des Bevölkerungswachstums steigen lassen? Soll man die Schwerindustrie oder die Leichtindustrie fördern? Bietet die Steigerung des Konsums in einer bestimmten Konjunktur Vorteile oder nicht? Das sind die politischen Probleme. Auf dieser Ebene finden wir keine ,Menschen‘.“
„Aber formulieren Sie nicht eben Ihren Humanismus? Warum soll man eine ökonomische Tendenz einer anderen gegenüber bevorzugen? Warum soll man das Wachstum der Bevölkerung regulieren? Geht es in all diesen politischen Aufgaben nicht um das Wohl der Menschen? […]“
„Ich möchte nicht, daß meine Behauptung als Slogan betrachtet wird. Zwar ist sie inzwischen zu einem Schlagwort geworden, aber gänzlich gegen meinen Willen. Vielmehr handelt es sich um eine tiefe Überzeugung, die ich aus der Erfahrung der üblen Dienste gewonnen habe, welche diese Idee des Menschen in so vielen Jahren geleistet hat.“ [Es gibt also zunächst einen ersten Einwand, den Foucault nennt: Die Humanwissenschaften suchen nicht nach dem Menschen, der Mensch kommt in den Humanwissenschaften nicht vor. Das ist sicherlich richtig. Eine Psychologie oder Soziologie interessiert sich nicht mehr für den Menschen, sie interessiert sich für Rollen, für Muster, für soziale Milieus. Der zweite Punkt ist, dass man mit der Idee des Menschen im Stalinismus oder im Nationalsozialismus usw., Politik und/oder Schindluder getrieben hat – natürlich ein berechtigter Hinweis. „Der Mensch“ hat sehr häufig dazu gedient, mehr als bedenkliche Maßnahmen „zu seinem eigenen Besten“ zu rechtfertigen oder Forderungen nach diesem und jenem zu legitimieren, die sich zwingend aus seiner „Wesensnatur“ ergeben, G. G.]
„Diese schlechten Dienste hat sie dem Menschen erwiesen. Auch Sie orientieren sich an einer humanistischen Forderung. Bis zu welchem Punkt glauben Sie, den Humanismus negieren zu können? Im Konkreten beschränken Sie sich doch darauf, die zu ihren eigenen Voraussetzungen im Widerspruch stehenden Humanismen, die überholten oder allzu beschränkten Humanismen zu denunzieren, was die Forderung einer moderneren, der heutigen Situation angemesseneren und elastischeren humanistischen Ideologie impliziert.“
[Es kommt ein dritter interessanter Einwand, G. G.] „Ich möchte nicht als Vorkämpfer eines technokratischen Humanismus oder eines Humanismus, der sich nicht als solchen zu bezeichnen wagt, auftreten. In Wahrheit ist ja niemand mehr Humanist als die Technokraten. [Natürlich. Warum? Alle Ingenieure verstehen das Argument sofort: Sie glauben oder rechtfertigen ihr Tun stets damit, alles zum Besten und zum Wohle der Menschen zu tun, G. G.]
Auf der anderen Seite muss eine linke Politik möglich sein, die ohne all diese konfusen humanistischen Mythen auskommt. […] Nach meinem Dafürhalten sind die Technokraten Humanisten und Technokratie ist eine Form des Humanismus. Die Technokraten glauben ja in einem gewissen Sinne die einzigen zu sein, die das ,Glück der Menschen‘ definieren und herbeiführen können.“ [Das ist des Pudels Kern. Der Technokrat glaubt, das Glück oder das Beste des Menschen technisch herbeiführen zu können. Der dritte Einwand wäre also: Humanismus nimmt in der modernen Welt zwangsläufig die Form eines technokratischen Humanismus an, G. G.]
„Allerdings meinen Sie, daß die humanistischen Mythen keineswegs mit dem Problem des Funktionierens der Menschen in Beziehungen aufeinander verbunden sein müssen.“
„Jawohl. Wenn wir über das Problem des Humanismus zu diskutieren scheinen, beziehen wir uns eigentlich auf ein einfacheres Problem, auf das des Glücks. Ich behaupte, daß sich der Humanismus zumindest auf der politischen Ebene als jene Einstellung definieren läßt, derzufolge es Zweck der Politik ist, das Glück herbeizuführen. Meiner Überzeugung nach kann aber der Begriff des Glücks nicht mehr gedacht werden. Das Glück existiert nicht und das Glück der Menschen existiert noch weniger.“28
Soweit die kurze Geschichte der Kritik am Humanismus, damit ist sie aber noch nicht zu Ende. Die Rede vom „Verschwinden des Menschen“ oder die von seiner „Verabschiedung“ wird zu einem weit verbreiteten Topos der philosophischen, kultur- und sozialwissenschaftlichen Debatten um Moderne und Postmoderne im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Motive M. Heideggers und der Kritischen Theorie um Max Horkheimer (1895–1973) und Theodor W. Adorno (1903–1969) aufnehmend, schreibt der Kommunikations- und Wissenschaftstheoretiker Vilém Flusser (1920–1991): „Das Subjekt wird sich selbst zum Objekt, und zwar in allen seinen Parametern. Der Mensch wird kalkulierbar, nicht nur als physische und physiologische, sondern auch als mentale, soziale und kulturelle ‚Sache‘. Alle seine Parameter werden analysierbar, in Punkte zersetzbar: die Wahrnehmungen in Reize, das Verhalten in Aktome, die Entscheidungen in Dezideme, die Sprache in Phoneme, die Kulturen in Kultureme. […] Als Objekt des Kalkulierens zerfließt der Mensch in sich einander überschneidende Netze von physiologischen, psychischen, sozialen und kulturellen Relationen; und der Mensch als Subjekt des Kalkulierens löst sich im Kalkulieren selbst auf. Das ist der berüchtigte ‚Tod des Humanismus‘.“29