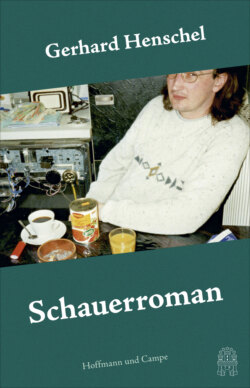Читать книгу Schauerroman - Gerhard Henschel - Страница 4
ОглавлениеIn der Wohnung sah es aus wie Sau, als ich mein Katerfrühstück einnahm. Man feierte nicht ungestraft Geburtstag in einer Kreuzberger Fabriketagen-WG! Pfützen, Bierdeckel, Styroporbecher, Sektkorken, Wurstzipfel, klebriges Leergut, verknautschte Zigarettenschachteln, fettige Papierservietten und als Aschenbecher mißbrauchte Teller mit erstarrten Speiseresten kündeten von einer langen, feuchtfröhlichen Nacht, und von Sigrun durfte ich mir anhören, daß sie die Fete zwar ganz lustig gefunden habe, aber nicht dieses eine total bescheuerte Lied, das irgendein Idiot um fünf Uhr morgens aufgelegt habe: »Weischt, welches i mai?«
Oja, ich wußte, welches sie meinte: das Lied von Stephan Remmler. Das einzige, das ich selbst ausgesucht hatte:
Einer ist immer der Loser
einer muß immer verliern …
»Des hedd mi faschd zom Wahnsinn gbrachd«, sagte sie. »I war da scho halb oigschlafa!«
Zum Glück gab es in meiner Wohngemeinschaft einen extrabreiten Saalbesen. Damit förderte ich auch zwei tote Mäuse zutage, die schon eine geraume Weile unter dem Fernsehsofa gelegen hatten.
Das Aufräumen und Saubermachen dauerte Stunden, und dann lehnten drei prallvolle Müllsäcke an der Wohnhallenwand.
Heraus zum 1. Mai! Den Zinnober, den die Autonomen in dieser Nacht veranstalteten, wollte ich mir einmal näher anschauen.
Philipp kam mit. Er glaubte, daß die größte Action am Görlitzer Bahnhof abgehe. Wir kämpften uns dorthin durch und sahen uns einer starken polizeilichen Streitmacht und deren Wasserwerfern gegenüber, während vermummte Demonstranten Steine warfen und aufgescheucht herumrannten.
Was sie damit bezweckten, blieb unklar. Es war kindisch, den Staat auf diese Weise herauszufordern. Welchem Ziel sollte es dienen, daß ein paar hundert Karnevalsbrüder Schaufenster einschmissen oder Autos in Brand steckten?
»Kein einziger von denen würde sein eigenes Auto anzünden«, wollte ich zu Philipp sagen, aber da driftete er in der wogenden Volksmenge schon woandershin, und als ich nach einem Ausweg suchte, schlug eine Polizistin mir ihren Knüppel so hart aufs linke Knie, daß ich zwei Tage lang nur noch hinken konnte.
Und dennoch ging es mir besser als dem Typen in Stephan Remmlers Lied. Allein im April hatte ich mit meinen Texten mehr als fünftausend Mark eingenommen. Lesungshonorare nicht eingerechnet.
Im Benno-Ohnesorg-Theater in der Galerie am Chamissoplatz nahm Wiglaf Droste am Sonnabend Stellung zur Randale vom 1. Mai: »Ein kleiner Leckerbissen am Rande sind in jedem Jahr die Versuche des Kreuzberger alternativen Mittelstands, sozialarbeiterische Arschkriecherei als ›Vernunft‹ auszugeben und sich schlichtend zwischen die Kontrahenten zu stellen. Bisher haben sie noch immer bekommen, was sie verdienen: tüchtig Haue von beiden Seiten …«
Der Subkulturforscher Klaus Farin, der als Gast aufgetreten war, fragte mich hinterher im Heidelberger Krug bei Bier und Bouletten nach meinem politischen Standort, den ich aber selbst nicht so genau kannte. »Und du wohnst in Berlin?«
»Ja. In einer Siebener-WG in der Graefestraße.«
»Kann man das aushalten?«
Das Schlimmste sei der allmorgendlich einsetzende Baustellenlärm, sagte ich, und dann lud Marcus Weimer alias Rattelschneck mich dazu ein, auf der Rückseite eines Kilkenny-Irish-Beer-Aufstellers mit einem Kugelschreiber die Zeichnung eines »Hausfrauenhimmels« zu komplettieren, in dem ein Engel auf den Wolken staubsaugte, während eine Ratte dem lieben Gott, der in Ruhe fernsehen wollte, auf den Kopf kotzte.
Tags darauf sahen Wiglaf, Marcus und ich uns im Arsenal die Originalfassung von John Fords Western »My Darling Clementine« an, von dessen Poesie man nicht viel wußte, wenn man ihn nur aus dem Fernsehen kannte. Gemein war allerdings der von Anfang an feststehende Tod der schönen Mexikanerin Chihuahua. In klassischen Western hatten gutaussehende mexikanische Bardamen keine Überlebenschance.
Beim Bier kamen wir vom Gespräch über die Schießerei am Ende des Films auf die Waffengeilheit der RAF, und Wiglaf verriet uns, was Bommi Baumann ihm über Andreas Baader erzählt habe: Der sei immer gern mit ’ner Knarre in der Hand rumgelaufen. Und als er einmal aus dem Bad gekommen sei, habe er einer Frau ein Handtuch zugeworfen und gesagt: »Los, Fotze, abtrocknen!«
Das glaubte ich unbesehen. Es paßte zum Sound der bekanntgewordenen RAF-Kassiber.
Marcus sagte, daß er auch eine Kriegsgeschichte auf Lager habe: Er sei mal in London bei einer Familie zu Gast gewesen, in deren Wohnzimmer es nur einen einzigen Steckkontakt gegeben habe. »An den konnte man entweder den Plattenspieler anschließen oder den Zierkamin. Und es gab jeden Abend Streit deswegen …«
Richtungslose Kneipengespräche waren immer eine Wonne, und wenn Marcus dabei war, konnte man sicher sein, daß sie nicht monothematisch verliefen.
Am späteren Abend schrieb ich wieder an meinem kleinen Buch für Klaus Bittermanns Edition Tiamat (»Menschlich viel Fieses«) über das Schnulzige in den Traktaten, Predigten, Memoiren und Versen der Bürgerrechtler, die gegen die DDR-Regierung aufbegehrt hatten.
Gedicht, steig auf, flieg himmelwärts!
Steig auf, gedicht, und sei
der vogel Schmerz …
Wegen solcher Gedichte war der Poet Reiner Kunze mit einem Berufsverbot belegt und von der Staatssicherheit drangsaliert worden, was die Gedichte aber nicht besser machte.
Von der Arbeit ablassen mußte ich dann, als im Ersten Woody Allens Beitrag zu dem Episodenfilm »New Yorker Geschichten« lief. Das Komischste, was ich von Allen je gesehen hatte: Eine tyrannische Mutter taucht nach ihrem Verschwinden plötzlich als riesenhafte Himmelserscheinung über Manhattan auf und rhabarbert über die Verfehlungen ihres Sohnes, der schon geglaubt hatte, er wäre sie für immer los. Wie schrecklich!
Die Redakteure des Fußballfachblatts Kicker liebten es, die Überschriften ihrer Artikel mit Namenswitzen aufzubrezeln:
Kurz hielt Thom kurz
Saftig auf dem Trockenen
Hart wie Holz, dieser Golz
Und in bezug auf den Bundesligaspieler Mehmet Scholl:
Mehmet, was s(ch)oll das?
Eine ebenso behämmerte wie putzige Marotte.
Für die Nullnummer der Zeitschrift Schnurrende Traglast, die Kathrin Passig und ich herausgeben wollten, schickte mir der Hamburger Journalist Christian Meurer einen Text, in dem es um dänischen Leberwurstpudding und »ein halbherziges Sommergeplänkel mit einem Hildesheimer Forstassessor auf Lanzarote« ging, und das waren genau die Petitessen, an die wir gedacht hatten, denn es sollte eine Zeitschrift für das Unwichtige werden.
In Los Angeles waren bei einer Protestdemonstration von Afroamerikanern 53 Menschen ums Leben gekommen und mehr als zweitausend verletzt worden. Vier Polizisten – drei Weiße und ein Latino – hatten zuvor einen am Boden liegenden Schwarzen minutenlang mit Schlagstöcken verprügelt und mit Füßen getreten, waren aber von einem Gericht freigesprochen worden, und in der Jury hatte kein einziger Schwarzer gesessen. Rassismus wie vor einhundert oder zweihundert Jahren: als hätte der von Martin Luther King angeführte Marsch auf Washington nie stattgefunden.
Was man in den Schreibwarenläden kaufen konnte, waren Muscle-T-Shirts, Rollschuhe und Seifenblasen, aber kaum noch Schreibwaren.
»Haben Sie Aktenordner?«
»Sind aus.«
»Und Kopierpapier?«
»Vielleicht kommende Woche wieder …«
»Und Radiergummis?«
»Hatten wir mal.«
War das die von Jürgen Habermas analysierte »Neue Unübersichtlichkeit«?
Der Tod von Marlene Dietrich ließ meine Mitbewohner kalt. Torsten kannte nicht einmal ihren Namen, Sigrun verwechselte sie mit Hildegard Knef, Jochen sagte, er stehe mehr auf Julia Roberts, für Lizzy begann die Filmgeschichte überhaupt erst 1983 mit dem Film »Klassenverhältnisse« von Jean-Marie Straub und Danièle Huillet, und Philipp befand sich gerade in einem unzugänglichen Bewußtseinszustand.
Von Reinhold lag keine Stellungnahme vor. Er war seit Monaten on the road, und ich hatte ihn noch nie gesehen.
»Da isch dai Großmuadr am Delefo«, sagte Sigrun.
»Hallo, Oma!«
»Ich grüße dich, Martin! Ist mein Geburtstagsbrief jetzt da? Der mit dem vielen Geld?«
»Nein, noch nicht. Jetzt streiken hier die Postbeamten. Und dazu noch die Müllmänner …«
Ich solle ihr sofort Bescheid geben, wenn er angekommen sei, sagte sie. »Geht’s dir denn gut, mein Lieber?«
»Ja! Ich fahr übermorgen zur Leipziger Buchmesse und treff mich da mit zweien meiner Verleger …«
Unter denen meine liebe alte Oma Jever sich vermutlich arriviertere Herren vorstellte als die Kleinverleger Michael Rudolf und Gerd König aus Greiz in Thüringen.
Fünfzig Millionen Postsendungen steckten im Stau, hieß es im Radio, und ich schätzte, daß mindestens zwei Millionen davon für mich bestimmt waren.
In der Zeit lobte Harry Rowohlt »den genialen Kolumnisten Max Goldt«:
So schöne Kolumnen möchte ich auch mal schreiben können. Aber ansonsten bin ich ganz froh, daß ich ich bin und nicht er, denn seine Groupies sehen sämtlich aus wie Hitlerjunge Flex, während bei meinen Groupies … äh … sozusagen noch alles drin ist.
Mit Harry Rowohlt hätte ich auch gern mal das Glas erhoben.
Auf dem Hinweg zu einem Lokal namens Marabu, wo ich mit Lizzys Freundin Dunja verabredet war, die laut Lizzy auf mich flog, obwohl sie sich, wie ich wußte, in festen Händen befand, wurde ich weichgeregnet, und im Marabu störten uns ständig irgendwelche von Dunjas Bekannten.
Mit denen ließ ich sie schließlich allein. Eine Frau, die so genau unter Beobachtung stand, wäre sowieso nicht auf Abwege zu bringen gewesen.
Um nach Leipzig fahren zu können, mußte ich erst einmal den Bahnhof Schöneweide erreichen, was gar nicht so leicht war, weil ich das System der Ostberliner S-Bahn nicht durchschaute.
Die Lautsprecherkommandos auf den Bahnsteigen erschollen noch immer im barschen Tonfall der sozialistischen Obrigkeit, und in den Waggons der Reichsbahn stank es, wie schon vor dem Mauerfall, nach dem todbringenden Desinfektionsmittel Wofasept aus Bitterfeld. Diese chemische Keule konnte nur von Irren hergestellt worden sein.
Schwarzgeledert und kaugummikauend stand Michael Rudolf im Leipziger Hauptbahnhof parat und salutierte. »Ey! Besuch aus’m Westen!«
Irgendwo am Stadtrand hatten Gerd König und er eine kleine Wohnung angemietet, in der auch ich übernachten konnte, aber unser erstes Ziel war das Messehaus.
Im Herbst, sagte Michael, könnten wir vielleicht ein bißchen auf Lesereise gehen. »Vielleicht nach Halle, Rostock, Jena und Chemnitz. Wenn der Sammelband mit deinen Texten erschienen ist. Für den wir uns noch einen Titel ausdenken müssen …«
Michaels Kompagnon Gerd König begrüßte mich herzlich. Ein Vogtländer mit gestutztem Vollbart und hellbrauner Breitcordjacke. Er war gelernter Zerspanungsmechaniker und hatte in den achtziger Jahren im Leipziger Literaturinstitut studiert und 1991 gemeinsam mit Michael den Verlag Weisser Stein gegründet.
Unserem Versuch, im Messehaus einen Happen essen zu gehen, blieb der Erfolg versagt: Es gab nur einen säuischen Fraß, den man nicht hinunterbekam.
»Schmeckt wie zerlassene Filzsandalen«, sagte Gerd König.
Am Stand des Verlags Knaus erkundigte ich mich nach dem Befinden von Walter Kempowski, der einen Schlaganfall erlitten hatte, wie ich wußte, aber dort hatten sie alle keinen Schimmer davon, wie es ihrem wichtigsten Autor ging.
Sehr viel besser war das Essen abends im Ratskeller, und das Köstritzer Schwarzbier, das wir dazu tranken, fand auch vor Michael Gnade. Als Gärungstechnologe alter Schule stellte er an jedes Bier die höchsten Ansprüche, und dieses hier schmeckte ihm: »Das ist noch mit Liebe gehopft!«
An einem der Nebentische parlierte der strauchhaarige SPD-Spitzenpolitiker Wolfgang Thierse, der mich aber nicht so stark beeindruckte wie der weißbekittelte Bedienstete mittleren Alters, der auf der Herrentoilette der Aufgabe nachkam, die Papierhandtücher aus dem Papierhandtuchspender zu ziehen und sie den Gästen darzureichen, die sich die Hände gewaschen hatten. Was war denn das für ein kurioser Beruf?
Vom Ratskeller zogen wir in die Moritzbastei um, einen katakombenartigen Gewölbekeller mit Ausschank und regem Zulauf aus Studentenkreisen. In einem der Gelasse saßen wir schon bald vor drei Bierhumpen und sprachen gerade darüber, wie mein Buch heißen solle, als eine bildschöne dunkelhaarige Frau die Treppe neben uns herunterkam und mir dabei tief in die Augen sah.
Ich entschuldigte mich bei Michael und Gerd, lief der Frau hinterher und entdeckte sie in einer separaten Bar namens Schwalbennest. »Du hast mich eben so freundlich angesehen«, sagte ich. »Darf ich dir was ausgeben?«
»Dann aber was Richtiges«, sagte sie. »Whiskey.«
Sie hieß Nicole, stammte aus Apolda und war Apothekerin in Leipzig, und es kam rasch zum ersten Kuß. Auf den unmittelbar nach dem zweiten gemeinsamen Getränk ein noch innigerer folgte. So gefiel mir das Leben!
Hello, I love you
Let me jump in your game …
Offenkundig war Nicole ebenso liebeshungrig wie ich, und ich überlegte schon, ob es statthaft wäre, sie in das Quartier meiner Verleger mitzunehmen.
»Hier steckst du also!« rief Michael. »Wir haben dich überall gesucht!« Er stellte meine Reisetasche hinter meinem Barhocker ab und sagte, daß Gerd König und er jetzt eine Lesung experimenteller Lyrik besuchen wollten. »Gleich um die Ecke. Kommst du mit?«
»Nein. Ich bleibe lieber noch im Schwalbennest.«
»Na gut. Dann sehen wir uns hier so in ’ner Stunde wieder …«
Wen lockte experimentelle Lyrik, wenn es stattdessen Zungenküsse gab?
In das Taxi, das uns zu der Unterkunft in der Vorstadt bringen sollte, stieg Nicole dann tatsächlich mit ein, und ich schuf ihr einen Platz auf meiner kargen Lagerstatt, die aus einer in der Küche liegenden Matratze bestand. Als Zudecke diente uns ein rauhes volkseigenes Badehandtuch. Doch was brauchten wir mehr?
Das Frühstück war mager: Malzkaffee und getoastetes Weißbrot mit Goldina-Margarine und Zörbiger Pflaumenmus.
Nicole und ich wollten in Verbindung bleiben, und wir tauschten einen langen Kuß und unsere Adressen aus, bevor der zweite Messetag begann.
Im Tageslicht sahen die Bauten in der Leipziger Vorstadt noch schäbiger aus als in der Nacht. Viele waren bis zum zweiten Stock mit Müll gefüllt.
In den öden Fensterhöhlen
Wohnt das Grauen …
Und die Menschen! Quallig, knorpelig und teigig rollten sie von A nach B und stellten ihre vom jahrzehntelangen Schweinekopfsülzwurst- und Würzfleischverzehr entstellten Körper zur Schau. Figuren wie aus einer Freakshow.
»Sowas sehen wir hier alle Tage«, sagte Michael. »Reiß dich mal zusammen!«
Auf der Messe hatte auch der Semmel-Verlach einen Stand, der Mutterkonzern des Hamburger Satiremagazins Kowalski, für das Michael und ich schrieben. Wir nahmen dort die Cartoonbände unseres lieben Freundes Eugen Egner aus dem Regal und plazierten sie an einer besser sichtbaren Stelle.
Im Treppenhaus wären wir um ein Haar mit dem CDU-MdB Rainer Eppelmann kollidiert, und einmal kreuzten wir den Weg des TV-Journalisten Hanns Joachim Friedrichs, der genauso aussah wie im Fernsehen: Toll, was man auf einer Buchmesse alles erlebte.
Michael wollte zum Stand der Sozialistischen Verlagsauslieferung, kurz SOVA, die unter anderem Bücher der Verlage Nautilus, März und Stroemfeld/Roter Stern vertrieb. Sein Ziel war, die SOVA auch für den Verlag Weisser Stein zu gewinnen. Es war jedoch gerade niemand da, der ansprechbar gewesen wäre, aber eine der SOVA-Damen gab sich als Kowalski-Leserin zu erkennen und füllte uns mit Sekt ab.
Nebenan krachten Raketen los. Dort fand die Lesung eines Autors namens Harry Hass statt, der Feuerwerkskörper und Knallerbsen ins Publikum schmiß und einen Text über Touristen vortrug, die sich an der Ostsee den Hintern mit toten Krähen abwischten. Von anderswoher waren über Lautsprecher die sonoren Stimmen existentiell leidender Lyrikerinnen zu vernehmen, und Michael blies stumm die Backen auf.
Am Abend führten meine Verleger mich in das berühmte Lokal Auerbachs Keller aus, in dem Doktor Faust einst auf einem Faß über die Treppen geritten sein sollte.
Als Titel für mein Debütwerk schlug Michael mir »Der Sprung in der Schüssel der imperialistischen Bestie« vor, aber ich hätte etwas Milderes vorgezogen. Wenn ich auch noch nicht wußte, was.
Wir tranken wieder Köstritzer, und Gerd König rezitierte etwas von einem erzgebirgischen Heimatdichter: »Im Wald, da steht ein Ofenrohr. Stell dir mal die Hitze vor!«
Aus mir selbst unerklärlichen Gründen mußte ich darüber so ausdauernd lachen, daß mein Essen kalt wurde. Ich kriegte mich kaum wieder ein. Dieses im Wald stehende heiße Ofenrohr machte mich hilflos gegen den von innen kommenden Lachkoller.
Zuhause wartete ein Fax von Marcus mit einer für die Schnurrende Traglast gedachten Zeichnung auf mich, die den Titel »Die Okay-Bande« trug und zwei Räuber zeigte, die zwei Postkutschern zuriefen: »Alles klar, Männer? Seid ihr okay?«
Das war genau der Stoff, auf den ich aus war.
Zu seinem zweiwöchentlich tagenden Debattierzirkel, an dem ich meistens teilnahm, hatte Michael Rutschky nun auch Kathrin Passig eingeladen. Wir fuhren gemeinsam hin, und als wir vier Stunden später wieder draußen waren, sagte sie: »Hat mir gut gefallen, daß die alle so geschrien haben. Aber ich glaube, ich passe nicht in Herrn Rutschkys Sonntagsschule. Interessant fand ich nur die Information, daß es Leute gibt, die Fische akupunktieren.«
Der Müllmänner- und auch der Postbeamtenstreik waren endlich vorüber, und ich erhielt einen Brief von Eugen Egner aus Worpswede, wo er und seine Gefährtin Urlaub gemacht hatten. Es sei alles sehr schön gewesen, nur das Essen beim »Sudlerwirt« nicht:
Wie ein Balkon-Ersatzreifen lag mir der Haifischbraten im Magen.
Oje. Was mochte Eugen da verspeist haben?
Während ich an meinem Buch für die Edition Tiamat schrieb, sah ich mir auf Video Filme an – »Der Pate«, »Der Pate – Teil II« und »Der Pate – Teil III« –, und als die tödlich getroffene Mary Corleone gegen vier Uhr morgens auf den Stufen des Opernhauses von Palermo verblutete, brach zwischen Jochen und Philipp ein Streit aus, der sich auch in mein Zimmer verlagerte. Es schien um eine Frau zu gehen. Die beiden Kampfhähne brüllten sich an und gingen mit den Fäusten aufeinander los, aber schon am nächsten Vormittag hatten sie sich wieder lieb.
»Was war noh da gäschdern nachd los?« fragte Sigrun. »I hon dachd, ihr batschd eich gloi ’n Schädl oi!«
»Vergiß es«, sagte Jochen. »Kleine Meinungsverschiedenheit.«
Auf Geheiß des Tip-Redakteurs Volker Gunske besuchte ich die Pressevorführung einiger Folgen der Serie Drei Drachen vom Grill, einer albernen Parodie der Vorabendserie Drei Damen vom Grill. Da wurden einem so matte Scherze zugemutet wie der, daß jemand bei einem Familienkrach in ein offenes Messer lief und die Hinterbliebenen seine Leiche im Wald verscharrten, aber ich war nicht wählerisch, was meine filmkritischen Auftragsarbeiten anging, und ich durfte schreiben, was ich wollte.
Klaus Bittermann hatte inzwischen das Cover für mein Buch collagiert: einen Zylinder, aus dem Jürgen Fuchs, Wolf Biermann, Sascha Anderson, Stephan Krawczyk, Lutz Rathenow, Vera Lengsfeld und andere Vertreter der DDR-Opposition herausquollen.
»John Heartfield läßt grüßen«, sagte ich, was Klaus sehr amüsierte.
»Und wie weit bist du jetzt?«
»Auf Seite achtzig.«
»Na, einen guten Monat hast du ja noch Zeit …«
Meine Lieblingswitzzeichnung in dem Buch »Aus der Toilette kamen Wischgeräusche« von Tex Rubinowitz war die von dem Mann, der sich über ein oben rauchendes und unten tropfendes Rohr beklagte: »Typisch Rohr – oben rauchts raus, unten tropfts, und in der Mitte issis verstopft.«
Im Vorwort beschrieb Max Goldt das Zimmer, in dem Tex Rubinowitz wohnte:
In einer Ecke stehen drei Säcke mit den Aufschriften: Staub 86, Staub 87 und Staub 88. Staub 89 und 90 sind noch nicht eingetütet, die liegen noch rum …
Ha! Und wie wollte er diese beiden Jahrgänge trennen?
Um mich abzulenken, hätte ich die Stunde, in der meine Zahnärztin an meinem defekten Schneidezahn tischlerte, gern mit Erinnerungen an Nicole verbracht, doch es gelang mir nicht, die Praxis in Gedanken zu verlassen.
»Spülen Sie bitte mal aus …«
Es wurde aufs Schauerlichste der Bohrer geschwungen. Nur Erleuchtete hätten sich dabei in einer erotischen Träumerei verlieren können. Oder Perverse.
Für meine Beiträge in der Rubrik »Briefe an die Leser« waren zwei kleine Schecks von der Titanic eingetroffen, und aus dem Stadtmagazin Zitty sprang mir neues Rohmaterial für diese Rubrik entgegen, aus einem Interview, in dem der Verleger Axel Matthes sich in urgroßväterlicher Weise als Kulturkritiker äußerte:
Ein gutes Buch bringt mich zum Sprechen, die Massenmedien strangulieren unser Sprechen.
Literatur sei Sehnsucht, sagte er da. Und:
Ohne das Rauschgift Buch und andere Anachronismen wüßte ich freilich nicht, wie das Jetzt aushalten.
Ich zitierte einige der Sätze und schrieb:
Wie sollen wir das jetzt aushalten? Ach ja, wir strangulieren einfach Ihr Sprechen.
Schon passiert.
Bevor ich diesen neuen Brief an die Titanic faxte, rief ich in Frankfurt an, um nach dem nächsten Redaktionsschlußtermin zu fragen.
Am Apparat war der Redakteur Christian Schmidt. Das Juniheft sei bereits fertig, sagte er. Und daß er mich gern kennengelernt hätte, als er im Februar in Berlin gewesen sei. »Vielleicht können wir das irgendwann nachholen. Und Sie sollten einfach mehr für uns machen, finde ich …«
Unsere Spülmaschine schwächelte: Sie legte los, als wäre alles in bester Ordnung, aber nach jeweils zwei oder drei Minuten hielt sie inne und gab einen Heulton von sich wie eine sterbende Robbe.
»Und wer kümmert sich jetzt darum?« fragte Jochen.
»Du«, sagte Lizzy.
»Aha. Und was krieg ich dafür?«
»Bist du nicht jemand, der schon alles hat?«
»Ach, stimmt ja … hab ich ganz vergessen …«
In Wirklichkeit krebsten Jochen und Philipp mit ihrer kleinen Werbefirma natürlich am Rande des Existenzminimums herum.
Aus irgendeiner alten Zeitschrift hatte Kathrin den Kolumnentitel »Reserviert für Eva Ping« und die Überschrift »Dieter – der ›Kachel-Caruso‹« ausgeschnitten und fertigte dazu bei einer Redaktionssitzung in meinem Zimmer ein paar Zeilen für die Schnurrende Traglast an:
Ich und der Kachel-Caruso, wir werden sein wie drei. Achso, und dann noch der Fugen-Figaro! Dann werden wir nochmal neu durchzählen müssen. So stelle ich mir das vor.
Eure Eva Ping
P.S.: Bleibe am Ball!
Meinen Rat, ihr Studium abzubrechen und Schriftstellerin zu werden, schlug Kathrin jedoch in den Wind: »Ich hab dir schon mal gesagt, daß ich dafür nicht eitel genug bin …«
Seit sieben Uhr morgens operierten Bauarbeiter unten im Hof mit einer Kreissäge, und der seit halb acht auf die Spülmaschine einhämmernde Kundendienstmensch tat ein übriges, um mich aus dem Schlaf zu reißen. Die Sinfonie der Großstadt!
In meiner Zahnarztpraxis bekam ich einen Kostenvoranschlag für die weitere Behandlung. »Damit müssen Sie zu Ihrer Krankenkasse«, wurde mir gesagt, »und zwar am besten persönlich, denn sonst dauert die Bearbeitung Wochen …«
Klar. Ich hatte ja nichts anderes zu tun und konnte meine Tage gut damit verbringen, in Berlin herumzuflitzen und in Wartezimmern Däumchen zu drehen.
Kathrin brachte mir dann doch einen kurzen Text vorbei, von dem sie glaubte, daß er sich für Kowalski eigne:
Als ich in der U-Bahn Eugen Egners »Meisterwerke der grauen Periode« studierte, stieg Orla Froschfresser ein und setzte sich neben mich. In letzter Zeit scheine ich solche Kreaturen anzuziehen. Orla Froschfresser war mindestens einsneunzig groß und trug schwarzes Leder.
»Heda, schöne Frau!« krächzte er. »Mit dem Buch!« In der Tat waren einige schöne Frauen anwesend, aber keine hatte ein Buch, nur ich. Standhaft starrte ich hinein, das verdroß ihn. »Nur Bilder und Geschichten??« maulte er und schielte garstig in mein Buch, »nur Bilder und Geschichten, hä?« Was erwarten die Leute eigentlich von Büchern? Orla hatte offensichtlich noch nie eines gesehen. Wie? Man kann sie nicht ficken? Nicht austrinken? Ekel und Enttäuschung! Das kommt davon, wenn man auf die Kunst keinen anderen als jenen Schlüssel anwendet, mit dessen Hilfe man die Gegenstände des täglichen Umgangs als sinnvoll begreift. Ficken! Austrinken! Dumm sterben!
Ich faxte die Seite an die Redaktion, mit den besten Empfehlungen, und sagte Kathrin wahrheitsgemäß, daß sie sich jetzt ungefähr ein halbes Jahr lang auf das Honorar freuen könne.
Da ich mit Max zum Testen exotischer Biersorten verabredet war, mußte ich schleunigst welche auftreiben. Ich fand aber nicht viele. Continental Guinness, Eschweger Klosterbräu, Newcastle Brown Ale, Imperial Russian Stout …
Er selbst hatte sogar japanisches und mexikanisches Bier ausfindig gemacht. Zuerst gab es bei ihm jedoch eine Original-DDR-Champignon-Tütensuppe und dazu mit Holstener Liesel bestrichenes Finn-Crisp-Knäckebrot. Ob das als Grundlage genügte?
Es müsse natürlich nicht immer Hausmacherkost sein, sagte er. »Wir können auch mal burmesisch essen gehen. Oder uruguayanisch. Auch polnisch würde mich reizen. Mikronesisch oder nauruisch wäre zu gewählt.«
»Wie wär’s mit ghanaisch?«
»Geht nicht. Es gibt nur allgemein afrikanische Restaurants. Afrikaner scheinen alle das gleiche zu essen …«
Dann spielte er mir Stücke einer Band namens Sparks vor. Das sei »große, heilige Musik«, und ich solle mir gleich morgen bei WOM in der Augsburger Straße, Ecke Kudamm, für 39 Mark 90 »The Ultimate Sparks Collection« besorgen!
Aber was die Sparks da taten, mochte noch so brillant sein – das einzige, was ich von Musik verlangte, war, daß mir bei ihr das Herz aufging. Auch wenn Adorno das kulinarische Hören verboten hatte.
Als Max von mir vernahm, daß ich vorhätte, das Buch seines Freundes Tex Rubinowitz für den Tip zu besprechen, bat er mich, in der Rezension lauter Behauptungen aufzustellen, über die Tex sich wundern werde: »Schreib, daß er Ohrlochpistolen ablehnt! Und daß er Robert Gernhardt mal einen Lünebest-Joghurt zugeschickt hat. Und daß er nie, nie, nie seine von Tesafilmstreifen zusammengehaltene Brille putzt!«
Beim Verkosten des Biers gingen wir anfangs noch bürokratisch vor: Max notierte die Uhrzeit, und dann probierten wir zum Beispiel ein belgisches Dünndampfbier oder ein Schinkenbier und erteilten ihm eine Note, die Max ebenso festhielt wie alle ergänzenden Bemerkungen (»schmeckt nach Petroleum«, »marmeladig«, »katenrauchfleischartig salzig«, »ungustiös«). Mit der Zeit wurden die Urteile gröber und die Notizen fahriger, aber wir besaßen noch genug Geistesgegenwart, um uns für Sonnabend zu verabreden, und zwar zu Marlene Dietrichs Beerdigung auf dem Friedhof an der Stubenrauchstraße. Treffpunkt: das Restaurant in der Hertie-Filiale am Walther-Schreiber-Platz.
Am Freitag mußte ich leider schon um sieben Uhr aufstehen. Meine alte Liebe Andrea hatte sich angekündigt: Sie war wieder einmal auf der Durchreise nach Brandenburg zu der Kommune, die sich Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung nannte, abgekürzt ZEGG, und wollte vorher gern mit mir im Grunewald lustwandeln, was an sich ein guter Plan war, aber wenn man es nicht darauf anlegte, öffentliches Ärgernis zu erregen, konnte man im Grunewald zwar spazierengehen, aber nicht miteinander schlafen, und nach zwei Stunden mit Andrea schmerzten meine Schwellkörper.
Günther Willen, einer meiner treuesten Korrespondenten, schrieb mir aus Hamburg, daß ihm die deutsche Einheit »voll auf den Kanister« gehe:
Vom Stasi-Unfug ganz zu schweigen. Kann und will darüber nichts mehr aufnehmen. Heute war z.B. ein langweiliger Tag, das heißt, wir schrieben hier in Hamburg 25 Grad. Ich also nichts wie rein ins Haus, habe praktisch keinen Schritt vor die Tür gemacht. Genieße den Schatten, lese einen guten Krimi über einen nörgelnden Kältetechniker, mache mir ein schönes TV-Dinner (irgendwas mit Tomatenmark), schalte die Kiste ein – und hastdunichtgesehn irgendwas mit der deutschen Einheit. Ich natürlich gleich wieder ausgeblendet. Geht nicht.
Die Redewendung »Geht nicht« schien gerade im Kommen zu sein.
In Sigruns Zimmer hatte ein Redakteur des Hochschulmagazins IQ das Ende April von ihr geschossene Foto erblickt, das mich zeigte, wie ich mit Perücke und Kunstschnurrbart auf einer Sesselruine einen Penner mimte, und das wünschte er sich als Titelbild für die nächste Ausgabe.
»Wenn mein Name nicht genannt wird, hab ich nichts dagegen«, sagte ich. »Wie hoch ist denn die Auflage?«
»Dreißigtausend.«
Coverboy Martin Schlosser! Das mußte ich Eugen schreiben. Der würde staunen.
Auf dem Friedhof schlossen Max und ich uns im warmen Maisonnenschein einer langen Menschenschlange an, die aus gutbürgerlichem und normalem Volk und auch aus schrill aufgetakelten Transvestiten bestand und nur zögerlich vorrückte.
»Das sind keine Transvestiten, sondern Drag Queens«, sagte Max.
»Und was ist da der Unterschied?«
»Transvestiten haben das Bedürfnis, sich durch das Tragen von Frauenkleidung aufzugeilen, aber eher heimlich, im Kabüffchen. Drag Queens wollen strahlen und scheinen, leuchten und gesehen werden …«
Es vergingen zwei Stunden, bis wir vor Marlene Dietrichs offenem Ehrengrab standen und je eine Handvoll Sand hineinwerfen konnten.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund …
Max trug sich sogar in das aufgebahrte Kondolenzbuch ein.
»Könnd ihr des mol leisr schdella?« schrie Sigrun durch die Wohnung, als ich wiederkam. »Man verschdehd ja sai eigenes Word nemme!«
Was sie nervte, war die von Jochen und Philipp auf volle Lautstärke gestellte Radiokonferenzübertragung vom letzten Spieltag der Bundesliga. Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart befanden sich punktgleich an der Spitze, und nun lag Dortmund auswärts in Duisburg mit einem Tor vorn, während es zwischen Leverkusen und Stuttgart 1:1 stand und zwischen Rostock und Frankfurt gleichfalls 1:1. Wenn es dabei blieb, war Dortmund Meister, zum erstenmal seit 1963, aber dann schoß Guido Buchwald in der 86. Minute das 2:1 für den VfB, der das bessere Torverhältnis hatte als Dortmund. Kurz darauf ging Rostock mit 2:1 gegen Frankfurt in Führung, und weil auch den Dortmundern bis zum Schlußpfiff nichts mehr glückte, holte Stuttgart sich den Meistertitel.
»Sigrun!« schrie Jochen jetzt zurück. »Schduagard isch Meischdr! Hörsch mi?«
Er selbst war ein Anhänger des 1. FC Nürnberg, der auf dem siebenten Platz gelandet war. Sechs Plätze vor Gladbach.
Bei Getränke Hoffmann begegnete ich der Schneiderin Beate, die nicht Beate genannt werden mochte. Und von der ich einmal verführt worden war. Oder umgekehrt.
»Komm mich doch mal wieder besuchen«, sagte sie und gab mir einen kleinen Beckenkick. »Meine Nummer haste ja.«
She had that certain flash every time she smiled …
Das war die Welt, in der ich leben wollte. Babylon! Gomorrha! Sodom!
Jochen unterrichtete mich davon, daß der SV Meppen in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga »verkackt« habe. Sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen.
Schauderhaft war ein Buch mit Betrachtungen, Reden und Aphorismen von Franz Werfel, das Carola mir auf meinen Wunsch bestellt hatte:
Liebes- und beziehungstaub keucht ein Ich am anderen vorbei. Der Rest ist Elend und Verbrechen.
Und:
Die Sünde ist der geheimnisvolle Inbegriff der Verkehrtheit des verkehrten Lebens.
Und:
Tod ist gefrorene Zeit. Zeit ist geschmolzener Tod.
Solchen Stuß durfte man nur bis zur Obersekunda schreiben. Franz Werfel war kein Dichter gewesen, sondern ein von sich selbst ergriffener Zuckerbäcker.
Völlig unverständlich war mir auch, was andere Männer an dem Model Claudia Schiffer fanden. Im direkten Vergleich mit dieser maschinell erzeugten Schönheitskönigin besaß selbst die alte Frau Waas aus den Jim-Knopf-Romanen mehr Sex-Appeal.
Anruf eines Kowalski-Lesers aus Bayern: »Florian Eberle hier. Ich hatte Sie ja Ende April zum DFB-Pokalfinale Gladbach und Hannover am kommenden Sonnabend eingeladen. Erinnern Sie sich?«
»Natürlich.«
»Die Frage wäre jetzt die, ob ich dann vielleicht bei Ihnen übernachten kann.«
»Ja, das geht …«
»Von Freitag bis Sonntag?«
»Ja.«
»Und könnte ich eventuell auch ein paar Freunde mitbringen?«
»Wie viele denn?«
»Sieben.«
Sieben! Das war so unverschämt, daß ich es schon wieder rührend fand. »Gut, wenn Sie keine zu hohen Erwartungen hegen … und sich Schlafsäcke und Luftmatratzen mitbringen …«
Der Spiegel kolportierte eine Äußerung der Chansonette Evelyn Künneke:
Für alle, denen Marlenes Heimkehr wegen ihres tapferen Anti-Hitler-Kurses ein Greuel ist, sprach Evelyn Künneke die ungeflügelten Worte: »Es gefällt mir nicht, wenn jemand sein Vaterland verleugnet.«
Diese Giftspritze! Sie selbst hatte der Wehrmacht als singende Truppenbetreuerin gedient und fand das also auch ein halbes Jahrhundert später anständiger als Marlene Dietrichs Weigerung, für Joseph Goebbels auf den Strich zu gehen.
Als ich mit dem Kostenvoranschlag bei der weit entfernten Barmer Ersatzkasse erschien, hieß es: »Wir haben hier gerade einen Systemausfall.«
Der Fluch des EDV-Zeitalters!
»Haben Sie denn Ihr Bonusheft dabei?«
»Mein was?«
»Ihr Bonusheft. In dem Ihre Zahnarztbesuche verzeichnet sind.«
»Davon weiß ich nichts.«
»Bei wem sind Sie denn in Behandlung?«
»Bei Frau Brunner. Aber erst seit Ostern.«
»Und davor?«
»Bei Frau Schwickerath.«
»Und da ist Ihnen kein Bonusheft ausgestellt worden?«
»Nein.«
»Dann müssen Sie da nochmal vorstellig werden. Sonst können wir Ihnen nicht helfen.«
Auch das noch. Stöhnend gondelte ich wieder heim. Zwei Vormittagsstunden futsch, für nichts und wieder nichts.
»Wie ist noch gleich die Nummer der Telefonauskunft?« fragte ich Philipp.
»In Berlin kannste das vergessen«, sagte er. »Da verhungerste in der Warteschleife.«
Ich versuchte es trotzdem und ergatterte schon nach drei Minuten die Nummer meiner alten Zahnarztpraxis. Dort meldete sich eine Stimme vom Anrufbeantworter: Die Praxis sei montags erst ab elf Uhr dreißig besetzt.
Es war 11.27 Uhr. So wurde man vom Leben ausgebremst.
Oma hatte mir geschrieben:
Mein lieber, wenn auch uralter Martin!
Wo nun der Poststreik zu Ende ist, hoffe ich, daß mein inhaltsschwerer (70 DM) Brief für Deinen Geburtstag doch noch bei Dir ankommen wird! Nun haben wir auch im kühlen Friesland sommerliche Wärme, die ich sehr genieße. Ich habe es diese Woche überhaupt sehr gut, denn seit Montagabend ist Dagmar hier, was mein ganzes Leben und Befinden positiv beeinflußt, oh, Du weißt ja, wie sehr sie mich belebt! Es geht mir richtig gut! Gestern bekam ich eine Karte von Wiebke aus Spanien und einen Brief von Kim, die wochenlang geschäftlich in Gibraltar und Portugal weilte und sich dort eine Vergiftung zuzog. Da gibt es ja nicht so frische Fische wie auf dem Wochenmarkt in Jever. Wir essen heute Schollen, abends Granat und Sonntag Spargel mit Schinken. Gerne würde ich Dich auch mal wieder bewirten. Nun kommt Dagmar dran! Von mir noch liebe Grüße! Oma
Moin Martin, lieber Patensohn! Das Wetter ist seit heute (ätsch) hochsommerlich, und so fühle ich mich richtig toll (im Gegensatz zu Dir …!). Ich habe eingekauft en gros, habe den Friedhof »bestückt«, habe Oma einen neuen Wasserkocher verschafft, der sich automatisch abschaltet etc. Auch die neue Bank vor der Haustür wurde teetrinkenderweise eingeweiht. Um Pfingsten oder Ende Mai fährt Oma zu Luise. Auf bald – Dagmar
Jetzt war ich wieder halbwegs auf dem laufenden über die Aktivitäten der Sippenmitglieder.
»Normalerweise verschicken wir Bonushefte aber nicht mit der Post«, sagte eine Tante aus Frau Schwickeraths Praxis, aber durch gutes Zureden konnte ich eine Ausnahmeregelung erwirken.
Anschließend wetzte ich zur Sparkasse, zum Büchereck, zum Fotoladen, zu Edeka, zum Copy-Shop und zu Getränke Hoffmann, Pfandflaschen wegbringen und neues Bier holen. Und irgendwas essen mußte ich auch noch.
Der Kicker war wirklich stets für die verwegensten Wortspiele gut:
Ist Effe über den Berg?
Vom selben Geist zeugten einige Überschriften im Kicker-Sonderheft zur Europameisterschaft:
Sammer hat das Zeug zum Hammer
Binz bringt’s
Helmer beinhart – Bein arm dran
Sehr flüssig las sich auch der Gastkommentar des Weltmeisters Klaus Augenthaler:
Denn jede Abwehr sieht nur so gut aus, wie das Mittelfeld die Räume zumacht und vor allem die Außenbahnen abschirmt.
»Dir hängd a Zibfl Schbinad am Kinn«, sagte Sigrun, als sie am Eßtisch vorbeikam.
Leider ging die Schneiderin nie ans Telefon. Doch dafür nahte der Termin, an dem sich der bereits 1982 in Pardon ausgesprochene und auch von mir geteilte Wunsch des Dichters Horst Tomayer nach einem genscherfreien Tag erfüllte, denn der Außenminister Hans-Dietrich Genscher war nach achtzehn Amtsjahren zurückgetreten. Ein Leben ohne diesen segelohrigen Intriganten, der sich einst mit Hilfe des Springerkonzerns aus der sozialliberalen Koalition hinausgestohlen hatte, rückte damit für uns Fernsehzuschauer und Zeitungsleser in eine fast greifbare Nähe.
Beerbt worden war Genscher von dem Freidemokraten Klaus Kinkel, der schon als Präsident des Bundesnachrichtendienstes einschlägige Erfahrungen gesammelt hatte.
Im Debattierzirkel sollte Martin Heideggers Aufsatz »Die Frage nach der Technik« durchgenommen werden, und ich mühte mich redlich damit ab.
Das Unaufhaltsame des Bestellens und das Verhaltene des Rettenden ziehen aneinander vorbei wie im Gang der Gestirne die Bahn zweier Sterne. Allein, dieser ihr Vorbeigang ist das Verborgene ihrer Nähe …
Nein, hier philosophierte Heidegger nicht. Er schwallte.
Kathrin hatte Zeichnungen vom »Sexualverhalten bei Bärenmakaken der Kolonie an der Universität Stanford« entdeckt und schenkte mir Kopien davon für die Schnurrende Traglast.
»Die treiben’s ja ganz schön bunt.«
»Und rumschwulen tun sie auch noch«, sagte Kathrin.
Unterdessen hatte Eugen Egner einen Auftrag erhalten, der ihn überanstrengte:
Zum 250. Geburtstag von Herrn Lichtenberg will die Stadt Göttingen heuer eine große Ausstellung zelebrieren. Man hat mich zur Mitwirkung eingeladen, weil anhand meiner verschiedenenorts veröffentlichten Werke der Schluß gezogen wurde, ich könne evtl. eine günstige Einstellung zu dem Herrn haben. Und richtig: Der Mann, der vermutete, die Erde könne ein Weibchen sein, und seinen Hausschuhen Namen gegeben hat, liegt mir in der Tat am Herzen. Allzu gern lese ich immer wieder in seinen Aphorismen, wenn ich nicht gerade etwas anderes tue. Als »ausgewählter Tiefgräber« (lt. Informationstext) werde ich versuchen, mir zu dem Thema was einfallen zu lassen. Bis jetzt ist mir aber noch nichts eingefallen. – Immer noch nicht. – Jetzt auch noch nicht. – Nichts. – Noch immer nicht – wird mir noch etwas einfallen? – Wenn ja, wann? – Wehe …
Andere hätten einfach irgendwas hingekleistert, aber Eugen war skrupulös.
Obwohl ich es haßte, unzureichend bekleidet herumzulaufen, legte ich mir ein ärmelloses Oberhemd zu, ein sogenanntes Muscle-Shirt, denn anders ging es bei dieser Hitze nicht mehr. Und der Schweiß tropfte mir trotzdem von der Nase auf die Tastatur und auf die Seiten, die ich für den Verlag Weisser Stein ausdruckte.
Nachts um drei kam Sigrun schlafblind in mein Zimmer und fragte: »Isch des a Nadeldruggr?«
»Äh … ja.«
»Der isch ziemlich laud. Brauchsch no lang dafür?«
»Ich kann auch morgen weiter ausdrucken.«
»Des wär mordsmäßich nedd …«
Der Kollege Frank Schulz erinnerte mich per Postkarte an einen schon etwas älteren Autogrammwunsch:
Denkst Du dran, bei Gelegenheit mal nach Wencke Myrrhe, Mürre oder Myre/Myrre/Myrrre zu schauen?
Er wußte, daß ich von meinem Vetter Gustav eine große Autogrammsammlung geerbt hatte. Ich sah nach, und wahrhaftig, es war eine Autogrammkarte der Schlagersängerin Wencke Myhre dabei. Aber unsigniert!
Ich schickte Frank die Karte trotzdem und steckte als Zusatzprämie eine signierte Autogrammkarte der Schauspielerin Uschi Glas in den Umschlag.
Nachdem Michael Rudolf und ich uns telefonisch auf den Buchtitel »Moselfahrten der Seele« geeinigt hatten, brachte ich die ausgedruckten Seiten zur Post. Mit Expreßzuschlag und Aufpreis für ein Einschreiben kostete mich das Päckchen fast zwölf Mark. In meiner Zeit als Hilfsarbeiter hätte ich dafür rund achtzig Minuten lang Schneckenwellen und Schoko-Crossies verladen müssen, während der Drogenboß Pablo Escobar die gleiche Summe wahrscheinlich in jeder Picosekunde scheffelte.
Interessehalber fuhr ich zum Alexanderplatz und besuchte eine Wahlkundgebung der rechtsradikalen Republikaner, bei der ihr Bundesvorsitzender Franz Schönhuber sprach, der auf eine stolze Vergangenheit als SS-Unterscharführer zurückblicken konnte.
Vor der Tribüne hatten sich viele Männer mit ausrasiertem Stiernacken versammelt. Einer applaudierte so wütend, als ob er lieber jemanden verprügelt hätte, und wenn es nichts zum Applaudieren gab, reckte und streckte er sich wie ein Boxer vor der ersten Runde.
Ihm und seinen vielen mißgelaunten Kameraden gehörte gewiß nicht die Zukunft. Man sah ihnen das Scheißkerlhafte viel zu gut an.
Mein Buch für Klaus Bittermann war erst auf fünfzig Seiten angewachsen, und im September sollte es schon erscheinen. Ich mußte einen Zahn zulegen, aber nebenbei wollte ich mir ein paar Thriller ansehen, und so traf es sich, daß ich die Schneiderin wiedersah, denn sie arbeitete jetzt als Videothekarin.
»Aber gleich hab ich Feierabend«, sagte sie. »Wollen wir was trinken gehen? Bei mir?«
Ihren Sohn hatte sie gerade irgendwo anders geparkt, und wir hielten uns nicht lange mit dem Vorspiel auf.
Nachdem ich Walter Kempowski ein Kärtchen mit Genesungswünschen geschickt hatte, versuchte ich mich noch einmal an Heidegger:
Im Blick und als Blick tritt das Wesen in sein eigenes Leuchten. Durch das Element seines Leuchtens hindurch birgt der Blick sein Erblicktes in das Blicken zurück. Das Blicken aber wahrt im Leuchten zugleich das verborgene Dunkel seiner Herkunft als das Ungelichtete …
Selbst wenn das alles wahr gewesen wäre, hätte es mich nicht interessiert. Viel lieber nahm ich mir die neue Ausgabe der Briefe von Karl Valentin vor. Im November 1928 hatte er an eine »Hochwohlgeborene Firma« geschrieben, daß ihr »Fahnenalbum« ihm viel Freude mache. Nur das Einkleben der Bilder sei katastrophal schiefgegangen. Er habe einen »Mehlpapp mit Zusatz von oberbayrischem Brunnenwasser« angerührt …
Dieser Mehlpapp hatte jedoch nicht die richtige Klebkraft, denn schon nach kurzen 22 Minuten fielen die Bilder schon wieder aus dem Album heraus. Ich habe über dieses Vorkommnis tagelang geweint.
Danach seien die Bilder von einem Spengler in das Album hineingelötet worden, was zu einer Feuersbrunst geführt habe:
Der Spengler und der heisse Lötkolben wurden sofort wegen Brandstiftung verhaftet. Dies zur gefälligen Kenntnis.
Da kam Heidegger nicht mit.
Zwei der acht Pokalfinalgäste fragten mich nach einem Blick auf meine Bücher, ob ich die alle gelesen hätte, und dann richtete sich die ganze Schar in unserem vakanten WG-Zimmer ein, bevor sie sich in das Nachtleben stürzte. Florian Eberle hätte mich gern dabeigehabt, aber das ging nicht: Ich mußte nun wirklich ernsthaft an meinem Buch arbeiten.
Bei ihrer Rückkehr verhielten sich meine Besucher vorbildlich leise, doch am nächsten Tag äußerte Jochen eine Beschwerde: »Wenn du das nächste Mal so viele Leute einlädst, dann bring ihnen doch bitte vorher bei, wie man duscht. Die haben das halbe Badezimmer geflutet …«
»Und wo sind sie jetzt?«
»Irgendwo in der Stadt. Und ich soll dir von ihnen bestellen, daß sie dich um drei Uhr abholen wollen.«
Mit ein paar Fotos von der Feier meines dreißigsten Geburtstags hatte ich Eugen eine frohe Minute bereitet:
Zentralgeheizten U-Boot-Dank dafür und viel mehr! Abgesehen von Dir, sowohl mit Bart als auch mit Gesicht, hat uns Hiesigen ’s Kathreinerle am besten gefallen. Sie schreibt nicht nur beseligt-beseligende Karten, nein, sie bietet auch einen erfreulichen Anblick. Weitermachen, Frau Spaßig! Unbedingt! Schön, schön!
Diesen Absatz las ich Kathrin am Telefon vor.
»In deiner Antwort solltest du aber klarstellen, daß du kein Bartträger bist«, sagte sie. »Sonst werden die Germanisten dich in hundert Jahren mit Günter Grass verwechseln.«
Olympiastadion, Oberring in der Westkurve, Block 14 links, Reihe 1: Dort waren unsere Plätze. Links von mir saß Florian Eberle mit seinen Mannen und rechts ein Schreihals, der seine Begleiter pausenlos mit nichtsnutzigen Kommentaren versorgte (»Also, bis jetzt hat Hannover ja mehr Spielanteile, aber die Flügelwechsel müssen noch schneller gehen!«).
Meine Stimmung wurde auch nicht durch die Bratwürste, das Bier und den Pissoirgestank gehoben, und schon gar nicht dadurch, daß der Zweitligist Hannover 96 nach einhundertzwanzig zähen und torlosen Spielminuten im Elfmeterschießen über Gladbach triumphierte.
Florian Eberle sagte, daß es anders gelaufen wäre, wenn Günter Netzer sich in der Verlängerung selbst eingewechselt hätte. Von Spielern wie Criens und Pflipsen könne man keine Wunder erwarten.
Übel waren auch das langwierige Hinauswalzen aus dem Stadion und die Verkehrsmittelbenutzung in Gesellschaft besoffener Fans.
Mit meinen Gästen ging ich zwar noch ins Nova, aber ich blieb nicht lange, denn als sie hörten, daß ich etwas für Bob Dylan übrig hätte, bezeichneten sie mich als »Tunte«, und das stand ihnen nicht zu. Acht Mann hoch bei mir kampieren und mich dann mit einem Ausdruck belegen, der bei ihnen in Bayern als ehrenrührig galt? Ja, wo samma denn?
Zugute halten mußte ich ihnen jedoch, daß sie am Sonntag säuberlich hinter sich aufräumten und keinen Krümel zurückließen.
Bei der Kommunalwahl stimmte ich für KPD/RZ (Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum). Diese Partei wollte die Hundesteuer um 700 % erhöhen und wegen der Häßlichkeit von Männerbeinen ein bei Außentemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gültiges Ausgehverbot für Herren erlassen.
Ein Anruf von Oma: Ob denn nun endlich der Geburtstagsbrief angekommen sei.
»Ja, gestern mittag«, log ich. »Vielen herzlichen Dank!«
Was hätte sie von der Wahrheit gehabt, daß ihr Brief von der Post versaubeutelt worden war?
Die sizilianische Mafia hatte einen Untersuchungsrichter mit einer Bombe umgebracht. Giovanni Falcone.
»Da kannst du Gift drauf nehmen, daß das mit dem Ministerpräsidenten Giulio Andreotti abgesprochen war«, sagte Philipp. »Der knödelt in Italien schon seit ’ner halben Ewigkeit ganz oben mit, und das schafft man nicht ohne den Segen der Mafia …«
Jochen, der ebenfalls vorm Fernseher saß, vertrat die Meinung, daß die Cosa Nostra anfänglich die richtigen Ziele verfolgt habe: »Das war mal ’ne antikolonialistische und später auch antifaschistische Organisation. Die kannste nicht pauschal verurteilen und sagen, hey, ihr handelt mit Drogen, also seid ihr Verbrecher! Verstehste? Da mußte auch mal die Hintergründe mitbedenken!«
Der geschichtliche Hintergrund sei ihm scheißegal, schrie Philipp. »Wenn ich sehe, wie die Mafia da die Leute umlegt, dann braucht mir keiner mehr mit der Antifaschismuskiste zu kommen! Da hört’s bei mir auf!«
In der neunten Folge seiner abonnierbaren Autobiographie erzählte der alte Verleger Jörg Schröder, wie er und seine damalige Frau Erika 1973 einmal Harry Rowohlt aus einer psychiatrischen Klinik in Rinteln abgeholt und mit ihm eine Striptease-Bar aufgesucht hätten:
Augenblicklich entwickelt sich enthemmte Geilheit, langsam und lüstern fallen Kittel, BH und Strapse, dann sieht man Brüste und Schamhaar, »schrumm, schrumm, schrumm«, Trommelwirbel.
Um elf habe Harry Rowohlt zurück in die Klinik gemußt:
Wir begleiteten ihn, und er stieg über die Mauer wie Fuchsberger in einem seiner frühen Würgerfilme.
Was für ein wunderschöner Satz. Auch wenn ich den Wahrheitsgehalt nicht beurteilen konnte.
Gegen den Protest von Lizzy, die fand, daß bei uns schon genug Müll herumrotte, bugsierte Torsten einen irgendwo geklauten Einkaufswagen in die Wohnung: So ein Gerät könne man immer brauchen …
Es fand auch gleich Verwendung bei einer kleinen Fotosatire, die ich mir für Kowalski ausgedacht hatte. Ich klebte Torsten ein Blatt Papier mit der Aufschrift »CIA« ans Hemd, setzte mir selbst eine Sonnenbrille auf, klebte mir wieder den künstlichen Schnurrbart an und ließ mich von Torsten im Einkaufswagen herumschieben. Das von Sigrun aufgenommene Foto konnte dann mit der Schlagzeile erscheinen:
Ringo Starr wurde von der CIA gekauft!
Für ein anderes Beweisfoto stellte ich mich mit zwei Makkaroni als Schlegeln zwischen Lizzy und Philipp:
Ringo Starr (Mitte) stand zwischen Yoko Ono und John Lennon!
Da Lizzy tatsächlich ein bißchen Ähnlichkeit mit Yoko Ono hatte, nahm Sigrun auch noch ein drittes Beweisfoto auf:
Als Ringo Starr das Gitarrespielen zu lernen versuchte und die Masern bekam, brachte ihm Yoko Ono Kaffee ans Bett!
»So verdienst du also dein Geld«, sagte Jochen, der kopfschüttelnd zusah. »Während unsereiner sich mit ehrlicher Arbeit abmüht …«
Die Masernflecken hatte ich mir mit einem Edding ins Gesicht getupft.
Von Dagmar hörte ich telefonisch Ungutes über die Lage in Meppen: »Deinem Bruder Volker hat dein Vater endgültig das Haus verboten. Das hat mir Therese berichtet. Er hat sie neulich wieder mal angerufen, und da hat er sich auch über dich und deine berufliche Traumtänzerei ausgelassen …«
Seit Papa verwitwet war, sprach er in unregelmäßigen Abständen Bannflüche aus. Mal über mich, mal über Volker, mal über seine Brüder und manchmal selbst über Renate. Nur über Wiebke meines Wissens nicht.
Ich durfte Papa aber noch besuchen kommen. Ende Mai diente ich ihm in Meppen drei Tage lang mit Einkaufsfahrten, Rasenmähen, Rindsrouladen, Kohlrabi und Salamibaguettes, und um mir auch mal eine Freude zu bereiten, schrieb ich einen langen Brief an meine flüchtige Freundin Nicole, die Gute, die mich hoffentlich noch nicht vergessen hatte.
Wieso war es zu dieser Jahreszeit schon so heiß? Ich schwitzte sogar im Liegen, fächelte mir mit einer Wurfsendung der Firma Mayrose Luft zu und soff jeden Tag vier Liter Cola.
In Jever tischte Oma mir eine Mammutportion Spargel auf und kassierte gleich danach drei schwere Schlappen im Malefizspiel, was ihr aber nichts ausmachte. »Hauptsache, du bist wieder mal hier, mien Jung!« sagte sie. »Wie geht’s denn deinem Vater?«
»Mittelhochprächtig.«
»Achtet er jetzt mal ’n bißchen auf seine Ernährung?«
Damit spielte sie auf Papas Zuckerkrankheit an, die ihn nicht groß bekümmerte. Er hatte nicht den Wunsch, noch möglichst lange zu leben.
Ich sagte Oma, daß Papa stark abgenommen habe, doch das war ihr auch wieder nicht recht: »Wenn einer nichts mehr auf den Rippen hat, dann ist das ganz sicher kein gutes Omen!«
An meinem alten Arbeitsplatz der Jahre 1989 bis 1991, der jeverschen Rumpeldiscothek Na Nu, drang der dicke Stammgast Wulf auf mich ein: »Haste inzwischen mal was über mich geschrieben? Das wollteste doch!«
Er trug kreischend bunte Shorts. Und er setzte noch einmal an: »Ey! Sachma! Wann schreibste endlich was über mich?«
»In meinen Lebenserinnerungen werde ich dich gebührend würdigen.«
I can feel it coming in the air tonight …
»Und wann kommen die raus?«
»2042.«
»In fuffzig Jahren! Leck mich fett! Da bin ich ja schon mit ’ner Altersmeise gesegnet …«
Er geriet dann wegen irgendeiner Frau in Streit mit einem Ochsen aus Addernhausen und wollte sich draußen mit ihm hauen. Ich ging als Schaulustiger hinter den beiden her, und als ich vor die Tür trat, rammte mir der Ochse seinen Schädel ins Genick, obwohl ich an diesem Revierkampf gar nicht beteiligt war.
Anyone with any sense had already left town …
Wie gut, daß ich meinen Wohnsitz von Friesland nach Berlin verlegt hatte!
Am Oldenburger Bahnhofskiosk kaufte ich mir auf der Rückreise die Frankfurter Rundschau, und ich hatte Glück: Es stand eine interessante Reportage darin, von Jutta Roitsch, die sich auf eine »Spurensuche in der ›kalten‹ Heimat Ostpreußen« begeben hatte und ernüchtert zurückgekehrt war:
Auch die Heimweh-Touristen, die jeden Abend im Beton-Hotel »Baltica« ihre Erfahrungen austauschen, machen sich da nichts vor. Hier leben will keiner, die Jüngeren reizt die billige Exotik. Für sie zählen auf dieser Reise die kleinen, anrührenden Gesten: Die Bäuerin, die ein Bund Zwiebelpflanzen mitgibt, »damit Sie im Winter Zwiebeln aus der Heimat haben«; der Apfelbaum-Zweig aus dem väterlichen Garten zum Aufpfropfen.
Diese Zeitungsseite wollte ich Papa schicken.
In Berlin war das Sonnengeschrei noch schlimmer als auf dem Lande. Man wurde gebraten, ohne sich in einen kühlen Kellerraum retten zu können. Das war der einzige Punkt, in dem ich eine andere Meinung vertrat als Leonard Cohen: In seine Hymne an die Sonne hätte ich nicht eingestimmt.
And the light came from her body …
Mir lief der Schweiß in Bächen aus den Achselhöhlen, und ich haßte das.
Frank Schulz regte brieflich einen kleinen Skandal auf der Frankfurter Buchmesse an:
Vielleicht könnte man ja ein bißchen als enfants terribles auftreten, oder tut man sowas nicht mehr? Ich überleg mir schon mal ein Konzept. Eventuell sollte es ganz gut kommen, entzündete man den Haffmans-Stand mit einem Fünfmarkschein, der anschließend einer dicken Brazil Feuer spendete, deren Raucher einen hysterischen Veitstanz um den jammernden Verleger aufführte.
Wie wär das?
Mit seinem Verleger Gerd Haffmans hatte Frank anscheinend ein Hühnchen zu rupfen, aber immerhin war er ein Haffmans-Autor und gehörte mithin zur Elite.
Auf Wunsch der Tip-Redakteurin Ulrike Kowalsky sah ich mir ein Video vom Premierenabend des neuen deutsch-französischen Fernsehsenders Arte an, der »eine neue Kommunikationskultur« herbeiführen wollte: Eine mondäne Postbotin schwang sich eine Wendeltreppe hinauf in den Festsaal; hinter Riffelglas krümmten sich Tanztheaterpantomimen und schlüpften durch Drehtüren; eine Kamera umkurvte einen Konzertflügel; Gerhard Polt, Peter Ustinov, Hanna Schygulla und der Krakelmaler Penck wurden ein- und wieder ausgeblendet, und dann trat Wolf Biermann ins Rampenlicht und sagte: »Ja, es ist schön, daß ich gelegentlich auch als Transportarbeiter arbeiten kann, als Transportarbeiter für Worte und Musik, und ich möchte Ihnen dieses Lied ›Il n’y a pas d’amour heureux‹ zeigen in deutscher Sprache. Das hat den Vorteil, die Franzosen kennen es sowieso, und die Deutschen freuen sich, wenn sie ein schönes Lied aus Frankreich hören. Dabei will ich Ihnen nicht verheimlichen, daß es mich ärgert, daß ausgerechnet Aragon dieses wunderbare Gedicht zustande gebracht hat.« Er griff sich an den Kopf. »Warum haben die Musen ihn bloß geküßt?« Jetzt rieb er sich sorgenvoll über die Stirn. »Er hatte doch so eine hündische« – er kniff die Augen zusammen – »Liebe zu Stalin … aber die Musik« – nun öffnete er die Augen wieder, die Hand sank, die Miene lichtete sich – »stammt von Brassens, der eine menschliche Liebe zu Katzen hatte, und alles zusammen ist eben ein schönes Lied.«
Dann turnten abermals Künstler über den Bildschirm, und Wim Wenders mopste sich über die Vorliebe der Russen für amerikanische Spielfilme. Ob das alles gutgehen konnte?
Lizzy nahm mich auf eine Journalistenparty mit. »Open End. Da kannst du Rotkäppchensekt aus Damenschuhen trinken …«
Man hätte dort aber verkleidet erscheinen sollen, und weil ich dem Dresscode nicht entsprach, rannte eine Art Schamane auf mich zu und kleckste mir grüne Farbe auf die Nase.
Auf der Tanzfläche wiegte sich eine schöne, nur in ein langes Herrenunterhemd gewandete Dame in den Hüften, die aber leider schon vergeben war, und zuhause brauchte ich eine halbe Stunde, um die Farbe wieder abzukriegen.
Für die Schnurrende Traglast lieferte Wiglaf mir eine »kritische Zeichnung«, auf der drei Container zu sehen waren: »Altglas«, »Altpapier« und »Alt-68er«.
Von Letzteren hätte ich niemals regiert werden wollen. In einer von Rudi Dutschke, Dieter Kunzelmann, Rainer Langhans und Horst Mahler gelenkten Räterepublik wäre spätestens nach drei Tagen alles Mus und Grus gewesen, und nach einer Woche hätten sich die Revolutionäre gegenseitig füsiliert.
Der nackte Schoß, den Sharon Stone in »Basic Instinct« beim Übereinanderschlagen ihrer Beine zeigte, war nur eine Zehntelsekunde lang zu erahnen, aber Jochen hatte angeblich nur auf ihr Gesicht geachtet: »Die hat mir dabei genau in die Augen gesehen! Die will’s jetzt echt wissen! Morgen flieg ich nach Los Angeles und mach sie lang, die Schlampe!«
Laut Spiegel herrschte auch im Auswärtigen Amt ein rauher Ton:
»Serbien muß in die Knie gezwungen werden«, forderte Bonns Außenminister Klaus Kinkel, den bisherigen EG-Steuermann Genscher im Jugoslawien-Konflikt an Härte beinahe noch übertreffend.
Sollten wir uns jetzt wieder ans Maulheldentum gewöhnen? Wie unter Wilhelm Zwo?
Sigrun und Lizzy blühten in der Junihitze auf, aber mich machte sie fertig. Ich japste nach Luft und mußte zwei- bis dreimal täglich duschen, um es mit mir selber aushalten zu können. Es war jedesmal eine Erleichterung, wenn die Scheißsonne endlich unterging.
Im zwölften Band von »Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur« (»Gegenwartsliteratur seit 1968«) behaupteten die Germanisten Keith Bullivant und Klaus Briegleb, daß sich in Walter Kempowskis Romanen »Aus großer Zeit« und »Schöne Aussicht« die »theoretische Möglichkeit einer kritischen Wirkung dieser versunkenen deutschbürgerlichen Romanwelt auf die Leser in einer fasziniert-wohlwollenden Großstimmungslage« verliere, in der – und nun wurde es vollends kryptisch – »eine neonationale Austreibung schonungsloser Erinnerung an das ›herrliche‹ Selbsterkennen des deutschen Bürgertums im Nazistaat, unüberprüfbar für Autor und Kritik, ›realistisch‹ lesend sich nun ab-spielen kann«.
Was wollten sie damit sagen, ohne es zu können? Wahrscheinlich nur, daß ihnen Kempowskis Romane irgendwie gegen den Strich gingen. Doch was sollte der quatschige Bindestrich in dem Wort »ab-spielen« bedeuten? Und was hatte es mit dem Begriff »neonational« auf sich? Das ganze Satzgebilde stand auf tönernen Füßen. In der Großstimmungslage sollte sich lesend eine unüberprüfbare Austreibung der Erinnerung an das Selbsterkennen des Bürgertums abgespielt haben? Wie bitte? Und diesen Humbug hatten Experten zu Papier gebracht, die sich hauptberuflich mit Literatur beschäftigten und den Studenten etwas über Sprachkunstwerke beibringen sollten!
Bonusheftmäßig hatte ich in der Zwischenzeit alles in Ordnung gebracht, aber meine Zähne bereiteten Frau Dr. Brunner noch immer Kopfzerbrechen. In den zwei Stunden, die ich bei ihr in Behandlung war, verpaßte sie mir vier Spritzen in den Gaumen, und danach schmeckte mein Oberkiefer nach Müll, und in meinen Ohren hallten die Bohrgeräusche nach.
Dutzende von Rezensenten hätten mein Buch bestellt, sagte Klaus Bittermann, als er mir in seinem Büro die Herbstvorschau der Edition Tiamat reichte.
Neue politische Bücher von Eike Geisel, Wolfgang Pohrt und Robert Kurz, zwei französische Kriminalromane und mein eigenes Buch. Das noch längst nicht fertig war …
Als Fan von Borussia Dortmund litt Klaus darunter, daß es mit der Meisterschaft nicht geklappt hatte.
»Du kommst doch aus Oberfranken. Wie bist du denn da an Dortmund gelangt?« fragte ich ihn.
»Aus reiner Opposition gegen meinen Vater. Der war für den Glupp.«
Glupp? Ach so, er meinte den Club, also den 1. FC Nürnberg.
Max und Marcus »muldierten« bei mir, das hieß, sie arrangierten an einem Tisch in meiner Wohngemeinschaft Zeichnungen, Texte und Zeitungsschnipsel für die Kowalski-Rubrik »Die Mulde«.
Nicht ohne Stolz zeigte ich eine Postkarte von Fritz Weigle alias F.W. Bernstein vor, die ich gerade erhalten hatte.
»Und die hast du gelocht?« fragte Max entsetzt. »Um sie abheften zu können? Man locht doch keine Karten von Fritz Weigle!«
Er selbst hatte einen ganzen Schwung Katzenpostkarten dabei und beschloß, die auch alle zu lochen. Für die »Mulde«. »Bring mir mal deinen Locher her!«
Während Max die ersten gelochten Katzenpostkarten betrachtete – »Süß! Aber jetzt süß mit Löchern!« –, zeichnete Marcus einen Mann, der ein Mädchen auf dem Bürgersteig liegen sah und sagte: »Wie süß!« Auf dem nächsten Bild hatte es eine Heroinspritze im Arm stecken, und der Mann rief ergänzend aus: »Mit Löchern!«
Weil es Max mißfiel, daß alle naselang jemand aus meiner WG ankam und glotzte, brachen wir die Session ab und gingen in einem Grill an der Urbanstraße Beck’s und Raki trinken. Und Marcus zeichnete immer weiter. Türkische Fliegen, Keilereien unter Engeln, beschriftete Löcher …
Für Marcus war Zeichnen wie Atmen. Er konnte gar nicht anders.
Beim »Umweltgipfel« in Rio strömten nach Zeitungsberichten mehr als 35000 Diplomaten, Ökologen und Journalisten zusammen.
»Fragt sich nur, ob die da nicht mehr Dreck verbreiten als verhindern«, sagte Jochen. »Sicher ist bloß, daß die brasilianischen Prostituierten bis Mitte Juni Überstunden schieben müssen …«
Meine Post entdeckte ich am Freitagmittag teils im Hof und teils im vermüllten Aufgang des Vorderhauses, aufgerissen und über die Treppenstufen verstreut: Welche Vandalen waren da am Werk gewesen?
Wir brauchten einen größeren Briefkasten, aus dem die Post nicht jeden Tag oben herausragte.
Von Berlin nach Greiz: Der IC nach Leipzig hatte eine Stunde Verspätung, der Anschlußzug war weg, und auf den nächsten mußte ich zwei Stunden warten.
Aus einer knallheißen Telefonzelle gab ich Michael Rudolf meine neue Ankunftszeit durch. Der Hörer glühte wie eine Herdplatte.
Zu meiner Unterhaltung hatte ich Bernd Eilerts Prosaband »Windige Passagen« dabei, und ich fand es gut, wie ruppig darin mit dem Heiratsschwindler Franz Kafka abgerechnet wurde. Dieses ewige Herumgeeier mit Felice Bauer!
Die erste Ver- und Entlobung machte ich noch mit, aber nach der zweiten hatte ich die Nase voll: Der Mann war zweifellos ein Terrorist, wenn auch ein sanfter – die Frau war offenbar eine ziemlich taube Nuß, sonst hätte sie ja wenigstens das rechtzeitig merken können.
In Gera, wo ich noch einmal umsteigen mußte, stand auf einem Schild, daß dies »Deutschlands 1. Nichtraucherbahnhof« sei. Haha! Wer kam denn auf so ’ne Idee?
Dann schlängelte sich der Bummelzug durch das liebliche Tal der Weißen Elster, und die Wälder schwollen auf und ab: Die Zone konnte auch sehr anziehend aussehen.
Wenn nur die Dörfer und die Städte nicht gewesen wären! Spröde, grau, verhärmt, verhutzelt und von allen guten Geistern verlassen präsentierte sich auch Greiz, als Michael mich vom Bahnhof abholte und wir zu seiner Wohnstätte am Gartenweg gingen, einer Straße, die halb einem Waldpfad und halb einer Panzertrasse glich.
Ganz am Ende des Gartenwegs wohnte Michael in einem porösen Altbau im Hochparterre, gemeinsam mit seiner freundlichen Frau Ina, einer Zahnärztin, die gerade alles von Kempowski las, wie ich sogleich erfuhr.
In Michaels Arbeitszimmer wartete ein Bücherturm auf mich – ostzonale Lyrik und politische Predigten wie »Dona nobis pacem. Fürbitten und Friedensgebete Herbst ’89 in Leipzig«, »Unser Glaube mischt sich ein«, »Bis alle Mauern fallen«, »Schmerzgrenze«, »Stasi intim« …
Am schlimmsten seien die Elaborate des Greizer Heimatdichters Günter Ullmann, sagte Michael. »Der hat sich alle Zähne ziehen lassen, weil er dachte, daß die Knechte von der Stasi ihm da Wanzen reinmontiert hätten.«
»Nein.«
»Doch! Die Stasi hat ihm wirklich übel mitgespielt, aber er leidet auch unter hausgemachtem Verfolgungswahn …«
In einem Lokal mit dem stark übertriebenen Namen Café Lebensart verputzten Michael und ich Speisen und Wernesgrüner Bier für 39 Mark, und zu späterer Stunde spielte er mir bei sich daheim noch einige Schallplatten vor: »Spitzenprodukte der DDR-Liedermacherszene«, wie er sagte. »Die darfst du in deinem Buch nicht vernachlässigen. Vor allem nicht die Stern-Combo Meißen und ihren Song über einen altersschwachen Müllkippenwärter …«
An diesem Musikstück war alles unfaßbar schlecht: die Melodie, die Instrumentierung, der dünne Gesang und nicht zuletzt der Text.
Und so lebt der Alte mit seinem Hunde,
Daß er uns erhalte wertvolle Funde.
Und so lebt der Alte mit uns im Bunde.
Ach, und manches kalte Herz wärmt die Kunde …
»Psychedelische Musik für Arme«, sagte Michael.
»Und an sowas habt ihr euch als Jugendliche hochgezogen?«
»Ich doch nicht! Für mich gab’s nur Jimi Hendrix! Aber da war natürlich schwerer ranzukommen als an diese einheimische Innerlichkeitsscheiße …«
Am Sonnabendvormittag gingen wir spazieren. Die meisten Häuser schienen einmal bessere Zeiten gesehen zu haben, an den Berghängen schimmerte Mischwald, und hoch über Greiz thronte ein schläfriges Schloß.
Die Menschen sahen anders aus als im Westen. Klobiger und bleicher. Sie bewegten sich auch irgendwie täppischer. Wie Meerschweinchen, die sich auf freier Wildbahn unwohl fühlten und schnell wieder in ihr Häuschen huschen wollten.
Oder kam mir das nur so vor?
»Nein, das siehst du schon ganz richtig«, sagte Michael und führte mich zu einem mitten in der Stadt aufgestellten Schaukasten der Bürgerrechtsbewegung Neues Forum, in dem er von einem gewissen Rudolf Kuhl, einem nicht gänzlich rechtschreibsicheren Mitbegründer jenes Forums, wegen eines polemischen Titanic-Beitrags über Greiz scharf angegangen wurde. Den Text, der dort aushing, las ich mit wachsendem Erstaunen:
Ich halte den Verfasser, der offenbar am Weißen Stein nach dem Stein der Weisen sucht, nicht für eine avantgardistische Oase in der Greizer Kulturwüste, sondern, um es in seinem Stil zu sagen, für einen unter Erfolgsdruck leidenten, arroganten, kleinen Schreiberling, der stumpfsinnig vor sich hindösend, Tag für Tag hochwertige Nahrungsmittel in sich stopft, um sie auf analem Wege später als stinkende, braune Masse auszuscheiden. Versagt ihm sein Anus diese Art der Entleerung, kommt es zu geistigen Absonderungen, die in der Qualität dieser bereits erwähnten Masse nicht nachstehen.
Also, Herr Rudolf, Schließmuskel entspannen und drücken, aber vorher frei machen, sonst geht’s in die Hose! Bestellen Sie ein T-Shirt bei »Kowalski« mit der Aufschrift »Aus dem Weg! Hier kommt ein Arschloch.« Tragen Sie es täglich, Sie haben es verdient!
»Das hängt da bereits seit zwei Monaten«, sagte Michael.
An seiner Stelle hätte ich schnellstmöglich den Wohnort gewechselt.
Gräsig war es auch in der Discothek, die wir abends besuchten. Die mit Kummerspeck vollgesogenen Kunstfasergardinen, die Lampenschalen in Obstform, das scheußliche Gestühl und ein pampiger Kellner vermittelten mir das Gefühl, von Walter Ulbricht regiert zu werden, während die Backfische so wie die im Westen schon wieder vergessene Schnepfe Olivia Newton-John auszusehen versuchten.
Was die Tanzenden da machten, nannte Michael »rhythmisches Herumstehen«, und er klärte mich darüber auf, daß in der DDR das »Auseinandertanzen« zeitweise verboten gewesen sei. Als Antwort auf den dekadenten Rock ’n’ Roll habe die SED 1959 einen zahmeren Tanz im Sechsvierteltakt erfunden und ihn »Lipsi« genannt. »Das war allerdings ein Schuß in den Ofen …«
Staatsorgane, die den Leuten vorschrieben, wie sie tanzen sollten! In der DDR schien weniger die Diktatur des Proletariats geherrscht zu haben als das Regiment eines vernagelten Kleinbürgertums, das sein Weltbild aus dem Tausendjährigen Reich in den Sozialismus hinübergerettet hatte.
Am Pfingstsonntag drehten Michael und ich ein paar Runden durch den Greizer Park, bis uns der Regen zurück ins Trockene trieb.
Ich nahm mir dann die Werke vor, die für mich bereitlagen. Es wimmelte darin von schwerverdaulichen Sätzen:
Wir sind hineinverflochten in eine Schuldgeschichte …
In diesem sämigen Stil ging es Seite um Seite weiter. Wer so redete oder schrieb, der wollte nicht streiten und aufklären, sondern Nebelkerzen zünden.
In einem der Bücher schilderte die DDR-Dissidentin Freya Klier ihre erste Begegnung mit dem Liedermacher Stephan Krawczyk:
Eines heißen und sonnigen Nachmittags, im Sattel bergauf, dringt an mein Ohr eine burgundene Musik. Oben, auf einem schroffen Stück Felsen, sitzt jemand. Es ist aber nicht die sich kämmende Lorelei, es ist ein Faun: mein Liedermacher mit seinem Bandoneon, nackt.
Ich las Michael die Stelle vor.
»Oha«, sagte er. »Stephan Krawczyk nackt am Bandoneon? Hat sie das auch auf Video?«
Abends sollte es ein Pilzgericht geben, doch weil mich der Hunger schon zwackte, beschaffte ich mir entgegen Michaels ausdrücklicher Warnung an einer Imbißbude ein Schnitzel.
Einen halben Bissen konnte ich davon herunterwürgen, aber mehr auch nicht. Selbst die geröstete Sohle einer Badelatsche hätte besser geschmeckt als dieser sehnige und versalzene Zadderklumpen aus der Küche eines thüringischen Brutzelschurken.
»Wer nicht hören will, muß fühlen«, sagte Michael.
Auch am Pfingstmontag regnete es stark, und der einzige nennenswerte Vorfall bestand darin, daß ich im Vorübergehen versehentlich den Schubladenknauf einer Flurkommode demolierte.
In der Greizer Buchhandlung Bücherwurm erwarb ich am Dienstag die Gedichtbände »Zangengeburt« von Lutz Rathenow sowie »Gegenstimme« und »Den Horizont um den Hals« von Günter Ullmann.
»Der Günter Ullmann ist gerade zur Tür rausgegangen«, sagte die Buchhändlerin. »Aber er hat noch gesehen, daß Sie sich seine Bücher ausgesucht haben!«
Nichts wie weg. Auf eine persönliche Fühlungnahme mit den Objekten meiner Studien war ich nicht erpicht.
Günter Ullmanns Bücher enthielten auch Stimmen über sein Werk:
Einzelne Texte sind so hell und bizarr, daß sie den Leser im Innersten treffen wie in »Schöpfungsbericht«: »gottes / kralle // heilt am trauer- / rand // seines aller- // kleinsten // fingers«. Mit wenigen Strichen wird Welt umrissen. Gott in neuer Einfügung wird wieder elementar begriffen: »kralle«. Trotz äußerster Lakonie ist Dynamik im Spiel. Jeder Schritt ein Sinn-Beweis. Totalität des Schöpfungsgeschehens: »gottes / kralle« – und Entweihung: »trauer- / rand // seines … fingers«. In der Faszination der Existenz liegt Ullmanns dichterische creatrix …
Creatrix??
Noch kümmerlicher waren die Gedichte von Lutz Rathenow:
Taten tuten vielzersprechend …
Er salpeterte einfach irgendwas zusammen und gab es als Lyrik aus:
Sprüche sind nicht oft spruchreif
Spruchreif ist nicht oft redwert
Redwert ist nicht oft sprachspreiz
Sprachspreiz ist nicht oft sinntoll
Sinntoll ist nicht oft lacharm …
Nachdem ich Michael auch diese Verse vorgelesen hatte, erließ er ein auf vierundzwanzig Stunden befristetes Vortragsverbot in seinen Räumlichkeiten und legte eine Jimi-Hendrix-LP auf. »Und jetzt hör mal gut zu! Da geht die Mucke nämlich ganz anders ab, Alter!«
Bevor ich mich am Mittwoch wieder in den Zug setzte, warf ich noch viele Kärtchen ein an alle meine Lieben.
In Berlin lag oben auf dem Stapel meiner Post eine Karte von Eckhard Henscheid aus Amberg:
Sehr geehrter Herr Schlosser, man sagt mir, die freundl. Rezensions-Zeilen im »Tip« sollen von Ihnen sein – vielen Dank dafür: in Zeiten der mittleren Anfechtung (u.a. Gesundheits-Dauerchaos) kann man derlei Zuspruch schon gut haben.
Gefallen haben mir m.E. auch alle Ihre anderen Artikel, die ich so lala vor Augen kriege, so in: »Kowalski«, »Merkur« und »konkret«. Ihren H.-E.-Richter-Inferno-Beitrag hab ich dankbar für eine Dummdeutsch-Buch-Endfassung (Reclam 1993) ausgebeutet. Dank & Grüße Eckhard Henscheid
Na, da schau her!
Eingegangen war auch ein Rundschreiben von Walter Kempowski:
Ich laboriere immer noch an meinem Schlaganfall und außerdem ist meine Mitarbeiterin auf Urlaub – ich kann Ihnen also leider nur kurz und auf mechanische Weise danken. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel.
Günther Willen wiederum ließ mich wissen, daß es ihm in Hamburg weiterhin zu heiß sei:
Ich warte auf den Regen, sonst werde ich noch halbkirre. Allerdings versetzte mich der Anblick eines jungen Schwaben, der seine Spätzle-Haare zu einem Dutt zusammengeflochten hatte (gerade im Luxor gesehen, Himmel hilf!), in eine tiefere Bestürzung als das sagenwirmal Ozonloch. Dutt für Männer verhält sich wie Vase zu Moped. Man möchte schwachsinnig werden.
Auch Frank Schulz hatte mir wieder geschrieben:
Betrachte Dich bitte als vielmals bedankt für Wenckemäuschen und Uschischätzchen. Ich hab’ versucht, aus nostalgischen Gründen darauf zu masturbieren, aber früher war eben alles anders.
Er gab mir dann noch Tips für Lesungen:
1. Nie vor weniger als einer Person lesen; 2. nie vor feiernden Finanzbeamten lesen; 3. bei Kneipenlesungen darauf bestehen, daß die Musik ausgemacht wird.
Außerdem war eine Einladung zur Eröffnung einer Ausstellung eingetroffen: »30 Jahre Neue Frankfurter Schule … und die Folgen«, 15. August, Theodor-Zink-Museum Kaiserslautern.
So viel schöne Post auf einem Haufen!
Mein Aufruf, Geld für einen größeren Briefkasten zusammenzulegen, fand in der WG kein Gehör. Die würden irgendwas Dreistelliges kosten, erklärte Philipp, und schon winkten alle ab.
Lizzy sagte, daß sie einen Zechkumpanen brauche, weil sie Liebeskummer habe. In ihrem Stammlokal Rizz trank ich daher mit ihr Tequila, bis sich irgendein Narr aus ihrem Bekanntenkreis zu uns setzte und über Piet Mondrian zu schwafeln begann, den Rechteckmaler, den auch Lizzy verehrte, und da zog ich mich zurück.
Es wäre ohnehin nicht klug gewesen, mit einer Frau aus der eigenen Wohngemeinschaft anzubandeln. Exogamie hieß die Parole!
Ich bedankte mich brieflich bei Eckhard Henscheid, wünschte ihm alles Gute für seine Gesundheit und legte meinem Schreiben den Herbstprospekt der Edition Tiamat bei.
Alles wuchs sich jetzt zurecht: Nachdem ich mir für den Tip eine Pressevorführung des beknackten Teenie-Films »Only You« angesehen hatte und in der Woody-Allen-Biographie von Eric Lax auf die Fehlinformation gestoßen war, »daß Frauen vier Vaginalkammern hätten, jede für einen unterschiedlichen Zweck«, verfolgten Wiglaf und ich bei Beck’s und Gin Tonic im Eiszeit-Kino das EM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und dem Team der GUS, und ich konnte davon leben, daß ich über diese Dinge schrieb.
Erfrischend waren auch immer die Briefe von Eugen:
Morgen haben wir Erdkunde, Mathematik, Englisch, Biologie und zwei Stunden Turnen – ich werde einfach so tun, als hätte ich die Mittlere Reife schon, und zuhause bleiben. Das geht schon klar, meine Eltern sind außerdem im Urlaub. Eine neue Identität werde ich mir zulegen, vielleicht die des Künstlers? Ich bleibe zuhause und behaupte, ich sei Künstler. Auf etwaige Anfragen hin kann ich ja in Ohnmacht fallen oder anfangen zu weinen.
Hätte sich nicht mal ein Mäzen um Eugen kümmern können? Irgendein millionenschwerer Kunstfreund?
Im Debattierzirkel ging es ein letztes Mal um Heidegger, wozu ich herzlich wenig beitragen konnte. Nach der Sommerpause sollte Ernst Jüngers Aufsatz »Der Waldgang« durchgenommen werden.
Herr Rutschky sagte, daß er vom Goethe-Institut für zwei Wochen nach Japan eingeladen worden sei. »Morgen nachmittag geht’s los. Zuerst nach Frankfurt und dann mit dem Flugzeug nach Tokio.«
Nach Tokio! Als wäre das Dasein in Europa nicht schon kompliziert genug!
I guess you go for nothing if you really want to go that far …
Es wollte mir nicht in den Kopf, was die Serben sich davon versprachen, daß sie Sarajevo bombardierten. Was hätten die Friesen von einem Angriff auf Oldenburg gehabt? Oder die Franken von einem Krieg gegen die Oberbayern? Wieso kapierten diese Leute nicht, daß es klüger wäre, friedlich Handel zu treiben und die Nachbarn zum Essen einzuladen?
Von Eckhard Henscheid kam ein Kärtchen:
Lb. Herr Schlosser,
raschen Dank, eh’s in die Ferien geht – und zu Ihrer Beruhigung: Tödlich ist die Krankheit (Myotendinotisches Schmerzsyndrom in der Folge eines – eher populären – HWS-Syndroms) nicht. Aber zäh. Schon 3½ bis letztendlich 5 Jahre. Und schwer zu bekämpfen. Und: größere literarische Projekte/Anstrengungen läßt sie meist nicht zu.
Ihnen viel Glück zum (ersten?) Buch. Einen guten Griff haben Sie vermutlich mit dem Verlag getan. Mein einziger, etwas ältlicher Rat fürs Buch und auch sonst: Nicht zu viel Fortissimo!
Grüße & Wünsche
Eckhard Henscheid
Es stimmte schon: Ich hatte manchmal über die Hutschnur gehauen. Aber was war ein HWS-Syndrom?
Es handele sich dabei um ein »Halswirbelsäulensyndrom«, sagte Philipp. Das sei »so ’ne Nackenmuskulaturgeschichte«, an der auch eine Freundin von ihm mal gelitten habe. Von einem »myotendinotischen Schmerzsyndrom« hatte er aber noch nie etwas gehört.
Im Eiszeit-Kino sahen Wiglaf und ich uns auch das EM-Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Schottland an. Der einzige Deutsche, der mir gefiel, war Jürgen Klinsmann; die anderen wirkten allesamt wie Holzhacker.
»Und der beste deutsche Spieler ist gar nicht dabei«, sagte Wiglaf. »Bernd Schuster. Weil der DFB-Chef Hermann Neuberger als alter Nazi selbstverständlich nicht vor diesem Freigeist auf die Knie gehen und ihn darum anbetteln konnte, in die Nationalmannschaft zurückzukehren …«
Deutschland gewann trotzdem 2:0.
Inzwischen hatten in Wuppertal die Dreharbeiten für den schon seit langem geplanten WDR-Film über Eugen Egner begonnen. Am Wochenende sollte ich darin mitspielen, in einer Nebenrolle, und Eugen schrieb mir, daß ich am Freitag mit dem Nahverkehr nach Wuppertal-Steinbeck fahren und nach einem Abstellgleis Ausschau halten müsse:
Zwei alte Waggons mit unbilligem Antennenwald zu Häupten, Scheinwerfer und Fernsehvolk, Übertragungs- und Handwagen (und -puppen), Souffleusen, Reitpferde, Schminkspiegel und eine kleine Kamera fallen dem durcheilenden Bahnpassagier sofort auf und verraten die Filmaktivität, die dort in hohem Maß zu verzeichnen sein wird.
Vorher wollte ich Andrea in Aachen besuchen. Ein herrliches Leben: Lustreisen, Minnedienste und Schauspielerei!
Andrea hatte einen neuen Freund, einen zwei Jahre jüngeren Elektrotechniker aus Düren, dem sie jedoch verheimlichte, daß es mich gab und daß sie mich in der Absicht empfing, unsere Liebe für zwei Tage und zwei Nächte wiederaufleben zu lassen.
»Und wo ist der jetzt?«
»Geschäftlich unterwegs. Bis übermorgen.«
Unter ihrem Sommerkleid hatte sie, wie ich herausfand, rein gar nichts an.
»Du bist also immer noch das alte Luder …«
»Mußt du gerade sagen!«
»Was soll das heißen?«
»Na, du vergreifst dich hier schließlich an der Freundin eines anderen Mannes«, sagte sie und lachte.
»Und du läßt dir das gefallen.«
»Stimmt.«
»Findest du nicht, daß du dafür bestraft werden solltest?«
»Ich bitte darum!«
Wie war das alles schön. Nur die Liebe allein und keine Beziehungsgespräche mehr.
So machten wir es auch am Donnerstag, und als ich mir abends die Partie Holland gegen Deutschland ansah, ging Andrea solange im Regen spazieren.
Obwohl wir 3:1 geschlagen wurden, kamen wir ins EM-Halbfinale, weil die anderen beiden Mannschaften in unserer Gruppe noch mieser gespielt hatten.
Ich führte Andrea in ein Restaurant namens Kalymnos aus, wo es allerdings angenehmer gewesen wäre, wenn wir Tischnachbarn gehabt hätten, denen keine Essensreste im Bart klebten. Und warum mußten diese Herrschaften so laut reden, daß man sein eigenes Wort nicht mehr verstand? Die optische und die akustische Aufdringlichkeit der »Öcher«, wie die Aachener sich nannten, stieß bei mir auf das gleiche Unverständnis wie Andreas fortbestehendes Faible für orientalische Musik, aber da wir kein Paar mehr waren, brauchten wir uns nicht mehr zu zanken.
Das auf dem Bahndamm in Wuppertal-Steinbeck tätige Fernsehteam war nicht zu übersehen.
Eugen machte mich mit dem Regisseur Enno Hungerland bekannt und zeigte mir eine Postbotenuniform: »Die kannst du morgen anziehen und mir die Post bringen. Dann werfe ich dir ein Päckchen an den Kopf, und du kannst ausrufen: ›Sie Postbotenschinder!‹ Einverstanden?«
Einer der Waggons war innen weihnachtlich geschmückt, wobei man auch nicht an Kerzen und Gebäck gespart hatte. Draußen wurde ein Indianerzelt errichtet, und eine Maskenbildnerin arbeitete an der Turmfrisur einer Schauspielerin, die Eugens Frau darstellen sollte.
Ich bemühte mich, nicht im Weg zu stehen, als eine Szene gedreht wurde, in der ein Kind mit Hahnenkopfmaske auftrat. Der Regisseur war darauf aus, Eugens Bilder lebendig zu machen.
Am frühen Abend entließ er Eugen und mich mit dem Auftrag, am Vormittag mit Ideen für die Postbotensequenz wiederzukommen.
Darüber berieten wir bei ihm zuhause. Während Eugens Gefährtin Auberginen mit Käsespänen überbuk, kamen wir zu dem Ergebnis, daß ich ihn beim Vergraben seiner Hausschuhe antreffen und ihn nach dem Grund dafür fragen solle. Darauf solle Eugen antworten: »Die wußten zuviel!« Und ich solle ihn dann fragen: »Tröstet Sie Post?«
Da das für meine Kleinrolle bereits genug Text war, wechselten wir das Thema und sprachen über Musik. Er besitze eine Original-Single der Kinks aus dem Jahr 1964, sagte Eugen und spielte sie mir vor.
Girl, you really got me goin’
You got me so I don’t know what I’m doin now …
»Zwischendurch muß aber auch viel Johann Sebastian Bach und ähnliches her«, sagte Eugen. »Als Antidot gegen die Zumutungen des Alltags.« Denn das oberste Motto der Menschheitsmehrheit laute nachweislich: »Alles – nur keine Vernunft!«
Bevor ich mich im Gästezimmer schlafen legte, sicherte er mir zu, daß er mein Buch »Moselfahrten der Seele« mit einem stimmigen Titelbild versehen werde.
Grandiose Aussichten. Vor zweieinhalb Jahren hatte ich noch kellnern müssen, und nun stürzte eine gute Nachricht nach der anderen auf mich ein.
Nachdem die Szene mit den Hausschuhen gedreht war, sollten Eugen und ich in einen der Waggons steigen und an einem Tisch in Eugens Fotoalben blättern. Das Hineinsteigen mußte jedoch wiederholt werden, weil ich angeblich in die Kamera gekuckt hatte, obwohl ich gar nicht wußte, wo sie stand.
Dann kam irgendein Flippi angerannt, verteilte Visitenkarten, die keiner haben wollte, und redete dummes Zeug.
Das sei einer der Geistesgestörten, die sich von Filmsets angezogen fühlten, sagte Enno Hungerland und seufzte.
Ich beneidete ihn nicht um seinen Job. Als Schriftsteller hatte man es doch weitaus leichter.
In der Graefestraße kam ich noch vor dem Anpfiff des EM-Halbfinalspiels zwischen Schweden und Deutschland an.
»Hock dich her!« schrie Jochen. »Und bring mir noch ’n Bier aus’m Kühlschrank mit!«
Schweden verlor verdient 2:3, doch es gab einen Schönheitsfehler, und der bestand in Stefan Effenbergs greulichem Poposcheitel.
Philipp, der seinerseits eine Art Afro-Look trug, wollte davon nichts hören: »Du mit deiner Langhaarmatte schwingst dich hier zum Frisurenkritiker auf! Kuck mal lieber in ’n Spiegel!«
Die Rechnung meiner Steuerberaterin für die Einkommensteuererklärungen 1990 und 1991 belief sich auf DM 507,75.
Wenn das Finanzamt nicht von den Erklärungen abweicht, werden sich nach meinen überschlägigen Berechnungen für Sie Steuernachzahlungen für 1990 und 1991 von insgesamt rd. DM 800,– ergeben.
Die Erklärungen mußte ich unterschreiben und an das Finanzamt Kreuzberg schicken. Wichtig war anscheinend auch die »Anlage KSO«, die Einkünfte aus Kapitalvermögen betraf. Da konnte das Finanzamt bei mir aber nichts holen. Ich lebte von der Hand in den Mund.
Das Hochschulmagazin mit mir als Coverboy war da. Doch man konnte mich glücklicherweise nicht erkennen: Man sah nur irgendeinen nicht identifizierbaren Strolch.
»Vielleicht steigen diese Hefte mal im Wert, wenn du berühmt bist«, sagte Lizzy.
Als ich mit der Arbeit an meinem Büchlein »Menschlich viel Fieses« fertig war, widmete ich es Michael Rudolf, dem »Erfinder der Klappstulle«, wie er sich gern nannte.
Aber was war nun eigentlich mit Nicole, der Apothekerin aus Leipzig? Wieso meldete die sich nie?
In dem von Max verfaßten Impressum der Kowalski-Rubrik »Die Mulde« standen im Juliheft die Worte:
Zuerst sollte diese Mulde in der Küche der WG des fanatischen Mulde-Befürworters Martin Schlosser entstehen, aber als wir da saßen und mit Stecknadeln und Bürolocher auf die Katzenpostkarten losgingen, kamen immer so komische Mitbewohner und kuckten komisch, und da sind wir halt mit Schlossi Bier trinken gegangen …
Mit Schlossi! Und das wurde in der neuen Titanic noch getoppt, mit einer von Wiglaf gefälschten Anzeige des Haffmans-Verlags, in der Bollerwagen zum Transport von »Zettel’s Traum« angeboten wurden:
Modell Martin Schlosser. Für Studenten und andere schmale Brieftaschen. Latschenkiefer furniert, div. kleinere Mängel, 380,– DM.
Modell Hans Wüllenweber. Mahagoni, Seidenfütterung, mindestens 12 Jahre in alten Sherryfässern gelagert, 1290,– DM.
Modell Reemtsma, deutsche Eiche, wirklich alt (von Noah gebraucht gekauft), div. Extras wie Aschenbecher, Servolenkung, Unterbodenschutz, Laufwerk von Lektor Bodmer handgeölt, 13480,– DM.
Mit Hans Wüllenweber war Hans Wollschläger gemeint. Das war das Pseudonym, das Eckhard Henscheid ihm nachträglich gegeben hatte, weil Wollschläger sich pikiert über seinen Auftritt in Henscheids Erzählung »Im Puff von Paris« geäußert hatte. In der Buchfassung dieser zuerst im Raben erschienenen Geschichte figurierte Wollschläger als Wüllenweber.
Ich hätte mich ja gern einmal wieder mit der Schneiderin getroffen, in aller Freundschaft, aber sie war nie zuhause, und ich wußte nicht, wo ich meine Angel auswerfen sollte.
Nachdem Deutschland im EM-Finale 0:2 gegen den Außenseiter Dänemark verloren hatte, verkündete der Bundestrainer Berti Vogts, daß er auch mit dem zweiten Platz zufrieden sei.
Es war schmerzlich, diesem traurigen kleinen Mann beim Lügen zuzusehen. Und noch schmerzlicher, daß sich die Bild-Zeitung auf ihn einschoß, deren Redakteure ganz einfach kein Recht dazu hatten, recht zu haben.
Klaus Bittermann, dem ich meinen Buchtext brachte, sowohl auf Papier als auch auf Diskette, hielt sich barfuß in seinem Büro auf, was ich bei mehr als 30 Grad Außentemperatur verzeihlich fand.
Obwohl der Sommer noch gar nicht richtig losgelegt hatte, sehnte ich mich nach dem Herbst. Von den haarigen Waden, die der gemeine Berliner enthüllte, sobald die Sonne durchbrach, hatte ich schon mehr als genug gesehen.
Mit seinem Titelbildvorschlag für mein Buch »Moselfahrten der Seele« machte Eugen Egner mich froh: Die Zeichnung zeigte einen Tanzwütigen, dessen rosa Pumphose vorn mit einem Schlauch an einen Motor angeschlossen war, und links und rechts von dem Herrn belebten zwei halbdebile Partyhühner die Szenerie.
Als ich auf der Toilette saß, lief mir eine Maus über die Füße und verschanzte sich in einer Ritze unter der Heizung. Und auf derselben Etage bewahrte ich meine signierten Henscheid- und Kempowski-Erstausgaben auf! Und meine eigenen Schriften! Wieso verpißten diese Mäusefamilien sich nicht in die Kornkammern der Provinz?
Klaus Bittermann rief mich an und sagte, daß manches nicht dicht genug am Thema sei. »Und es wäre auch gut, wenn du das neue Werk von Rainer Eppelmann noch einarbeiten könntest …«
»Und bis wann?«
»Bis Mitte Juli. Spätestens.« Am 3. August werde »Menschlich viel Fieses« dann gedruckt.
Ächz.
»Wendewege« hieß das Buch, in dem Rainer Eppelmann seine Wandlung vom pazifistischen Bürgerrechtler zum Verteidigungsminister beschrieb. Auch sein Privatleben kam darin nicht zu kurz, denn er sprach ausführlich seine Ex-Frau Evi an:
Liebe Evi, Du bist der wichtigste Mensch für mich! Seitdem ich Dich liebe und wir zusammenleben, hast Du meine Wege entscheidend beeinflußt. Es gibt Punkte in meinem Leben, an denen ich immer wieder das Gespräch mit Dir gesucht habe. Ein solcher Punkt ist nun wieder erreicht. Du bist leider nicht mehr hier. Seit dem 11. Juni 1988 sind wir geschieden. Du wolltest es so. Ich würde gerne heute mit Dir in unserer Küche hocken, wie so oft früher, mit viel Tee und Rotwein und in dem Bewußtsein, daß wir nun nicht mehr abgehört werden. Ich hätte heute das Gespräch gebraucht, weil ich mich entschlossen habe, in der Regierung Lothar de Mazières das Amt des Ministers für Abrüstung und Verteidigung zu übernehmen. Nun will ich Dir wenigstens schreiben, in der Hoffnung, auf diese Weise ein Stück Vertrautheit und Nähe wiederherzustellen …
Zwei Jahre später hatten sie einander wieder geheiratet, was Eppelmann in einem weiteren offenen Brief an Evi zu der Feststellung veranlaßte:
Wir sind ein Muster deutsch-deutscher Vereinigung.
Da kannte Eppelmann keine falsche Bescheidenheit.
So wie sich mein Lebensgefühl in unserer wiedergefundenen Ehegemeinschaft gesteigert hat, so glaube ich, müßte sich auch sonst im Erinnern das Lebensgefühl der Deutschen erweitern.
Nein, es genierte ihn nicht, das in die Welt hinauszuposaunen und Evi öffentlich seine Liebe zu erklären:
Ich umarme Dich, mein liebes zweifaches Weib.
Und er setzte noch einen drauf:
Im Sinn Jesu will ich fortwirken.
In dem Buch »Störenfried«, Wolfgang Rüddenklaus Geschichte der DDR-Opposition, kam Eppelmann nicht ganz so gut wie Jesus weg:
Selbst in seiner Glanzzeit, in den Jahren 1981/82, hatte er im ESG-Friedenskreis und im Friedenskreis Pankow eine starke Konkurrenz. In den späteren Jahren verlor er dann aufgrund seiner maßlosen Eitelkeit und seines autoritären Führungsstils immer mehr Anhänger.
Die Abkürzung ESG stand für die Evangelischen Studentengemeinden in Berlin. Mit denen ich aber auch nichts hätte zu tun haben wollen. »Friedenskreis Pankow«, das klang schon so verzopft, wie es wahrscheinlich auch gewesen war.
Mein Geld schwand dahin: 400 Mark für die Zahnbehandlung, 500 Mark für die Steuerberaterin, 650 Mark Miete und urplötzlich noch 500 Mark Kaution, die schon bei meinem Einzug fällig gewesen wären, wenn Jochen nicht vergessen hätte, sie mir abzufordern. Und dann mußte ich mir noch ein neues Paar Halbschuhe kaufen. Oder Sandalen. Mit meinen Friesenstiefeln konnte ich nicht durch den Sommer kommen.
Auf dem Weg nach Helgoland machte ich in Hamburg Station bei Günther Willen. Er habe kürzlich Harry Rowohlt von dessen Schokoladenseite kennengelernt, sagte er beim Bier im Luxor. »Auf ’ner Grillveranstaltung. Wir haben uns über Catchen, Country Clubs und Dean Martin unterhalten. Harry ist ein lehrreicher und munterer Plauderer, der auch gern den tödlichen Paß spielt. Beziehungsweise trinkt …« Sie seien dann in einer »kommunistischen Nazi-Kneipe« versackt und hätten »Samtkragen« gepichelt. »Das ist ein hammerartiges Getränk. Doppelkorn mit Underberg. Macht ein pelziges Gefühl auf der Zunge …«
Wir fanden beide, daß Harry Rowohlts Zeit-Kolumnen endlich mal als Sammelband erscheinen sollten. »Am besten im Verlag Weisser Stein«, sagte ich, aber Günther glaubte, daß der Verleger Haffmans da schon die Hand drauf habe, obwohl der Verlag Weisser Stein sicherlich auch nicht verkehrt sei.
Ich erzählte ein bißchen von meinem Besuch in Greiz
»Scheint ein guter Mann zu sein, dieser Michael Rudolf«, sagte Günther. »Aus dem wird noch mal was!«
Am Donnerstagvormittag fanden Max, Marcus und ich uns im Hamburger Hauptbahnhof zusammen und nahmen den Zug nach Cuxhaven, wo unsere Fähre ablegen sollte.
Auf meine Prophezeiung, daß wir auf Helgoland nur Rentner zu sehen bekämen, erwiderte Max, daß Kurzreisen zu bei Rentnern beliebten Orten »unschlimm« seien.
»Kennst du noch mehr unschlimme Dinge?« fragte Marcus.
»Oja«, sagte Max. »Zum Beispiel die ausgesuchte Höflichkeit, mit der man unhöflichem Cafépersonal begegnen sollte. Und das Tragen langer Hosen und langärmeliger Hemden im Sommer, um die Schuppenflechte zu verbergen, selbst wenn man, wie ich, keinerlei Schuppenflechte hat.«
In Cuxhaven fuhren wir mit einem Bus zum Hafen, und dort legte sie an, die MS Wappen von Helgoland. Entgegen meiner Prognose stiegen auch mehrere Schulklassen an Bord.
Es gab lauwarme Würstchen, Bier und knarrende Durchsagen: »Wir fahren jetzt mit zwanzig Knoten …«
Als nach zweieinhalb Stunden Land in Sicht kam, war Max verschwunden. Aus irgendwelchen nautischen Gründen mußte man auf offener See von der Fähre in ein schwankendes Börteboot turnen. Hatte Max bereits ein anderes genommen?
Weil Marcus und ich unsere leeren Bierflaschen an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle abstellten, fingen wir uns die Rüge eines Passagiers mit gescheiteltem Schnurrbart ein, und im Boot setzte der Kerl sich nicht hin. Er blieb stehen, als einziger, breitbeinig und mit verschränkten Armen. Ein echtes Arschgesicht.
Am Anleger wartete Max bereits auf uns. Er habe nicht auf uns bierselige Trödeltypen warten wollen und daher ein früheres Börteboot genommen, sagte er, und sein Frösteln während der Passage habe er nach der langen Hitzeperiode weidlich genossen.
Nachdem wir im Hotel Insulaner eingecheckt hatten, gingen wir spazieren. Ich knipste die Lange Anna, einen hoch aufragenden Buntsandsteinfelsen, der die einzige Attraktion der Insel bildete, und später knipste ich Marcus, wie er mit einer leeren Finn-Crisp-Schachtel Wasser aus der Nordsee schöpfte und Max damit am Strand den Sand von den Füßen spülte.
In der Fußgängerzone wichen wir dem Schnurrbart aus und wurden von fünf Jugendlichen bestürmt: »Wenn wir Ihnen Geld geben, könnten Sie uns dann zwei Flaschen Bacardi kaufen? Von uns ist leider noch keiner achtzehn!«
Das tat ich natürlich. Ehrensache.
Max sagte, es habe mit Ehre nichts zu tun, Minderjährigen den Konsum von Alkohol zu erleichtern …
Wir beide hatten uns jeweils einen Sonnenbrand im Gesicht geholt, während Marcus verschont geblieben war.
Mit dem einzigen Hochseeinselfahrstuhl der Welt fuhren wir zum Oberland, kehrten in ein Fischrestaurant ein, in dem Dolche, Messer und andere Stichwaffen an den Wänden hingen, aßen Fisch und sahen dabei zwei Hummern zu, die in einem Aquarium miteinander kämpften, was ihnen schwerfiel, weil man ihnen die Scheren zusammengebunden hatte, und nachdem wir mit dem Fahrstuhl wieder nach unten gefahren waren, kam uns abermals der Schnurrbart entgegen. Dieser Lackel. Hatte der kein Zuhause?
In einer Gaststätte namens Windjammer tranken wir Eiergrog, eine helgoländische Spezialität, die man durch einen Strohhalm zu sich nahm, und schrieben Kärtchen. Ich bedachte auch die Apothekerin, obwohl sie mir nie geantwortet hatte.
Als Titel des Berichts von unserer Reise, den ich für Michael Rutschkys Alltag schreiben wollte, schlug Max mir »Ferien auf Unhawaii« vor, was ich als passend empfand. Ich war zwar nie auf Hawaii gewesen, aber auch noch nie auf einer unhawaiianischeren Insel als Helgoland. Außer dem Ausbooten, der Langen Anna und zwei zum Tode verurteilten Hummern hatte dieses Eiland nichts zu bieten, was der Rede wert gewesen wäre.
Ich sei ein Ignorant, sagte Max. »Sowas wie Helgoland gibt’s auf der ganzen Welt nicht noch mal! Evakuierung der gesamten Bevölkerung, dann Bombardement durch die Briten – die Krater kann man ja immer noch sehen –, später die Besetzung der Insel durch Heidelberger Studenten und ab 1960 die Rückkehr der Bewohner auf das verwüstete Gebiet, das ist absolut einzigartig!«
Na, von mir aus …
Am Morgen schimpfte Max im Speisesaal mit Marcus und mir: »Wieso steht ihr denn jetzt erst auf? Ich bin schon lange fertig, und die räumen hier gleich ab! Wir sehen uns dann am Hafen …«
Wozu die Eile? Nach dem Frühstück und vor dem Einbooten blieb uns noch recht viel Zeit, auf der Hotelterrasse zu sitzen und einer Amsel zuzuschauen, die von einem Strauch Johannisbeeren pickte und sie sich mit gerecktem Kopf den Hals hinunterrollen ließ.
»Die hat dadrin bestimmt ’ne Kegelbahn«, sagte Marcus. »Die Beeren sind die Kugeln, und unten in der Kehle wird gezählt, wie viele Kegel umfallen.«
Am Ableger konnte man Fotos vom gestrigen Ausbooten kaufen, aber durch sein affiges Posieren hatte der Schnurrbart sie alle verhäßlicht, und der Wind hatte mir eine Haarsträhne vor die Stirn geweht, was sehr blöd aussah.
Max fand auf dem Boot keinen Sitzplatz mehr und mußte stehen. Dreimal wäre er fast über Bord gegangen.
»Aber nur fast«, sagte Max hinterher. Er habe noch immer eine gute Standfestigkeit, weil er jahrelang seinen vier Kilometer langen Schulweg zu Fuß gegangen sei.
In Hamburg gab Marcus mir am Taxistand vorm Hauptbahnhof zum Abschied einen Zungenkuß. Nicht uninteressant, so eine Männerzunge, aber Frauenzungen waren mir doch lieber.
Zuhause fand ich ein Schreiben der Sparkasse, die mir mitteilte, daß mein Dispositionskredit ausgereizt sei, und einen Brief von Oma:
Hier war auch wieder mörderische Hitze, da konnte ich nicht auf meiner Bank sitzen, aber ich wich aus auf den Küchenbalkon und habe mich nicht vom Fleck gerührt, und so lebe ich noch! Überhaupt ist alles noch wie immer: Das Schloß steht noch in seiner Schönheit da, und der Hahn in der Nachbarschaft kräht so fleißig wie eh und je!
Heute ist mal wieder Lehrertreffen im Schloßcafé, wo ich mich hinfahren lassen werde.
Neulich hat Dein Papa angerufen und mir erzählt, daß er seine Eisenbahnanlage gern loswerden würde, aber wohin damit? Früher hat er sich doch gern damit beschäftigt!
Ja und nein. Er hatte nur sehr selten Teile davon aufgebaut, und dann war Mama jedesmal vor Wut explodiert und hatte darauf gedrungen, daß Papa erstmal alle Reparaturen im und am Haus erledigen solle. Wie hätte dabei Freude aufkommen können?
Als Tip-Reporter besichtigte ich das Internationale Jugendcamp Fließtal in Tegel. Zwischen Zelten und Lagerfeuern beugten sich Koreaner in knielangen Hosen mit Blütenmuster über Pfannen, in denen Hackbällchen schmurgelten, artig frisierte Mädchen saßen auf Bänken und schrieben Postkarten an Mommy in Übersee, ein paar Teenager spielten allen Ernstes Mensch-ärgere-Dich-nicht, zwei Kanadier sangen »Frère Jacques«, alle Neuankömmlinge lächelten so versonnen, als ob sie zum Kirchentag wollten, und im Gästebuch hatten drei Salzburgerinnen vermerkt:
Die Leit do san recht liab (und des moanama ernst!!!).
Gehörte es nicht zum Jungsein, daß man auch mal über die Stränge schlug? Was war mit dieser Jugend los?
Jochen und Philipp lümmelten sich auf dem Sofa und kuckten irgendeinen Mist über ein japanisches Institut, in dem Verbeugungslehrkräfte den Schülern 15-, 30- und 45-Grad-Verbeugungen beibrachten.
»Die spinnen, die Japsen«, sagte Jochen, aber Philipp meinte, diese Verbeugungskultur sei ein Beweis für die Überlegenheit des japanischen Formgefühls …
Was halt so dahergeredet wurde in meiner WG.
Schreiben konnte ich nachts nur bei geschlossenem Fenster, weil sonst geflügelte Insekten in mein Zimmer schwirrten. Giftgrüne Apparate mit einem Gesicht, das wahrlich nur ihrer Mutter gefallen konnte. Selbst als Vogel hätte ich mich gesträubt, wenn solche Wesen auf meinem Eßteller gelandet wären.
Auf der Leserbriefseite der taz entdeckte ich den Begriff »Mißbrauchsdynamik« und die Wendung »Wut macht Mut« und empfahl Eckhard Henscheid brieflich beides für eine Neuauflage seines Lexikons »Dummdeutsch«. Henscheid zuarbeiten: eine gute Aufgabe für Nachwuchskräfte.
Post von Andrea:
Hallo Schnucki!
Danke für das hübsche Kärtchen aus Helgoland. Ob das wohl mal ganz wertvoll wird mit den Unterschriften solch erlesener Herren?
Mit der Liebe ist es ganz schön, jedenfalls dann, wenn ich gerade nicht dabei bin, mich auramäßig zu verknittern und verknattern, nur weil der junge Mann mal wieder nichts mit Esoterik am Hut hat. Nu ja! Aber im Herbst fahr ich trotzdem wieder nach Belzig, und dann komm ich auch nach Berlin, is ja klar.
Und was macht bei dir die Liebe und das Leben?
Mit den besten Wünschen für die Zukunft
Madame de la Kappes
Ich schrieb ihr zurück, daß ich mich auf die Buchmesse freute und im Herbst vielleicht ein bißchen auf Lesereise ginge, und berichtete ihr auch von der treulosen Leipziger Apothekerin.
Dann rief ich in der Kowalski-Redaktion an und erkundigte mich nach dem Honorar für meine Beiträge im Aprilheft. »Immerhin haben wir ja schon Juli …«
Die nächsten Schecks würden voraussichtlich am kommenden Montag rausgehen, hieß es.
Aus der Taufe gehoben hätte ich gern auch einmal einen lustigen Fotoroman. Über irgendeinen Scheinheiligen, der im Hinterzimmer seines Ashrams eine illegale Spielbank unterhält oder so.
In einem Brief, der am Donnerstag eintraf, entschuldigte sich die Apothekerin für ihre Saumseligkeit. Ihr Leben sei gerade ein Riesenchaos …
Der einzige Lichtblick: Nachrichten von Martin Schlosser – welcher Art auch immer. Ich werde mich in Kürze irgendwie melden – ich hoffe wenigstens, dann von meinen 1000 Problemen 999 gelöst zu haben.
In Kürze irgendwie? Ließ mich das hoffen?
Da sei Dunja für mich am Telefon, sagte Lizzy und hielt mir den Hörer hin.
»Ja?«
»Martin? Hey! Weißt du, was ich heute nacht geträumt hab?«
»Nein, woher auch?«
»Daß wir ein Verhältnis miteinander hätten.«
»Soso …«
»Wollen wir mal wieder ’n Bier zusammen trinken gehen? Im Nova? So um acht?«
Im Nova bot ich Dunja eine Rolle in meinem Fotoroman an, doch die lehnte sie ab. Das verstimmte mich. Ich hörte bloß noch mit einem halben Ohr hin, während sie sich über die gestörte Beziehung zu ihrem Gesangslehrer verbreitete, und als sich ein Freund von ihr an unseren Tisch pflanzte, ein pferdeschwanz- und ohrringetragender »Klanginstallateur« namens Dominik, war mir bereits klar geworden, daß sie mich nicht verführen wollte. Aber wozu hatte sie mich dann herbestellt?
In seinen Klanginstallationen befasse er sich auf musikalische Weise mit gesellschaftlichen Problemen, sagte Dominik, und ich hielt ihm entgegen, daß wir alle gar keine Probleme hätten: »Von Todkranken mal abgesehen. Ernstzunehmende Probleme haben doch wohl eher die Menschen auf der Südhalbkugel der Erde …«
»Das halte ich für Zweckoptimismus«, sagte er und hob Dunjas leeres Bierglas in Richtung Kellnerin. »Kriegen wir noch ’ne Runde von dem hier?«
Ein verkorkster Kreuzberger Kneipenabend. Was wollte ich da noch?
Sein neues Werk »Das Blöken der Blumen«, einen Cartoonband, der in der Post lag, hatte Eugen mir postalisch »in unverwüstlicher Haarbruderschaft-Liebe« übersandt und es zuvor mit einer barocken Widmung ausgestattet:
Für Prof. Dr. Martin Schlosser,1
den Wiederbeleber des uralten Schildnöck-Gedankens2,
ein jedes Amtsgericht brauche sein eigenes Sinfonieorchester.3
In inniger Haarbruder-Liebe4 und
chronischer Ideenlosigkeit sowie Uninspiriertheit:5/6
Eugen Egner
09.07.1992
1 mit Gesicht und Bart
2 und großen Reisenden
3 wohlfeiles Selbstzitat (Egner)
4 siehe Grußformel Brief v. 09.07.92
5 leider ja
6 oder lieber doch nicht
↑
kalter Kaffee; eigens für die nachgeborenen Forscher aufgeführt.
Wir kennen das doch alles längst. Nicht? Du? Was? Hm?
Da hatte er der Egner- und der Schlosser-Forschung ein paar harte Nüsse zu knacken gegeben.
Mein Lieblingsbild in dem Band trug den Titel »Als der alte Mond hilflos im Graben lag und obendrein noch mit einem Spielzeugbus beworfen wurde«.
Herr Rutschky berichtete mir, daß ihn eine Mitarbeiterin des Goethe-Instituts in Tokio mit den Worten begrüßt habe: »Guten Tag, mein Name ist Sabine M. Frühstück, und ich forsche am menschlichen Körper!«
In Japan sei es übrigens Usus, Garnelen lebend zu verzehren. Die säßen bereits geschält auf dem Teller, zitternd vor Angst, und dann stippe man sie in ein Töpfchen mit Sojasoße und beiße sie tot.
Von Robert Altmans neuem Spielfilm »The Player« riet er mir ab (»Das war nix!«), und für die Schnurrende Traglast gab er mir zwei Fotos: »Selbstporträt beim Niesen« und »Selbstporträt als fett«. Da sah man einfach seinen nackten Bauch.
Ganz unverhofft kam dann doch Nicole zu Besuch. Sie war mit ihrem Trabi aus Leipzig angereist und verschlang das Bier im Nova abends aus Halbliterkrügen. So wie ich. Dazu ließ sie sich Whiskey kommen, und wenn ich etwas Freches sagte, haute sie mich.
Wir hatten viel Spaß miteinander, ohne dabei ein engeres Bündnis anzustreben. Bevor sie wieder abfuhr, spazierten wir am Sonntag noch über die Pfaueninsel, auf der dann ein Pfau auch fahrplanmäßig ein Rad für uns schlug.
Danach nahm Jochen mich beiseite. »Du hast doch neulich diese Perle aus Aachen bei dir gehabt«, sagte er. »Und jetzt diese andere Schnecke. Wie kriegst du das hin, daß die sich nicht in die Quere kommen?«
Wo hätte ich anfangen sollen, um ihm zu erklären, daß ich kein Doppelspiel trieb? Und daß es mir fernlag, an Frauen als Perlen oder Schnecken zu denken?
Max schickte mir etwas für die Schnurrende Traglast zu:
In Tallinn, das einst Reval hieß
fand ich einen Kebabspieß …
Weiter wußte ich nicht. Da ich aber sowieso gerade einen Brief an Robert Gernhardt zu schreiben hatte, fragte ich ihn, ob er weiter wüßte. Er wußte weiter:
… von ungeheurer Länge.
Worauf ich ihn verteilen ließ
in Tartu, das einst Dorpat hieß –
Mann, gab das ein Gedränge.
Hm, sehr schön zwar, aber ich hatte mir eigentlich einen Kebabspieß ohne Kebab vorgestellt. Doch das wußte Robert ja nicht. Außerdem scheint er eine eigenartige Auffassung von Erotik zu haben (Gedränge wegen ungeheurer Länge).
Als Herausgeber der Traglast hatte ich damit wieder einen guten Fang gemacht.
Bei einem von Carola organisierten Tip-Autorenstammtisch lernte ich die bezaubernde Journalistin Juliane Schäfer kennen und konnte sie sofort für die Mitarbeit an meinem vage geplanten Fotoroman gewinnen. Wiglaf willigte ein, den Bösewicht darin zu spielen, und Carola hatte nichts gegen die weibliche Hauptrolle, die ich ihr antrug. »Wie immer die dann aussehen mag …«
»Es könnte sein, daß du erschlagen wirst. Der Plot ist noch nicht ausgereift.«
»Har, har!« rief Wiglaf. »Das hat Dashiell Hammett auch immer behauptet, wenn er mit seinen Miezen in der Hollywoodschaukel gelegen hat, anstatt sich ums Drehbuch zu kümmern!«
Neue Post von Andrea:
Hallo Schnuddiwuddi!
Sollten meine Briefwechsel jemals ediert werden, war ich geliefert.
Die Liebe blüht noch immer, obwohl die Diskussionen mit einem E-Techniker, der auch noch Skorpion ist, zuweilen etwas anstrengend sein können.
Was der junge Herr zu den Besuchen eines langhaarigen Berliner Bohemiens bei der süßen kleinen Andrjuschka sagen würde, weiß ich nicht. Das hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, inwieweit man ihn über den tatsächlichen Zustand alter Liebesverhältnisse informiert. Aus der Distanz betrachtet wäre es ja irgendwie schon fast amüsant, wenn Du im Film »Zeter+Mordio-Dreiecksgeschichten die 195ste« mal die Rolle des alten Liebhabers einnähmst.
Na, mal sehen. Ich hab zwar keine Lust auf Neuauflagen alter Liebesdramen, aber im Zweifelsfall laß ich mich auch von besitzergreifenden jungen Herren nicht davon abhalten, zu tun, was ich will.
Die Apothekerin ist ja dumm, die weiß ja gar nicht, was ihr entgeht – na, isse ja selbst schuld.
Da war Andrea noch nicht auf dem neuesten Stand.
Herzallerallerliebste Grüße und Küsse
Deine Andrjuschkula
PS: Schreib mir doch mal bitte die diversen Termine, wo Du in Frankfurt oder anderswo eventuell eine weibliche Begleitung wünschst. Ich werde mich dann mit Lichtbild und Lebenslauf bewerben.
Wie leicht lebte es sich ohne die Bürde des Paarseins!
»Wenn du am Donnerstag kommst, dann bring mir aus ’ner Apotheke Rennie-Tabletten mit«, sagte Papa am Telefon. »Das Geld geb ich dir wieder.«
Vorher mußte ich allerdings noch bis in die Puppen mein endlich fertiggestelltes Buch ausdrucken. Und Klaus Bittermann eine Diskette mit der Datei in den Briefkasten stecken. Das tat ich morgens um vier, während die Vögel schon schrien.
Papa saß im vollgerauchten Wohnzimmer und nahm zwei von den Tabletten zu sich, die ich mitgebracht hatte. Dann stierte er wieder ins Nichts.
Es gab nichts Neues. Oder doch: Das Meppener Hindenburgstadion war in Emslandstadion umbenannt worden. Drei bis vier Jahrzehnte früher wäre das zwar auch schon wünschenswert, aber nicht durchsetzbar gewesen. Der Respekt vor dem Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg hätte das nicht erlaubt, obwohl er Adolf Hitler zur Macht verholfen hatte. Doch inzwischen schienen so viele alte Nazis gestorben zu sein, daß der SV Meppen es wagen durfte, den Namen seines Stadions zu modernisieren. 47 Jahre nach Kriegsende.
Ich nahm ein Bad mit Sandelholz und dachte an Andrea.
Your letters they all say that you’re beside me now …
Was wußte denn wohl irgend so ein milchbärtiger Elektrotechniker von ihr?
Als ich runterging, lief eine Reportage über die Suche nach Hitlers Leiche. Papa schlief bereits, im Sitzen, und ich ließ ihn. Ich stellte nur den Fernseher aus. Dann legte ich mich in meinem alten Zimmer ins Bett und wartete darauf, daß draußen jemand auf den Zigarettenautomaten eindrosch, der noch nie funktioniert hatte, doch es blieb still.
Papa war seine Lebensversicherung ausgezahlt worden, und nun wollte er für Renate, Volker, Wiebke und mich Konten einrichten und jeweils vierzigtausend Mark darauf einzahlen. »Das Geld soll aber nicht verplempert werden, sondern Zinsen abwerfen!«
In der Meppener Kreissparkasse füllte ein Glatzkopf die Formulare für mich aus. »Beruf?«
»Journalist«, sagte Papa.
»Nein, Schriftsteller«, sagte ich, und Papa verdrehte die Augen.
Vierzigtausend Mark, die ich nicht antasten durfte. Einerseits war ich Papa natürlich dankbar für dieses Geld. Aber andererseits …
Das Ganze schien auch eine Machtdemonstration zu sein. Aus eigener Kraft wäre ich nicht fähig gewesen, eine solche Summe zusammenzukratzen, und daraus folgte, daß er besser für mich sorgen konnte als ich selbst.
In dem Spielfilm »Und immer lockt das Weib« von 1956, der abends auf Eins Plus kam, waren alle hinter der vollbusigen Brigitte Bardot her. In einer Szene hatte sie einen Fahrradplatten und sagte: »Ich bin platt.« Und der Mann, der ihr das Fahrrad abnahm, sagte: »Na sowas! Davon sieht man ja gar nichts.«
Welch spritziger Humor!
»Als dieser Mist in den Kinos lief, ist Renate geboren worden«, sagte Papa. »Da war ich noch lange nicht mit meinem Studium fertig. Und im Jahr darauf ist meine Tuberkulose ausgebrochen. Daß das ein Kriegsfolgeschaden war, ist niemals anerkannt worden. Sonst hätte der Staat mir meine gesamte Ausbildung finanzieren müssen. Aber Mama und ich haben nie einen Pfennig gekriegt. Uns hat keiner geholfen. Keiner! Wir waren immer allein auf uns selbst angewiesen …«
Er weinte, und ich wußte nicht, was ich tun sollte. Ihn umarmen?
Auf der Bahnreise nach Jever machte ich am Sonnabend einen kleinen Abstecher in die Oldenburger Lindenstraße, um mal wieder Heike und Matthias zu besuchen, aber Heike, meine langverflossene erste Freundin, die sich im Laufe der Zeit zur radikalfeministischen Lesbe gemausert hatte, fertigte mich an der Wohnungstür ab: Matthias sei nicht da, und sie selbst habe keine Zeit.
Das sei ja schade, sagte ich, und Heike, die meiner Miene einen Zweifel abzulesen schien, erwiderte: »Wieso? Kann doch sein?«
Nun denn. Ich wollte mich niemandem aufdrängen.
Urgemütlich war’s dafür bei Oma Jever. Matjes, Pellkartoffeln, Dill, Familienfotos, Ansichtskarten aus den Urlaubsorten der Töchter und der Enkelkinder, Thiele-Tee, Rosinenbrot und Schlehenfeuer: In diesem Universum blieb alles beim alten, solange Oma lebte.
Ich schob sie über den Friedhof und auch durch den Schloßgarten, denn dort war sie schon lange nicht mehr gewesen. All die trauten, schön geschwungenen Wege, die vorzeitlichen Baumriesen und die schnatternden Nachkommen jener Stockenten, die ich als Kind mit Brot gefüttert hatte …
In der Großen Burgstraße trafen wir auf Frau Böger, Omas einstige Mühlenstraßennachbarin. »Na, Frau Lüttjes?« sagte sie. »Is dat nich moi weer vandaag? Und wie ich sehe, haben Sie hohen Besuch!«
»Ja, ich fühle mich direkt verwöhnt«, sagte Oma und lachte. »Aber jetzt wird’s mir bald schon zuviel mit der Sonne!«
Am Sonntagabend stieß ich im Programm des Senders Kabel eins auf eine Folge der amerikanischen Sitcom Hoppla, Lucy. Eine Serie aus den späten Sechzigern. Da ließen zwei Weiber ein Geschenkpaket fallen, das ihnen jemand in Verwahrung gegeben hatte. Sie packten es aus und versuchten, die darin befindlichen Scherben einer Keramikskulptur wieder korrekt zusammenzukleben. Mit dem Ding, das dabei entstand, gingen sie in einen Geschenkeshop und fragten den Inhaber, ob beispielsweise die von ihm vertriebene serienmäßige Skulptur eines harfespielenden Engels, wenn man sie zertrümmere und wieder zusammenklebe, so ähnlich aussehe wie das Objekt, das sie hier mitgebracht hätten …
Auf etwas so Lustiges war ich beim Zappen gar nicht gefaßt gewesen.
Bei meiner Abreise steckte Oma mir am Montag eine Tafel Milka-Vollmilch-Schokolade zu. Als wäre ich noch immer sieben Jahre alt und heiß auf Süßigkeiten!
Ich fuhr nach Hannover zu Dagmar und erhielt von ihr als nachträgliches Geburtstagsgeschenk ein Oberhemd mit Puffärmelchen, das ich nur unter Ausschluß der Öffentlichkeit tragen konnte.
Dagmar verbat sich diesen Ausdruck: »Das sind keine Puffärmelchen! Ich würde dir doch kein Dirndl schenken!«
Bei Minestrone mit Kirschtomaten redeten wir über den demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton, der gerade erklärt hatte, daß er zwar einmal Marihuana geraucht, aber nicht inhaliert habe.
»Auch wenn er da gelogen hat, wäre mir dieser Clinton lieber als der olle George Bush«, sagte Dagmar. »Der geht doch nun schon auf die siebzig zu! In diesem Alter sollten Politiker allmählich mal kürzertreten …«
Im schweineheißen Intercity nach Berlin hielt ich es nur im Gang auf einem Klappsitz am offenen Fenster aus. In einem vollen Sechserabteil wäre ich kollabiert.
Und dann nach jedem Halt die Eselei der neuzugestiegenen Leute, die die Gangtür nicht aufzogen, was ja auch möglich gewesen wäre, sondern sie unbedingt aufstoßen wollten, obwohl meine Knie und mein Gepäck ein gut sichtbares Hindernis bildeten! Wie war dieses Volk bloß jemals darauf verfallen, daß ihm der Rang einer führenden Kulturnation gebühre?
Zuhause stellte ich fest, daß Omas Schokoladentafel in meiner Reisetasche geschmolzen war. Eine Riesenferkelei. Die Schokolade hatte meine Strümpfe durchsuppt und sich sogar den Weg in meine Waschtasche gebahnt.
Doch was machte das schon! Ich fand endlich wieder einen Kowalski-Scheck in meiner Post vor. Und einen Brief von Eugen mit der nicht unberechtigten Frage:
Wieso küßt Dich Marcus? Mußt Du den jetzt heiraten? Kann der Dich überhaupt ernähren?
Bereits fünf Minuten nach dem Duschen war ich wieder naßgeschwitzt, und wenn ich die Hemdsärmel aufkrempelte, blieben meine Unterarme auf der Schreibtischplatte pappen.
Marcus rief an: Er sei in Berlin, und wir müßten uns betrinken.
Ich traf mich mit ihm im Nova und erzählte ihm von Hoppla, Lucy und der kaputtgegangenen Skulptur, bis er sich vor Lachen krümmte. Und das war nicht nur eine Redensart: Marcus kringelte sich unterm Tisch und hielt sich den Bauch.
»Alles okay bei euch?« fragte die Kellnerin, die uns die nächste Runde brachte.
In Komplizenschaft mit der brutalen Morgensonne machten die im Hof rabaukenden Bauarbeiter wieder einmal meinen Schlaf zuschanden. Den ganzen Vormittag über ließen sie Schleifgeräte aufheulen, die seit der Haager Landkriegsordnung als geächtet galten, und was mir aus den Poren floß, fühlte sich nicht mehr wie Schweiß an, sondern wie Zweikomponentenkleber.
Ein Kärtchen von Max:
Info-Radio 101 vermeldete eben, daß 2000 bosnische Flüchtlinge »ein Dach auf den Kopf bekommen« hätten. Das ist aber nicht nett. Und das Wasser des Wannsees hat 32°! Das ist ja wie in Kaffee baden. Ich bin seit einer Woche verkabelt, aber ich möchte das wieder weghaben. Es kommt ja überhaupt nichts.
Was die Privaten so zeigten, waren Schaumstoffsendungen wie Glücksrad, Traumreisen, Li-La-Launebär, Nathalies Lifestyle Magazin, Top Model, Super Shop, Eurobics und Der Preis ist heiß. Oder Filme wie »Todesmonster greifen an« und »Wenn die prallen Möpse hüpfen«. So hatten es die Medienpolitiker der CDU gewollt.
Die Zahl der freilaufenden Hunde schien in Kreuzberg täglich zuzunehmen. Auf jeder Straße sprangen sie herum, markierten ihr Revier und kackten alles voll. Selbst auf unserer Haustreppe mehrten sich die Häufchen, und als ich in einer Plastiktüte zwei Nackenkoteletts heimtrug, machte eine dieser Tölen sogar Miene, mir die Beute zu entwinden.
Gab es keine Hundefänger mehr?
Ein Gewitter! Endlich! Blitze! Donner!
Doch der Abkühlungseffekt hielt nicht lange vor. Nach dem abschließenden Regenschauer heizte Berlin sich wieder auf und spielte São Paulo.
Kurt Scheel hatte mir erlaubt, im Merkur gegen den Philosophen Günther Anders zu polemisieren, den ich nicht ausstehen konnte. Ich vertiefte mich noch einmal in dessen Werke und staunte über den blühenden Unsinn, mit dem er als Gesellschaftskritiker hervorgetreten war. Wenn es nach Anders gegangen wäre, hätte es kein Fernsehen geben dürfen …
Die letzten Reste dessen, was auch in standardisiertesten Ländern an häuslichem Milieu, an gemeinsamem Leben, an Atmosphäre noch bestanden hatte, sind damit liquidiert …
… keine Kosmetik …
Beispiel für Selbstverdinglichung: das make-up … Ohne make-up unter Leute zu gehen, kommt für girls nicht in Betracht …
… keine entartete Musik …
… die Orgien, die diese Tänze, etwa in den Tanz-Etablissements Haarlems, darstellen, haben mit »Vergnügungen« nichts mehr zu tun; sie sind viel weniger und viel mehr als das: nämlich ekstatische Opfertänze, die dem Baal der Maschine zu Ehren kultisch zelebriert werden …
… und keine Kofferradios:
Die Liebenden, die mit einem sprechenden »portable« am Ufer des Hudson, der Themse oder der Donau spazieren gehen, sprechen nicht zueinander, sondern hören einer dritten Person zu: der öffentlichen, meist anonymen Stimme des Programms, die sie, einem Hündchen gleich, spazieren führen, richtiger: von der sie sich spazieren führen lassen. Ihre Promenade machen sie, da sie eben nur das Miniaturpublikum sind, das der Stimme folgt, nicht zu Zweien, sondern zu Dritt. Von einer intimen Sprechsituation kann also gar keine Rede sein, diese ist von vornherein aufgehoben …
Und allein Günther Anders sah die Zeichen des Verfalls und bot dem Urbösen die Stirn! Von dem häuslichen Milieu, in dem Mama, Papa, Renate, Volker, Wiebke und ich in den frühen siebziger Jahren gemeinsam Der Kommissar, Drei mal Neun oder Die Rudi Carrell Show gekuckt hatten, wußte Anders weniger als nichts, und da er Liebespärchen das Musikhören mißgönnte, hätte man vielleicht mal Anders’ eigenes Balzverhalten untersuchen sollen. Wie mochte er selbst eine intime Sprechsituation herbeigeführt haben? Mit Zwölftonmusik? Oder vollkommen lautlos? Und hatte er sich nur mit ungeschminkten Frauen verabredet? Oder ihnen sonst Vorträge über die Selbstverdinglichung durch Kosmetik gehalten?
Er hielt sich für einen Propheten, und es mußte ihm einmal jemand in die Parade fahren. Ich hatte noch nie irgendwo ein kritisches Wort über ihn gelesen.
Einem ihrer Texte für die Schnurrende Traglast hatte Kathrin den Titel »Tüschwa« gegeben:
In der WG, in der ich zähneknirschend mein junges Leben friste, steht ein Küchenschrank, dessen Name ist Tüschwa. »Weil er türkis und schwarz gestrichen ist!« Tüschwa. Nie wieder werde ich dieses Wort aus meinem Gedächtnis tilgen können. Trotzdem werden meine schlaflosen Nächte in Zukunft glimpflicher verlaufen, wenn ich weiß, daß sich einige Tausend gleich mir auf der Matratze wälzen, während durch ihre Gehirnwindungen das eine, das verfluchte Wort braust: Tüschwa.
Als ich ihr vorschlug, in einem Essay das Aussterben des Schottenrocks zu beweinen, sagte sie: »Ich werde mich hüten. Meine waren kratzig. Alle beide.«
Im Copydrom in der Graefestraße machten wir Kopien für mehr als dreißig Mark und klebten dann unsere Lieblingsbildchen mit fädenziehendem Fixogum auf die Seiten der Nullnummer.
»Und das im Zeitalter des Desktop Publishing!« sagte Kathrin. »Die nächste Ausgabe sollten wir im Kartoffeldruckverfahren herstellen. Dann sieht alles noch schmieriger aus …«
Zur Abwechslung lud ich sie ins Restaurant Amaretto ein, was sie nicht daran hinderte, mich darauf aufmerksam zu machen, daß ich ziemlich dick geworden sei.
Ich zog meinen Bauch ein und sagte, daß ein Bauch, den man einziehen könne, kein Bauch sei, aber Kathrin war bereits bei einem anderen Thema: Sie erwarte ungeduldig den Kinostart von »Alien 3«. Anfang September sei es soweit. »Man zählt die Tage …«
Um fünf Uhr morgens war die Schnurrende Traglast fertig.
»Und niemand wird es uns lohnen«, sagte Kathrin und plädierte deshalb für eine Umbenennung in Schnarrende Truglust.
Bevor ich das Heft vervielfältigen konnte, unter welchem Titel auch immer, mußte ich erst einmal wieder zu Geld kommen.
In alter Frische setzten mir am Montag Mischmaschinen, Preßlufthämmer und der stechende Sonnenschein zu. Und was hatte Günther Anders, wie ich lesen mußte, wieder dekretiert?
Man hat den Begriff »Schizotopie« als den entscheidenden Begriff der heutigen Moral oder Unmoral einzuführen …
So, hatte man das? Und wenn man sich weigerte? Kriegte man von Anders dann eine Sechs in Sozialkunde? Und drei Punkte in Flensburg?
Auf dem Eßtisch lagen Lizzys Musikzeitschriften herum, die ich alle nicht lesen konnte, weil ich die Sprache nicht verstand, in der sie geschrieben waren.
… gutturaler Digital-Underground-Gast-Rap … das mischt präzise und abgezirkelt … die upfronteste Discothek … lockeres Hinaufgleiten zu einer Dichte, die alle Zwischenräume zuläßt und durch Kontrolle Flächen öffnet …
Ein grauenhaftes Kauderwelsch. Im Popmusikjournalismus schien es noch übler herzugehen als in der Literaturkritik.
»Zween derbe Spaßvögel«, stand unten auf dem Plakat, das Eugen Egner für Michael Rudolfs und meine Lesungen entworfen und mir als Kopie zugeschickt hatte, und oben: »Die Lesewölfe kommen!«
Gezeichnet hatte Eugen ihn und mich dazu als zwei waidwunde Landstreicher, deren Äußeres bei allen Eltern den Impuls wecken mußte, die Kinder ins Haus zu holen. Wundervoll! So wollte ich unsere Lesungen beworben sehen. Welch ein Segen, als von Eugen Egner gezeichneter Schuftikus auf Lesereise gehen zu dürfen!
Erich Honecker war von Moskau nach Berlin ausgeflogen und verhaftet worden. Und was stellten sie nun mit ihm an? Nachdem sie ihn als Staatsgast hofiert hatten, als er noch mit der Nationalen Volksarmee bewaffnet gewesen war?
Gemeinsam mit Max quasselte ich beide Seiten einer 90er-Kassette voll, die wir Eugen schenken wollten.
»Ich möchte mit vollem Mund intelligente Dinge äußern«, sagte Max und las knäckebrotfutternd eine Geschichte von Robert Walser vor. Danach beschimpften wir einander, und dann gurrten wir uns an. Und wir gingen auch raus, um Eugen das Viertel zu beschreiben, in dem Max wohnte, einschließlich der häßlichen Kunstwerke, die in Moabit herumstanden.
Wenn schon Berlin, dann Kreuzberg, dachte ich. Obwohl ich ja selbst mal in Moabit gewohnt hatte.
Am Ende des Abends schenkte Max mir ein paar Nummern des Berliner Fanzines Ich und mein Staubsauger, für das er in den achtziger Jahren kolumniert hatte, und dann verpaßte ich leider die letzte U-Bahn und mußte im Regen nachhause laufen.
Kurz vor dem Ziel war ich versucht, von meinem Kurs abzuirren und bei der Schneiderin zu klingeln, aber das verkniff ich mir. Es hatte ja doch keinen Zweck mit ihr.
Die Nachtwanderung hatte mir eine dicke Erkältung beschert. Ich war zu fast nichts mehr zu gebrauchen und schaffte es gerade noch, Max auf einem Kärtchen mitzuteilen, daß ich erkrankt sei. Mein einziger Trost war die in der Augustnummer von Kowalski abgedruckte Warnung vor dem Weltuntergang, der am 12. September 1994 stattfinden werde, wenn ich nicht genug Barmittel besäße, um ihn aufzuhalten. Unterstützen, hatte ich geschrieben, könne man mich mit Überweisungen auf das »Sonderkonto Doomsday«, Berliner Sparkasse, Kontonummer 1 410 325 195, Bankleitzahl 100 500 00.
In einer Ausgabe von Ich und mein Staubsauger berichtete Max, daß er mit einem Freund namens Fritz in Stralsund in das Restaurant Gastmahl des Meeres eingekehrt sei und einen »Indischen Seefisch« bestellt habe.
Was man sich an der Ostsee unter Indien vorstellt, ist bemerkenswert: In der Mitte des Tellers befand sich der Fisch, aber völlig bedeckt von einer rote-Bete-geröteten Soße, mit der man bei uns Heringssalat anmacht. Ringsherum lag folgendes Arrangement: Sauerkraut, gehobelte Gewürzgurken, Ananas, Silberzwiebeln, 1 alkoholtriefende Marachino-Kirsche, 5 Sauerkirschen, 1 Cocktailwürstchen (gab ich Fritz), Petersilie, geraspelte Karotten. Es hätte mich gar nicht gewundert, wenn auch noch ein paar Zigaretten dazwischen gelegen hätten.
Ich las das gern, aber mir lief die Nase, und ich hatte grausige Kopfschmerzen.
Jochen war so nett, mir ab und an Essen, Bier und Zigaretten an mein Krankenlager zu bringen, das Geschirr abzuräumen und den Aschenbecher zu leeren.
Am Freitagmittag warf Sigrun mir durch die Tür einen Brief zu: »Der isch für di! Abr i komm ned nähr. I will mi ned anschdegga!«
Der Brief war von Oma.
Vor einer Woche hatte ich mal einen aufregenden Tag! Am Dienstag fuhr die gute Frau Lange mich im Rollstuhl zur Sparkasse. Beim Aussteigen habe ich mich am rechten Knöchel sehr verletzt, so daß sich ein doller Blutstrom ergoß. Die Vorhalle der Sparkasse habe ich total mit Blut versaut, große Aufregung, man meinte, ich müßte per Rettungswagen versorgt werden! Schmerzen hatte ich gar nicht, und eh ich mich versah, lag ich auf einer Trage und ab zu Dr. Tarbiat am Marktplatz. Der stellte aber fest, daß er das gar nicht zu nähen brauchte, es wurde nur verbunden. Heute ist die Wunde fast verheilt – – – aber es kam eine Rechnung vom Rettungsdienst Friesland über 470 DM!! Sagenhaft!
Nun geht das Leben in seiner ruhigen Art weiter, es ist kühl geworden, aber ab morgen soll es wieder heiß werden. Weißt Du schon, daß die Blums gut in Korsika angekommen sind? Auf der Insel, die sie ja schon kennen, sind sie sehr glücklich. Immo und Luise sind von Teneriffa zurück und finden es in Itzum viel schöner als dort! Dagmar und Wiebke planen zu meinem 86. Geburtstag zu kommen und auch das Wochenende in Jever zu bleiben, denn am 8.8. ist hier Altstadtfest! Hättest Du nicht auch mal wieder Lust auf »Bohnensopp«?
Bohnensopp: Das war dieser hochprozentige Blödmacher, ohne den in Friesland nichts rundlief.
Therese ist inzwischen pensioniert. Bei der Abschiedsfeier mußte sie eine Rede halten, da entdeckte sie unter den Zuhörern zu ihrer Freude ihren Norman.
Nun ist mein Vorrat an Neuigkeiten zu Ende – also Schluß! Hoffentlich höre ich bald mal wieder von Dir?
Ich wollte Oma gern wieder besuchen, aber nicht so bald. Erstmal mußte ich gesund werden.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte Karl Kraus lange geschwiegen und im Oktober 1933 dann in der Fackel ein Gedicht über sein Schweigen veröffentlicht:
Man frage nicht, was all die Zeit ich machte.
Ich bleibe stumm;
und sage nicht, warum.
Und Stille gibt es, da die Erde krachte.
Kein Wort, das traf;
man spricht nur aus dem Schlaf.
Und träumt von einer Sonne, welche lachte.
Es geht vorbei;
nachher war’s einerlei.
Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte.
Als hätte er die unaussprechlichen Verbrechen schon geahnt, die noch folgen sollten.
Weil ich es im Bett wegen der Hitze nicht mehr aushielt, ging ich ins Kino, obwohl ich noch Fieber hatte. Zuerst, entgegen Herrn Rutschkys Rat, in »The Player«, wobei ich mich langweilte, denn wen interessierten schon Satiren auf den Niedergang Hollywoods, und dann in »Batmans Rückkehr«, wobei ich mich noch ärger langweilte. Diese Superheldenscheiße war auch durch ironische Brechungen nicht zu retten.
Sigrun servierte mir Zitronensaft.
»Schmegg’s dir ned?« fragte sie.
»Nein.«
»Gud! Medizin wirgd nur, wenn sie schlechd schmeggd!«
Sie lachte, aber mir war nicht zum Lachen.
Am Montagmittag fuhr ich zur Amerika-Gedenkbibliothek, um mir noch mehr Bücher von und über Günther Anders zu beschaffen, doch sie machte erst um drei Uhr nachmittags auf. Warum nur?
Ich suchte mir eine schattige Bank, auf der ich die zwei Stunden Wartezeit lesend überbrücken wollte. Ohne Lektüre ging ich fast nie aus dem Haus.
In seinem großen Aufsatz »Warum die Fackel nicht erscheint« hatte Karl Kraus im Juli 1934 in der Fackel die Gründe für ihr Nichterscheinen erläutert und dargelegt, daß er sich dem Weltkrieg geistig noch gewachsen gefühlt habe, aber nicht mehr der »Erscheinung Hitler« …
… indem etwa die Möglichkeit, daß ein Proletarier 192 Stunden in einem der bekannten Stehsärge zubringen muß, oder »Judenliebchen« durch die Straßen geführt werden, außer dem Bereich meines Denkens und Dichtens liegt.
Denn gegen Stehsärge könne man nicht polemisieren. Kraus hatte befürchtet, mit jedem seiner Worte »die Wut des Peinigers zu vermehren«. Es sei eine Lage,
worin Verantwortung den schmerzlichsten Verzicht auf den literarischen Effekt geringer achtet als das tragische Opfer des ärmsten, anonym verschollenen Menschenlebens …
Und all das zu einer Zeit, in der Opa Jever sich zum Eintritt in die NSDAP entschlossen hatte. Regungen des Widerstands gegen die Nazis waren mir auch von Opa Schlosser nicht bekannt.
Nach einer halben Stunde war der Baumschatten verflogen, und ich zog mich ins Hertie-Restaurant zurück, wo ich acht Mark siebzig für einen Teller trockener, saurer Spaghetti mit einer widerlich scharfen Soße berappte.
Von meinem Platz aus hatte ich eine Uhr am Straßenrand im Auge, und es wunderte mich, wie träge die Zeit verging.
Als die Uhr auf fünf vor drei stand, brach ich auf und stellte fest, daß sie eine Dreiviertelstunde nachging. Und in der Gedenkbibliothek konnte ich dann doch nichts ausleihen, weil das Computersystem zusammengebrochen war. Phantastisch!
Die US-amerikanische Feministin Andrea Dworkin glich ihrer eigenen Karikatur: eine unfaßlich korpulente, gnatzige und verbiesterte Dogmatikerin, die nicht nur der Prostitution und der Pornographie, sondern auch dem heterosexuellen Geschlechtsverkehr im allgemeinen den Kampf angesagt hatte. Das Aussehen dieser Frau war eine nonverbale Kriegserklärung.
Für den Tip ging ich wieder in eine Pressevorführung. »Steinzeit Junior«: Da mischte ein reanimierter Jüngling aus prähistorischer Zeit eine Highschool auf und entlockte den Mädchen kleine spitze Schreie. Ein quälender Quark, aber das Zeilengeld machte es wett.
Einen Scheck von der Titanic über 84 Mark trug ich zur Sparkassenfiliale am Kottbusser Tor, doch die hatte dienstags bereits ab drei Uhr nachmittags geschlossen.
Wollten die Angestellten dort an Dienstagnachmittagen mal schön unter sich sein?
Helmut Krause rief mich an, einer der Organisatoren der Neue-Frankfurter-Schule-Ausstellung in Kaiserslautern, um zu fragen, ob er mir für den 15. August ein Hotelzimmer reservieren solle.
Ich bat ihn um ein Doppelzimmer, und das wurde mir genehmigt.
In meinem Oberkiefer hatte es nur leicht gepocht, aber die Zahnärztin sprach von fortgeschrittener Parodontose und schliff unbarmherzig an mir herum. Es wurde auch eine Art Sandstrahler eingesetzt. Pfui baba.
Doch wie schön war es dann immer, aus der Praxis wieder hinauszugehen und an andere Dinge zu denken als an den nächsten Termin.
Was bog dort um die Ecke? Noch nicht ersehen und schon geliebt! Ich stürze mich in dieses Abenteuer …
Von Max war wieder ein Kärtchen eingelaufen:
Weh, du Armer, hast dich auf dem Heimwege verkühlt! Hatte sich die U-Bahn schon verkrümelt? Gott strafe sie! Nicht mehr so krank ist offenbar Herr Kempowski. Im Tagesspiegel las ich gerade, er habe mit Egon Krenz in so einer Spontan-Talkshow geplaudert. Obwohl: Man weiß ja nicht. Die Brüder wiederholen heutzutage ja auch alte Talkshows. Laufend!
War Kempowski also nun wieder auf dem Damm oder nicht?
Ins Gewicht fiel eine Mietnebenkostennachzahlungsforderung: 173 Mark für jeden. Und Philipp verlangte mir 68 Mark für die Haushaltskasse ab. Jetzt mußte subito ein neuer Scheck her.
Der Titanic-Redakteur Christian Schmidt rief an: Er habe vor, mit dem Motorrad nach Polen zu fahren, und auf dem Hinweg würde er gern in Berlin übernachten. Ob am Sonntag vielleicht ein Schlafplatz bei mir frei sei?
»Ja. Klar. Hier ist sogar ’n ganzes Zimmer frei.«
»Knorke! Schnafte! Dit is mein Ballien!«
Ich schickte Oma eine Glückwunschkarte und kehrte von diesem kleinen Gang zum Briefkasten total verschwitzt zurück, aber Lizzy und Sigrun war es in Berlin noch nicht heiß genug: Sie brachen nach Ägypten beziehungsweise in die Türkei auf. Zwei Sonnenländer, in die ich niemals freiwillig gereist wäre.
Wenn Günther Anders philosophische Diskussionen wiedergab, die er geführt hatte, hob er gern hervor, daß seinen Gesprächspartnern im Nu die Argumente ausgegangen seien:
Mir schien, daß die Frage nun begann, in ihn einzusinken. Er strich sich mit den Fingern durch seine Mähne und begann, schwer zu atmen.
Und:
Seine Frische und sein Selbstbewußtsein waren dahin. Ich nahm nun die Sache in die Hand.
Und:
Er öffnete seinen Mund mehrere Male, aber diesmal gelang ihm nicht einmal das Flüstern.
Dem Durchblicker Anders war einfach niemand ebenbürtig. Eine Frau sollte sich sogar übergeben haben, als sie die Tragweite seiner Gedanken erkannt hatte:
Da wurde sie grau im Gesicht und erbrach sich.
Ich dachte zuerst, ich hätte mich verlesen, aber nein: So hatte Anders die Reaktion jener Frau auf die von ihm geäußerten Weisheiten beschrieben. Und niemand war ihm jemals öffentlich entgegengetreten, um ihm zu sagen, daß er kein Philosoph sei, sondern ein sich selbst beweihräuchernder Schwadroneur.
In Don Siegels Film »Der Tod eines Killers« von 1964, den Wiglaf und ich uns im Kino ansahen, erschoß Lee Marvin am Ende Ronald Reagan.
»Darauf hab ich mich schon die ganze Zeit gefreut«, sagte Wiglaf.
Lee Marvin, gleichfalls angeschossen, torkelte dann sterbend aus dem Haus und sah selbst dabei noch würdevoll aus.
Als er tot war, suchten wir einen Biergarten auf und erzielten Einigkeit darüber, daß ein guter Gangsterfilm auch ohne den Overkill an Feuerbällen auskomme, den inzwischen jeder Zwölfjährige im Kino für sein Taschengeld erwarte.
Am Nebentisch ließ sich ein Koloß nieder, in dem Wiglaf den Journalisten Carlo von Tiedemann zu erkennen glaubte. Dieser Typ, sagte er, habe einmal einen Radiobeitrag über das Leben der Juden in Deutschland so abmoderiert: »Und nun weiter im Pogrom!«
Aber Carlo von Tiedemann – oder sein Doppelgänger – verhielt sich ruhig, wir konnten friedlich austrinken, und Wiglaf trug mir auf, Eugen Egner bitte auszurichten, daß er Gott sei.
Laut Tagesspiegel sollte Sonntag, der 9. August 1992, in Berlin der heißeste Tag des Jahrhunderts werden, und diese Vorhersage erwies sich leider als wahr. Arno Schmidt hatte recht:
Die Sonne?!: ein Wahnsinniger fuhrwerkte da oben mit seinen brüllenden Schmelzflüssen herum!
Ich bezweifelte, daß auch nur einer von tausend Verbrauchern, die das Dralle-Beauty-Pflege-Shampoo benutzten, sich unter dem darin angeblich enthaltenen »natürlichen Seidenprotein« irgendetwas Konkretes vorstellen konnte, und das war so ungefähr der einzige Gedanke, den ich unter der Dusche fassen konnte.
Am Abend traf ich mich mit Christian Schmidt im Nova. Wir setzten uns an einen beschirmten Tisch und tranken Brüderschaft. Sein Gepäck bestand in einer kleinen Reisetasche und einem Motorradhelm. Das Motorrad hatte er irgendwo an der Urbanstraße geparkt.
Er hätte mich gern schon früher als freien Autor gewonnen, sagte er. »Aber die Texte, die du eingeschickt hast, waren irgendwie nicht die richtigen …«
Christian war Jahrgang 1956 und seit drei Jahren in der Redaktion. Er stammte aus Bielefeld, ebenso wie sein Jugendfreund Hans Zippert, der jetzt als Titanic-Chefredakteur amtierte. Und Christian kannte natürlich auch Robert Gernhardt, Chlodwig Poth und die ganze Korona, die sich in Frankfurt um die Titanic scharte. Bei der Montagskonferenz, sagte er, rede meistens Gernhardt, während Chlodwig Poth nur stumm am Tisch sitze und voller Verachtung in den Lifestyle-Magazinen blättere, die da so herumlägen.
»Und Eckhard Henscheid?«
»Der läßt sich nicht blicken.«
Beim dritten oder vierten Bier zückte Christian einen Band mit Schriften von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und deklamierte daraus wie ein Volkstribun, und dann überredete er drei wildfremde Männer von einem Nachbartisch zum Pokern.
»Wie? Mit denen willst du jetzt um Geld spielen?«
»Na klar! Was denkst’n du?«
Sie taten das mit großem Juchhee, und Christian meinte, daß ich ruhig gehen könne. Er werde bei seinen neuen Pokerfreunden übernachten.
Als ich ging, dankte ich dem Himmel dafür, daß Papa nicht ahnen konnte, in welchen Kreisen ich mich bewegte.
Michael Rudolf, der am Montag kurz zu Besuch kam, händigte ich eine Kopie der Urfassung meines satirischen Romans »Das erwachende Selber« aus.
»Den bringen wir dann im nächsten Jahr raus«, sagte Michael. »Und zwar illustriert! Irgendwelche Wünsche? Wer soll’s machen?«
»Yvonne Kuschel. Die könnte das.«
»Klingt plausibel. Ich kau das mit Gerd König durch, und dann hörst du von uns. Alter! Hey! Und auf der Frankfurter Buchmesse machen wir ’n Faß auf!«
Dann rief der konkret-Redakteur Wolfgang Schneider an und fragte, ob ich das neue Buch von Luise Rinser besprechen wolle.
»Ist dafür nicht Eckhard Henscheid zuständig?«
»Ja, aber der möchte nicht. Er hat gesagt, das stelle er den Nachgeborenen anheim.«
Eigentlich ja eine Ehre: Henscheid mal die Arbeit abzunehmen. Das sagte ich auch zu René Martens, als er mich für ein kleines Autorenporträt interviewte, das er dem Magazin Szene Hamburg anbieten wollte.
In Jon Amiels neuem Kinofilm »Julia und ihre Liebhaber« spielte Peter Falk einen Hörspielregisseur, der sich einen Jux daraus machte, das Volk der Albaner auf groteske Weise zu verunglimpfen. Einmal imitierte er sogar das Winseln eines deutschen, von einem Albaner geschändeten Schäferhundes und ließ den Täter zur Entschuldigung vorbringen, daß dies ein »alter albanischer Brauch sei«, woraufhin erzürnte Albaner den Radiosender stürmten und niederbrannten …
Carola, Wiglaf und ich kamen aus dem Lachen kaum heraus. Wunderbar, diese in ihrem Nationalstolz gekränkten und bis aufs Blut gereizten Männer! Solange man sich nicht in ihrer Gewalt befand, waren solche Leute ungeheuer komisch.
Von Jon Amiel stammte auch die unvergessene Fernsehserie The Singing Detective. Die hätten sie mal wiederholen sollen.
Von meiner Zahnärztin wurde ich bereits nach zehn Minuten Behandlung entlassen: Der böse Feind, die Parodontose, war besiegt, und ich hatte auf Monate hinaus zahnarztfrei.
Eine gute Zeit, um sich neu zu verlieben. Doch in wen?
Eugen Egner schrieb mir, daß einer seiner Nachbarn neulich um sechs Uhr früh zur Bewässerung seines Gartens geschritten sei:
Dabei entfachte der Wasserdruck unter Zuhilfenahme von Wasserhahn und Gartenschlauch ein unvermutet, ja: überzeugend durchdringendes Schrillpfeifen, daß es das Hirn wie ein meningitisches Sägewerk sauber in mehrere Hemisphären, Globuli und Segmente trennte. Wie Würfelbrühe (das unmäßige Schwitzen ob der auch bei Nacht beleidigend wüsten Hitze zersetzte uns zu geklumpter Würze) schwappten wir auf den Laken. Das Schrillen schwoll, alle Nerven wurden ausgebohrt, und der Schlaf schien Schieberware zu werden …
Und er berichtete mir, was Helmut Krause ihm von seinem Besuch bei Eckhard Henscheid in Frankfurt erzählt habe:
Die Rede kam auf den Nachwuchs. Der Dichterfürst äußerte seine Eindrücke und Ansichten, was den betraf (den Nachwuchs nämlich). Und was soll man sagen: Unter den neueren, ja: jungen Kollegen wußte (so habe ich’s vernommen aus Helmut Krauses Mund) Meister Eckhardt, nein, ohne »t« (und verzeih überhaupt die blöde Namensformulierung, aber ich will die Climax jetzt so aufbauen, daß es erst durch Anwendung ganz doofer Ausdrücke wie »Meister Eckhard« stimmungsmäßig in den Keller geht, um mit dem Folgenden sodann eine rasante Raketenhimmelfahrt der Emotion zu verursachen – Du siehst, ich verstehe was von Spannung! Muß ich auch als Romancier, der ich vielleicht gar nicht bin!) besonders zu rühmen den Dr. Schlosser aus Berlin! Sei dessen eingedenk.
Das las ich gern.
Weniger erbaulich waren die schimmligen Brotreste in der Küche und die Verstopfung, an der das Gefrierfach litt. Irgendwer hatte da vor Monaten vier Packungen Spinat hineingepfropft, die jedem Neuzugang das Leben erschwerten.
Ich hätte nun doch gern mal wieder solo gewohnt.
Ein Leser aus Hof hatte mir zur Verhinderung des Weltuntergangs 4,38 DM überwiesen, und Marcus schrieb mir aus Paris:
Habe mit der aus dem New Yorker weltberühmten Schreiberin Jane Kramer telefoniert. Fragte, wie es Wiglaf Droste geht. Stell dir vor, eine Frau, die die halbe Zeit (½ Jahr) in New York lebt, fragt mich (der ein Jahr durchgehend in HH lebt und das folgende und das davor), wie es Droste geht, in Paris. Mein spannendstes Ferienerlebnis.
Und damit nicht genug: Professor Weigle alias F.W. Bernstein rief mich an und fragte, ob er ein Foto von mir bekommen könne, denn er wolle mich zeichnen, für ein Lesungsplakat. Der Schriftsteller Axel Marquardt habe das angeregt, denn seine Frau und er planten die Organisation einiger Lesungen von Autoren aus dem Titanic- und Kowalski-Umfeld.
An der Eröffnung der Ausstellung in Kaiserslautern werde er zwar nicht teilnehmen, sagte Herr Weigle, aber vielleicht könnten wir ja demnächst einmal in Berlin zusammentreffen. »Dann werde ich Ihnen ein paar ausgedehnte Komplimente machen …«
Das schrieb ich mir auf, für mein Archiv, und dann schickte ich Fritz Weigle drei Fotos von mir zu.
In ihrem neuen Buch (»Wir Heimatlosen«) sprach Luise Rinser Luise Rinser:
Liebe, das ist meine Natur selbst. Die Gnade hat es leicht mit mir. Sie baut einfach auf meiner Natur auf.
Und sie quakte wieder laut auf:
Mehr, mehr, mehr, ihr Frauen der Erde! Ihr Frauen Israels, warum schreit ihr nicht? Warum nicht, ihr Irakerinnen? Haben wir Frauen denn noch nicht begriffen, daß das Weibliche allein die Erde rettet?
Geehrt worden war dieses dumme Huhn 1986 mit der Ehrendoktorwürde der Universität Pjöngjang und 1987 mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der DDR.
Aus Korsika meldete meine fünfjährige Patentochter Nantje mir:
LIEBER MARTIN
ICH KANN JETZT SCHON RICHTIG SCHWIMMEN
Die liebe Kleine. Und ich war ihr ein so schlechter Patenonkel!
Die von Reinhold Beckmann moderierte neue Fußballshow ran auf SAT.1 war bis zum Bersten gefüllt mit Werbeblöcken und Gewinnspielen. Einmal sah man den mit Firmenlogos vollgepappten Trainer Udo Lattek, der als Kopfbedeckung ein Müllermilchkäppi trug, und vom Wolfgangsee wurde Helmut Kohl zugeschaltet.
In dem Zug, der mich nach Kaiserslautern brachte, las ich den Roman »Die molussische Katakombe« von Günther Anders. Ein steriles Produkt, das auch Gedichte umfaßte:
Weh Roggen, weh Weizen,
Man wird Euch verheizen,
Weh Reis und weh Bohnen,
Nichts wird er verschonen,
Müßt alle in die Glut hinein,
Hüte Dich, schön Blümelein …
Diese Verse schrieb Anders einer Romanfigur namens Yegussa zu.
Ihr Kiefern, Ihr Fichten,
Auch Euch wird man lichten …
So sang Yegussa, und er sang das Lied mit verzweifelter Begeisterung.
Mich erinnerte das stark an eine Protestsongparodie von Robert Gernhardt:
Mutter, dein Sohn ist Minister,
doch daß er auch Mensch ist, vergißt er …
Vor dem Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern lief Andrea, die ich dorthin bestellt hatte, auf mich zu und rief: »Hallo, Gschpusi!«
Dann erschienen Eugen Egner und seine Gefährtin, und Eugen fragte Andrea: »Sind Sie die Tanzbäuchnerin?«
Gleich darauf traf Michael Rudolf ein und machte uns mit Heribert Lenz und Achim Greser bekannt, »den guten Buben«, wie er betonte, und ich faßte sofort Zutrauen in diese massiven Gestalten aus Schweinfurt und aus Lohr am Main.
In der großen Ausstellung von Werken aus dreißig Jahren der Neuen Frankfurter Schule befanden sich auch Gemälde von Eugen und absonderliche Skulpturen seines Freundes R.M.E. Streuf, doch bevor ich mich näher umsehen konnte, schritt der Kurator Helmut Krause mir entgegen und sagte: »Sind Sie der Herr Doktor Schlosser? Grüeziwohl! Ist das nicht alles überaus schön geworden hier? Und Sie« – zu Andrea gewandt – »sind Herrn Schlossers Angetraute?«
Mit wehenden Haaren führte er uns durch die Räume und klagte darüber, daß »die Stadtverwaltungssippschaft hier« sonst allein für ein neunzigminütiges Konzert der Violinistin Anne-Sophie Mutter sechzigtausend Mark aus dem Säckel tue.
Meinen Plan, etwas gegen Günther Anders zu schreiben, hieß Helmut Krause gut: »Da stichst du in ein hochempfindliches Brummwespen- und Dösbattelnest! In diesen Moralhuber- und Gutfrömmelkreisen sitzt der Beleidigtheitsnerv mindestens so locker wie der Schraubensalat im Hirnkastl!« Gut befreundet war er hingegen mit Bernd Rauschenbach von der Arno-Schmidt-Stiftung. »Einer unserer Allergrößten! Er lebe hoch! Bargfeld blüht dank ihm fast mehr als dank Arno Schmidt!«
Es gab viele Hände zu schütteln. Hans Zippert und seine Leute von der Titanic schwärmten herein sowie der Zeichner Rudi Hurzlmeier – ein Bär von einem Mann! – und gleich nach ihm Kathrin Passig, die ich jetzt auch mal mit Andrea bekanntmachen konnte.
»Und Sie sind Herr Schlosser, wenn ich mich nicht irre«, sagte ein junger Mann zu mir. »Ich bin Ivo Wessel und soll Ihnen herzliche Grüße von Eckhard Henscheid überbringen.«
»Der aber heute nicht hier ist?«
»Leider nein.«
»Grüßen Sie ihn bitte herzlich zurück …«
Er schenkte mir einen von ihm selbst hergestellten Sonderdruck mit faksimilierten Manuskriptseiten von Henscheid und der eingeklebten Kopie eines Artikels aus einer Amberger Lokalzeitung von 1977. Die Fotos zu dem Artikel, sagte Herr Wessel, hätten Henscheid zu den Bildbeschreibungen in dem Roman »Die Mätresse des Bischofs« inspiriert. »Da heißt es, daß der Raiffeisenbankdirektor, den man hier erblicken kann, wie eine Kreuzung aus Heilbutt, Dachs und Sollnhofener Urvogel aussehe, und ich finde, das trifft den Nagel auf den Kopf!«
Nach der festlichen Ausstellungseröffnung versammelten wir uns alle in einem italienischen Restaurant.
Beim Essen sagten wir Gedichte auf, und Kathrin wackelte mit den Ohren.
»Studien treiben, Martin, Studien treiben!« flüsterte Eugen mir zu. »Das kommt ja nie wieder!« Und als ich auf seinen Wunsch das Gesicht der Mona Lisa nachmachte, fragte er mich: »Ist das die Mona Lisa mit oder ohne Rahmen?«
»Ohne.«
»Kannst du auch mit?«
Ich versuchte es. Simone Borowiak zuliebe ahmte ich auch das Gesicht von Marilyn Monroe nach, und auf den besonderen Wunsch von Achim Greser stellte ich mimisch den Übergang vom Impressionismus zum Expressionismus dar, ohne allerdings meinen Gesichtsausdruck zu verändern.
Zwischen zwei Bieren bastelte Heribert einen enormen Joint und erzählte von Achims und seiner persönlichen Begegnung mit dem Schwergewichtsboxer Karl Mildenberger. Dessen Hände hätten wir mal sehen sollen: »So groß wie Klosettdeckel!«
Auf Eugens Bitte hin versuchte ich auch Mildenbergers Hände mimisch nachzuahmen, was mir nach Achims und Heriberts einhelliger Meinung jedoch nicht gelang.
»Nee, was seid ihr nur für Leute«, sagte Andrea lachend und stupste mir ihre Nase ans Ohr. »Wollen wir nicht gehen? Ich bin solche Exzesse nicht gewohnt, und ich hab noch was mit dir vor …«
Von Heriberts und Achims Tischseite rollten immer neue Lachgewitter herüber.
»Wie die Wurstgoten!« rief Eugen. »Aber wißt ihr was? In meiner Kindheit habe ich armlange Marzipanbrote gefressen!«
»Lieber Martin«, sagte Helmut Krause anderntags beim Abschiednehmen im Frühstücksraum des Hotels, »sei dazu angehalten, es dir schön und gut und feierlich gehen und sein zu lassen, auf daß alles seine Ordnung habe und ein Licht sei in der Welt! Mögen deine Geschicke in gute Bahnen schlüpfen. Immerdar und allewege!«
Und Eugen fragte mich: »Hast du auch schon einen Wintervorrat an Hausschuhen angelegt?«
Unsere Bahnfahrt nach Aachen unterbrachen wir in Koblenz für zwei Stunden, damit ich Andrea mein altes Elternhaus auf dem Mallendarer Berg und das Wambachtal zeigen konnte.
»Und hier hat mein Schulfreund Michael Gerlach gewohnt …«
»Willst du da nicht mal klingeln? Vielleicht ist er ja zuhause!«
»Lieber nicht. Der hat sich schon seit sieben Jahren nicht mehr bei mir gemeldet.«
Hinter den gardinenverhangenen Fenstern regte sich nichts.
Alles, was die Küche in Andreas kleiner Wohnung hergab, waren selbstgemachte Buchweizenpfannkuchen mit Frischkäse und ein bitterer Salat, der auf den Namen Rucola hörte, aber ich enthielt mich der Kritik, damit wir nach dem Essen unbeschwert zum Vögeln übergehen konnten.
Am Montagvormittag hakte Andrea sich bei mir ein und begleitete mich durch den Regen zum Bahnhof. Das Wochenende habe sie erschöpft, sagte sie. »Mir ist die ganze Energie zum Mund rausgewachsen …«
Meine alte Freundin. Ich war ihr von Herzen gut.
Mitgeschleppt hatte ich auf meiner Reise allerhand Sekundärliteratur zu Günther Anders. Größte Ehrerbietung war ihm auch von dem christdemokratischen Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann zuteil geworden. Anläßlich der Verleihung des Theodor-W.-Adorno-Preises an Anders hatte Wallmann 1983 in seiner Laudatio erklärt:
Wir ehren den Schriftsteller Günther Anders, weil er uns widerspricht, weil er uns mahnt, weil er uns rüttelt.
Als ob Walter Wallmann scharf darauf gewesen wäre, ermahnt und gerüttelt zu werden! Und von diesem Heuchler hatte Anders sich ehren lassen.
In Berlin federte ich zur Sparkasse. Ein Leser aus Eisenhüttenstadt hatte fünfzig Mark auf mein Weltrettungskonto überwiesen, doch es war trotzdem noch überzogen. Wo blieb der nächste Kowalski-Scheck?
Im Hof jaulte wieder eine Kreissäge, ein Stockwerk unter uns wurde bestialisch gebohrt, und in Afghanistan gingen Sunniten, Schiiten, Paschtunen und Tadschiken einander an die Gurgel.
»Solche Nachrichda mog i gar nemme seha«, sagte Sigrun. »Immer nur Haß ond Gewald! Könna die sich ned mol verdraga?«
Wenn die deutsche Verleihfirma ehrlich gewesen wäre, hätte sie Ridley Scotts Filmklamotte »Thelma & Louise«, die ich mir aus der Videothek besorgt hatte, den Titel »Zwei tollkühne Weiber bauen Scheiße« verpassen müssen. Und was war das für ein einfallsreicher Showdown – sie geben vor der Klippe Gas und stürzen mit ihrem Thunderbird in den Tod! Das mußte Liebe sein!
Aus Greiz waren die Fahnen von »Moselfahrten der Seele« eingetroffen. Mit Eugen Egners Vorwort, das mit dem Satz begann:
Martin Schlosser, von Max Goldt zärtlich »Schlossi« genannt, ist einer, der da soll und muß.
Zunächst mußte ich jedoch wieder ins Kino, für den Tip, in eine Pressevorführung des Films »Calamari Union« von Aki Kaurismäki. In der Inhaltsangabe hieß es:
18 junge Männer, von denen 17 Frank heißen, versuchen etwas Einzigartiges: Bedroht von bösen alten Frauen mit kleinen spitzen Ellbogen, von Löffeln, Hämmern, Schreibmaschinen und kuhgroßen Hunden durchqueren sie eine wilde und gnadenlose Stadt, um an die Küste zu gelangen, »wo man freier atmen kann«.
Ein sehr hübscher Film. Achtzehn Männer auf der Flucht. Aber waren es nicht nur vierzehn? Ich zählte immer wieder durch.
Wo kamen nur die vielen Rechtschreibfehler in den Fahnen der »Moselfahrten« her? Ein paar davon stammten leider von mir selbst, aber woher rührte der Rest?
Ich verbrauchte 118 Telefoneinheiten, als ich Michael Rudolf meine Korrekturen durchgab.
Auf der Rückseite von Eugen Egners Haffmans-Taschenbuch »Als der Weihnachtsmann eine Frau war« stand ein Zitat von mir:
Mächtig schreitet die Egner-Forschung voran. Und die Abhängigkeit nimmt zu.
So weit hatte ich es also gebracht, doch in meiner WG gab es niemanden, vor dem ich damit angeben konnte.
»Eugen Egner?« sagte Sigrun. »Muß man den kenna? Isch des a bdeidendr Künsdlr odr was?«
Lizzy hob die Brauen. Das sei so ’n Quatschzeichner, sagte sie, aus der Titanic-Ecke, der an die Wand geschraubte Bratwürste und sowas male …
Ich war versucht, diesen unqualifizierten Kommentar mit harten Worten über die von Lizzy höher geschätzten Quadratepinsler und Metallhaufenarchitekten abzubügeln, die sich alle fünf Jahre auf der Documenta versammelten, aber dann siegte mein Stolz.
Während ich Kurt Scheel den Aufsatz faxte, in dem ich Günther Anders angriff, stürzte Torsten aus seinem Zimmer und rief, daß er beschossen worden sei: Irgendein Nachbar habe durchs Fenster auf ihn geballert.
Die Ermittlungen, an denen sich die gesamte Wohngemeinschaft beteiligte, ergaben, daß Torstens Zimmerfenster von einer Stahlkugel durchschlagen worden war. Davon zeugten ein Loch in der Fensterscheibe und die unter sein Sofa gekullerte Kugel.
»Hast du irgendwelche Feinde in der Nachbarschaft?« fragte Jochen. »Oder zu laut Musik gehört?«
»Weder noch«, sagte Torsten. »Aber wenn diese Kugel mich in den Kopf getroffen hätte, wär ich tot.«
Sollten wir die Polizei anrufen?
»Des bringd do nix«, sagte Sigrun.
Philipp spähte durch das Loch nach außen und erklärte, daß sich die Position des Schützen anhand des Einschußwinkels bestimmen lasse. »Aber nur von echten Kriminalisten, und die würde ich hier nicht so gerne sehen, ehrlich gesagt. Wenn die unsere Teppiche ausbürsten, kommen wir alle hinter Gitter …«
In mein eigenes Zimmer drang dankenswerterweise nur Lärm ein.
Meine Steuerberaterin hatte die vom Finanzamt Kreuzberg ausgestellten Einkommensteuerbescheide für 1990 und 1991 an mich weitergeleitet. 1377,53 DM sollte ich blechen und außerdem am 10. September und am 10. Dezember jeweils 460 Mark Vorauszahlung leisten und ab dem 10. März 1993 vierteljährlich 230 Mark. So als wäre ich der Aga Khan oder ein Schlotbaron.
Wie Sie aus der beigefügten Kopie meines heutigen Schreibens an das Finanzamt Kreuzberg ersehen, habe ich Einspruch eingelegt und für einen Teilbetrag der jetzt festgesetzten Steuer Aussetzung der Vollziehung beantragt.
Dann bestand ja noch Hoffnung, daß ich was wiederkriegte.
Weil alle meine Feuerzeuge versagten, ging ich zu Lizzy, um sie um Feuer zu bitten.
Sie hörte sich gerade eine Tonkonserve an: »Weiß war der Kalk an den Wänden. Ich wollte nichts Weißes berühren. Ein Nagel stand aus der Wand. Kahl. Als könnten sein Kopf und mein Kopf für einen Augenblick dasselbe sein. Ich schaute weg. An dem Nagel hat nie was gehängt …«
»Das ist ja gruselig«, sagte ich. »Wer liest da?«
»Herta Müller. Eine Rumäniendeutsche, die gegen das Regime von Ceauşescu opponiert hat.«
»Das gibt ihr aber nicht das Recht, langweiliges Zeug zu schreiben.«
»Hey, Mann! Du kommst hier rein, hörst zwei, drei Sätze von einer Frau, über die du nichts weißt, und bist innerhalb von Sekunden mit deinem Urteil fertig? Hier, schnapp dir das Feuerzeug, und dann raus mit dir!«
Es war schön, auf der Familienfeier in Hildesheim-Itzum die Sippe wieder einmal beisammen zu sehen, aber die schnippischen Bemerkungen über meine Haartracht hatte ich bald dicke. Erquickend waren jedoch die Gespräche mit Nantje. Ich stellte ihr Was-wäre-dir-lieber-Fragen: »Was wäre dir lieber, eine Bratwurst als Nase oder zwei Spiegeleier als Ohren?« Und: »Was wäre dir lieber, eine Milliarde Gummibärchen oder aus dem Hals nach Katzenfutter riechen?«
Nach reiflicher Überlegung schlug sie mit einer selbstgebauten Was-wäre-dir-lieber-Frage zurück: »Was wäre dir lieber, ein Erdbeereis kriegen oder eingesperrt in einer Kiste sitzen und von ’nem Skelett gegessen werden?«
Um Nantje brauchte man sich keine Sorgen zu machen. Die war so frech, daß ihr ein guter Lebensweg vorherbestimmt sein mußte.
Auf der Rückfahrt setzte sich im Großraumwagen plötzlich jemand neben mich und sagte: »Na?«
Max Goldt war’s.
»Was liest du denn da Schönes?« fragte er und nahm mir mein Buch aus der Hand: »Das Orakel vom Berge« von Philip K. Dick. Vornedrin stand die Widmung:
An Ernst Jünger für »Auf den Marmorklippen«
Da zog Max seine eigene Reiselektüre hervor: Ernst Jünger, »Auf den Marmorklippen«.
»Das ist ja schon fast gespenstisch« sagte ich.
»Gespenstisch nicht direkt«, sagte Max, »aber ein Zufall königlichster Sahne.«
Er hatte in Kassel gelesen und einen Ausstellungskatalog dabei, in dessen Autorenverzeichnis stand, daß er in Berlin lebe und arbeite. »Das steht da auch bei allen anderen. Lebt und arbeitet in Berlin, lebt und arbeitet in Frankfurt, lebt und arbeitet in München – bei mir sollte stehen: Lebt und faulenzt in Berlin!«
Seit Tagen marodierte in Rostock-Lichtenhagen ein Mob aus Nazis vor einem Hochhaus, in dem vietnamesische Asylbewerber wohnten. Es flogen sogar Molotowcocktails, doch die Polizei war nicht fähig oder nicht willens, für Ordnung zu sorgen und das Leben und die Sicherheit der Vietnamesen zu gewährleisten.
»I kann’s überhaupt ned fassa«, sagte Sigrun beim Anblick der Fernsehbilder.
»Wenn sich diese Schweine vor dem Kanzleramt zusammengerottet hätten, wären sie binnen zwei Minuten hoppgenommen worden«, sagte Jochen. »Aber die paar Schlitzaugen, die da um ihr Leben zittern, sind den Bullen wurscht …«
In der Post war am Montag ein Brief, in dem Eugen mir seinen Tagesablauf schilderte. Vom frühen Morgen …
Nach dem von Anthropologie und extra hart gekochten Hühnereiern begleiteten Frühstück (den Abwasch überspringen wir) sah uns der Tageslauf in Essen, wo wir uns eine Ausstellung unterbreiten ließen (Edward Hopper und die Photographie) …
… bis zum späten Abend:
Voraussichtlicher Tagesausklang wird wohl eine abermalige, neuerliche (konservierte) Folge eines Billy-Wilder-Interviews sein sowie die Fortsetzung der Anthropologie-Lesung im Bett.
Ein gutes Leben: Kunstgenüsse, Bildungsreisen und Zweisamkeit. Und ein Dach überm Kopf und genug zu essen. Das war mehr, als den meisten anderen Menschenkindern zuteil wurde.
Klaus Bittermann rief an: »Menschlich viel Fieses« sei da. »Magst du rüberkommen und es dir abholen?«
Das tat ich mit Freuden, doch als ich es aufschlug, fiel mir sofort ein dicker Druckfehler auf. Ich hatte das Buch ja Michael Rudolf gewidmet, dem Erfinder der Klappstulle, aber daraus hatte der Setzer nach der Fahnenkorrektur eigenmächtig etwas anderes gemacht:
Für Michael Rudolf,
den Erfinder der Klappstühle
Es gebe leider keine Bücher ohne Druckfehler, sagte Klaus. »Wir berichtigen das dann in der zweiten Auflage deines Bestsellers …«
Es überraschte mich, Woody Allen in den Klatschspalten wiederzufinden. Er hatte sich mit der Stieftochter seiner Ex-Freundin Mia Farrow zusammengetan, aber die Stieftochter war volljährig, und wen ging es etwas an, was zwei Erwachsene miteinander anfingen? Mußte sich darüber alle Welt das Maul zerreißen?
In Howard Hawks’ Komödie »Monkey Business«, die Carola und Wiglaf im Kinoprogramm aufgespürt hatten, machte Cary Grant selbst als vertrottelter Chemiker im Laborkittel eine gute Figur. Ein begnadeter Frauenschwarm. Man sagte ihm zwar nach, daß er schwul gewesen sei, aber Wiglaf kannte ein dagegen sprechendes Zitat von Cary Grants dritter Ehefrau Betsy Drake: »Why would I believe Cary was homosexual when we were busy fucking?«