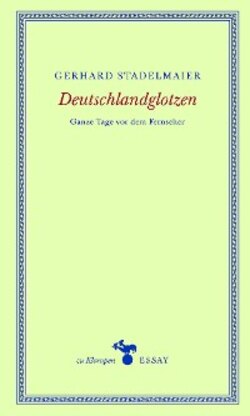Читать книгу Deutschlandglotzen - Gerhard Stadelmaier - Страница 7
Der kleine rote Ball oder: Wer sitzt auf dem Königsthron?
ОглавлениеAm Abend des 19. April 2020, einem Sonntag, knapp vor 21 Uhr 45, war es dann so weit: Der kleine rote Ball rollte durchs Bild. Er hatte seit Mitte Januar die weitere, vorzugsweise fernöstliche oder italienische, später auch die französische und amerikanische, mindestens seit Anfang März die deutsche Welt in Bann und Atem und Zwang und Todesangst massenhaft gefesselt gehalten. Hatte zu Wirtschaftskollapsen, medizinischen Tragödien, Grenzschließungen, Quarantänen, Ansteckungshorribilitäten, Leichentransporten mittels Militärfahrzeugen und Sonderzügen geführt. Erzwang Betriebs- und Schul- und Kindergartenschließungen, Absagen von Festivals, von Konzerten, Opern, Schauspielen, Sportveranstaltungen, Parteitagen, Kongressen bis weit in den Herbst hinein. Verdonnerte Millionen zur Arbeit von zu Hause aus. War schuld daran, dass zum ersten Mal in unserem bewusst gelebten Dasein es keine Passionsmusiken und Gottesdienste in der Karwoche gab, dass diese »Woche, Zeugin heiliger Beschwerde!« (Mörike) zu einer absolut leeren lähmenden Beschwernis wurde, worauf auch keine Osternachtsfeier samt Osterfeuer, kein Hochamt am Hochfest der Auferstehung Jesu Christi, keine feierliche lateinisch gesungene und mit Mozart- und Engelsstimmen musizierte Orchestermesse folgte, keine Feier der Erstkommunion eine Woche später.
Das verfluchte kleine rote Ding veranlasste Panikkäufe, Klopapier- und Mehlhortungshysterien. Forderte nie gekannte Abstands-, Maskenzwang- und Händewasch- und Desinfektionsregeln. Schuf ganz neue Wichtigkeitswörter, wie zum Beispiel »Risikogruppe« und »systemrelevante Gruppen«, als sei nicht jeder fürs gesellschaftliche Leben relevant, das sie nennen mögen, wie sie wollen, gerne auch »System«. Zog aber auch Gutes nach sich: Weil plötzlich die blödsinnige Abschiedsfloskel »Tschüss!«, was ja eigentlich nichts weiter als eine Verballhornung des schönen alten »Adieu« ist, wenn nicht ganz verschwand, so doch teilweise ersetzt wurde durch den neuen Gruß der Stunde »Bleiben Sie gesund!«. Aber leibhaftig gesehen hatte den kleinen roten Ball bis dahin niemand außer vielleicht ein paar Virologen unter ihren Supermikroskopen. Aber nun rollte er durchs Fernsehbild. Das heißt, er rollte nicht. Gezeigt wurde, dass er schwamm: durchs Schluss-Bild eines »Tatorts«. Und da bei der Erstausstrahlung eines »Tatorts« im Schnitt neun Millionen Zuschauer auf die Bildschirmbühnen bei sich zu Hause schauen, schwamm der kleine rote Ball auch durch neun Millionen theatralisch einsame Köpfe.
Zwar hatten sich ganz gewiss mehr als die üblichen neun Millionen »Tatort«-Zuschauerköpfe schon ein Bild vom kleinen roten Ball gemacht, benannt »das Virus«. Manche wechselten auch vom »das« in »der Virus«, als sei’s ein lebensvolles Subjekt statt eines tückisch das Leben attackierenden Nicht-Lebewesens, das als Hintergrund-Bühnenbild bei fast keiner informationellen Fernsehsendung fehlte in diesen allumfassenden Katastrophen-Tagen, an dessen vielen Unglückseligkeiten allein dieser kleine rote Ball schuld war. Und ganz gewiss war der »Tatort« aus Frankfurt bereits ein Jahr zuvor gedreht worden, als noch niemand etwas vom kleinen roten Ball und seiner tödlichen Gefährlichkeit wusste oder auch nur wissen wollte. Und natürlich trug der kleine rote Frankfurter »Tatort«-Ball auch nicht auf seiner Oberfläche diese vielen gewürznelkenhaften horrorniedlichen Pustel-Noppen, die der kleine rote Virus-Ball, von dem man sich sonst immer nur ein virologisches schematisches Vergrößerungshintergrundbild gemacht hatte, im Fernsehen jener Tage von morgens bis mitternachts auf allen Kanälen zuverlässig trug. Aber gerade deshalb taugte er wunderbar zum Stellvertreter. In einem pandämonischen Königsdrama. Nicht umsonst trägt das Virus den wunderschönen lateinischen Namen »Corona«, was ja einen Ehrenkranz, auch eine Art Krone bedeutet.
Man sah in diesem »Tatort« also einen erst mäßigen, dann immer reißender werdenden Bach, der über den Flur des Frankfurter Polizeipräsidiums strömte. Und den kleinen roten Ball mit sich riss. Polizeipräsidiumsflure, in die durch schadhaft reparierte Dächer und Wände Wassermassen dringen, zeigen an, dass die Welt der Ordnungen und Sicherungen und also der beruhigenden Verfolgung alles Bösen aus allen Dichtungsfugen sein muss. Und kein Hamlet in Sicht, der, »oh Pein und Gram, zur Welt sie einzurichten kam«. Was ja sowieso immer schiefgeht. Sodom und Gomorrha am Main. Apocalypsis cum figuris. Der Titel: »Die Guten und die Bösen«. Das System: in Auflösung begriffen. Das Polizeipräsidium eine marode Baustelle voller Fallen, Tür-Wirrnisse, Flur-Leerstellen, fehlender Wände, kreischender Sägen, wummernder Elektro-Hämmer, mit lauter Nicht-Orten für unmögliche Verhöre in einem düsteren, ausweglosen Drama mit verkaterten Polizisten, die ihre mit Erbrochenem besudelten Hemden mangels Umkleideräumen auf dem Präsidiumsparkplatz wechseln müssen – und einem sturen Kollegen, der sich umstandslos als Mörder und Folterer bekennt.
Er hatte den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Frau, die sich nach dem ihr zugefügten Verbrechen von ihm scheiden ließ und Selbstmord beging, erst gefesselt, ihm mit brennenden Zigaretten ganze Hautpartien versengt und ihn dann mit einer Plastiktüte erstickt: »Um das System zu retten« und mit seiner bösen Tat »die Guten zu rechtfertigen«, die mitsamt ihrem Rechtssystem den Vergewaltiger und Frauenschänder damals aus Mangel an handfesten Beweisen hatten laufen lassen müssen. Dieser Polizist heißt Matzerath wie der kleine Oskar aus der »Blechtrommel«, und die längst pensionierte Kommissarin, die in irgendeinem leeren, düsteren Archiv-Untergeschoss des Präsidiums sitzt wie eine Parze, die versucht, die Aktenlebensfäden der unerledigten Fälle noch einmal aufzuwickeln, bevor sie die Verjährungsfrist abknipst, heißt Bronski. Als ermittele – wenigstens den Namen nach – die halbe Günter-Grass-Kaschubei in einem Frankfurt a. d. Danziger Bucht. Bewohnt von lauter bösen Würgegeistern aus früherer böser Zeit, die jetzt zugreifen und zudrücken. Als gäbe es kein Morgen.
Die Bronski wurde von Hannelore Elsner gespielt. Eine ihrer letzten Rollen vor ihrem Tod im April 2019. Eine Figur, still, zäh, nur noch von der pergamentdünnen Haut ihres aus allen Erloschenheiten in brennender Zähigkeitssorge aufflackernden Willens zusammengehalten, der nicht mehr viel Zeit hat. Der kleine rote Ball gehörte dem Hund der Bronski, der ihn vor sich herjagte, mit dem Maul danach schnappte, ihn einzufangen versuchte. So dass die Kamera allzu oft auf Bodenhöhe mit dem kleinen roten Ball bleiben zu müssen glaubte: als sei er, nicht die anderen, am wenigsten der Hund, die Hauptsache. Und am Ende schwamm er so triumphal wie wellentänzelnd hohnvoll davon – hinaus in die Welt. In die hinein er alles Unheil mitnahm und sie damit infizierte. Und nahm auch in der Welt Platz. Auf einem Herrscherthron. Dem ein Jahr später die ganze bewohnte Welt untertan war, und natürlich auch die Fernsehsender dieser Welt. Und der diese ganze Welt in einen tiefen, weiten Stillstand, einen tranceähnlichen Schlaf versetzte. Sie zur absoluten Passivität und Bewegungslosigkeit verdammte, gleichgültig, ob Demokratien oder Diktaturen, Präsidialzarenreiche oder Gottesterrorstaaten, autokratisch Links- oder Rechtsunterdrückte, Arme oder Reiche. Er machte sich dabei natürlich wieder unsichtbar. So unsichtbar eben wie eine Metapher, die sich in ein Virus zurückverwandelt. Aber er herrschte sichtbar und gründlich und gnadenlos: gekrönt als König Corona.
Kann gut sein, dass er, wenn dieses Buch erschienen sein wird, längst wieder vom Thron verstoßen sein wird. Weshalb hier das Imperfekt durchaus sinnvoll scheint. Obwohl es eine – auch und gerade auf allen Fernsehkanälen – verbreitete ideologische Gewissheit gab, die behauptete, nichts werde »nach Corona« noch so sein wie »vor Corona«. Und also der Königsthron auf Jahre hinaus vom kleinen roten Ball besetzt bleiben würde. Man muss aber mit der menschlichen und vor allem mit der medialen Vergesslichkeit, ja Gleichgültigkeit und Leichtsinnigkeit durchaus rechnen: dass nämlich auch »nach Corona« alles beim alten bleiben wird. Wie nach allen Katastrophen bisher noch immer alles beim alten geblieben ist. Kann aber auch genauso gut sein, dass er noch lange Zeit herrschen wird. Auf seine Art.
»Man muß spüren, daß die Welt des Gewöhnlichen plötzlich anhält, in Schlaf versinkt, in Trance, in einem schrecklichen Waffenstillstand erstarrt; die Zeit muß gelöscht, alle Verbindung zur Außenwelt gekappt sein, und alles muß, zurückgezogen in sich selbst, in eine tiefe Ohnmacht fallen, das Irdische vergessend.« So beschwört Thomas de Quincey in seinem 1823 erschienenen Essay »Über das Klopfen an die Pforte in Shakespeares ›Macbeth‹« den Zustand einer unheimlichen Quarantäne: »Mord und Mörder müssen isoliert werden – abgeschnitten durch einen unermeßlichen Graben von dem gewöhnlichen Auf und Ab des menschlichen Treibens und eingeschlossen in eine tiefe Abgeschiedenheit.« Thomas de Quincey, ein »al fresco«, also außerhalb der üblichen gesellschaftlichen Grenzen lebender romantisch verzweifelt frei vazierender Schreibgeist, der sich nicht nur in seinen »Bekenntnissen eines englischen Opiumessers« und seinem berühmtesten Werk »Mord als schöne Kunst betrachtet« (1853) vom Abseitigen, Irrationalen, Verbotenen fasziniert zeigt, hat dabei das nächtliche Gemetzel im Auge, das Macbeth und seine Lady am schlafenden König Duncan verübten, der auf Macbeths Burg zu Gast war.
Ein Mord, der noch viele Morde nach sich ziehen wird, ganze Hekatomben von Toten. »An jedem neuen Morgen heulen neue Witwen, / Und neue Waisen wimmern; neuer Jammer / Schlägt an des Himmels Wölbung, daß er tönt…«, klagt Macduff (IV/3) über den mörderischen Krieg, den Macbeth gegen alle und alle Welt angezettelt hat (in der Schlegel-Tieckschen deutschen Übersetzung). Es ist wie eine Seuche, eine Selbstansteckung in Macbeth (und in seiner Lady), eine virale Hirn- und Gedankenentzündung: »O Zeit! Vor eilst du meinem grausen Tun! / Nie wird der flücht’ge Vorsatz eingeholt, / Geht nicht die Tat gleich mit. Von Stund an nun / Sei immer meines Herzens Erstling auch / Erstling der Hand. Und den Gedanken gleich / Zu krönen, sei’s getan, so wie gedacht.« Und ein Arzt, eine Art Schloss-Psychiater, diagnostiziert: »Von Greueln flüstert man – und Taten unnatürlich / Erzeugen unnatürliche Zerrüttung.« (V/2) Was aber De Quincey nicht weiter interessiert. Er bleibt bei diesem einen Moment stehen. Und er beschreibt in Worten, die wie von den Opiaten getränkt wirken, die man aus den Blumen des Bösen destilliert, einen absoluten moralischen Lockdown. Der erst durch das Pochen an die Pforte wieder gelöst und gelockert wird, als Macduff und Lenox kommen, und mit ihnen wieder die normale Welt Einzug hält. Oder was die Welt so für normal hält.
Wobei der Schloss-Pförtner, der beinahe so berühmt geworden ist wie der Titelheld des Dramas, beim Wahrnehmen des Pochens einen grandiosen Monolog hält, auf den De Quincey allerdings nicht näher eingeht, ihm genügt allein die Tatsache des Pochens, der Pförtner als Figur und Person ist ihm gleichgültig. In diesem Monolog rätselt der Pförtner, indem er sich, noch immer halbtrunken vom Besäufnis der letzten Nacht, die Hosen anzuziehen versucht, wer da wohl Einlass begehre: ein Pächter, der sich »in Erwartung einer reichen Ernte aufhing?«; »ein Zweideutler, der in beide Schalen gegen jede Schale schwören konnte, der um Gottes willen Verrätereien genug beging und sich doch nicht zum Himmel hinein zweideuteln konnte?«; »ein englischer Schneider, hier angekommen, weil er etwas aus einer französischen Hose gestohlen?«. Sein Resümee: »Hier ist es zu kalt für die Hölle; ich mag nicht länger Teufelspförtner sein.« Nämlich für kapitalistische Selbstmörder, rabulistische Jesuiten, nationalistische Diebe. Aber immerhin Leute von Welt. Wenn auch Schelme. Von draußen. Und es ist wie eine Erlösung. Die Tragödie nimmt endlich ihren effektvollen Lauf – bis hin zur Vernichtung des falschen, mörderischen Königs. Auf freiem Feld. Im Offenen. Aber, wie gesagt, mit Hekatomben von Toten.
Am Abend des 18. März 2020 war es im großen deutschen Königsdrama umgekehrt. An die Fernsehpforte klopften mit fast hysterischer Munterkeit und rasselnd und tempolustig gehörigen Lärm machend: lauter Prothesen. Krücken. Hilfsmittel. Wunderdinge. Lebensretter. Erlöser. Befreier. Herkommend aus den Feldlazaretten der großen Gesundheitsschlachten. Draußen vor dem Tor. Zuerst ein von einem lustigen, in Reibeisen-Baritonlage sprechenden Mops begleitetes Wesen namens Voltaren: das als einzureibendes Gel die Befreiung von allen Gliederschmerzen verhieß. Wir werden ihm in einem späteren Kapitel noch einmal begegnen. Dann ein Mascara-XL-Volumen-Ding, das langes, schönes Wimpernwachstum versprach. Dann gleich noch ein Schmerz-Gel, das eine am Meeresstrand samt Hund und Mann ins Bild kommende ältere, wiewohl immer noch schöne, reife Frau im Regenmantel zur alles Gute garantierenden Folge hatte, die sich als zuvor Nackte das Gel in die Schulter gerieben hatte und nun, trenchcoatbedeckt, vor schäumenden Meereswellenkämmen als eine Soft-Erotikerin der Dankbarkeit mit dementsprechendem über die Schulter geworfenen Augenaufschlag selig bekannte: »Doc, ich liebe dich!« Wogegen es die darauf folgende jüngere, ihre notbergende Verkrampfung nur mühsam unter lächelnder Kontrolle haltende Frau schwerer hatte, ein Latschenkiefer-Konzentrat zur Reduzierung der Fußhornhaut so zu präsentieren, dass man ihrem mühsam einstudierten zähnebleckenden Jubellaut »Meine Hornhaut is wech!« genau den Glauben schenken mochte wie dem meckernden Gelächter einer bebrillten grauschlaffen Frühgreisin, die nach Einnahme eines legalen pharmazeutischen Dopingmittels namens Vitasprint verkündete, »ich könnte die Welt aus den Angeln heben«. Dem dann ein in grenzdebilen Lächelorgien fast versinkendes Strahlemädchen die Wunderkrone aufsetzte, indem sie sich auf neidisches Befragen durch eine Lächelorgien-Kollegin offenbar mit einem Hyaluron-Präparat eingerieben hatte, das ihr eine »natürliche Hautbräune« sicherte und den »Spaß daran, nun endlich auch im Winter mehr Haut zu zeigen«. Dabei war schon hellster Frühling.
Und all diese an die große deutsche Fernsehpforte herrisch pochenden Prothesen, auf deren Werbegelder die öffentlich und rechtlich und mit einer unterschiedslos erhobenen milliardenschweren Zwangsabgabe finanzierten Sendeanstalten eigentlich nicht angewiesen sein sollten, die also eine gewisse willkürliche, aufdringliche Rolle spielten, verlangten Einlass, begehrten Öffnung, riefen: »Platz da für die Wunden und Siechen! Die wir wieder heilen!« Doch das Tor blieb zu. An diesem Abend sogar demonstrativ. Gleich nach der Hyaluron-Mamsell kam eine Deutschlandfahne halb und eine Europaflagge zu einem Viertel ins Bild. Die starre Kamera war durch ein großes Fenster des Berliner Kanzleramts auf den Reichstag gegenüber gerichtet, konzentrierte sich aber auf die deutsche Bundeskanzlerin, die im dunkelblauen Blazer, mit einer dezenten Kette um den Hals und sanft toupierter Bob-Frisur an einem großen Schreibtisch vor dem Fenster Platz genommen hatte. Und die Königsdramen-Verhältnisse umkehrte. Der König, der »bloody dog« und »scheußliche Tyrann«, wurde ausgeschlossen. Er musste draußen bleiben. Zumindest sollte er das. Es wurde ein Bann über ihn verhängt. Und wie im deutschen Regisseurstheater, im künstlerischen wie im politischen, üblich, kam es in der Tragödie, die hier ihren Gang nahm, zu einem fundamentalen Figuren- und Charakterverwechslungstausch.
»Nimm etwas Wasser und wasch von deiner Hand das garst’ge Zeugnis«, verlangt ja Lady Macbeth (II/3) von ihrem Mann (nach dem Mord an Duncan). Und später fragt der Arzt, wie gesagt eine Art Schlosspsychiater, als er die Lady schlafwandeln sieht (V/2): »Was macht sie nun? Schaut, wie sie sich die Hände reibt.« Und die Kammerfrau der Lady klärt auf: »Das ist ihre gewöhnliche Gebärde, daß sie tut, als wüsche sie sich die Hände; ich habe wohl gesehen, daß sie es eine Viertelstunde hintereinander tat.« Wenig später bringt sich die böse Lady Macbeth um. So hält sie Abstand zur Welt. Und wäscht ihre Hände in Schuld: bei Shakespeare (1606). Bei Angela Merkel (2020) wird die böse Lady zur guten, vorsehenden, sorgenden Kanzlerin, die das Land, das ganze große Schloss Deutschland, gegen den bösen viralen Terror- und Infektionskönig abschließt, das Tor, die Pforte verrammelt, »zu Hause bleiben«, »Abstand halten« (»im Moment ist Abstand der Ausdruck von Fürsorge«), »niemand ist verzichtbar«, »jeder wird gebraucht«, »gemeinsam schützen und helfen« als Losungen ausgibt und den »Lock-« oder auch »Shutdown«, bezeichnend das radikale Herunterfahren alles gesellschaftlichen Lebens, in den allgemeinen Umgangssprachschatz befördert – aber alles mit dem hauptsächlichen internen Rettungsvorschlag grundiert, den ihr die Lady vorgesprochen zu haben scheint: Hände waschen! Nicht gerade eine »Viertelstunde hintereinander«, aber mindestens 30 Sekunden. Für viele Deutsche, die nicht bis 30 zählen, aber dafür ein kompliziertes englisches Geburtstagslied gut singen können, wird danach in vielen aufklärenden Fernseh-Gesprächsrunden und -interviews der Rat gegeben, sich so lange die Hände zu waschen, bis man zweimal hintereinander »Happy Birthday« gesungen habe. Je lauter man das tut, desto länger dauern die 30 Sekunden …
Was sich als Folge dieser und noch anderer, gleichartiger, wenn auch nicht so gewichtig staatsbewegender Ansprachen der Kanzlerin ergab, war ein großes, beispielloses, folgsames allgemeines Zusammenrücken: ein Volk!, eine Republik!, eine Disziplin! Eine anscheinend durch alle Schulen der Vernunft und der Aufklärung gegangene Einsicht in die Notwendigkeit, sich zurückzunehmen, bestimmte, genau definierte Grundrechte nicht wahrnehmen zu können, zum Beispiel das Recht auf Versammlungs- und Reisefreiheit. Quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Die Angst vor dem Tod durch die Heimtücke der unkontrollierbaren, weltweit und ja Kontinente und Länder wie nichts überrollenden Feldzüge des Königs Corona hatte die Menschen, die ja die einzigen Tiere sind, die wissen, dass sie sterben müssen, paradoxerweise in Abermillionen Einsamkeiten und Voneinanderabsonderungen und Abstandshaltungsregeln zusammengeschweißt. Enge in großer Distanz. Wenigstens eine Zeitlang. Ungefähr vier Wochen. Dann war die Zusammenrückgeduld vielerorts aufgebraucht. Aber gleichwohl hüpften in jeder Werbepause seitdem die Comic-Mainzelzipfelmännchen des ZDF auf Springbällen durch die Szene, über die »Abstand halten« geschrieben ward oder »Wir bleiben zu Hause« oder »Nicht in Gruppen rausgehen« oder »Bleibt gesund« oder »Hände waschen«. Es war, als hätte der Ausnahmezustand, in den die Republik versetzt und gezwungen wurde, Monsieur Alcèste aus Molières »Menschenfeind«, wenigstens so, wie ihn Botho Strauß bearbeitet hat, aufs Menschenfreundlichste, also aufs Paradoxeste gerechtfertigt: »Menschen sind mein Schlimmstes!« verkündet der Alcèste des Botho Strauß. Er meint es grundsätzlich, weil au fond und aus Existenzgrundsatz misanthropisch. Das Schlimmste freilich, was die Gefahr einer Ansteckung angeht, ist dem Menschen der andere, vom Virus womöglich befallene Mensch. Die Distanz, der mit abwehrenden Ekelgesten garnierte Abstandswille, den Alcèste zelebriert, wird, wenn das Böse in Virus-Gestalt so sichtbar unsichtbar allgemein in der Welt ist, zur wenn nicht schon menschenfreundlichen, so doch wenigstens menschenschonenden Regel.
Aber dann der per »Tagesschau«- und »heute«-Nachrichten eingeblendete Gegensatz zur deutschen Regelschule: die wilde Kriegserklärung aus nahfernem Freundesland: »Nous sommes en guerre!« sprach Monsieur le Président de la Nation, Emmanuel Macron, sehr ernst und mit dunkler Krawatte hinter seinem Empire-Schreibtisch im Elysée-Palast postiert, in die Kamera, neben sich eine Trikolore und die Europafahne. Als schieße das Virus mit Kanonen, sitze in Kanzeln von Bombern oder an den Abschussrampen von Atomraketenbatterien oder vor den Lenksystemen von Kampfdrohnen. Als sei die Verschleißunruhe der Gegenwart, der Zerfall der Welt auf einmal angehalten in einem Katastrophenaugenblick, der keine Parteien mehr kennt, keine Meinungen, keine Unterschiede mehr – nur noch den Kampf. Auch eine Art Stillgestelltheit: in der Abwehr einer Apokalypse. Alle Vergangenheit ausgeblendet. Alle Zukunft in eine einzige Abwehrgeste prästabiliert. Der kleine rote Ball kam in Macrons Rhetorik zu geradezu gigantischen Schreckensehren. Das weiche, ja immer wie noch ungar wirkende Sanftheitsgesicht des jungenhaften Präsidenten zur Entschlossenheitsmaske erstarrt, der Blick mühsam in dunkles Funkelfeuer gebracht, das Kinn gereckt. Die deutsche Rolle im weltweiten Königsdrama: die Hygieneherrschaft. Dem Feind ausweichen! Ihm buchstäblich eins auswischen, will sagen auswaschen!
Die französische Rolle im weltweiten Königsdrama aber: das Gegenkönigtum. Nicht noch einmal einen Feind verkennen, wie so oft in der französischen Geschichte! Nicht wie einst Karl VI. die französische Krone (Corona) an den Engländer Heinrich V. dadurch verlieren, dass man einen offensichtlich längst in Gang befindlichen Krieg wenn nicht leugnet, so doch kaum ernst nimmt und sich so blasiert wie feige dekadent wegduckt! Sondern selbst die Rolle Heinrichs übernehmen! Als Franzose den Engländer spielen! Wie 1415 vor Harfleur Heinrich V. es vorgemacht hat in der Urszene alles Durchhaltewillens, komme er, woher auch immer, manifestiere er sich, in welchem Land auch immer, vom Engländer William Shakespeare als große Auf-geht’s!-Rede unsterblich formuliert für alle kommenden Nous-sommes-en-guerre!-Befehlshaber vom Schlage eines Churchills zum Beispiel (»König Heinrich V.«, III/1): »Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde! / Sonst füllt mit toten Englischen die Mauer. / Im Frieden kann so wohl nichts einen Mann / Als Demut und bescheidne Stille kleiden, / Doch bläst des Kriegs Wetter euch ins Ohr, / Dann ahmt dem Tiger nach in seinem Tun; / Spannt eure Sehnen, ruft das Blut herbei, / Entstellt die liebliche Natur mit Wut, / Dann leiht dem Auge einen Schreckensblick / Und laßt es durch des Hauptes Bollwerk spähn / Wie ehernes Geschütz; die Braue schatt’ es / So furchtbarlich, wie ein zerfreßner Fels / Weit vorhängt über seinen schwachen Fuß, / Vom wilden wüsten Ozean umwühlt.« Er hätte auch sagen können, dass er seinen Kämpfern nichts als Blut, Schweiß und Tränen verspreche. Es ist die Animations- und zugleich Durchhalterede par excellence – in Zeiten vor allem, wo nichts gewiss ist außer Gefahr und Risiko. Und der Sieg nur ein vages Versprechen.
Die König-Heinrich-Rolle im Verzweiflungskampf gegen König Corona hatte auf der großen französischen Fernsehbühne als erster klassischer Staatsschauspieler Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron mit großem Pathos ergriffen. An der TV-Rampe der Nation. Zur besten Sendezeit. Sozusagen als bissiger Königspudel. In Deutschland war das eine Sache der Kanzlerwelpen. An den TV-Rampen der Nation. Aber mit dem gleichen Heinrich-Zuschnitt und dem gleichen Pathos. Während die Kanzlerin als Fürsorge-Leitwölfin den Ton vorgab und von Krieg nichts, vom Händewaschen und Abstandhalten alles wissen wollte, spielten zwei Ministerpräsidenten und ein Minister im großen Auf-geht’s-wider-den-Feind!-Spiel die hauptsächlichen vordergründigen Nebenrollen. Wobei der bayerische Ministerpräsident als Hauptwelpe das Rudel vor sich hertrieb. Mit einer Strenge und Entschiedenheit und selbst im offenen Hemdkragen und mit von durchkonferierten Nächten müdgeröteten Augen noch in allererster Verbellfront fit und agil, als müsse sich der kleine rote mächtige Coronakönigsball schon vor dem Luftzug seiner Basta-Reden in alle Ecken verziehen. Strengste Kontaktverbote. Freiwillige Isolation. Gang aus dem Haus nur mit triftigem Grund. Strengste Hygieneregeln sowieso. Er verkündete hinter mit Plastikfolie vor seinen eventuellen Vireneruptionen strengstens geschützten Mikrophonen auch nichts anderes als die Kanzlerin. Aber dies in einem gleichsam heinrichderfünftemäßigen Überkanzler-Ton. Hauptsatz um Hauptsatz. Er »ahmt dem Tiger nach in seinem Tun«.
Wogegen der gaumige nordrheinwestfälische Ministerpräsident, von Natur aus schon ein Weichzeichner, in weichgespülten Nebensätzen gurgelnd zu ertrinken schien, aber mit exakt derselben Botschaft wie der fränkische Bayer und mit demselben Überkanzler-Tonversuch. Er »lieh dem Auge einen Schreckensblick«. Während der Gesundheitsminister, den sich der Rheinländer für seine Parteivorsitzenden-Ambitionen ins Vize-Beiboot geholt hatte, naturgemäß ganz im von Tag zu Tag und von Lage zu Lage sich verändernden Verbotsmanagement im Auf-geht’s-wider-den-Feind!-Geschäft sich dauerlächelnd aufrieb, aber das Ganze irgendwie sehr sportlich nahm. Er »spannt seine Sehnen« – und wird selber allein gewusst haben, wofür und zu welchem Ende. Immerhin fand er, hinterm desinfizierten Rednerpult im Deutschen Bundestag, wir würden uns gegenseitig »nach der Corona-Krise vieles zu verzeihen haben«.
Sowohl der Königspudel in Frankreich als auch die Fürsorge-Leitwölfin und ihre Kanzlerwelpen in Deutschland traten in einem so seltenen wie denkwürdigen Moment auf: Als wirklich einmal die Welt und ihre Geschichte stillstand beziehungsweise stillzustehen schien. Als außer den täglich verkündeten Zahlen der an Covid-19 Erkrankten, Gestorbenen oder davon Genesenen nichts von dem wahrzunehmen war, was sonst immer ein dauernder, dahinstrudelnder Fluss an Meldungen von Katastrophen und Konflikten und Konferenzen und Problemen war. Ein Fluss, der auf einmal versiegt schien. Es schien, als hätte sich mit Hilfe und unter Anleitung eines verteufelt kleinen Virus, unseres kleinen roten Balls, die große unbekannte, unserer täglichen Aufmerksamkeit völlig abgewandte Rückseite der wahrnehmbaren Welt in den Vordergrund gedreht. Ohne aber ihr Geheimnis preiszugeben, also ohne Mittel und Wege zu zeigen, wie sie rasch durchforscht, bewältigt, entschlüsselt werden könnte. Was gerade von den drei Kanzlerwelpen sonst immer, wenn sie auf dem Bildschirm auftauchten, als sie noch nicht in zellophanverhüllte sterile Mikrophone sprachen und auch noch keine Nasen- und Mundschutzmasken trugen, in lässiger, aber doch jede Menge an Straffheit in Reserve versprechender Haltung vorgetragen wurde, nämlich dass sie »die Lage« oder auch »die Sache« oder »das Problem« wenn nicht im Griff, so doch im Kopf hätten, das fehlte ihnen jetzt völlig. Trotz oder gerade wegen aller Entschlossenheitsrhetorik.
Und wenn früher das Fernsehteam, das um sie herum war oder ihnen entgegenfilmte und den geeigneten Hintergrund für das Statement suchte, am besten eine holzgetäfelte Wand in einer Parteizentrale oder ein lichtes Treppenhaus oder auch nur die Rückwand der Bundespressekonferenz, wenn also das Fernsehen den jeweils zu Befragenden förmlich inszenierte, wie es ja alles, was es zeigt, in irgendeine Szene setzt, dann war es üblich, dass der zu Befragende oder auch nur der etwas besonders Wichtiges Sagenwollende zuerst mal gezeigt wurde, wie er eine Treppe herunter- oder einen lichtdurchfluteten Flur entlanggeht. Als sei er eben zu etwas ganz Unaufschiebbarem, Dringlichem, dem Fluss der Welt, wenn nicht der Geschichte, mindestens aber der Gegenwart Beförderndem unterwegs. Und als lasse er sich halt jetzt in Gottes Namen herab, um ganz rasch das dringende Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zu befriedigen in Sachen Mindestlohn oder Brexit oder Klimawandel mitsamt entsprechenden Schulschwänz-Demonstrationen jeden Freitag oder Energiewende oder Rechtsterrorismus oder verkorkster Thüringer Ministerpräsidentenwahl oder rassistischen oder antisemitischen Amokschießereien mit neun Toten wie in Hanau oder zwei Toten wie in Halle – und hätte die Synagogentür dort nicht den Kugeln des Attentäters standgehalten, hätte es Dutzende von jüdischen Toten an diesem Tag gegeben.
Das waren die hauptsächlichen, keineswegs irgendeiner Lösung oder gar letzthinniger Erklärung zugeführten Ereignisse, die eine Deutschland-Welt in Atem und in Aufregung und in Entsetzen und Scham und Schande hielten, bevor diese Welt völlig zum Stillstand kam. Jetzt aber standen eben die Kanzlerwelpen auch still. Sie kamen keine Gänge mehr entlang. Schienen zu gar nichts mehr unterwegs zu sein. Als Figuren hatten sie plötzlich einen Text vorzutragen, der – obwohl sie ihre, wie gesagt, Entschiedenheitsrhetorik nicht ablegten – von Ratlosigkeit, allerdings einer Basta!-Ratlosigkeit gezeichnet war. Die Sprache der drei wirkte, als umspielte sie in ihrer Tiefenstruktur nichts weniger als die Schlussworte der »Drei Schwestern« von Tschechow: »Wenn man es nur wüsste …«, nämlich das, was noch kommt oder wird. Der jüngsten hat man den Verlobten erschossen, der mittleren den Geliebten genommen und sie zu ihrem langweiligen Gatten zurückverdonnert, der ältesten eine lebenslange Mühsal als heftekorrigierende Lehrerin auferlegt, allen dreien das Elternhaus und die letzte Sehnsuchtshoffnung, »Nach Moskau! Nach Moskau! Nach Moskau!«, genommen. Und nun, am Ende, erleben sie, wie die Zeit völlig stillsteht, obwohl sie natürlich vergeht. Und dass sie aufs Rad dessen geflochten sind, was man Schicksal nennt. Dass sie, die glaubten, über ihr Leben bestimmen und verfügen zu können, spüren, dass die Dinge nicht in ihrer Hand sind, es nie eigentlich waren. So ein Gefühl schafft entweder Demut – oder Verzweiflung. »Ducunt volentem fata, nolentem trahunt« (Den Willfährigen führt das Schicksal, den Widerwilligen zieht es mit sich weg), schrieb Seneca, ein Virtuose der Schicksalsergebenheit, in seinem Fall bis zum Tod, zu dem ihn Nero zwang, aber so weit muss es selbst für Stoiker nicht kommen, obwohl die Neros weltweit wieder im Kommen sind.
Plötzlich nun war nicht nur etwas, sondern sehr viel von dieser Schicksalshaftigkeit und dem unhintergehbaren Gefühl, die Dinge der Weltbewegung nicht mehr wie einst so locker in Händen zu haben, wieder in der Welt nicht nur der drei Kanzlerwelpen aufgetaucht und hatte sie ganz und gar beherrscht. Ihre neue Welterfahrung war von da an die einer Kontingenz und Hilflosigkeit, die durch ein vorläufiges Nichthelfenkönnen in der Hauptsache, dem fehlenden Impf- und Kampfstoff wider den kleinen roten Ball, ausgeglichen wurde durch die in fast königlich majestätischem »Wir müssen!«- und »Wir dürfen nicht!«-Ton vorgebrachten administrativen und vor jeder Fernsehkamera geduldig in endloser Wiederholung erklärten Maßnahmen. Wie überhaupt das Wort »Maßnahme« einen ungeheuren Aufschwung erlebte. Die unbekannte Rückseite der bekannten Welt, die sich plötzlich in die völlig rätselhafte, vorerst nicht zu bewältigende Vorderseite verwandelt hatte, ließ es auch – wenigstens eine gewisse Zeit lang – nicht zu, dass den Verkündigungen und Anordnungen der drei aus besserwisserischen Gründen widersprochen wurde. Weil niemand etwas Besseres wusste oder zu wissen behauptete. Wenigstens eine Zeitlang. Noch selten in der Geschichte der Fernsehdeutschland-Welt waren die Herrschenden und die Beherrschten samt ihren Beobachtern in den Sendeanstalten und den entsprechenden Fernsehformaten so einig, kamen sich so geschlossen, so vernünftig vor. Eine Idylle in Quarantäne. Wenigstens eine Zeitlang.
Das lag vor allem an drei Figuren, die zuvor schon sich forschend und suchend auf den rückseitigen Gefilden der bekannten Welt herumgetrieben und dort die Genese von kleinen roten Virus-Bällen im Blick hatten. Und die nun sozusagen den drei Königskanzlerwelpen nicht gerade als Wahrsager und Astrologen, so doch als Wahrscheinlichkeitssager und Möglichkeitsweltendeuter, als Zukunftsdeuter und -ausrechner beigeordnet waren: die Virologen. Ihr Text, ihre Haltung bestand aus einer ständigen »Wenn, dann«- beziehungsweise »Wenn nicht, dann«-Paraphrase. Wenn wir dies oder jenes tun, zu Hause bleiben, Abstand halten, Mundschutz tragen, Schulen schließen et cetera, dann erreichen wir Erträgliches. Wenn wir dies oder jenes nicht tun, blüht uns Furchtbares. Der eine ein brillanter Wuschelkopf namens Drosten, der zweite ein grauer Herr namens Wiehler, der dritte ein schneidiger Husar namens Kekulé. Was sie auszeichnete, war, dass sie keine Macht hatten, irgend etwas anzuordnen, und dies auch gar nicht sich zu wollen trauten, weil es ihnen auch gar nicht zustand, aber danach strebten, immer besser Bescheid über den kleinen roten Ball zu wissen. Im Gegensatz zu den Mächtigen, die nicht Bescheid wussten und auch gar nicht Bescheid wissen konnten, außer vielleicht ein bisschen der gesundheitsministerielle Kanzlerwelpe, aber das anordnen mussten, was die Krise eindämmen half.
Der dramatische Urahne unserer Virologen, sozusagen ihr Rollenlieferant, ist der Arzt Astrow aus Tschechows »Onkel Wanja«; wie ja bei Tschechow sowieso alle unsere Gegenwartsfiguren wie in einem historischen Familienalbum vorweg fotografiert und umrahmt scheinen. Es gibt keinen besseren Reservoir-Dramatiker für unsere aktuellen szenischen Anknüpfungsbedürfnisse. Dr. Astrow also, in den mindestens zwei Frauen unsterblich verliebt sind (in Prof. Dr. Drosten und seinen lausbübischen Wuschelkopf sollen, Boulevardvermutungen zufolge, im viralen Frühjahr 2020 Tausende verliebt gewesen sein, mindestens so viele, wie ihn nach der ersten großen Euphorie und der dann erfolgten Disziplinlockerungssehnsucht hassten und schmähten – so geht’s halt mit der Liebe oft zu in unserer verrückten Welt, und sie kannten und liebten und hassten ihn nur aus dem Fernsehen), unser Tschechow-Doktor also kämpft wie seine modernen Kollegen vorzüglich gegen Epidemien: »Flecktyphus … In den Hütten lagen die Leute einer neben dem andern … Dreck, Gestank, Rauch, die Kälber auf dem Boden, mitten unter den Kranken … Auch die Ferkel.«
Man sieht unweigerlich, wenn man das liest und es sich plastisch vorstellt, den Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan vor sich mit dem Gewirr von Menschen, Fledermäusen, Schlangen und Gürteltieren. Außerdem ist Dr. Astrow unaufhörlich mit der Rettung des Klimas beschäftigt, kämpft gegen das Waldsterben und für die umweltschonende Vernunft. Sein öffentliches Verantwortungsethos kann es in den Grundsätzlichkeiten mit dem Ethos jedes gegenwärtigen TV-Virologen aufnehmen: »Der Mensch ist mit Vernunft und Schöpferkraft begabt, um zu vermehren, was ihm gegeben worden ist, aber bis heute hat er nichts geschaffen, sondern nur zerstört. Wälder gibt es immer weniger und weniger, die Flüsse versiegen, das Wild stirbt aus, das Klima ist verdorben, und mit jedem Tag wird die Erde ärmer und gesichtsloser.«
Um noch einmal zu demonstrieren, wie brandaktuell Tschechows Ärzte argumentieren, werfen wir ein Selektionslichtlein auf Dr. Astrows Kollegen Dr. Jewgeni Sergejewitsch Dorn in der »Möwe«; bei Tschechow kommen schon deswegen oft Ärzte vor, weil er sich in diesem Metier am besten auskannte, außer natürlich im menschlichen Metier überhaupt, denn Tschechow war selbst Arzt und neben Shakespeare wahrscheinlich der beste Menschenkenner. Dr. Dorn also weigert sich konsequent, Menschen zu behandeln, die über sechzig sind (»Das ist Unsinn«). Mehr als Baldriantropfen, Chinin, Soda würde er ihnen – nur so zur Beruhigung, nicht zur Heilung – nicht verordnen. Auch verachtet er die Todesangst als »tierische Angst«, man »muß sie unterdrücken. Angst vor dem Tode haben bewußt nur die, die an ein ewiges Leben glauben, die Angst wegen ihrer Sünden haben.« Er würde ohne Bedenken, denkt man ihn sich in der Situation einer gegenwärtigen Intensivstation, die sogenannte Triage praktizieren, also alten Patienten die Beatmungsmasken wegnehmen, um sie jüngeren überzustülpen. Wozu, um den Tschechowschen Doktor-Dreier vollzumachen, der Militärarzt Dr. Tschebutykin aus den »Drei Schwestern« nur sein gleichgültiges, wodkagetränktes »Ist doch völlig egal!« brummen und vielleicht noch seinen Dauerspruch »Er hatte noch nicht ach gesagt, als ihn auch schon der Bär gepackt!« draufpacken würde.
Auf einmal auch rückten Ärzte, die ja mit Fragen auf Leben und Tod und Wissen und Gewissen wie »Lohnt sich noch eine Operation?« oder »Apparate abschalten? Magensonde drinlassen?« oder »Das Bein bei dieser oder jener Sepsis-Lage vorsorglich amputieren?« alltäglich gewohnheitsmäßig konfrontiert sind, als tragische Möglichkeitsfiguren ins weitere gesellschaftliche Bewusstsein. Was ja sonst die Fernsehöffentlichkeit außer in Ärztespielfilmserien kaum interessiert, wo es immer zugunsten einer Nichttragik gut ausgeht, die septischen Beine also alle dranbleiben, aber darauf kommen wir noch zurück. Die Figur, lange von den Theaterbühnen verschwunden, auf die sie eigentlich gehörte – aber die Bühnen spielen seit Jahren schon nicht mehr das, was eigentlich auf sie gehört, also muss sie sich auf geradezu schicksalhaften Umwegen den Weg zurück ins Öffentliche suchen –, wäre der Arzt am Scheideweg, der jetzt seine schaurig triumphale Wiederkehr feierte. Und weit über die g’schlamperte Schnoddrigkeit von Tschechows Dr. Dorn hinausging. »Der Arzt am Scheideweg« (»The Doctor’s Dilemma«) ist ein grundtrauerwitziges Stück des Dramatikers und Impfgegners George Bernard Shaw aus dem Jahr 1906. Sein Doktor heißt Dr. Colenso Ridgeon. Und die Grundfrage des Stücks von 1906, die im deutschen Fernsehen im Frühjahr 2020 zuerst nur in Anklängen und Berichtssplittern aus der Ferne gestellt wurde, in der Paris, Straßburg, New York, Mailand, Madrid und Bergamo liegen, sich dann je länger, je mehr mit Furcht und Hoffnungslosigkeitsphantasien und Empörungsmechanik dynamisch auflud, lautet: Welches Leben ist mehr wert? Wenn gilt, dass es nicht für alle reicht? Aber alle das wollen, wofür alle auf der Welt sind: überleben?
Für Anne Will zum Beispiel, eine der tonangebenden Gouvernanten-Primadonnen des Ersten Deutschen Fernsehens, gleichsam die Abfrage-Königin eines nationalpolitischen TV-Stuhlkreises, in den sich alle, die in der politischen Öffentlichkeit eine Rolle spielen wollen, ohne Murren einzureihen haben, um schülerhaft still dazusitzen und erst dann zu antworten, wenn sie gefragt werden, ist das gar keine Frage gewesen. Sondern eine Ungeheuerlichkeit. Spätabends hatte sie sich mit strengem, keine Aus- und Widerrede duldendem Gestus an Robert Habeck, den Vorsitzenden der Bundespartei der Grünen, im Hauptberuf Schriftsteller, gewandt und ihn gefragt, was er denn von den Interviewäußerungen Boris Palmers, des Tübinger Oberbürgermeisters und Parteifreundes von Habeck, halte, der auf dem Privatsender Sati in Sachen Corona-Schutzverordnungen gemeint hatte: »Wir schützen hier Leute, die in ein paar Monaten sowieso gestorben wären.« Wobei alle den Palmerschen Nachsatz ignorierten, dass unsere Schutz- und Restriktionsunternehmungen vor allem im wirtschaftlichen Bereich zur Folge hätten, dass in Afrika Millionen von Kindern verhungern könnten. Habeck, eine Ichgebe-sofort-zu!-Botmäßigkeit im Abgefragtenblick und -tonfall, konzedierte, ohne zu zögern, dass »der Boris herzlos« sei und dass die Partei sich Konsequenzen, sprich Rauswurfmöglichkeiten überlege. Was die Gouvernante mit gnädigem Augenliderschließen quittierte.
Dabei hatten die französischen, italienischen, spanischen, amerikanischen Ärzte vielfach Shaws und Palmers Scheideweg-Frage zu diesem Sendezeitpunkt auf ihre tragische Weise beantworten müssen. Die Zelte, Fleischkühl- und sogar Turnhallen, die Lastwagen und die Militärtransporter bargen dort die Tausenden von Leichen, die zu Lebzeiten (eben auch) Opfer der Frage waren, die Shaws Dr. Ridgeon zu entscheiden hatte. Dabei hatte es Colenso Ridgeon noch leicht. Er hatte die Wahl zwischen einem genialen, aber völlig asozialen, bigamistischen, erpresserischen, weiberwegwerfenden, verschwenderischen, in Saus und Braus betrügerisch hausenden, schuldenmachenden Künstlergenie und Malervirtuosen und einem armen, braven, abgerissenen, aber grundlangweiligen, öden, kaum gesellschaftstauglichen Sozialmediziner, der selbst die Einladung zu einem Abendessen ablehnen muss, weil er indessen seine Arbeiter-Patienten vernachlässigen würde, auf deren paar Honorar-Schillinge er dringend angewiesen ist. Ridgeon hat die Wahl zwischen einem »Bilderhaufen und einem Menschen«, wie Sir Patrick Cullen, sein alter zynischer Mediziner-Freund, findet. Sowohl der geniale Bilderhaufen wie der langweilige Mensch leiden an Tuberkulose, was ja zu Zeiten eine viel tückischere und massenhafter virulente Krankheit gewesen ist, als es Covid-19 in diesem berühmten Frühjahr 2020 war. Und Dr. Ridgeon hat gerade noch einen Therapieplatz beziehungsweise eine Dosis des von ihm erfundenen und erfolgreich angewendeten Heilmittels übrig. Dr. Ridgeon entscheidet sich für den Armenarzt, der überlebt. Das Künstlergenie, das daran stirbt, überlässt er der Behandlung durch einen unbegabten, pfuscherischen Kollegen. Denn Dr. Ridgeon war auf die Frau des Künstlers scharf, die er nach des Künstlers Tod leichter zu erobern hofft, zumal er glaubte, dass die »schönste Frau Cornwalls«, vom Malergenie vielfach hintergangen, betrogen und ausgenutzt, ihm leichter Hand zufallen würde. Worin er sich gewaltig täuschte.
Die Betrogene wird ihren verstorbenen Genie-Engel ewig lieben und richtet ihm tolle postume Vernissagen aus: »Sie haben versucht, dieses schöne und wunderbare Leben zu zerstören, bloß weil Sie ihm eine Frau missgönnten, von der Sie niemals erwarten durften, dass ihr an Ihnen etwas gelegen sein könnte.« Worauf er repliziert: »Dann habe ich einen ganz uneigennützigen Mord begangen.« Was als Ende einer Komödie ein Witz ist – der sie als Tragödie offenbart. Mehr kann man von einem Drama über Ausweglosigkeiten nicht verlangen. Auf dem Theater. Und natürlich ist die dramatische Erinnerung an Dr. Ridgeon in den dramatischen Virus-Fernsehtagen eine unstatthafte und frivol anachronistische theatralische Gemütsreminiszenz – was die Motivlage Dr. Ridgeons angeht. Nicht was die Zwangslage betrifft. Auch in unserer Realität.
Und als der ZDF-Journalist Theo Koll, der ja immer so wirkt, als komme er in seinen teuren Jacketts, seinen maßgeschneiderten Hemden, erlesenen Krawatten und seiner schwungvoll gebändigten Künstlerredakteursmähne gerade aus einem jener Londoner Clubs, in die ein Dr. Ridgeon auch schon vor Zeiten soupieren gegangen sein könnte, den Bundesfinanzminister sorgenvoll fragte: »Wie geht es Ihnen persönlich, Herr Scholz?« und dieser antwortete, man wolle »alles tun« mit den Restriktionen und Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen, damit es nicht zu Zuständen wie in Italien oder Spanien oder Amerika komme, dann hatte der Minister natürlich nicht die Frage des Fragenden beantwortet, das tun Politiker sowieso sehr selten. Und der rhetorische Vordergrund bestand aus lauter Beruhigung. Aber im dramatischen Hintergrund, der hie und da durch das grelle Licht von Herzlosigkeitsspots wie das Palmersche kurz und böse aufleuchtet, lauern die Ärzte an möglichen Scheidewegen. Ärzte, die im Frühjahr des Unheiljahrs 2020 in die Politik und ins Fernsehen so weit hineinwirkten wie selten zuvor.
Und wenn Prof. Dr. Streeck, ein junger Virologe aus Bonn, meinte: »Wir können das nicht lange durchhalten«, nämlich die Restriktionen, die Kontaktverbote, das Wirtschaft-, Kultur- und Gesellschaftherunterfahren et cetera, dann war das weniger eine wissenschaftliche, vielmehr eine gesellschaftspolitische Aussage. Vorgetragen aber mit der Autorität eines Wissenschaftlers. Die allerdings wenn auch nur mittelbar ins Politische übergriff. Denn das Zauberwort, das nicht nur in der Politik, sondern vor allem im Fernsehen eine große Rolle spielt, ist ja das Wort »Wissenschaft«. Alles, was Wissenschaft ist, wird im deutschen Fernsehen und in der deutschen Öffentlichkeit verehrt und geglaubt, als habe eine unfehlbare Institution ein Dogma verkündet, als betrete jedes Mal, wenn die Wissenschaft oder eine Studie, die dies oder jenes »festgestellt« und also den Fernsehbühnenvorhang aufgezogen hat, eine Art Papst oder wahlweise gleich Gott der Herr die Szene. Als sei Wahrheit und Endgültigkeit und unerschütterbare Letzthinnigkeit das Wesen von Wissenschaft. Man erlebte das zum Beispiel in den täglichen »heute-Spezial«-Sendungen. Vor einem roten, mit hektischen »Spezial«-Schriftzügen bemalten Vorhang trat ein äußerst gütiger, mit beruhigendem Bariton begabter Herr namens Niehaves oder eine noch sehr junge Frau Zimmermann, die ebenso gütig schien wie der Herr Niehaves, nur mit strahlenderer Miene. Beide wechselten sich in jenen Tagen oft ab – aber nicht in ihrer ehrfürchtigen Haltung Wissenschaftlern gegenüber, denen sie Fragen von Zuschauern weiterreichten, die diese über sogenannte Soziale Medien wie Twitter oder Facebook eingereicht hatten. »Hilft viel Wasser trinken gegen Corona?« und ähnliches mehr.
Natürlich waren die Wissenschaftler damit sehr unterfordert. Hatten es aber in solchen Wassertrink-Fällen, in denen das Fernsehen sich als Plattform der Nation begreift, will sagen aufspielt, mit der Wahrheit ganz leicht. Und natürlich war jedes »Spezial« ganz und gar unspeziell, auch wenn Herr Niehaves mit seinem Dreitagebart und seinem Gütigkeitsblick fand, dass der Zuschauer »bei uns, den Öffentlich-Rechtlichen« die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit vermittelt bekomme, er nannte das zwar nicht »Wahrheit«, sondern sprach von »Fakten«, aber so, dass zwischen beiden kein Unterschied sei. Freilich war alles, wovon im »Spezial« die Rede war, schon vorher ausführlich in den »heute«- oder den »Tagesschau«-Nachrichten vorgekommen. Selbst die erfreuliche Tatsache für eine reiselustige Nation, dass – was überflüssigerweise als großer »Spezial«-Service angepriesen wurde – die Kosten einer Pauschalreise, sollte das Auswärtige Amt eine entsprechende Reisewarnung für das betreffende Land ausgesprochen haben, vom Veranstalter zurückerstattet werden müssten.
Je länger aber die Fernsehsender, vor allem die Öffentlich-Rechtlichen im Morgenmagazin oder im Mittagsmagazin oder in »Hallo Deutschland« am Spätnachmittag Bilder von verzweifelten, manchmal gar hemmungslos schluchzenden Eltern, Müttern zuvorderst zeigten, die mit der Aufgabe, ihre Kinder zu Hause erstens zu bespaßen, zweitens zu bekochen, drittens zu unterrichten und viertens davon abzuhalten, auf die Straße zu rennen, völlig überfordert und mit den Nerven dementsprechend am Ende waren, also mit der Aufgabe, all das zu tun, was früher ganze Elterngenerationen wie von selbst hingekriegt hatten und was seit Jahren an Kindertagesstätten, Heime und Schulen delegiert ist, weil die Eltern zu beruflichen, nicht zu erzieherischen Strapazen sich gesellschaftlich verdonnert fühlen, desto mehr fingen interessierte Kreise von rechts bis links, von liberal bis radikal, von spinnert bis wahnsinnig, befeuert von krawallgebürsteten Boulevard-Medien, von den drei wissenschaftlichen Beratern der drei Kanzlerwelpen plötzlich das einzufordern, was diese als Wissenschaftler gar nicht liefern konnten: erstens Wahrheit; zweitens Gewissheit; drittens noch mehr Wahrheit.
Und plötzlich waren sogenannte Theorien im Schwange, obwohl man an so etwas Schönes wie eine Theorie doch gewisse intellektuelle Anforderungen stellen darf und man das, was dieses Im-Schwange-Zeugs so vor sich hin streute, nicht mit dem Ehrentitel »Theorie« nennen sollte, die das Gift von Vermutungen und Verdächten der Öffentlichkeit injizierte, der kleine rote Ball sei von Juden, wahlweise auch Freimaurern, von amerikanischen Milliardären mit Impfinteressen, von chinesischen Militärlabors, von finsteren Mächten, zu denen auch Geheimdienste zählen mussten, bewusst und aus Weltherrschaftsgründen in die Welt gesetzt worden. Und der brillante Virologe mit dem Wuschelkopf habe mit seiner erst noch zu untersuchenden und auf experimenteller Basis zu stellenden Vermutung, nicht schon einer zu verkündenden Wahrheit, dass Kinder eventuell genauso ansteckend seien wie Erwachsene, dafür gesorgt, dass Kindertagesstätten und Schulen geschlossen worden seien und also Eltern, alleingelassen mit ihren Kindern, die offenbar das schlimmste und belastendst Vorstellbare für sie sind, am Rande der Nervenzerrüttung kollabieren müssten.
Aber das war nur die Zerrspiegelung dessen, was sowohl der Königspudel in Frankreich als auch die Fürsorge-Leitwölfin und ihre Kanzlerwelpen in Deutschland als den Urgrund ihrer Auf-geht’s-widerden-Feind!-Pathosreden anklingen ließen: Wir müssen zusammenrücken! Deutschland war in jenen Tagen fernsehoffiziell ein einig Volk von Anti-Virus-Brüdern. Wenigstens eine Zeitlang. Auch eine Art Ausnahmezustand.