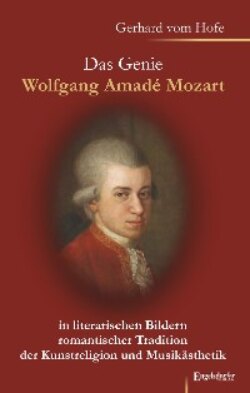Читать книгу Das Genie Wolfgang Amadé Mozart in literarischen Bildern romantischer Tradition der Kunstreligion und Musikästhetik - Gerhard vom Hofe - Страница 8
Kapitel 1
Wolfgang Amadé Mozart:
Das Wunderkind und unbegreifliche Genie in der Optik der Mozarts sowie der Zeitgenossen und grundsätzliche Überlegungen zur Genieproblematik
ОглавлениеDer Versuch, sich ein differenziertes Urteil über die Qualitäten des Genies Wolfgang Amadé Mozarts zu bilden und im Zusammenhang damit die Frage: „Wer war Mozart?“ wenigstens annähernd sachgerecht beantworten zu können, scheint noch immer ein herausforderndes hermeneutisches Experiment und ein durchaus aufregendes Abenteuer. Für eine korrekte Entscheidung dieser Problematik scheint der Umstand, ob man die Voraussetzung einer unlösbaren Einheit von Künstler und Person Mozarts berücksichtigt, ob man also die Frage nach dem Geheimnis des Genies mit der Frage nach dem Charakter und der individuellen Lebensweise des Komponisten unlösbar verbunden sieht, eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen. Eine Alternative könnte darin liegen, das Genieproblem ausschließlich hinsichtlich der Produktionsweise des Künstlers und der Frage nach der Originalität seiner geschaffenen Werke zu betrachten, mithin von der Biographie des Künstlers und seinen spezifischen, historisch bedingten Lebensumständen weitgehend abzusehen. In diesem Fall müsste jedoch der besondere Zusammenhang mit der allgemeinen musikgeschichtlichen Entwicklung und mit der musikästhetischen Tradition an Bedeutung gewinnen. Beobachtet man rückblickend die literarischen Mozartdarstellungen und deren Behandlung der Geniethematik (und das gilt für die Literatur unterschiedlicher Provenienz und unterschiedlichen Ranges), so lässt sich grundsätzlich sagen, dass sie in der Regel die Vermittlung der Aspekte des schaffenden Künstlers und der mitteilsamen Person des Komponisten, der Art und Weise seiner Produktion (ob man es hier mit Modalitäten einer Mimesis oder einer originären Schöpfung zu tun hat) und deren Reflexion in den Blickpunkt ihres Interesses rücken. Dabei kommen auch und immer wieder Aspekte zur Sprache, die den Charakter des genialen Künstlers Mozart beleuchten.
Ebenso scheint folgender Tatbestand kaum zu bestreiten: Angesichts der facettenreichen Mozart-Literatur sieht sich der Mozartliebhaber mit einer Pluralität von Mozart-Bildern konfrontiert (um nicht zu sagen: umstellt), die sich aus der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des Komponisten herleiten lassen und die der Literatur seit dem zeitgenössischen Verständnis, hauptsächlich aber aus der Tradition der romantischen Interpretationen und dem 19. Jahrhundert zugewachsen sind und die sich gelegentlich noch immer hartnäckig behaupten. Die heute bisweilen in den Medien propagierte Etikette vom „Jahrtausendgenie“ ist denn doch letztlich ein plakatives, viel zu abstraktes Klischee und entbehrt aller präzisen Bestimmungen. Sie bleibt ohne Aussagekraft und verrät nichts über die spezifischen Ausdrucks- und Erscheinungsformen des Genialen bei Mozart. Ließe sich das nicht mit demselben Recht von Bach
oder Beethoven behaupten? Die marktschreierische Etikette, auf die hier das Profil des Genies reduziert wird, kann allenfalls den Vorteil beanspruchen, nicht wahnsinnig falsch zu sein; und sie scheint als Superlativ – modisch geredet – kaum noch zu „toppen“. Auf den Punkt gebracht wäre damit immerhin eine Auszeichnung Mozarts als des schlechthin Unvergleichlichen in der neueren Musikgeschichte; es fragt sich nur, mit welchem besonderen Erkenntniswert?
Erst seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, vor allem in Wolfgang Hildesheimers Mozartstudien1, ist die kritische Frage nach dem authentischen Profil des Komponisten, nach dem widerständigen Genie und nach dem „wahren“ Mozart wieder einmal entschieden neu gestellt worden, und dies in einer bisher kaum vertretenen Radikalität. Die Resonanz schien denn auch verhalten. Hildesheimers Mozartdarstellung fand nicht die vom Autor erhoffte Zustimmung. Zuvor waren nur in Ausnahmefällen einmal unpopuläre Mozartbilder vertreten worden, die bei Kennern und Liebhabern Mozarts kaum Akzeptanz gefunden hatten. Man denke etwa nur an Auffassungen des „dämonischen Genies“, dem kein geringerer als Goethe das Wort geredet hatte. Mit Wolfgang Hildesheimers radikalen Thesen schien der Impuls zu einer Revision traditioneller, zäh fortlebender Vorstellungen vom Genie Mozart mit ihren deutlichen Tendenzen einer Mythisierung und Idealisierung gegeben. Auch das Kapitel einer entschiedeneren Kritik der immer noch reichlich sprudelnden Quellen der Mozart-Legenden und anderer fragwürdiger überlieferter Zeugnisse war damit neu aufgeschlagen. Darüber hinaus hat der moderne Mozartbiograph einen erneuten Anstoß dazu gegeben, die überkommenen Mozart – Bilder kritisch zu überdenken und die beliebten Motive der Legenden, derer sich vorzugsweise die spekulativ verfahrende Literatur bedient hat und die in der herkömmlichen Biographik dankbar genutzt worden sind, zu destruieren. Emphatisch geredet: Wieder einmal schien es an der Zeit, die Arbeit einer „Entmythisierung“ zu leisten.
Seither haben die Lebens- und Werkgeschichten Mozarts neue Wege beschritten: Ein Rekurs auf die kritisch edierten Quellen, die in sorgfältigen Ausgaben verfügbaren historischen Dokumente, auf die Briefe des Komponisten und der Familie Mozart, auf zeitgenössische und posthume Zeugnisse setzte ein. Eine Rückbesinnung auf die historisch verbürgten Lebensumstände und die Schaffensbedingungen des Genies Mozart fand in stärkerem Maße als bisher Berücksichtigung. Das Befolgen des Imperativs „ad fontes“, bewährte Tugend des wissenschaftlich arbeitenden Forschers und des Philologen, schien schließlich verlässlicher zum Ziel zu führen und einen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Bestimmung von Mozarts wahrem Genie zu ermöglichen. Denn das ist doch immerhin ein bedeutsamer und erfreulicher Tatbestand: Die Vita Wolfgang Amadé Mozarts und seine Werkgeschichte sind (im Vergleich zu anderen Komponisten des 18. Jahrhunderts) erstaunlich gut, breit und zuverlässig dokumentiert.2
Beinahe 1500 Briefe der Familie Mozart, davon bald ein Drittel vom Komponisten selbst, datierend von 1769 bis zum 14.10.1791, also bis kurz vor seinem Tod, sind als immerhin aussagekräftiges, wenn auch natürlich interpretationsbedürftiges Material überliefert und liegen in kritischen Ausgaben vor. Das gilt nicht allein für die Dokumentation der Lebensgeschichte Mozarts. Auch seine Kompositionen sind in wissenschaftlich vorbildlicher Weise ediert. Dem Musikwissenschaftler wie dem Biographen und Historiker stehen außerdem zahlreiche und sogar ergiebige Berichte von Zeitgenossen, aber auch spätere Zeugnisse der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte zur Verfügung. Zudem liegen diese Texte wie auch die musikalischen Werke Mozarts mittlerweile in kritischen und gründlich kommentierten neueren Ausgaben vor.3 Gleichwohl hält die Auseinandersetzung um den „wahren Mozart“, halten die Bestimmungsversuche seines Genies mit kontrovers ausgetragenen Diskussionen weiter an. Ein Hauptgrund dafür scheint mir die wenigstens untergründig fortlebende Tradition der Mozart-Legenden und ihrer Faszination zu sein, welche vor allem die Romantik seit Friedrich Rochlitz zu verantworten hat.4
Trotz der inzwischen schon sehr weit fortgeschrittenen Destruktionsarbeit scheinen Anekdoten und Legenden ihre Faszinationskraft noch immer nicht ganz eingebüßt zu haben. Ein weiterer Anlass für die oft mit Mutmaßungen und Spekulationen operierenden Deutungen des Mozartischen Genies liegt vielleicht in der häufigen Ambivalenz, ja Vieldeutigkeit der Sprache und in stilistischen Eigenarten des Briefschreibers Mozart, 5 auch seiner Selbstdeutungen.
Trotz der günstigen Quellenlage bleiben also Hindernisse. Lücken in der Dokumentation wichtiger Phasen von Mozarts Lebensgeschichte, auch werkgeschichtlich ungeklärte Fragen erschweren manchmal eine angemessene Urteilsfindung und verhindern ein konsensfähiges Mozart – Bild. Solche Probleme betreffen z.B. Mozarts Verhältnis zum Vater Leopold nach seiner Abdankung beim Fürsterzbischof Colloredo in Salzburg und nach seiner Entscheidung für Wien 1781, sodann den Prozess seiner Emanzipation vom mächtigen Vater mit der Heirat Constanze Webers wider dessen Einwände.
Bis heute nicht letztlich geklärt ist auch Mozarts Beziehung zum durch seine Briefe berühmt gewordenen Bäsle in Augsburg. Ähnliches gilt auch für die Art und Weise seiner Zusammenarbeit mit Lorenzo da Ponte und für Mozarts persönliches Verhältnis zu diesem berühmten Librettisten, dem wir die Texte der großen späten Opern (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte) verdanken und der auch – wie dessen späte Memoiren verraten – ein klares Bewusstsein für die historische Bedeutung von Mozarts Genie gewonnen, aber zu dessen Lebzeiten sich offensichtlich nicht in der Lage gesehen hatte, seine Überzeugung angemessen zu vermitteln und Mozarts Anerkennung als singuläres Genie in der Öffentlichkeit zu beflügeln. Ob sein Diktum deshalb als eine heimliche Selbstkritik gelesen werden kann, bleibt wohl eine Mutmaßung: „Obwohl Mozart das höchste Talent und eine vielleicht größere Begabung als irgendein anderer Komponist der Vergangenheit oder Gegenwart besaß, so war es ihm infolge der Intrigen seiner Gegner doch nicht gelungen, sein göttliches Genie in Wien zur Geltung zu bringen. Er blieb im Dunkeln gleich einem kostbaren Edelstein, der seinen Glanz im Schoß der Erde verbirgt.“6
Einige Probleme bereiten noch immer die endgültige Klärung der Frage, wie denn Mozart in Wahrheit menschlich zu seinem musikalischen Rivalen Salieri oder auch zu anderen Künstlern der zeitgenössischen Musikszene gestanden haben mag. Und noch nicht hinreichend geklärt scheint auch die Frage nach den wirklichen Ursachen für die finanziellen Nöte und für die Misere, in die Mozart offensichtlich ab 1787 geraten ist. Schließlich hat dieser Umstand Stoff für eine ganze Flut von Legenden über Mozarts Kind gebliebene, lebensuntüchtige Künstlerexistenz geboten, haben die entsprechenden Legenden und Anekdoten seine mangelnde Ökonomie, seine Leichtfertigkeit, seine Lebensfremde und naive (oder besser gesagt: unbesonnene) Großmut des Genies und Arglosigkeit des im Grunde sozial eingestellten Mozart ausdrücklich zu erklären versucht.7
Oder man denke nur an die bis heute nicht vollends aufgeklärten Kompositionsmotive für die späten großen Werke, fürs Requiem und die letzten drei großen Sinfonien in Es- Dur, g- moll und C- Dur (KV 543, 550, 551)8 und deren Entstehungsgeschichten. Allerdings hat vor kurzem Christoph Wolff gerade diesen Themenkomplex neu beleuchtet und in seiner jüngst erschienenen Mozartmonographie überzeugende Einsichten vermittelt.9
Die außerdem in vielen Punkten dunklen, d.h. historisch unbefriedigend und lückenhaft dokumentierten Ereignisse der letzten Lebenswochen Mozarts und seiner Todesumstände konnten in besonderem Maße zu vielen bis in unsere Gegenwart hinein populär gebliebenen Legenden führen.10 Und viele gerade dieser apokryphen Texte haben sich teilweise sogar als vermeintlich seriöse Zeugnisse von Fakten in Mozarts Biographie (aller kritischen Vorbehalte zum Trotz) behaupten können.
*****
Bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts (dies lässt sich zumindest tendenziell feststellen) dominierte in der wissenschaftlichen Biographik, in literarischen Mozartdarstellungen, aber auch allgemein in der Musikkultur und unter Liebhabern das Bild vom seraphischen Götterliebling Amadeus. Man glaubte in Mozart eine geradezu mustergültige Inkarnation eines apollinischen Künstlergottes und das schlechthinnige Paradigma eines begnadeten göttlichen Wunderkindes zu erkennen. Dies Bild verrät natürlich oft mehr über die Interessen der Betrachter als über den wahren Sachverhalt des Objekts der Anschauung: Der Geist des historisch orientierten Bildungs- und Kulturbürgertums findet darin seinen signifikanten Ausdruck. Und dies Bild verdankt seine Entstehung wesentlich dem frühen 19. Jahrhundert und der romantischen Tradition der Musikästhetik.11
Komplementär zum Bild der göttlichen Lichtgestalt Mozarts und der Anschauung des Wunderkindes haben die frühen Mozartverehrer der Zeit um 1800 – um hier nur die prominentesten Autoren zu nennen: vornehmlich Goethe und E.T.A. Hoffmann – das Bild eines durch das Dämonische gezeichneten und tragischen Genies, eines damit letztlich auch fremden und unheimlichen Mozart geprägt. Dabei spielt das Erlebnis seiner Oper Don Giovanni, angeschaut und interpretiert als Spiegelbild des Komponisten, ja als eine verborgene Selbstdarstellung, eine maßgebliche Rolle.12 Diese Sichtweise wird dann Wolfgang Hildesheimer aufnehmen und aus moderner Optik und in Kenntnis der Rezeptionsgeschichte mit aller Entschiedenheit, ja Radikalität das „dämonische Element“ Mozarts als des der Welt und dem Leben gänzlich Fremden betonen. Er vertritt gegen die Tradition seit der Romantik, auch gegen den Strich nahezu aller literarischen Mozart- Darstellungen die radikale These des absolut isolierten, nicht mitteilsamen und schlechterdings inkommensurablen, in anderen Kategorien existierenden Künstlers Mozart.13
Mit Hildesheimers Sicht einher geht im Unterschied etwa zu E.T.A. Hoffmanns idealisierender Interpretation in dessen romantischer Erzählung Don Juan14 eine konsequente Destruktion der Mythisierungen des Genies Mozart als des göttlichen und apollinischen Kindes vor allem in der Folge des Raffaelkultes der deutschen Frühromantik, der von Wackenroder/Tieck begründet worden ist.15 Diesen Rezeptionsprozess hat der Leipziger Musikkritiker und Schriftsteller Friedrich Rochlitz maßgeblich befördert. Dessen Auffassung hat bis weit ins 19. Jahrhundert hinein eine nachhaltige Resonanz gefunden. Rochlitz hatte 1798 in seiner Allgemeinen Musikalischen Zeitung eine kommentierte Sammlung von Mozart-Anekdoten veröffentlicht16 und damit der unbefriedigten psychologischen Neugier vieler Mozartliebhaber Rechnung getragen, dem Geheimnis der Person des Genies auf die Spur zu kommen und über die Seelengeschichte und die Innerlichkeit Mozarts Näheres in Erfahrung zu bringen als dies durch die bisher publizierten Quellen, etwa den Nekrolog Schlichtegrolls von 179217 oder auch durch Niem(e)tscheks erste Biographie von 179818 möglich schien.
Außerdem hatte Rochlitz in einem programmatischen Aufsatz mit dem Titel Raffael und Mozart, erschienen in der Juninummer seiner Musikalischen Zeitschrift des Jahres 180019, alles Unheimliche, Peinliche und Fremde bewusst ausblendend oder doch überspielend, in deutlich apologetischer Absicht die Einheit des Künstlergenies und des großen tugendhaften Menschen Mozart akzentuiert und damit großen Einfluss auf die Urteilsbildung der musikalischen Öffentlichkeit genommen, ja das Mozart-Bild der künftigen Rezeptionsgeschichte für Jahrzehnte geprägt. Elemente des durch Rochlitz fixierten und normbildend nachwirkenden Mozart-Bildes finden sich sogar noch in Peter Shaffers Amadeus - Theaterstück und in Milos Formans darauf zurückgehenden Film unserer Zeit.20
Rochlitz hatte offenbar die Absicht, die seiner Zeit vorherrschende Mozart-Kritik der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts zu verabschieden.21 Diese frühe Rezeptionsphase hatte dem Komponisten wohl ein „großes Genie“ im Sinne einer musikalischen Zeitgröße von Rang attestiert, aber eben nicht in der Bedeutung eines vollendeten „klassischen“ Künstlers.
Eine historische Erklärung dafür bietet vielleicht der für das späte 18. Jahrhundert charakteristische und oft beschworene „Paradigmenwechsel“ von der Vokal- zur Instrumentalmusik22, der mit der Begründung einer romantischen Musikästhetik eine „Metaphysik der Instrumentalmusik“ zur Folge hatte, die aber den Blick für die Bedeutung von Mozarts großen klassischen Sinfonien noch nicht gewonnen hatte. Zudem hatte man Mozart „eigentlich wenig höhere Kultur und wenig wissenschaftlichen Geschmack“23 als beklagenswerten Mangel vorgehalten.
Bei Rochlitz finden sich alle wichtigen und wirkungsmächtigen Motive des populär gewordenen romantischen Mozart-Bildes ausgebildet: eine klare Profilierung der menschlichen Tugenden Mozarts (seine Gefälligkeit, sein Gerechtigkeitsgefühl, sein Fleiß, seine Gatten- und Familienliebe, sein Selbstbewusstsein, seine soziale Einstellung, seine Treue zur deutschen Nation etc.); nicht minder die Idealisierung seines unglaublichen musikalischen Vermögens, seines unfasslichen Ideenreichtums (traditionell rhetorisch ausgedrückt: seiner unglaublichen inventio) wie der unvorstellbaren Mühelosigkeit seines Komponierens, die im Hinblick auf die zeitgemäßen Erklärungsmodelle der in den frühen 90er Jahren entwickelten romantischen Musikästhetik unwillkürlich mit dem Wunderbaren in Verbindung gebracht wurde. In Wackenroder/Tiecks Phantasien über die Kunst oder dann auch in E.T A. Hoffmanns musikästhetischen Schriften wird als Gegenstand der „eigentlichen Musik“ des romantischen Zeitalters – im Gegensatz zur überlieferten Ästhetik der Vokalmusik mit ihrer zentralen Kategorie der imitatio naturae – in der nun stark betonten „Metaphysik der Instrumentalmusik“ das „Übermenschliche“ und „Wunderbare“ (statt des Natürlichen) geradezu schwärmerisch akzentuiert.24
Rochlitz reklamiert für Mozart (der Gedanke lag nahe) die Auffassung von der Musik als einer göttlichen, heiligen Kunst mit einer „religiösen Substanz“ im Sinne der Kunstfrömmigkeit der Romantik seiner Zeit, womit dann wiederum eine besondere Wertschätzung seiner Kirchenmusik verbunden ist und im Blick auf die erkannte Raffael-Parallele, speziell auf dessen Transfigurationsbild (seine Verklärung Christi von 1520)25 in Mozarts Komposition des Requiems dessen Vermächtnis und vermeintlich Mozarts höchst vollendetes Werk gesehen wurde.26
Der spekulative Vergleich Mozarts mit Raffael, dem erklärten Kunstgott der Romantik seit Wackenroders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders und den von Tieck herausgegebenen Phantasien über die Kunst, verfolgt das Ziel, den Menschen Mozart zum vorbildlich idealen und einzigartigen Künstler zu erhöhen, ihn zu genialisieren und den religiösen Gehalt seiner Werke als Emanationen des himmlischen Kunstgeistes zu erklären.27
Der Dichter Franz Grillparzer zitiert in einem 1843 entstandenen Gedicht Zu Mozarts Feier das längst zum Topos gewordene Motiv der Künstlerparallele:
„Mit Raffael, dem Maler der Madonnen, steht er <Mozart!> deshalb, ein gleichgescharter Cherub, der Ausdruck und der Hüter wahrer Kunst, in der der Himmel sich vermählt der Erde.“28
Klassische und romantische Vorstellungen erscheinen bei der Berufung Raffaels als des neuzeitlichen Realisators des klassisch-antiken Schönheitsideals par excellence vermittelt. An das Raffael-Bild Winckelmanns29 erinnern die ästhetischen Prinzipien des Klassizismus30, die beispielsweise die Schlussstrophe eines Huldigungsgedichts mit dem Titel An Mozart des Königs Ludwig I. von Bayern von 1856 metaphorisch zur Sprache bringt, wenn er Mozart poetisch feiert als die Sonne, „welche ewig glüht“:
„Vermählet ist in deinen Tönen
Die Melodie mit Harmonie.
Es lebt das Ideal des Schönen
Im Zauber deiner Phantasie.“31
*****
Es scheint unverzichtbar, noch eine weitere Mozart-Publikation von Friedrich Rochlitz zu erwähnen, weil diese nicht weniger gravierende Folgen für das bis ins 20. Jahrhundert kanonisch gebliebene Mozart-Bild hatte. Es handelt sich hierbei (wie man heute weiß) um eine vorsätzliche Geschichtsklitterung: das 1815 veröffentlichte Schreiben Mozarts an den Baron von ...32, eine scheinbar authentische Antwort auf die Frage nach dem Schaffensvorgang des Komponisten. Hier sollte der Mythos vom leichthin im Kopf komponierenden Mozart, der experimentell nicht einmal auf das Klavier angewiesen schien, seine angeblich vom Komponisten selbst autorisierte Begründung finden. Diese eigentümliche und einzigartig geniale Kompositionsweise Mozarts, die vermeintlich nur noch eines mechanischen Schreibakts bedarf, wurde immer wieder als besondere Auszeichnung des göttlichen Musensohns hervorgehoben.
Goethe, ein großer Bewunderer Mozarts33, aber auch andere Prominente haben an diese Art göttlicher Inspiration Mozarts bereitwillig geglaubt. Und selbst wenn es so gewesen wäre und der Komponist nach dem Empfang seiner Eingebungen naturgemäß nur noch, wie mutmaßlich Thomas Bernhard (der Schluss von dessen Roman Das Kalkwerk kommt einem unwillkürlich in den Sinn34) gesagt hätte, „seinen Kopf urplötzlich von einem Augenblick auf den anderen (...) auf das Papier“ hätte „kippen“ müssen; selbst dann bliebe noch allein die mechanische Arbeit der Niederschrift von insgesamt 23.000 Seiten Noten nach Zählung der Neuen Mozart-Werkausgabe, und dies in einem Zeitraum von noch nicht einmal siebenunddreißig Lebensjahren (abzüglich der frühen Kindheitszeit) als eine beinahe unglaublich zeitaufwändige Fleißarbeit maßlos zu bestaunen.
Ulrich Konrads Habilitationsschrift über die Schaffensweise, über Skizzen und Notizhefte Mozarts hat diesen durch Rochlitz in die Welt gesetzten Mythos der Produktionsweise, dem die Familie Mozart selber durch briefliche Äußerungen Vorschub geleistet hatte, zuletzt entscheidend korrigiert und wenigstens tendenziell in den Bereich der Legenden verwiesen.35
Generell wird man Rochlitz vorhalten müssen, dass er im Interesse seiner apologetischen Absichten unhistorisch und fabulierend verfährt und mit seiner Idealisierung Mozarts der künftigen Verklärung gewollt oder ungewollt Vorschub geleistet hat. Sein Mozart-Bild spiegelt letztlich seine eigene Weltsicht und die Kunst- und Genieauffassung seiner Zeit, der Romantik, wider, klärt aber nicht die wahren Lebens- und Schaffensumstände Mozarts, versucht nicht die wahren Sachverhalte aufzuklären und die überlieferten Selbstzeugnisse und Dokumente zu befragen und dadurch eine Antwort zu finden auf die Frage, wie es eigentlich gewesen ist. Und dies lässt sich verallgemeinernd wohl von den meisten Mozart-Bildern des ausgehenden 18. und des 19. Jahrhunderts behaupten: Sie bringen eher die subjektiven Anschauungen der Interpreten zum Ausdruck und verraten oft die Tendenz der Vereinnahmung dessen, den sie ins Bild zu setzen versuchen.
Natürlich präfiguriert Rochlitz auch die Stilisierung Mozarts auf die apollinische Künstlerfigur, die dann in Mörikes berühmter Novelle von 1856, wenn hier auch ins Spielerisch- Selbstironische zurückgenommen und mit Vorbehalten versehen, noch einmal als zentrales Motiv angeschlagen wird.
Dies literarisch wirkungsmächtige Legendenmotiv geht schon bei den Zeitgenossen Mozarts eine harmonische Verbindung mit dem Topos des göttlichen Wunderkindes ein. Dafür boten sich genügend Anknüpfungspunkte in den Lebenszeugnissen, vor allem in den Briefen des Vaters und anderer Zeitgenossen. Allerdings fällt auf, dass Leopold Mozart die schon frühzeitig bemerkte außerordentliche Begabung seines „Wolferl“ wohl als ein Wunder begreift, es aber doch eher konventionell als ein Geschenk Gottes deutet und sein Erstaunen darüber im Zusammenhang mit seinem katholischen Weltbild „gläubig“ rationalisiert.
Beispielsweise ist vom sechs- und siebenjährigen Wunderknaben und der Wunderwirkung seines Klavier- oder Orgelspiels in den Briefen von der ersten großen Reise nach Wien 1762/63 des Öfteren die Rede: So berichtet der Vater seinem Freund Lorenz Hagenauer in Salzburg: „Hauptsächlich erstaunet alles ob dem Bueben, und ich habe noch niemand gehört, der nicht sagt, daß es unbegreiflich seye.“36 Sogleich nach ihrer Ankunft in Wien (so schreibt Leopold Mozart) habe er Befehl erhalten, an den Kaiserhof zu kommen. Der Ruf des Wunderknaben sei ihnen vorausgeeilt. Aus Wasserburg, wo Leopold seinem Sohn das Pedal der Orgel erklärt, habe Wolfgang dann „stante pede die Probe abgeleget, (...) stehend preambulirt und das pedal dazu getreten, (...) als wenn er schon viele Monate geübt hätte. alles gerüeth in Erstaunen und ist eine neue Gnad Gottes, die mancher nach vieler Mühe erst erhält.“37
Aus Paris im Februar 1764 erfährt Frau Hagenauer vom Vater Mozarts:
„stellen sie sich den Lermen für, den diese Sonaten (gemeint sind vier Klaviersonaten, die der Knabe gerade komponiert hat; d.Vf.) in der Welt machen werden, wann am Titlblat (sic!) stehet, daß es ein Werk eines Kindes von 7 Jahren ist (...).“ Ich „kann Ihnen sagen (...), daß Gott täglich neue Wunder an diesem Kinde wirket“.38
Und dann folgt eine für den Vater Leopold typische Bemerkung, die seine pädagogische Strategie verrät, die er mit den für ein Kind schließlich höchst anstrengenden, eigentlich unzumutbaren Reisen verfolgt:
„bis wir: wenn Gott will: nach Hause kommen, ist er (d.h. Wolfgang; d.Vf.) im Stande Hofdienste zu verrichten. Er accompagniert wirk: allerzeit bey öffent: Concerten. Er transponirt so gar à prima vista die Arien beym accompagniren; und aller Orten legt man ihm bald Ital: bald französ: Stücke vor, die er vom blatt=weg (sic!) spielet.“39
Aus London 1764 berichtet Leopold, Wolfgang habe dem König Stücke von Bach, Abel und Händel vom Blatt „weggespielt“, er habe die Königin bei einer Arie begleitet und über einem Bass die schönste Melodie gespielt, „so, daß alles in das äusserste Erstaunen gerieth.“
Was Wolfgang jetzt könne, das übersteige alle Einbildungskraft.40 Und eine letzte Briefstelle sei angeführt. Aus München im November 1766 rechtfertigt Leopold wieder einmal seine Erziehungsmethode gegenüber Lorenz Hagenauer:
„Gott (...) hat meinen Kindern (die Tochter Nannerl also eingeschlossen; d.Vf.) solche Talente gegeben, die, ohne an die Schuldigkeit eines Vatters zu gedenken, mich reitzen würde, alles der guten Erziehung derselben aufzuopfern. jeder Augenblick, den ich verliehre, ist auf ewig verlohren. und wenn ich jemahls gewust habe, wie kostbar die Zeit für die Jugend ist, so weis ich es itzt. Sie wissen daß meine Kinder zur arbeit gewohnt sind: (...) sie wissen auch selbst wie viel meine Kinder, sonderlich der Wolfgangerl zu lernen hat.“41
Hier spricht der christlich denkende Aufklärer, dem bewusst ist, dass es mit dem Genie des Wunderknaben allein nicht getan ist. Und Leopold Mozart leitet aus dem ihm und der Welt von Gott gesandten Wunder die geradezu missionarische Verpflichtung ab, das ihm mit Wolfgang anvertraute Gottesgeschenk zu hüten, es durch sorgsame Belehrung in seiner Entwicklung zu fördern – und es der Welt zu demonstrieren. Hier verrät sich ein christlich religiöses Motiv für die großen strapaziösen Reisen durch Europa, das sich übrigens für den Vater mit dem profanen Aspekt des Ruhm- und Gelderwerbs, einer ganz praktisch und ökonomisch motivierten Bildungsreise zum Zwecke der „Vermarktung“ des Wunderknaben mühelos zu verbinden schien.42 Ein Brief aus Rom vom April 1770, ein Zeugnis der ersten Italienreise, die nicht mehr nur privat arrangierte Konzerte zumeist in Adelshäusern anstrebte, sondern bewusst mit dem Versuch unternommen wurde, für Mozart einen Produktionsvertrag für die italienische Oper abzuschließen, bringt unmissverständlich zum Ausdruck, dass nunmehr Wolfgangs mit Fleiß erworbenes handwerkliches Können und sein ungemein rasches Fortschreiten in der „Compositionswissenschaft“ der Hauptgrund für die allerorts spürbare Bewunderung ist (und der Ruf des Wunderkindes allein nicht mehr zieht): „ie tiefer wir in Italien kamen, ie mehr wuchs die verwunderung. der Wolfg. bleibt mit seiner Wissenschaft auch nicht stehen, sondern wächst von tage zu tage, so, daß die grösten kenner und Meister nicht worte genug finden ihre Bewunderung auszudrücken (...).“ 43
Schon während der großen Westeuropa-Reise der Jahre 1763 bis 1765, stärker ausgeprägt freilich dann später in den Jahren der Italienreisen 1771-1773 und in denen der „Orientierung“ 1777 – 178144, hier besonders in der Mannheimer und Pariser Zeit, tritt Mozarts musikalische Welterkundung, das forcierte Lernen und Arbeiten, das Sich-Vertraut machen mit den verschiedenen zeitgemäßen Stilrichtungen der Musik in den europäischen Zentren in den Vordergrund und gewinnt als das heimliche pädagogische Konzept Leopolds und als Hauptzweck der Reisen immer mehr an Bedeutung. Die Erinnerungen an die ersten Auftritte des Wunderkinds in der Fremde verblassen mehr und mehr. Bald bricht die Zeit der professionellen Bewährung des außerordentlichen Talents an. Der junge Komponist wird zunehmend selbstbewusster. Er weiß sich zum „Kapellmeister“ geboren, und er thematisiert in seinem Brief vom 11. September 1778 aus Paris an seinen Vater sein Selbstbewusstsein als ein „Mensch von superieuren Talent“, „welches ich mir selbst, ohne gottlos zu seyn, nicht absprechen kan.“45
Und in demselben Brief heißt es weiter:
„ich darf und kann mein Talent im Componiren, welches mir der gütige Gott so reichlich gegeben hat, / ich darf ohne hochmuth so sagen / denn ich fühle es nun mehr als jemals nicht so vergraben.“46
Wie der Vater beruft auch der Sohn das biblische Gleichnis vom Talentwucher und leitet daraus die religiöse Selbstverpflichtung ab, seine göttliche Berufung zum Komponisten als seine Lebensbestimmung zu verwirklichen. Das Klavier sei eigentlich nur seine „sehr starcke nebensach“, das Komponieren sei dagegen seine „einzige freüde und Paßion“.47
Die Tätigkeit des Unterrichtens, worauf Mozart noch während seiner Wiener Jahre ohne eine höfische Position angewiesen war, galt ihm eher als eine Last und ein „notwendiges Übel“.48 Den zuletzt zitierten Briefzeugnissen, die Mozarts Selbsteinschätzung seiner ungewöhnlichen Gaben demonstrieren, möchte ich wenigstens eine historisch verbürgte Äußerung über das Wunderkind Mozart zur Seite stellen, die nicht nur die andere Optik der zeitgenössischen Öffentlichkeit repräsentiert, sondern die auch deshalb besonders interessant ist, weil sie das Urteil eines eher skeptischen Aufklärers darstellt. Ein Freund Diderots, der Diplomat und Schriftsteller Baron Melchior von Grimm, übrigens ein wichtiger Mittelsmann der Mozarts in Paris, verbindet mit seinem Ausdruck der irritierten, aber grenzenlosen Bewunderung zugleich den vielleicht für die Zeit charakteristischen Versuch einer rationalen Klärung der Wirkung eines für ihn sprichwörtlich unbegreiflichen Wunders.
Grimm schreibt in seiner Kritischen Korrespondenz am 1.12.1763:
„Wahre Wunder sind so selten, daß man davon spricht, wenn man einmal eins erlebt. Ein Kapellmeister aus Salzburg mit Namen Mozart ist hier (i.e. in Paris; d.Vf.) kürzlich mit zwei Kindern von allerliebstem Anblick eingetroffen. Seine Tochter spielt hinreißend Klavier; (...) ihr Bruder, der im nächsten Februar sieben Jahr alt wird, ist ein so ungewöhnliches Wunderkind, daß man kaum glauben kann, was man mit seinen Augen sieht und mit seinen Ohren hört.“ (...)
„geradezu unglaublich ist es, ihn eine Stunde lang aus dem Kopfe spielen und sich der Eingebung seines Genies und einer Menge entzückender Einfälle überlassen zu sehen, die er zudem geschmackvoll und geordnet folgen zu lassen weiß.“ (...) „Mühelos liest er alle Noten, die man ihm vorlegt; er komponiert mit wunderbarer Leichtigkeit, ohne zum Klavier zu gehen und seine Akkorde suchen zu müssen.“ (...)
„Dieses Kind wird mich bestimmt noch närrisch machen, wenn ich es öfters höre; es zeigt mir, wie schwer es ist, sich vor Tollheit zu hüten, wenn man Wunder erlebt. Daß der heilige Paulus nach seiner seltsamen Vision den Kopf verlor, setzt mich nicht mehr in Erstaunen.“49
Überschaut man die angeführten lebensgeschichtlichen und historisch-authentischen Briefzeugnisse hinsichtlich ihrer Rede vom Wunderkind Mozart, so fällt auf, dass sie mit ihren Versuchen einer rationalen Klärung der Wirkung des Wunderbaren durchaus eine metaphysische Erklärung in Betracht ziehen. Was den phänomenalen Effekt der öffentlichen Auftritte des jungen Mozart angeht, die dadurch ausgelöste Bewunderung, ja Irritation, so hätte der zuvor schon einmal zitierte Thomas Bernhard hier vielleicht (wie in seinem Roman Der Untergeher im Hinblick auf den phänomenalen Pianisten Glenn Gould) überspitzt von einer (freilich bei Mozart nicht bloß) „klavieristischen Weltverblüffung“ gesprochen.50
Aber von einer romantischen Interpretation, die auf eine Verherrlichung und Verklärung des göttlichen Genies Mozarts und seiner apollinischen Erscheinung im Lichte Raffaels und einer durch ihn historisch vorbereiteten Kunstreligion abzielt, kann weder in den historischen Zeugnissen der Selbstdeutung noch in den zeitgenössischen Dokumenten des 18. Jahrhunderts schon die Rede sein. Auch von einer klassischen Idealisierung des begnadeten Subjekts und von einer Mythisierung des großen Komponisten Mozart sehen die gerade angeführten Dokumente (noch) ab. Das unterscheidet gerade deren Profil von den erst nach Mozarts Tod proklamierten Anschauungen, die im Wesentlichen unter der Voraussetzung romantischer Ideen und eines säkularen kunstfrommen Denkens entstanden sind und die frühe Rezeptionsphase Mozarts mit ihrer Favorisierung der Vokal- und Kirchenmusik geprägt haben. Erst dieser hauptsächlich durch Rochlitz und die Romantik begründeten Tradition einer Sakralisierung der Kunst (die maßgeblich auf Wackenroder und Tiecks Publikationen sowie publikumswirksam dann auf E.T.A. Hoffmann zurückgehen) verdanken sich die ästhetisch wie psychologisch folgenreichen Tendenzen des Mozart-Bildes, welche noch heute ihre Wirkung zeigen. Darüber hinaus wird die hauptsächlich durch E. T. A. Hoffmann richtungweisende Bestimmung und fortwährende Wirkung der romantischen Musikästhetik künftig die Mozart-Darstellungen maßgeblich beeinflussen. In Mörikes Mozarts Bild leuchtet paradigmatisch noch eine Kombination beider Traditionen auf: die einer eher klassischen und spielerischen Wiederaufnahme des mythologisch begründeten apollinischen Genies – und die des Fortlebens einer Tradition typisch romantischer Musikästhetik.