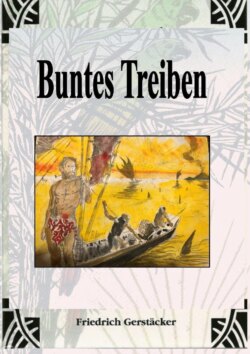Читать книгу Buntes Treiben - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGesammelte Schriften
von
Friedrich Gerstäcker.
Zweite Serie.
Sechzehnter Band.
Volks- und Familien-Ausgabe.
Buntes Treiben
Jena,
Hermann Costenoble.
Ausgabe letzter Hand, ungekürzt, mit den Seitenzahlen der Vorlage
Gefördert durch die Richard-Borek-Stiftung und Stiftung Braunschweigischer Kuilturbesitz
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. und Edition Corsar, Braunschweig, 2020
Herausgegeben von Thomas Ostwald nach der von Friedrich Gerstäcker
eingerichteten Textausgabe für H. Costenoble
Geschäftsstelle: Am Uhlenbusch 17, 38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten! © 2016 / © 2020
Im Mondenschein.
Keine Idylle.
Hoch oben im -Gebirge, und von dessen mächtiger Waldung nach allen Seiten hin umgeben, lag ein kleines, ärmliches Dorf, Holzhäusel genannt, dessen Bewohner eigentlich nur von dem lebten, was sie sich mit der Bearbeitung und Ausnutzung des Forstes verdienten.
Man sagt mit Recht: „Es ist ein armes Land, wo blos Quirle wachsen"; die Quirlmacher spielten auch hier eine bedeutende Rolle; dann gab es noch „Harzer", Kohlenbrenner und Löffelschneider. Auch Schindeln wurden gespalten, und Klafterholz bildete einen Hauptausfuhrartikel, besonders im Winter, mit Schneeschlitten den Berg hinab. Freilich verdienten die armen Leute mit alledem doch immer nur das Notdürftigste, was sie gerade zum Leben brauchten - und Gott weiß es, wie wenig das war; aber sie lebten doch und hatten dabei ihre Heimath so lieb, als ob sie in einem Paradiese und in allem Ueberfluß gelegen hätte.
Uebrigens gehörte das Dorf noch nicht einmal zu den kleinsten im Walde, denn es besaß seine eigene Kirche und sogar ein königliches Gebäude - das Chausseehaus nämlich, das an der vorbeiführenden Straße stand; auch lagen einige Felder darum her, und einzelne der Bewohner, die Honoratioren, trieben ein wenig Ackerbau. Was konnten sie freilich in einem Klima ziehen, wo die Kartoffel eigentlich schon zu den tropischen Früchten zählte und der Hafer oft aus dem /2/ Schnee heraus geschnitten werden mußte - so früh setzte manchmal der Winter ein. Aber der Versuch wurde immer wieder gemacht, und zu Zeiten gelang es ihnen doch, ihre mit sauerm Schweiß erbauten Früchte einzuheimsen.
Trotz aller Armuth gab es aber in Holzhäusel eine wahre Unzahl von kleinen Kindern, wie wir es denn gar häufig finden, daß gerade in den dürftigsten Districten die Zucht des kleinen Volkes am allerbesten zu gedeihen scheint. Im sächsischen Erzgebirge z. B., wo die armen Klöpplerfamilien kaum das Salz zu ihren Kartoffeln verdienen, sieht fast jedes Haus wie eine Schule aus, und Holzhäusel stand darin wenigstens dem Erzgebirge nicht nach. An schönen Sommerabendcn tummelten sich oft ganze Schwärme blondhaariger und barfüßiger Jungen und Mädchen auf ihrem Spielplatz unter der alten Buche umher, die mit wunderlich verschnittenem Wipfel vor der kleinen hölzernen Kirche stand, und das war dann ein Lachen und Jubeln, daß man sein eigen Wort kaum hören konnte. Was wußte das kleine Volk auch von Kummer oder Sorgen, wenn es nur nicht gerade hungern mußte!
Natürlich war es unter solchen Umständen nothwendig geworden, einen Schulmeister zu gewinnen, denn der Herr Pastor behielt mit all' den vielen Taufen kaum Zeit genug, um seine wöchentlichen Predigten auszuarbeiten. Die Holzhäusler konnten ihm freilich nicht viel bieten, aber was braucht auch ein Dorfschulmeister viel, der schon von Jugend auf zu Hunger und Kummer ordentlich trainirt wird und - wenn er nur recht viel zu arbeiten und recht vielen Aerger hat - außerordentlich wenig zu seinem eigentlichen Leben bedarf oder wenigstens bekommt!
Es war deshalb lange nicht so schwer, einen passenden Mann für diese ärmliche Stelle zu bekommen, als man vielleicht hätte glauben sollen, und doch wurde von ihm verlangt, daß er nicht allein Dorfschulmeister - nein sogar Dorfschulmeister in Holzhäusel werden sollte, und dazu außer den nöthigen Kenntnissen auch noch Geduld und Ausdauer wie einen hinlänglich zähen Körper mitbringen mußte, um seiner Stellung zu genügen. Es giebt freilich in unserem gesegneten Vaterlande eine Menge solcher armer Teufel, denen der Brod- /3/korb noch höher hängt, als selbst Holzhäusel über dem Meeresspiegel lag, und Andreas Pech war Einer von diesen Unglücklichen.
Andreas hatte sogar Theologie studirt, aber in seinem letzten Semester eine doppelte Dummheit begangen: sich nämlich erstens in ein wohl braves, aber blutarmes Mädchen verliebt, und dann auch noch einen rohen Burschen, der sie beleidigte, gefordert. Er zahlte ihn allerdings tüchtig aus, bekam aber selber bei der Sache eine tiefe Schramme über die ganze Backe weg, die ihn für zeitlebens zeichnete und dadurch auch seine spätere Carrière als Geistlicher vollständig unmöglich machte. Wie hätte man einen Geistlichen gebrauchen können, der schon einmal bewiesen, daß er persönlichen Muth besaß - es war nicht denkbar, und das Einzige, was unserem armen Andreas, der nicht Geld genug hatte, um umzusatteln, übrig blieb, war, eine Hauslehrerstelle anzunehmen - aber die Liebe!
Andreas Pech war ein ehrlicher Kerl. Er hatte seinem Mädchen versprochen, sie zu heirathen, und er that es; trug er doch dabei das Ideal von „einer Hütte und ihr Herz" herum, und wußte, eben so wenig wie seine junge Frau, wie nüchtern und prosaisch sich gewöhnlich das Leben mit in diese, ohnehin so kleine Hütte hinein setzt.
Seine Hauslehrerstelle mußte er natürlich aufgeben, denn die verschiedenen Rittergutsbesitzer konnten sich nicht in den Gedanken eines verheiratheten Informators hineinfinden, und nachdem er eine Weile Hunger und Kummer ertragen, blieb ihm nichts Anderes übrig, als um eine Schulmeisterstelle nachzusuchen.
Diese erhielt er auch und verwaltete sie viele Jahre brav und redlich, aber er verfiel dabei in einen sehr großen Fehler. Er wollte nämlich nicht blos die ihm aufgegebenen Stunden abhalten, sondern auch selbstständig denken und urtheilen, und das konnte auf die Länge der Zeit kein gut thun.
Wenn er an die Verbesserung des Schullehrerstandes als einzelnes Individuum dachte, so wäre das weiter kein großes Vergehen gewesen, und es stand ihm dafür der gesetzliche Weg offen, seine eigene Stellung zu verbessern: nämlich eine Eingabe an das Ministerium zu machen. Diese würde ihm aller-/4/dings, wie Niemand leugnete, gar nichts genützt haben, aber er hätte sich denn doch in der Erfüllung seiner Pflicht vollständig beruhigen können. - Das that er jedoch nicht. Er besuchte im Gegentheil Lehrerversammlungen und hielt von dem gerade herrschenden Ministerium verpönte Zeitungen - ja er hatte sogar einmal in einer solchen Versammlung eine Rede gehalten und sich darin ausgesprochen, daß der Stand der Lehrer ein eben so achtbarer sei als der der Theologen - und damit war dem Fasse der Boden ausgetreten.
Zuerst kam eine Verwarnung, dann, als diese nichts half, eine Vorladung vor das hohe Consistorium mit einem tüchtigen Rüffel und der Behauptung, daß er „am Umsturz des Bestehenden" arbeite und ein Wühler sei. Als er aber sogar noch die Kühnheit hatte, dieses Verhör in einem jener Schulblätter zu beschreiben, und sich selber zu vertheidigen, erhielt er plötzlich ein Schreiben, das ihn „mit halbem Gehalt" zur Disposition stellte.
Ein Schulmeister mit halbem Gehalt - es liegt eigentlich Humor in dem Gedanken und klingt etwa gerade so, als wenn Jemand erzählt, er habe einem Infusionsthier ein Bein ausgerissen. Die Sache hatte aber doch auch eine furchtbar ernste Seite, und Andreas Pech fand bald, daß er nichts weiter auf der Welt besaß, als, wonach er sich früher so heiß gesehnt - nämlich: eine Hütte und ihr Herz - und daß er doch bedeutend mehr zum Leben brauche.
Er gerieth in die furchtbarste Noth, und hätte er sie allein zu tragen gehabt, er würde vielleicht kein Wort darum verloren haben, aber so schrieen nebenbei noch fünf Kinder nach Brod, und seine arme brave Frau ging bleich und elend herum wie ein Schatten. So konnte es auch nicht lange bleiben - er mußte wieder eine Anstellung bekommen, wo er, außer dem dürftigen Gehalt, auch noch wenigstens ein Stück Feld und etwas Deputat-Holz erhielt, er konnte seine Kinder nicht hungern und frieren sehen, nur weil ihr Vater eine Schramme auf der Backe hatte. Er that auch Schritte deshalb, aber lange glückte es ihm nicht, denn kein anderer Staat wollte einen armen Familienvater mit fünf Kindern aufnehmen und sich damit eine Last auf den Hals laden. /5/ Endlich wurde die Stelle in Holzhäusel ausgeboten, die so wenig Verlockendes zu haben schien, daß nicht einmal unter den Schulmeistern eine Concurrenz deshalb entstand.
Einige Dörfer hatten ihn freilich schon früher nehmen wollen, denn man wußte, daß er ein tüchtiger Lehrer sei, aber er war von der Regierung, seiner Antecedentien wegen, nie bestätigt worden - nach Holzhäusel machte man dagegen keine Schwierigkeiten, das lag an einer Stelle, „wo sich die Füchse Gute Nacht sagen", und dort sollten ihm auch, wie man hoffte, die „republikanischen" Gedanken bald vergehen.
Dort war er denn richtig Schulmeister geworden, und zwar mit dem enormen Gehalt von hundertundzwanzig Thalern, einem Acker Kartoffelland, zwei Klaftern Deputat-Holz und freier Wohnung - einem kleinen Häuschen, das dem Ideal seiner „Hütte“ außerordentlich nahe kam. Aber er lebte doch - seine Kinder brauchten nicht mehr zu hungern, und er durfte hoffen, dort oben ungestört zu bleiben und nicht einmal von einem hohen Consistorium behelligt zu werden - welchen Schaden hätte er dort auch anrichten können!
Ein Gedanke ging ihm freilich manchmal durch den Kopf und drohte selbst ihn, der bis jetzt Alles so kräftig und unerschüttert ertragen hatte, nieder zu drücken: was nämlich aus seiner armen Elise - aus seinen Kindern würde, wenn er einmal plötzlich sterben sollte, denn der Wittwengehalt einer Schulmeisters-Frau, zwölf oder achtzehn Thaler jährlich, hätte ihnen weiter nichts übrig gelassen, als betteln zu gehen. Wenn das Bild vor seiner Seele aufstieg, zog es ihm das Herz wie mit eisernen Klammern zusammen. Aber er durfte nicht daran denken - kein Schulmeister darf das - und außerdem hatte ihn das Denken auch schon früher in Verlegenheit gebracht. Was half's auch; damit änderte er die Sache nicht und hätte sich sein ohnedies nicht freudiges Leben nur noch mehr verbittert. Vielleicht wurde es einmal besser; die damalige Regierung blieb ja nicht ewig am Ruder, und dann durfte er doch jedenfalls hoffen, seine Stellung zu verbessern.
Uebrigens war Andreas nicht allein ein ganz kluger, aufgeweckter Kopf, der wohl eine bessere Stellung ehrenhaft ausgefüllt hätte als die eines Schulmeisters in Holzhäusel, sondern /6/ er zeigte sich auch anstellig zu anderen als geistigen Arbeiten und benutzte die wenige freie Zeit, die ihm blieb, jetzt nicht mehr wie früher zu nichts einbringender literarischer Polemik, sondern suchte sich Fertigkeit in den hier üblichen Holzarbeiten anzueignen. Dadurch konnte er sich noch einen kleinen Nebenverdienst schaffen und wenigstens der dringendsten Noth begegnen, denn sein ärmlicher Gehalt reichte nirgends aus.
Besonders geschickt zeigte er sich bald im Schneiden der Löffel, denen er eine besondere leichte und gefällige Form gab, wo sie sich früher durch ihre Plumpheit ausgezeichnet hatten. Bei Einem der Leute, der eine Drehbank hatte, ging er sogar in die Lehre, und ließ dabei seine Kinder ebenfalls wacker arbeiten, so daß er schon anfing, mit mehr Vertrauen in die Zukunft zu sehen - wie bescheiden waren seine Ansprüche auch geworden!
Das Einzige freilich, was ihm in dem öden, einsamen Nest fehlte, schien ein passender Umgang, ein paar Menschen nur, mit denen eine vernünftige Unterhaltung möglich gewesen wäre. Aber wen hatte er dazu hier in Holzhäusel und besonders in den langen Wintern, wo hohe Schneewände die Kuppe umgaben, auf welcher das Dorf lag, und selbst die Post manchmal Schwierigkeit hatte, sich hindurch zu schaufeln? Den Herrn Pastor? Auf den Dörfern halten sich eigentlich die Pastoren sehr fern von den Schulmeistern, um ihrer Würde nichts zu vergeben, aber der Pastor in Holzhäusel war ein lieber und einfacher Mann und verkehrte mit allen Leuten freundlich. Leider aber plagte ihn ein rheumatisches Leiden - er konnte das rauhe Klima nicht vertragen, und dazu hatte sich auch noch Schwerhörigkeit gesellt, die eine Unterhaltung unmöglich machte. Der schon ältliche Herr schien auch schon verschiedene Eingaben gemacht zu haben, um von hier auf etwas wärmeren Boden versetzt zu werden, doch umsonst. Er saß eben so gut wie der Schulmeister hier in seiner „Strafcolonie" - und es geschah ihm recht. Weshalb erzählte er auch den frommen Christen offen von der Kanzel, daß cs gar keinen Teufel gäbe und derselbe nur eigentlich bildlich zu verstehen sei! Was wußte er davon?
Da blieb dem armen Schulmeister dann nur noch der /7/ Chaussee-Einnehmer, ein früherer Schreiber, und das war ein doppelter Segen in dieser Wildniß, denn er besaß für Holzhäusel einen ordentlichen Schatz, nämlich eine kleine Bibliothek. Zwar bestand diese nur aus circa vierzig Bänden - noch dazu lauter Räuberromane von Spieß und Cramer, und war von dem jetzigen Eigenthümer einmal auf einer Auction für einen Thaler zehn Neugroschen erstanden worden - aber was liest ein Mensch nicht, wenn er allein in einer Wüste sitzt. Selbst in einem solchen Räuberroman kam doch manchmal ein Gedanke vor, und dem haschte der Schulmeister nach - erst durch alle vierzig Bände durch, und dann wieder den nämlichen Weg zurück.
Der Chaussee-Einnehmer war ein kleines lebendiges Männchen, immer vergnügt, immer gefällig, und wurde besonders im Haus des Schulmeisters, wenn er sich einmal sehen ließ, von den Kindern mit Jubel empfangen. Vermittelte er doch auch, durch Fuhrleute und Boten, mit denen er in unmittelbare Berührung kam, den Verkehr mit der Außenwelt, mit der nächsten Stadt, und wußte besonders dort eine Quelle, wo man die beste Cichorie und den billigsten Zucker bekam, ja verschaffte sogar dem Herrn Pastor und zu Zeiten auch dem Schulmeister am Sonntag Morgen frische Semmeln aus dem nächsten - allerdings eine volle deutsche Meile entlegenen Bäckerladen.
Sein Hauptverdienst in den Augen des Schulmeisters war aber seine liberale Gesinnung. Trotzdem, daß er als königlicher Diener seine Stellung verwaltete (er ist kürzlich gestorben oder ich würde ihn nicht denunciren), blieb er ein Demokrat vom reinsten Wasser. Er liebte allerdings seinen Landesvater und dachte an keine Republik - wo jedenfalls auch die Chaussee-Einnehmerstellen abgeschafft wären - aber er sprach von der gerade bestehenden Regierung oft in Ausdrücken - allerdings nur unter vier Augen mit dem Schulmeister - daß ihm jeder wohlgesinnte Staatsanwalt hätte den schönsten Criminalproceß auf den Hals laden können.
„Wenn ich König wäre," sagte er oft und schlug dabei auf das Fensterbrett, daß die Scheiben klirrten, „ich wollte es den Blutigeln zeigen, was es heißt, meinem armen Volke das Mark aus den Knochen ziehen - viertausend Thaler /8/Gehalt für einen Minister? - nicht vierhundert Thaler kriegten sie; aber die kleinen Beamten, die sich ihr ganzes Leben lang schinden und plagen müssen - und für was? denen wollte ich auf die Beine helfen - und Ihr Schulmeister - Ihr solltet einmal sehen, was ich aus Euch Schulmeistern machte - die Minister selber sollten den Hut vor Euch abziehen, denn Ihr seid die eigentlichen Träger des Volkes, und wo kämen denn überhaupt die Minister her, wenn sie keine Schulmeister gehabt hätten, die ihnen das erste A-B-C und später das X und U beigebracht?"
Der kleine Chaussee-Einnehmer war sonst ein ganz vernünftiger Mann, aber wenn er auf Politik zu sprechen kam, ging sein Verstand mit ihm durch und zahlte nirgends Chausseegeld mehr. Auch hatte er dabei die üble Gewohnheit, seine Rede nur zu häufig mit dem Ausruf zu bekräftigen: „Hol' mich der Deubel!" und Andreas hatte ihm das auch schon einigemal in seiner freundlichen Art verwiesen. Der Chaussee-Einnehmer lachte daun aber jedesmal und meinte: das sei der harmloseste Schwur von allen miteinander, denn da es gar keinen Teufel gäbe, könne ihn auch keiner holen, und dabei klänge er kräftig und mache dem Herzen Luft.
So einverstanden nun Andreas auch fast immer mit den politischen Ansichten seines Freundes sein mochte, obgleich er doch einer etwas mehr gemäßigten Partei angehörte, so schien er über diese Sache seine Bedenken zu haben, da er im flachen Lande zu lange Jahre bei einem streng orthodoxen Geistlichen Küsterdienste versehen hatte. Bei jenem frommen Mann aber war auf der Kanzel der Teufel immer das dritte Wort gewesen, ja er hielt ganze Predigten über ihn und sprach dabei mit einer solchen Ueberzeugung und Wärme, daß Andreas zuletzt selber zweifelhaft wurde und sich, wenn er nicht seiner Meinung entschieden beitrat, jedenfalls neutral verhielt. Es konnte einen Teufel geben - es konnte keinen geben - wer wußte es, wer hatte ihn schon gesehen, und er würde deshalb nie selber solche leichtfertige Worte gebraucht haben, wie sie so oft aus dem Munde des Chaussee-Einnehmers kamen. Doch sprach er sich nie deutlicher darüber aus, denn er fürchtete den Spott des kleinen Mannes. /9/ So war der Winter mit seinen riesigen Schneemassen und harten Frösten vorübergegangen und das Frühjahr in's Land gekommen, von dem sie hier oben freilich immer erst durch durchpassirende Fuhrleute Kunde bekommen. Hier nämlich lag, wenn unten die Matten schon grünten und blühten, noch hartnäckig der tiefe Schnee, und die ersten Frühlingsboten waren stets die Blumen, welche die Fuhrleute unten im Thale gepflückt und auf die Hüte gesteckt hatten. Dem Chaussee-Einnehmer brachten sie dann auch manchmal einen Strauß von goldgelben Himmelsschlüsseln mit, die er in einem Wasserglas an sein Fenster stellte und sich dann noch Wochen lang auf den nahenden Lenz freute.
Und auch der kam endlich - hier und da fing schon die Sonne an, von den ihren Strahlen am meisten ausgesetzten Rasenflccken den Schnee wegzuthauen. Mit wildem Poltern schurrten große Lawinen vom steilen Schindeldach der Kirche nieder - Finken und Rotschwänzchen ließen sich sehen, und die Buchenknospen quollen dick und glänzend auf. Und Blumen kamen, Schneeglöckchen und Primeln - auch aus dem Wald zog sich die Schneedecke weiter und weiter in Ravinen und Einschnitte zurück, und endlich, endlich brach er aus in grünen Blättern und Blüthen und lag so wundervoll auf dem herrlichen Walde, daß es eine wahre Lust und Freude war.
Jetzt durften die Holzhäusler Bewohner auch wieder ihre Arbeiten draußen vornehmen, und besonders hatte Andreas schon lange auf die Zeit gewartet, wo er einen im vorigen Herbst gekauften und geschlagenen Baum, der aber den Winter durch tief im Schnee gelegen, in Angriff nehmen und die einzelnen Stücke in sein Haus führen konnte. Freilich mußte er sich die Zeit dazu förmlich abstehlen, denn unter der Hand hatten sie Nachricht bekommen, daß in ganz kurzer Zeit eine Schulvisitation zu Holzhäusel stattfinden solle. Der Kinderschaar mußte bis dahin noch eine unverhältnißmäßige Quantität von Wissen eingeprügelt werden, damit sie nicht mit Schimpf und Schande beständen und Andreas den gestrengen Herren einen schlechten Begriff von seiner Zucht beibrachte. Aber die Arbeit im Wald war ihm, nach dem langen Aufenthalt in der dunstigen Schulstube, fast mehr eine Erholung als eine Beschwerde, und er /10/ kam oft erst bei eingesetzter Nacht nach Hause zurück. Ja einmal, Sonnabends, als der Vollmond hell am Himmel stand, ging er sogar nach dem Abendbrod nochmals hinaus, um einen der Blöcke, den er zu einer besondern Arbeit brauchte, fertig zu behauen und so aufzuspalten, daß er die einzelnen Stücke auf seiner Schulter zum Hause tragen konnte.
Es war eine wunderbar schöne Nacht; kein Lüftchen regte sich; drinnen im Busch klagte die Nachtschwalbe, und in einem kleinen Forellenteich in der Nähe quakten die Frösche; sonst unterbrach kein Laut die fast todtenähnliche Stille. Aber hell und klar stand der Vollmond an dem mit mattfunkelnden Sternen besäeten Himmel und warf die riesigen Schatten der Waldbäume auf eine kleine Lichtung, in welcher der von Andreas gefällte Baum lag.
Thau war gefallen, und wie das im Mondenlicht spielte und glitzerte, wenn sich die Strahlen in den Milliarden Tropfen brachen, und wie das duftete von Harz und Waldmoos! Dem armen Schulmeisterlein ging das Herz ordentlich auf, denn hier genoß er etwas, was jetzt der reichste Städter, ja kein König mit ihm theilen konnte, das vollste, reinste Entzücken an dem Zauber dieser herrlichen Natur - und stille Einsamkeit und Ruhe in dieser Waldeseinsamkeit.
Er legte sich erst eine ganze Weile auf das weiche, schwellende Moos, um den würzigen Duft mit vollen Zügen einzuathmen, und schaute dabei zu, wie der Mond so majestätisch dort am Himmel schwebte und einzelne kleine durchsichtige Wolkenschleier wie Schatten daran vorüberflogen. Aber lange durfte er sich diesem Genuß doch nicht hingeben, denn er kam sonst zu spät nach Hause, und seine Elise ängstigte sich nachher vielleicht über sein Ausbleiben. Rüstig ging er deshalb an die Arbeit, und so warm war es dabei hier oben schon geworden, daß er sogar seinen Rock ausziehen mußte, um sich nicht zu heiß zu machen.
„Eigentlich ist es doch ein ganz sonderbares Gefühl," murmelte er, als er sich, um einen Moment zu ruhen, auf seine Axt stützte und den Blick dabei über die mondglänzende Lichtung warf, „so bei Mondschein im Wald zu arbeiten. Wie dumpf hallen die Schläge, und wie das dabei zischelt und flüstert im Wald - wenn Einer furchtsam wäre, könnt's ihn /11/ wahrhaftig ordentlich gruseln. Am Tag ist das freilich 'was Anderes. Da sieht man doch da und dort einen Vogel und hört sie in den Büschen drin zwitschern; auch vom Dorf dringt manchmal das Krähen eines Hahnes oder das Jubeln einer Kinderstimme herüber. Jetzt ist Alles wie ausgestorben, und man kommt sich fast so vor, als ob man allein auf der Welt übrig geblieben wäre und nun an seinem eigenen Sarge hämmerte. Aber jetzt bin ich ja auch gleich fertig und spare dafür morgen den Weg in der Sonnenhitze, statt dessen ich meine doch nur so kurze Mittagsruhe halten kann - den Klotz nehme ich heut Abend mit, und das Andere können mir die Jungen den Montag nach der Schule in dem kleinen Wägelchen in's Dorf fahren, das schadet ihnen nichts, und die Bewegung ist nur gesund."
Wieder arbeitete er eine Zeit lang und fing dabei schon an müde zu werden, denn seine Arme waren den scharfen Dienst nicht gewohnt, aber er hatte sich einmal vorgenommen, den alten Klotz zum Gebrauch fertig zu behauen, und ließ deshalb auch nicht nach. Nur wenn er einmal ruhen mußte, warf er sich einen Augenblick auf das Moos nieder.
So hatte er eben auch wieder eine Pause gemacht und schaute nach dem Mond hinauf, um danach die Zeit zu wissen. Alle Wetter, es war in der That spät geworden und mußte schon lange elf Uhr vorüber sein. Wie leicht sich das aber auch in der frischen Nacht arbeitete, viel besser als an einem warmen Tage, und viel schneller auch. Aber jetzt mußte er wirklich nach Hause - nur noch die letzte Seite wollte er zuhauen - er hatte ihn sich schon zurecht gestellt, und unwillkürlich warf er den Blick nach der Stelle, wo er lag, fuhr aber auch in demselben Moment erschreckt in die Höhe, denn - er war nicht mehr allein.
Wo, um Gottes willen, kam denn der Mensch auf einmal her? Er hatte doch keine Seele kommen sehen, und auf dem mondbeschienenen Plan wäre das ja nicht anders möglich gewesen. Jetzt aber saß auf seinem eigenen Holz ein anständig gekleideter Herr, der fast selber wie ein Schulmeister aussah, mit einer solchen Ruhe, als ob er da schon eine Stunde verbracht und ihm zugesehen hätte. /12/ Im ersten Moment glaubte er, das Licht des Mondes täusche ihn nur, und was er da vor sich sähe, sei weiter nichts als der wunderlich gestaltete Schatten eines Baumwipfels, der gerade auf die Stelle fiele. Aber ein Blick nach dem Mond selber überzeugte ihn, daß das nicht möglich sein könne, denn dieser stand jetzt hoch am Himmel, und die Schatten der Bäume reichten gar nicht bis dorthin. Ueber die Wirklichkeit der Gestalt sollte er aber auch außerdem nicht lange in Zweifel bleiben, denn ehe er sich nur noch recht gesammelt hatte, sagte diese freundlich:
„Guten Abend, Andreas. Noch so fleißig?"
Der Schulmeister wußte wirklich nicht, wie ihm geschah. Jetzt, da er scharf hinblickte, konnte er selbst die Züge des Fremden deutlich erkennen, aber er erinnerte sich nicht, ihm je begegnet zu sein, und trotzdem redete ihn dieser mit seinem Namen an und hatte außerdem ein Antlitz, das man, wenn einmal gesehen, wohl schwerlich wieder vergessen konnte.
Es war eine schlanke, edle Gestalt, schwarz, aber sehr sauber gekleidet, besonders mit schneeweißer Wäsche - etwas sehr Ungewöhnliches in Holzhäusel an einem Sonnabend Abend. Sein Gesicht schien allerdings bleich - wozu vielleicht auch das Mondlicht beitragen mochte, aber er hatte große, sprechende Augen und feingeschnittene Lippen, und ein weicher, pechschwarzer Bart kräuste sich leicht um sein Kinn.
„Guten Abend, mein Herr," sagte der Schulmeister ganz verdutzt, indem er den Fremden so starr ansah, daß dieser ein leichtes Lächeln kaum unterdrücken konnte - „aber wo kommen Sie denn auf einmal her, woher kennen Sie mich?"
„Ach, mein lieber Herr Pech," sagte dieser aber freundlich, „ich kenne Sie schon seit lange, und habe Ihnen oft mit Vergnügen zugehört, wenn sie sich Abends mit Bellermeier, dem Chaussee-Einnehmer, unterhielten."
„Da haben Sie zugehört?" rief Andreas, die Augen weit aufreißend - „wie ist denn das möglich?"
„Ja ja," lachte der junge fremde Herr herzlich vor sich hin. „Bellermeier ist ein komischer Kauz, und wie oft schon hat er mich eingeladen, ihn zu holen."
„Sie hat er eingeladen, ihn zu holen?" rief Andreas, /13/ wirklich erschreckt, indem er in die Höhe sprang. „Ja, um Gottes willen, wer sind Sie denn eigentlich?"
„Bitte, lieber Herr Pech," sagte der fremde Herr aber ganz ruhig, indem er ihm mit der Hand winkte, - „behalten Sie Platz und erschrecken Sie nicht. Sie haben nicht den geringsten Grund dafür. Ich bin blos der Teufel."
„Der Teufel?" sagte Andreas und sank wirklich auf seinen Sitz zurück, fühlte aber auch, wie ihm das Herz ängstlich an zu klopfen fing - er mußte todtenblaß geworden sein.
„Aber, bester Herr Pech," sagte der Teufel, „was schneiden Sie denn für ein trostloses Gesicht. Sie fürchten sich doch nicht vor mir? Das wäre ja rein kindisch und ist gegenwärtig ein vollkommen überwundener Standpunkt. Ich thue Ihnen nichts, und einzig und allein Ihre späte Beschäftigung hat mich angezogen."
„Meine Beschäftigung?" sagte Andreas, der sich wirklich schon in etwas von dem ersten Schreck erholt hatte, wenn er auch ein leises Grausen über diese Begegnung nicht unterdrücken konnte.
„Ja," nickte der Teufel leise vor sich hin - „Ihre Arbeit im Mondenschein. In früheren Jahrhunderten hatte ich über alle Die Gewalt, die im Mondenschein arbeiteten, denn das Mondenlicht ist mein specielles Eigenthum. Mit den vielen Neuerungen der jetzigen Aera ist aber auch das nun abgelöst, und ich habe nur noch mein Vergnügen daran, den Leuten zuzuschauen, die meinen Mondenschein benutzen."
„Aber ich habe gar nicht gewußt, daß das Sünde wäre.'" sagte der arme Schulmeister ganz bestürzt.
„Sünde?" sagte der Teufel, die Achseln zuckend; „lieber Gott, was ist eigentlich Sünde! Wir haben es da mit einem sehr weiten Begriff zu thun. Todtschlag ist Sünde, nicht wahr? Aber ich kenne eine Menge von Beispielen, wo die frommen Geistlichen selbst auf den Kanzeln dem lieben Gott danken, wenn recht viele Menschen todtgeschlagen sind und die zuckenden Leichen noch draußen auf dem Schlachtfeld liegen. Sünde! Diebstahl ist Sünde, und wer stiehlt in unserer Zeit nicht - und wenn es nur den guten Ruf seines Mitmenschen wäre. Wir könnten auf die Art die ganzen zehn Gebote durchnehmen." /14/ Andreas schüttelte mit dem Kopf; er war jetzt, während der Fremde sprach, ruhiger geworden und fing an, sich die Sache zu überlegen. Das sollte der Teufel sein? Ein Herr in einem schwarzen Frack und mit einem Cylinderhut auf? Unsinn! Wenn er auch noch nicht recht begriff, wie er hierher gekommen sein konnte, ohne daß er ihn bemerkt hätte, so ließ sich doch nichts Anderes denken, als daß es irgend ein Fremder wäre, der sich hier im Wald verirrt haben mußte. Natürlich war er dann durch die weitschallenden Schläge seiner Art dieser Richtung zugezogen worden, und da er unbemerkt herankam, wollte er sich jetzt einen Spaß mit ihm machen und sich für den „Gottseibeiuns" selber ausgeben.
Erstlich war Andreas, wie schon früher erwähnt, noch lange nicht mit sich einig, ob es wirklich nur überhaupt einen Teufel gäbe, und wenn in der That, so sah der doch jedenfalls anders aus als ein vornehmer Stadtherr, der mit Glanzstiefeln im Wald herumläuft und Glacehandschuhe trägt. Mit dem Verdacht wuchs aber auch wieder sein Muth - wie man ihn überhaupt nicht furchtsam nennen konnte - und er fing an, sich die Sache von der humoristischen Seite zu betrachten.
Der Fremde hatte in der Zeit sehr ruhig seine Cigarrentasche herausgeholt und sich eine Cigarre genommen.
„Rauchen Sie, Herr Pech?" frug er freundlich - wo in aller Welt hatte er nur seinen Namen wegbekommen – indem er ihm die Tasche hinhielt.
„Bitte," sagte dieser, „wenn Sie erlauben - eine gute Cigarre bekommt man hier in der Gegend selten."
„Diese sind ächt," sagte der Fremde, „ich habe sie selber von Havanna mitgebracht."
„Waren Sie in Amerika?" rief Andreas, der eigentlich keine weitere Sehnsucht kannte als Amerika, es aber etwa ebenso betrachtete, wie den Mond oder einen andern Planeten, nach dem man sich wohl hinwünschen, den man aber auch nie erreichen könne.
„Allerdings," lächelte der Fremde, „ich habe dort viel zu thun."
„Wirklich?" sagte Andreas, und hatte dabei seinen Stahl /15/ und Schwamm aus der Tasche genommen, um Feuer zu schlagen, als der Fremde seinen linken Handschuh auszog, den Finger an seine Cigarre hielt und diese dadurch augenblicklich in Brand brachte. Dann reichte er sie artig dem Schulmeister, der die seinige verdutzt daran anzündete. Wo hatte der fremde Mensch so schnell Feuer herbekommen? - aus dem Finger? Das war ja doch rein unmöglich. Der fremde Herr aber zog seinen Handschuh wieder an und blies den Rauch in kleinen kurzen Wölkchen in das Mondenlicht hinein. „Was zum Henker," dachte aber Andreas, „Du fragst ihn einmal, wo er herkommt und wohin er will, denn aus Stunden weit ist ja kein anderes Dorf in der Nachbarschaft. Rede muß er doch stehen!"
„Sie entschuldigen," sagte er deshalb laut und genoß dabei in langsamen Zügen seine eigene Cigarre, denn so ein Blatt hatte er in seinem ganzen Leben nicht geraucht. „Woher kommen Sie denn eigentlich heute?"
„Heute?" sagte der Fremde, „oh, nicht weit, blos von Petersburg, wo ich etwas zu besorgen hatte, und nur, wie ich eben über den Wald flog und Sie hier unten im Mondenlicht arbeiten sah, bin ich einen Augenblick heruntergekommen, um ein bischen mit Ihnen zu plaudern."
„Ueber den Wald fliegen?" lächelte Andreas still vor sich hin, denn er war jetzt fest überzeugt, daß sich der fremde Herr einen Spaß mit ihm machen wolle - „so! und nachher fliegen Sie auch wohl wieder fort?"
„Es wird mir wohl nichts Anderes übrig bleiben," nickte freundlich der Fremde, „denn was soll ich in Holzhäusel machen? Etwa den Chaussee-Einnehmer holen? Das wäre wirklich nicht der Mühe werth, denn der kommt mir schon mit der Zeit von selber - und wenn er nicht kommt, ist's auch kein Unglück."
Den Schulmeister überlief‘s wieder. Der Fremde sprach so zuversichtlich, und erst jetzt fiel ihm eine merkwürdige Eigenschaft an seinem unheimlichen Besuch auf, denn einmal war es ihm, als ob er durch den dunkeln Frack hin die dahinter liegenden Umrisse des Holzes erkennen könne, und dann - beim Himmel, der fremde Mensch warf gar keinen Schatten!
„Lasten Sie Ihre Cigarre nicht ausgehen," sagte aber /16/ der Teufel freundlich - denn daß er es sei, daran konnte der arme Schulmeister jetzt nicht einmal mehr zweifeln, „sie schmeckt nachher nicht mehr so gut, wenn sie erst einmal kalt geworden ist. Wie geht es denn eigentlich Ihrer Familie?"
„Oh, ich danke - recht gut," stammelte Andreas, dem es jetzt eiskalt durch die Glieder zog - „aber wie - wie um Gottes willen ist mir denn? Sie können doch nicht wahr und wahrhaftig -"
„Der Teufel sein?" lächelte dieser, „und weshalb nicht, Herr Pech? Weil ich anständig gekleidet gehe? Wollen Sie sich einmal ein Bild Ihrer Altvorderen betrachten, einen jener urkräftigen Cherusker oder wie die Herren hießen, mit einem Bärenfell-Mantel, große Büffelhörner als Helm auf dem Kopfe und mit bloßen Beinen - laufen aber die Deutschen jetzt noch so in der Welt herum? - Nein, sie haben sich civilisirt, und ich sehe wirklich nicht ein, weshalb ich da allein eine Ausnahme machen sollte. Wo könnte ich mich jetzt wohl noch anständiger Weise mit Schweif und Pferdefuß sehen lassen, und ein oft so nöthiges Incognito wäre ganz unmöglich."
„Wunderbar," stöhnte der Schulmeister, der durch die gemüthliche Plauderweise des Schrecklichen aber auch wieder Muth zu fassen begann. Dabei fiel ihm aber sein Herr Pfarrer ein - wenn er dem dies Begegniß erzählte, der glaubte kein Wort davon - und Bellermeier erst, der hätte ihn gerade ausgelacht, und er wäre am Ende noch in den höchst ungerechten Verdacht gekommen, ein Glas Bier über den Durst getrunken zu haben. Gütiger Himmel! es warf ihm nicht einmal eins für den Durst ab, und er war so nüchtern wie eine junge Katze.
„Lieber Freund," sagte der Teufel aber ruhig, „es giebt sehr viel Wunderbares auf der Welt - viel mehr, als sich die Menschen gewöhnlich träumen lassen. Manchmal sehen sie's nur nicht; manchmal aber wollen sie es auch nicht sehen, und der Teufel geht oft mitten unter ihnen herum, ohne daß sie ihn bemerken."
„Aber früher," sagte Andreas schüchtern, „hatte man doch immer so viel Angst, daß er Einen holte (er sprach noch /17/ immer von dem Gefürchteten in dritter Person, denn er getraute es sich nicht, ihn selber anzureden), und jetzt hört man eigentlich gar nichts mehr davon."
„Das ist sehr natürlich," versicherte der unheimliche Fremde. „Früher, als ich noch absoluter Monarch in der Hölle war, durfte ich machen, was ich wollte, und machte mir deshalb manchmal einen Spaß; denn daß mir an einer lumpigen Seele nicht viel liegt, können Sie sich denken, Herr Pech. Jetzt aber, seit wir eine Constitution haben -"
„Eine Constitution?" platzte der Schulmeister erstaunt heraus.
„Versteht sich - seit 48, wo auch hier oben Alles drunter und drüber ging. Ich hatte damals hier alle Hände voll zu thun und ließ deshalb leichtsinniger Weise mein eigenes Reich etwas außer Acht. Die Folge blieb nicht aus. Als ich zurückkehrte, brachten sie mir gleich den ersten Abend eine Katzenmusik, meiner eigenen Großmutter warfen sie die Fenster ein und schickten mir nachher eine Deputation auf den Hals, mit welcher ich die weiteren Bedingungen meiner Regierung besprechen mußte. Was wollte ich machen? Ich war noch froh, daß sie - dumm genug - nicht mehr verlangten, und bewilligte Alles."
„Und jetzt holen Sie Niemanden mehr?" frug Andreas, der schon dreister wurde, je länger die Unterhaltung währte, und sich dafür besonders zu interessieren schien.
„Nein," sagte der Teufel, „ich bekomme jedes Jahr mein Deputat geliefert und habe mich sogar nicht einmal mehr um die Verwendung der eingelieferten Seelen zu bekümmern, da das die Arbeitervereine besorgen."
„Man sollte es nicht für möglich halten," sagte staunend der Schulmeister, „selbst in der Hölle haben sie eine Constitution, und hier bei uns -"
„Beruhigen Sie sich darüber," lächelte der Teufel, „sie ist auch danach, aber sie erfüllt immerhin ihren Zweck, denn ich beziehe noch das nämliche Einkommen, und habe dafür weniger zu thun. Sonst hat sich fast gar nichts geändert, nur daß die Sache vielleicht etwas umständlicher geworden ist, als sie früher war." /18/ „Aber Sie erwähnten doch vorhin meinen Freund, den Chaussee-Einnehmer," sagte Andreas schüchtern, „von wegen holen, meine ich."
„Nur ein Scherz," lächelte der Teufel; „wie schon gesagt, befasse ich mich auch damit nur noch ausnahmsweise und in ganz besonderen Fällen - von denen ich Ihnen allerdings einige namhaft machen könnte - es ist aber kein rechtes Leben mehr in der Sache. Ueberhaupt, lieber Freund," setzte er zutraulich hinzu,„kann ich Sie versichern, daß die Welt immer prosaischer wird, und die Menschen behaupten ganz falsch: die Poesie ginge zum Teufel. Es ist nicht wahr und nur eine ihrer gewöhnlichen Uebertreibungen, denn ich habe in letzterer Zeit nichts von ihr gesehen; wir werden immer praktischer wohl, aber wirklich nicht glücklicher dabei. Was für ein wunderbares Vergnügen war das früher, z. B. mit dem wilden Jäger mit Hallo und Rüdengebell durch die Welt zu Hetzen und sich einmal recht tüchtig auszutoben. Sie können sich keine Idee davon machen, wie wohl das that, und man fühlte sich nach einem solchen Ritt um tausend Jahre jünger. Jetzt, nach Einführung der Jagdkarten, ist uns da auch ein Riegel vorgeschoben, denn es gehörte wirklich heidenmäßig viel Geld dazu, um hier in Eurem zersplitterten Deutschland, wo man beinah auf jede Pferdelänge in ein anderes Fürstenthum und Revier kommt, für jedes wieder eine neue Karte zu lösen."
Andreas hörte voller Erstaunen und mit offenem Munde zu, denn er hatte bis jetzt einen ganz andern Begriff von der Macht und den Rechten des Teufels gehabt.
„Ja, aber wie ist mir denn," sagte er endlich ganz verdutzt, „braucht denn der - entschuldigen Sie - braucht denn der Teufel auch eine Jagdkarte, wenn er jagen will? Das hab' ich ja gar nicht gewußt."
„Ihr macht Euch hier oben überhaupt ganz sonderbare Gedanken über uns," sagte der Teufel achselzuckend, „und ich habe Bilder gesehen," fuhr er, still vor sich hin lachend fort, „wo die Hölle als ein einziger lodernder Feuerpfuhl abgebildet war, in dem also eine nur einigermaßen erträgliche Existenz gar nicht möglich wäre. Was würden Sie aber sagen, wenn /19/ ich Ihnen erzähle, daß die ganze Hölle mit Gas erleuchtet ist, Herr Pech?"
„Mit Gas?" rief Andreas verwundert.
„Versteht sich - aber was haben wir dabei gewonnen? Nichts. Früher brannten wir nur fette Sünder, und Sie glauben gar nicht, was oft für komische Scenen dabei vorfielen. Jetzt ist das aber als inhuman verschrieen, und die langweiligen Candelaber stehen nun dort unten Jahrhunderte ein und aus und verbreiten ihr regelmäßiges monotones Licht."
„Petroleum benutzen Sie also nicht?" frug Andreas, der sich schon lange eine solche Lampe gewünscht hatte.
„Nur zum Schmoren," sagte der Teufel gleichmüthig, „aber schon seit vielen tausend Jahren. Es war von jeher unser Hauptbrennmaterial, wenn es die Menschen auch erst vor kurzer Zeit entdeckt haben. Trotzdem nennen sie uns noch immer den „dummen Teufel"."
Andreas schwieg verlegen still, denn er wußte nicht gleich, was er darauf erwidern solle - er mochte doch nicht grob sein, und eine gewöhnliche Schmeichelei schien ihm hier auch nicht am Platze. Dem Teufel hätte er sie doch nicht - noch dazu als christlicher Schulmeister - sagen können. Der Teufel aber, seinem eigenen Gedankengang folgend, fuhr fort:
„Sie hätten freilich Recht, wenn ich dem Bild entspräche, das sie sich von mir entwerfen. Ich soll z. B. die Leute holen, die hier oben recht nichtsnutzige Streiche machen oder gemeine Schurken sind - es ist zu abgeschmackt! Die lasse ich doch gerade am allerliebsten so lange als nur irgend möglich auf Erden herumlaufen, schon des guten Beispiels wegen. Den Beweis für das Gesagte finden Sie auch überall auf der Erde bestätigt. Die guten Menschen sterben weg und die schlechten bleiben; wo sie aber irgendwo in einem Land Jemanden haben, den einzelne Personen, oder den das ganze Volk zum Teufel wünschte, so können Sie sich fest darauf verlassen, daß ich ihn nicht hole, sondern daß der ein ewiges Leben zu haben scheint."
Andreas seufzte und dachte an einen bestimmten Consistorialrath, den er kannte. /20/ „Die laufen mir lange gut," fuhr aber der Teufel fort, „die säen Haß und Erbitterung aus nach Herzenslust, und wenn ihre Zeit einmal um ist, entwischen sie mir doch nicht, wozu also eine so alberne Uebereilung."
„Merkwürdig," sagte Andreas, fast mehr mit sich selber als zu seinem Gesellschafter redend.
„Finden Sie das merkwürdig?" lächelte der Teufel.
„Ach nein - das nicht," seufzte Andreas, „ich kenne selber einige sehr auffallende Beispiele, die das allerdings bestätigen, was Sie eben sagten - nein, ich meine nur, daß Sie, verehrter Herr," er kam etwas in Verlegenheit, wie er den Teufel eigentlich anreden müsse, denn daß er allein keinen Titel habe, ließ sich doch nicht gut denken, - wenn er ihn aber nicht ordentlich titulirte, nahm er es ihm am Ende übel. Wurde doch der sonst so gutmüthige Bellermeier fast böse, wenn man ihn bei seinem eigenen Namen nannte, und man mußte immer „Herr Chaussee-Einnehmer" dazu setzen.
„Nun?" frug der Teufel, der wohl merkte, daß er etwas auf dem Herzen hatte, „womit kann ich dienen?"
„Bitte," sagte Andreas erschreckt, denn daß sich der Teufel so bereitwillig zeigte, ihm mit etwas zu dienen, kam ihm doch bedenklich vor. „Ich - ich wußte nur nicht gleich, wie ich Sie tituliren sollte."
„Mich?" lachte der Teufel laut auf, „das ist himmlisch! Woher vermuthen Sie, daß ich einen Titel habe, Herr Pech?"
„Ja, aber - ohne Titel," sagte der Schulmeister, „es ist doch nicht wohl anzunehmen, daß ein anständiger Mensch - ich wenigstens kenne kein Beispiel -"
„Ohne Titel in der Welt herumlaufe?" ergänzte der Teufel seine Rede, und sein Gesicht glänzte ordentlich vor Vergnügen. „Aber Sie stehen mit Ihrer Meinung nicht vereinzelt da," fuhr er, plötzlich ernster werdend, fort, „denn selbst meine gute und sonst so vernünftige Großmutter hat mich einmal eine lange Zeit gequält, ich sollte mir einen solchen zu verschaffen suchen - was mir bei meinen Connexionen allerdings nicht schwer geworden wäre - und mich „geheimer Commissionsrath" nennen lassen, aber ich habe es trotzdem abgelehnt, denn eine Auszeichnung muß ich doch vor den Menschen /21/ haben und - Verwechselungen waren mir auch vielleicht unangenehm gewesen. Nennen Sie mich deshalb nur, da wir uns doch hier in Deutschland befinden, bei meinem deutschen Namen Teufel - also Herr Teufel, wenn Sie wollen, der mit dem hebräischen Satan gleichbedeutend ist. Alle übrigen Benennungen sind gemeine Schimpfworte, die ich mir allerdings verbitte. Aber Sie wollten mir vorher, als ich Sie unterbrach, noch etwas Anderes mittheilen. Sie fanden etwas, worüber Sie sich noch nicht ausgesprochen haben, merkwürdig."
„Ach ja," sagte Andreas, der sich jetzt besann - „ich meinte nur, es wäre merkwürdig, daß so viele Menschen gar nicht an Sie - der doch jetzt leibhaftig vor mir steht, glauben wollen und Ihre ganze Existenz leugnen."
„Bah," sagte der Teufel verächtlich, „und was bedeutet das? Es giebt ebenso Tausende von Menschen, die selbst einen Gott leugnen, und ändert das etwas im Weltensystem? Früher meintet Ihr, die Erde liege still und die Sonne bewege sich - thaten sie es deshalb wirklich? Nein, die Erde lief ihre vorgeschriebene Bahn fort, und die Sonne stand still, und nur einer späteren Zeit war es vorbehalten zu beweisen, daß sich Josua mit seinen astronomischen Kenntnissen gründlich blamirt habe. Ebenso wird sich aber auch der Teufel die Freiheit nehmen - und nimmt sie sich in der That - auf Erden herum zu gehen, ob nun Einzelne an ihn glauben oder nicht. Meinen besonderen Freunden bin ich doch bekannt und vertraut, und diese verleugnen mich auch nicht. Ich möchte z. B. einmal sehen, was Ihnen geschähe, wenn Sie einer General-Synode erklären wollten: es gäbe keinen Teufel. Ja, selbst die Regierungen nehmen sich meiner an, und als vor einigen Jahren die „Münchener Fliegenden Blätter" einmal ein albernes Spottbild auf mich brachten, erhielten sie ein Rescript der königlich sächsischen Regierung, worin ihnen gedroht wurde, die Blätter im ganzen Königreich polizeilich zu verbieten, wenn sie noch einmal versuchten, „einen Gegenstand der christlichen Verehrung" lächerlich zu machen."
Andreas seufzte nur, denn ähnliche Rescripte und Verwarnungen, die er selber erhalten, gingen ihm im Kopf herum. /22/ „So viel ist sicher," sagte er endlich, „daß es selbst der Teufel besser hat als ein armes Dorfschulmeisterlein, denn wir werden nicht als Gegenstände der Verehrung, sondern als Fußschemel betrachtet, an denen sich Jeder ungestraft die Stiefel abtreten kann, und doch sollen wir eine neue Generation von Menschen heranbilden."
„Bah," sagte der Teufel, „daran seid Ihr selber schuld und dürft Euch deshalb nicht darüber beklagen."
„Wir?" rief Andreas verwundert.
„Ja Ihr - weiter Niemand," nickte der Teufel leise vor sich hin. „Weshalb beschränkt Ihr Euch nicht darauf, die Kinder das zu lehren, was sie allein zu lernen brauchen, um gute Staatsbürger zu werden. Nachher hättet Ihr den Himmel auf Erden und säßet bis über die Ohren in der Wolle."
„Ja aber -" sagte Andreas verdutzt, „was ist denn das eigentlich, und kann denn der Mensch überhaupt je zu viel lernen?"
„Gewiß kann er, mein lieber Herr Pech, gewiß kann er," nickte der Teufel mit einem vergnügten Grinsen, „und er weiß jetzt schon eigentlich viel mehr, als ihm gut ist. Der Katechismus ist die Hauptsache - den muß er vor- und rückwärts auswendig kennen, Bibelsprüche meinetwegen so viel in den Kopf gehen, denn die halten seinen Geist von anderen gefährlichen Dingen ab. Außerdem lesen und schreiben und ein wenig rechnen, und meinetwegen auch ein wenig Geographie des bestimmten Landestheiles nämlich, in dem Ihr gerade lebt, mit vaterländischer Geschichte, d. h. um Gottes willen nicht Schlosser's Weltgeschichte, der viel mehr sagt, als irgend nöthig ist, sondern Erzählungen aus dem Leben der verstorbenen Landesväter, worin deren Tapferkeit, Milde, Weisheit, Güte und Gerechtigkeit dem Schüler zugleich mit dem Bewußtsein eingeprägt wird, daß alle diese Tugenden auf den noch lebenden und gerade regierenden Herrscher übergegangen sind. Außerdem Lateinisch und besonders alte römische Geschichte, in welcher sämmtliche Vorbilder von Freiheit und Republikanismus vollkommen ungefährlich sind, oder vielmehr durch den vortragenden Lehrer ungefährlich gemacht werden /23/ können. Er darf natürlich keine Vergleiche mit damals und jetzt ziehen und muß die Sache mehr als Mythe behandeln - weshalb ich auch besonders altgriechische Mythologie empfehle."
„Aber Naturwissenschaften - Denkübungen."
„Bah, seien Sie nicht kindisch!" sagte der Teufel. „Für Naturwissenschaften genügt einfache Naturgeschichte, worin erzählt wird, daß der Löwe, der König der Thiere, großmüthig, und die Schlange noch vom ersten Sündenfall her verdammt ist, im Staube zu kriechen. Allerdings hat sie auch vorher schon eben so wenig Beine gehabt wie jetzt, aber das schadet nichts. Statt Denkübungen lassen Sie die Kleinen dann ordentlich, besonders recht lange Gedichte auswendig lernen: Die Bürgschaft z. B., den Taucher, den Kampf mit dem Drachen, das Lied vom braven Mann und tausend andere. Das verhindert sie am sichersten, über etwas Selbstständiges nachzudenken und einen eigenen Ideengang zu verfolgen."
„Aber, bester Herr," sagte Andreas halb verzweifelt, „Sie geben mir da Rathschläge, die das junge Volk nicht allein zu Grunde richten, nein, die es zu Dummköpfen machen müssen."
„Reden Sie keinen Unsinn," sagte der Teufel ärgerlich, „von Zugrunderichten ist gar keine Rede; auf die Höhe der Zeit sollen sie gehoben werden. Die Wissenschaft muß umkehren, wenn sie den Weg, den sie gelaufen, überblicken und dadurch zu einer genauen Kenntniß ihrer selbst gelangen will. Apropos - Sie haben in vierzehn Tagen hier Schulvisitation, nicht wahr?"
„Allerdings," sagte Andreas verwundert, „aber woher wissen Sie denn das schon?"
„Weshalb sollte ich es nicht wissen? - Sie wünschen eine bessere Stelle, nicht wahr?"
„Großer Gott," seufzte Andreas, „ich bin Dorfschulmeister in Holzhäusel, und damit ist wohl Alles gesagt."
„Gut, haben Sie Ihre Vorbereitungen dazu getroffen?"
„So viel in meinen Kräften stand, ja," sagte Andreas. „In der Geographie nehme ich jetzt die Vereinigten Staaten von Nordamerika durch, in der Geschichte bin ich bei Joseph II. von Oesterreich." /24/ „Jetzt thun Sie mir den Gefallen," fuhr der Teufel auf - „Sie müssen Ihren Verstand verloren haben! Was wissen die Bauernjungen von Joseph II., was brauchen sie von ihm zu wissen! Gehen Sie gleich Montag früh daran und pauken Sie den Rangen die Geschichte des unglückseligen Franz von Neapel ein und erfüllen Sie ihre kleinen Herzen mit Empörung über die dort verübte Ungerechtigkeit, darauf setzen Sie einige sechzig Sprüche und Psalmen."
„Aber ich darf die Kinder nicht so viel auswendig lernen lassen," warf Andreas ein. „Die Eltern beklagen sich immer, daß ihnen damit zu viel Zeit zur Arbeit verloren geht, und die Leute sind ohnedies so arm."
„Bah, Unsinn, was geht das Sie an?" sagte der Teufel. „Jeder ist sich selbst der Nächste, und ich garantire Ihnen, daß Sie versetzt werden."
„Sie meinen wirklich?"
„Mir dürfen Sie glauben - aber alle Wetter!" unterbrach er sich plötzlich, nach seiner Uhr sehend - „es ist spät geworden und ich muß fort – also, auf Wiedersehen, Herr Pech!"
In dem Augenblick schreckte, dicht hinter Andreas, ein Rehbock, der hier im Mondenschein auf die Lichtung getreten war und natürlich keine Gesellschaft da vermuthen konnte. Er mußte auch ganz dicht herangekommen sein, als er die Witterung von etwas Verdächtigem bekam, und der laute Ton, den diese Thiere in einem solchen Fall gewöhnlich ausstoßen, machte, daß der überdies etwas erregte Schulmeister blitzschnell nach ihm herumfuhr. Das scheue Thier hielt sich aber nicht auf, sondern floh in langen Sätzen über den mondhellen Schlag, um sein schützendes Dickicht zu erreichen. Jetzt tauchte es in die Büsche; als aber Andreas den Kopf wieder seinem Besuch zudrehte, war dieser spurlos verschwunden und ein eigener moderartiger Geruch schien die Luft zu erfüllen. Der Schulmeister bemerkte auch jetzt erst, worauf er früher gar nicht geachtet, daß aus dem tiefer gelegenen Theil der kleinen Lichtung ein feiner, aber feuchter Nebel herausquoll - und wie weit war der Mond schon am Himmel hingerückt! Es mußte wahrhaftig spät geworden sein, und kalt war's auch, /25/ denn es fing an, ihn in Hemdsärmeln zu frösteln. Oder war das vielleicht die Scheu vor seinem unheimlichen Besuch? Er schaute sich vorsichtig nach rechts und links um, ob er die dunkle Gestalt nirgends mehr erkennen könne - aber die Lichtung war leer, und der schreckliche Gast dorthin verweht, woher er gekommen sein mußte - in die Luft.
Den armen Schulmeister fing es jetzt an zu grausen. Wenn er nun noch einmal zurückkehrte und - der Teufel traue dem Teufel! Er zog rasch seinen Rock an, hob sich den fertigen Klotz, den er mitnehmen wollte, auf die Schulter, griff dann mit der andern Hand sein Werkzeug auf und schritt, so rasch ihn seine Füße trugen, der Heimath zu, wo er indessen auch wirklich schon mit schweren Sorgen erwartet wurde.
„Aber, Andreas, um Gottes willen! wo bleibst Du denn nur bis so tief in die Nacht hinein?" rief ihm seine Frau entgegen, die in aller Sorge und Angst noch aufgeblieben, oder vielmehr wieder aufgestanden war - „wie bange ist mir schon um Dich geworden, und wenn ich nur den Weg gewußt, ich wäre selber hinausgelaufen, um Dich zu suchen."
„Aber, liebes Kind," sagte der Mann verlegen, „so spät ist es doch noch gar nicht?"
„So spät nicht?" rief aber die Frau, „schon lange ein Uhr vorbei."
„Hm," sagte Andreas, der in dem Augenblick daran dachte, daß der Teufel gerade um ein Uhr verschwunden sein mußte - „es arbeitete sich heute Nacht so herrlich da draußen, daß ich gar nicht wieder fortkommen konnte und fast meinen ganzen Baum zertheilt habe."
„Und Dich selber machst Du dabei krank und reibst Dich auf - und die feuchte Nachtluft ist doch wahrhaftig auch nicht gesund."
„Die schadet mir nichts," sagte der Schulmeister freundlich, „sorge Dich nur nicht meinethalben. Die scharfe Bewegung in der gesunden Waldesluft hat mir viel mehr genutzt, als wehe gethan. Es ist freilich ein bischen spät geworden - ich wollte eigentlich gar nicht so lange ausbleiben, aber wenn man einmal anfängt, kann man gar nicht wieder aufhören /26/ und noch dazu bei der herrlichen Nacht - ich weiß wirklich nicht, wo die Zeit hingekommen ist."
„So mache nur jetzt wenigstens, daß Du in's Bett kommst," sorgte die Frau - „es ist doch wieder recht frisch geworden. Denke nur, was aus uns werden sollte, wenn Du krank würdest."
Andreas folgte dem Rath, es war ihm überhaupt heute gar nicht mehr darum zu thun, viel zu sprechen, wo er so viel zu denken hatte, und er lag auch noch lange, lange Zeit in seinem Bett, über das Erlebte nachgrübelnd, bis ihm endlich selber die Augen zufielen. - Aber wie sonderbar war ihm erst am nächsten Morgen zu Muthe, als ihm die gestrige Erscheinung wieder einfiel und jetzt mehr wie ein wüster Traum, wie als etwas wirklich Gesehenes vorkam.
Es war Sonntag, und er mußte früh in die Kirche, um sich an die Glocke zu hängen und damit den frommen Christen ein Zeichen zu geben, daß sie sich ein wenig rasch rasirten und in ihren Sonntagsstaat würfen, da die Predigt bald beginne. Aber an was dachte er dabei? Es schauderte ihm selber, wenn er sich dessen klar wurde, und er suchte die Gedanken gewaltsam von sich abzuschütteln - wenn ihm das nur möglich gewesen wäre.
An dem Nachmittag ging er zum Chaussee-Einnehmer hinaus, um sich mit diesem ein wenig zu unterhalten. Er fühlte das dringende Bedürfniß sich mitzutheilen, und wagte cs trotzdem nicht; denn durfte er hoffen, gerade bei Bellermeier, der immer gern für einen Freigeist gelten wollte, Glauben zu finden? Es war nicht denkbar. Dadurch fühlte er sich niedergedrückt, und dem kleinen Chaussee-Einnehmer konnte es nicht lange verborgen bleiben, daß dem Schulmeister etwas auf der Seele liege. Seiner Meinung nach konnte das aber natürlich nichts Anderes sein, als die bevorstehende Schulinspection.
„Hört einmal, Schulmeister," rief er endlich, „das ist langweilig, Ihr nehmt Euch die Sache viel zu sehr zu Herzen. Ob die Schwarzröcke einmal die Nase in Eure Schulstube stecken oder nicht, was kümmert das Euch hier in Holzhäusel? Höher versetzt könnt Ihr nicht mehr werden, /27/ Ihr schneidet aber, hol' mich der Deubel, ein Gesicht, als ob Ihr schon heute auf der Armesünderbank säßet."
„Lieber Herr Chaussee-Einnehmer," bat Andreas freundlich, „thun Sie mir den einzigen Gefallen und sagen Sie nicht immer: „hol' mich der Teufel" - es ist - man weiß doch nicht - und noch dazu an einem Sonntag."
„Nanu!" lachte aber der kleine Mann gerade heraus und sah den Schulmeister ordentlich erstaunt an. „Was ist Ihnen denn heute in die Perrücke gefahren, Schulmeister, denn der Sonntag hat Sie doch sonst eben nicht genirt? Weshalb soll ich nicht sagen: hol' mich der Deubel?"
„Es ist doch eigentlich Gotteslästerung."
„Wenn ich sage, hol' mich der Deubel? Hehehehehe, Sie sind wirklich göttlich! Was hat denn der liebe Gott mit dem Deubel zu thun? Hören Sie, hören Sie, Schulmeister, Sie arbeiten sich doch nicht etwa auf den Mucker los? Dann sind wir wenigstens die längste Zeit Freunde gewesen, was mir hier, in dem verbrannten Nest, unendlich leid thun sollte."
„Mein lieber Herr Chaussee-Einnehmer," sagte Pech, „man braucht noch kein Mucker zu sein, um an solchen gefährlichen Worten keine Freude zu finden -"
„Gefährlichen Worten!" lachte aber Bellermeier wieder, „lieber Herr Schulmeister, nehmen Sie mir's nicht übel, aber ich vermuthe fast, es muß bei Ihnen irgendwo im Gehirnkasten eine Schraube losgegangen sein."
Andreas hatte es auf der Zunge, dem kleinen Mann sein gestriges Abenteuer zu erzählen, aber er fühlte auch recht gut, daß er nur Spott und Hohn dafür einernten würde. Er war dadurch niedergeschlagen, die Unterhaltung wollte nicht recht fließen, und er ging auch bald wieder nach Hause, um sich auf seine morgende Schule vorzubereiten. Aber der Kopf wirbelte ihm, denn drinnen herum gingen ihm die Rathschläge, welche ihm die Erscheinung gestern Nacht gegeben, und wenn er sich auch wieder und wieder vorhielt, von wem sie eigentlich kamen, so fühlte er doch auch - ja er wußte genau, daß der Fremde Recht gehabt, ja daß er nur das mit deutlichen, klaren Worten ausgesprochen habe, was er selber schon lange mit sich herumgetragen. /28/ Wie war es anderen Lehrern gegangen, die vielleicht nicht einmal so fleißig studirt hatten, wie er selber. Der eine, ein Schulkamerad von ihm, war mit einem enormen Gehalt Director eines Gymnasiums geworden, trug zwei oder drei Orden im Knopfloch und die Nase wer weiß wie hoch. Ein anderer stand sich als Rector in - ebenfalls außerordentlich gut; mehrere Andere aber, die sich dem Lehrerfach gewidmet, lebten wenigstens in erträglichen Verhältnissen - nicht am Ende der Welt in Holzhäusel. Und woher kam das? - weil sie nie versucht hatten, gegen den Strom zu schwimmen, sondern immer langsam und behaglich darauf hingeglitten waren. Die kamen deshalb auch an's Ziel, er aber hielt sich unterwegs nicht allein unnöthiger Weise auf, sondern rückte auch nicht einmal vom Fleck - ja, je mehr er arbeitete und Widerstand leistete, in immer gefährlichere Wirbel gerieth er hinein, und ein solcher Wirbel hatte ihn hier nach Holzhäusel hinauf getrieben. War es denn wirklich gar nicht möglich, wieder in günstigeres Fahrwasser zurück zu kommen? Es mußte wenigstens versucht werden.
Noch nie war er so fleißig in der Schule gewesen, als in der hierauf folgenden Woche, und die Kinder erschraken nicht wenig über die ihnen plötzlich aufgebürdete Arbeitslast. Wo hatte er früher daran gedacht, so viel auswendig lernen zu lassen! Er unterhielt sich gewöhnlich mit ihnen und brachte irgend ein Thema vor, über das ihm jedes Kind seine Meinung sagen mußte, ja er ließ sie sogar untereinander darüber debattiren und hatte es dadurch wirklich so weit gebracht, daß es wohl kein aufgeweckteres kleines Volk im ganzen Gebirge gab, als seine Schüler. Jetzt plötzlich überraschte er sie mit einer andern Methode, auf die sie allerdings nicht vorbereitet waren, und die noch weniger ihren Eltern in den Kopf wollte. Sonst, wenn sie aus der Schule nach Haus gekommen, gingen sie gewöhnlich an ihre Arbeit und plauderten dabei fröhlich über das Gehörte weiter, jetzt aber hockten sie in den Ecken, kratzten sich die krausen Köpfe und lasen laut und ängstlich vor sich hin.
Die Eltern thaten auch Einspruch und liefen dem Schulmeister fast das Haus ein: er solle ihren Kindern nicht so /29/ viel aufgeben, denn sie behielten keinen Augenblick Zeit für sich selber und müßten ja doch mithelfen, das spärliche Brod zu verdienen. - Es half ihnen nichts. Andreas Pech bat sie, nur ein paar Wochen Geduld zu haben, nachher sollte schon Alles wieder besser werden, jetzt könne er ihnen aber nicht helfen, die Kinder müßten lernen, was er ihnen aufgegeben, und thäten sie es nicht, setzte er als versteckte Drohung hinzu, so könne es leicht kommen, daß die Schulcommisston den Unterricht nicht für genügend halte und ihnen noch täglich eine Stunde zulege. Wie das aber erst störend für sie sein würde, wüßten sie besser, als er es ihnen sagen könnte.
Das half. Die Kinder erhielten jetzt schon mehr Unterricht, als sie, die selber in ihrer Jugend wenig oder gar nichts gelernt, für nöthig glaubten, und nun noch täglich eine Stunde länger der Hausarbeit entzogen, hätte sie am Ende ganz ruiniren müssen. Da doch lieber die vierzehn Tage ertragen und sonst Alles beim Alten gelassen.
Der Herr Pastor war gerade in dieser Zeit recht leidend und konnte sogar den einen Sonntag nicht einmal predigen, wo denn Andreas die aufgeschriebene Predigt an seiner Statt ablesen mußte. Aus dem Haus kam er dabei gar nicht, noch weniger in die Schule. Er ließ nur einmal Andreas zu sich kommen und legte ihm an's Herz, sich ja rechte Mühe mit den Kindern zu geben, damit sie nachher keine Unannehmlichkeiten hätten. Dieser beruhigte ihn aber vollständig darüber und versicherte ihm, er hoffe, daß die Commission Holzhäusel befriedigt verlaßen würde. Er selber habe wenigstens nicht die geringste Furcht.
Damit mußte sich der alte Herr denn auch begnügen, und die Zeit rückte indessen immer näher, in welcher die von den Kindern mit bangem Herzklopfen erwartete Commission erscheinen sollte.
Auch der Tag kam endlich; unaufhaltsam vorwärts rollt ja das ewige Rad, und Morgens um zehn Uhr rollten ebenfalls zwei Chaisen am Chausseehaus vorüber, die Bellermeier schon damit bis auf's Blut ärgerten, daß sie nicht anhielten, sondern ihm nur vom Wagen aus zwei gelbe Freikarten zeigten, die er respectiren mußte.
,,Hol' sie der Deubel!" murmelte er auch vor sich hin in den Bart, als er das rasch aufgerissene Fenster wieder schloß, „es ist doch nur Federvieh, und das zahlt kein Chausseegeld. Jetzt freue Dich, Andreas Pech, jetzt geht Deine Noth an."
Die Herren: der Generalsuperintendent, zwei Confistorialräthe und ein Schulrath, fuhren aber vor der Pfarre vor - denn in dem erbärmlichen Wirthshaus hätten sie doch kein Unterkommen gefunden - und wurden hier von der Frau Pastorin auf das Freundlichste und Gastlichste empfangen. Ein solennes Frühstück mit allen möglichen Kuchenarten zum Dessert, wie auch ein paar Flaschen Rheinwein, prangte schon auf dem Tische, und indessen die Herren das verzehrten, war dem „Schulmeister" aufgegeben worden, seine Kinder zusammen zu trommeln, d. h. sie so rasch als möglich nach Hause zu schicken, damit sie in ihre Sonntagskleider fahren konnten.
Allerdings hatte Andreas genau den Tag, ja die Stunde vorher gewußt, in welcher die ehrwürdigen Herren eintreffen sollten, aber nach stillschweigendem Uebereinkommen wurde - das Frühstück natürlich nicht mit inbegriffen - gar keine weitere Notiz davon genommen und die Ueberraschuug auch glücklich imitirt. Die Prüfung mußte ja aus dem Stegreif stattfinden.
Nach dem Frühstück begann das Examen, und die Kinder hatten bis dahin auch genügende Zeit bekommen, um reine Wäsche anzuziehen und in einem wahren Angstschweiß noch eine Viertelstunde zu versitzen. Endlich nahte der große Augenblick, und der Generalsuperintendent nahm selber die Prüfung ab, an die er allerdings mit sehr ernster Amtsmiene ging und sich, allem Anschein nach, keine besondere Erbauung davon versprach. Was er wenigstens bis dahin von dem Schulmeister in Holzhäusel gehört, schien ihn nicht sonderlich für denselben eingenommen zu haben. Aber sein Gesicht heiterte sich wunderbarer Weise auf, je mehr er darin vorrückte und weitere Fortschritte entdeckte; ja die Kinder überraschten ihn durch ihre Kenntniß zahlloser Sprüche, die er von ihrem späteren Wohlergehen für unzertrennbar hielt. Sein Gesicht verklärte sich aber ordentlich, als sie zur Geschichte übergingen und die Jugend von Holzhäusel plötzlich einstimmig für den /31/ verjagten König von Neapel Partei nahm und ebenfalls den Griechen vollständig das Recht bestritt, ihren König nach eigenem Gefallen zu wählen. Der alte Herr nickte fortwährend freundlich über seine Brille hin.
Auch in der Naturgeschichte waren die Kinder bewandert; sie wußten außerdem genau, wie lange die Welt steht, und wie sie gemacht wurde, und wer die Sünde hineingebracht hatte, und die Prüfung verlief außerordentlich günstig.
Nach derselben drückte aber der Herr Generalsuperintendent dem Dorfschulmeister leibhaftig die Hand - es war noch nicht vorgekommen, so lange Holzhäusel stand - und sagte ihm anerkennende Worte.
„Noch Eins, was ich Sie fragen wollte, Herr Pech," unterbrach er sich dabei, „wie halten Sie es mit den Turnstunden?"
„Ich fürchte, ich bin da nicht Ihrer Meinung, Hochwürden," sagte Andreas achselzuckend.
„Nicht? - wie so?"
„Ich hatte die Kinder früher im Turnen unterrichtet," sagte Andreas, „aber - ich finde, daß es - daß es eigentlich nicht nöthig ist, und hatte die Absicht, es dieses Jahr ganz auszusetzen. Sie haben außerdem Bewegung genug und es zieht ihren Geist doch von - Wichtigerem ab."
„Es könnte sein, mein lieber Herr Pech," nickte der alte Herr freundlich, „daß unsere Meinungen nicht so weit auseinander lägen, als Sie vielleicht zu glauben scheinen. Doch - was ich Sie noch fragen wollte. Wie viel Gehalt beziehen Sie hier?"
„Hundertzwanzig Thaler, Hochwürden," seufzte Andreas leise.
„Und haben Sie Familie?"
„Eine Frau und sechs Kinder."
„Hm - da - da hätten Sie wohl nichts dagegen, wenn sich Ihre Lage verbesserte?" lächelte der alte Herr freundlich.
„Ach, Hochwürden, - wenn das möglich wäre!"
„Nun, versprechen kann ich's nicht, dazu ist mein Einsfluß zu unbedeutend, aber - wir wollen sehen. Es herrscht jetzt ein böser, eigenmächtiger Geist im Lande und leider – wie /32/ ich zu meinem großen Bedauern aussprechen muß - auch unter den Lehrern. Wir brauchen deshalb gutgesinnte Kräfte in unserer Nähe, um uns in dem schweren Werk zu unterstützen. Nun wir wollen sehen, Herr Pech - wir wollen sehen. Es hat mich aufrichtig gefreut, Sie hier in Ihrer Wirksamkeit kennen zu lernen. Ich glaube auch, ich werde im Stande sein, manche Vorurtheile zu widerlegen, die noch Ihretwegen im untern Lande circuliren. Auf Wiedersehen, mein lieber Herr Pech - auf Wiedersehen!"
Andreas ging an dem Tage wie in einem Traum herum, denn der Generalsuperintendent hatte ihm die Hand gegeben und ihn mein lieber Herr Pech genannt. - Natürlich war heute Nachmittag frei, wie hätte er, mit dem vollen Herzen - noch Stunde geben können.
Die Herren waren wieder fortgefahren, und er lief zum Chaussee-Einnehmer hinüber - er mußte Jemanden haben, gegen den er sich aussprechen konnte. Als er aber an der Pfarre vorbeiging, hatte ihn wohl der Herr Pastor vom Fenster aus gesehen und ließ ihn heraufrufen.
Auch dort wartete seiner ein freundlicher Empfang, wenn auch aus anderem Grunde.
„Schulmeister," sagte der alte Pastor, „Sie haben mir einen großen Stein vom Herzen gewälzt, denn ich fürchtete einen bösen Tag, und es scheint Alles vortrefflich abgelaufen zu sein."
„Ich habe mein Möglichstes gethan, Herr Pastor."
„Mehr, lieber Pech, mehr. Das Sprüche-Auswendiglernen ist ein Hauptsteckenpferd des Generalsuperintendenten, und wenn ich eine Ahnung gehabt, daß er selber heraufkommen würde, hätte ich Sie sogar darauf aufmerksam gemacht."
„Ich dachte mir selber, daß die Herren -" stotterte Andreas.
„Den Gedanken hat Ihnen der liebe Gott eingegeben, Pech," unterbrach ihn der Pastor.
„Bitt' um Entschuldigung," fuhr Andreas heraus, hielt aber auch wieder gleich erschrocken inne, denn er durfte doch nicht verrathen, daß gerade das Gegentheil der Fall gewesen. Der Pastor aber, überhaupt schwerhörig, schien zum Glück den Einwurf nicht verstanden zu haben, und zu dem Tisch gehend, /33/ auf dem noch die Weinflaschen standen, schenkte er dem armen Schulmeister, der ein solches Labsal nur schluckweise beim Abendmahl zu kosten bekam, ein ganzes Bierglas bis zum Rand voll und schob es ihm mit den Worten hin:
„Da trinken Sie, Pech - trinken Sie herzlich, und wohl bekomme es Ihnen. Es ist wirklich ächter Affenthaler."
Der Wein ging dem Schulmeister wie Feuer durch die Adern, und als er sich bald nachher bei dem Herrn Pastor verabschiedete, tanzte er ordentlich nach dem Hause des Chaussee- Einnehmers hinüber, wo seiner aber ein nicht so freundlicher Empfang wartete.
„Na," sagte Bellermeier mürrisch, „ist die Schinderei vorüber, und können die armen Würmer jetzt die Bibel auf acht Tage auswendig?"
„Auf acht Tage, lieber Chaussee-Einnehmer? - Ich hoffe, daß -"
„Ach Papperlapapp, bleiben Sie mir mit Ihrem Schnickschnack vom Leibe," rief der kleine Mann, „ich habe Alles gehört; die armen Leute sind in den letzten vierzehn Tagen alle Augenblicke bei mir gewesen, um mir ihre Noth zu klagen. Aber den Schwarzkitteln hat's gefallen, wie? - Hol' sie der Deubel!"
„Lieber Herr Chaussee-Einnehmer," sagte Andreas freundlich, „Sie wissen, wie oft ich Sie schon gebeten habe -"
„Ach was, hol' Sie auch der Deubel!" rief der kleine Mann ärgerlich - „wenn Sie den Mucker herausbeißen wollen, sind wir geschiedene Leute, und ich gründe hier in meiner Burg eine geschlossene Gesellschaft als einziges Mitglied. Pech! Andreas Pech, was treiben Sie denn für Streiche? Muß ich das an Ihnen erleben?"
„Aber ich begreife Sie gar nicht, Herr Chaussee-Einnehmer."
„Reden wir von 'was Anderem," lenkte aber der kleine Mann ein, der sich grundsätzlich nicht ärgern wollte. „Jetzt haben wir wenigstens ein paar Jahre Ruhe, ehe die - Mucker wieder heraufkommen. Verdirbt mir immer meinen ganzen Appetit, wenn ich die feisten Gesichter zu sehen bekomme. Apropos, wie ist Ihnen neulich Ihr Schlaf auf der Waldwiese bekommen?" /34/ „Mein Schlaf auf der Waldwiese?" sagte Andreas erstaunt.
„Na, wie sie neulich bis Nachts um ein Uhr draußen gewesen waren und dann nach Hause gekommen sind und im Schlafe allerhand dummes Zeug geschnackt haben, Ihre Frau hat mir's geklagt."
„Ich habe gar nicht draußen geschlafen," sagte Andreas, „und wenn Sie wüßten, wer mir dort begegnet ist."
„Nanu?" sagte der kleine Mann erstaunt, „doch nicht etwa der Leibhaftige?"
„Sie glauben ja an keinen," sagte Andreas zurückhaltend.
„Ne wirklich?" frug aber der Chaussee-Einnehmer und sah dabei vollkommen ernsthaft aus, aber über sein Gesicht zuckte es wie mit lauter kleinen elektrischen Funken, und jede Muskel desselben schien in Bewegung, ohne aber den Ausdruck irgendwie zu verändern.
„Und wenn ich Ihnen nun sage wirklich?"
Da konnte sich aber Bellermeier nicht länger halten und platzte dermaßen heraus, daß es ihm die Stirnadern zu zersprengen drohte. Als er nur einigermaßen wieder zu sich kam, wollte er auch wissen, wie der Samiel ausgesehen und ob er recht nach Schwefel gestunken hätte, aber Andreas fühlte sich über diesen Hohn tief gekränkt und schnitt jedes weitere Forschen damit gründlich ab, daß er seinen Hut nahm und das Haus verließ.
Von da an kamen die Beiden nicht mehr so oft zusammen, denn Bellermeier ließ seinen Spott nicht, und der Schulmeister fühlte sich nicht in der Stimmung darauf einzugehen, bis plötzlich nach vier Wochen ein Rescript einlief, das Andreas Pech's Versetzung nach der Hauptstadt an das Gymnasium enthielt.
Der Pastor wünschte ihm von Herzen Glück dazu, der Chaussee-Einnehmer aber sah ordentlich traurig aus, als er es ihm mittheilte.
„Schulmeister," sagte er, indem er ihm ernst in's Auge sah, „Sie sind bis jetzt immer, ein paar verrückte Ansichten ausgenommen, ein braver, freisinniger Mann gewesen, und ich habe Sie deshalb lieb gehabt, soll das jetzt anders werden?" /35/ „Aber, lieber Chaussee-Einnehmer," sagte der Schulmeister verlegen, „das ist doch in meiner neuen Stellung nicht bedingt."
„Nein," sagte Bellermeier, „allerdings nicht, aber ich kenne Beispiele -"
„Und wir bleiben Freunde, nicht wahr?"
„So lange Sie ein ehrlicher Kerl sind, von ganzem Herzen," rief der Chaussee-Einnehmer, in die dargebotene Hand einschlagend.
Am nächsten Tage fuhr Andreas Pech auf einem Leiterwagen mit seiner Familie zu Thal, und das nämliche Fuhrwerk war dazu bestimmt, das nächste schulmeisterliche Schlachtopfer nach Holzhäusel von unten herauf zu befördern, denn die Kinder durften nicht ohne Unterricht bleiben. Aber Andreas Pech schien seinen Namen von jetzt ab mit Unrecht zu führen, denn eine neue Sonne ging ihm auf.
Schon seine erste Stellung in *** war eine günstige und besserte seine Umstände bedeutend - aber er blieb nicht einmal lange darin, sondern avancirte. Im zweiten Jahre war er, der Liebling des Generalsuperintendenten - Director an einer größeren Bürgerschule - ja noch ein Jahr später bekam er - jetzt mit einem nicht unbedeutenden Gehalt, den „Unausweichlichen" und den Titel Schulrath.
In der Stadt gingen allerdings Gerüchte über seine sehr verschiedenartige Thätigkeit, aber der Herr Schulrath Pech hörte entweder nichts davon, oder wollte nichts davon hören - zählte er doch den angesehensten Leuten der Stadt zu und konnte sich leicht über Klatschereien hinwegsetzen. Er war Vorstand des Gustav-Adolf-Vereins geworden - ebenso Vorsitzender in einem zwar kleinen, aber sehr gewählten politischen Verein, selbst der Minister hatte ihn schon zur Tafel gezogen, und man sprach sogar davon, daß er die Leitung eines bedeutenden Blattes übernehmen solle. Kurz und gut, aus dem armen Dorfschulmeisterlein war ein Mann geworden, dessen Behäbigkeit auch begann, sich in seiner körperlichen Anlage zu zeigen. Er sah ordentlich gravitätisch aus, wenn er in seinem etwas langen schwarzen Rock, mit dem bunten Band im Knopfloch, und mit glatt rasirtem Kinn wohlwollend nach rechts und links grüßend, durch die Straßen schritt. /36/ So kam er auch heute gerade aus einer Sitzung, die etwas hitziger Natur gewesen und lange gedauert hatte; er mußte aber mit dem Erfolg zufrieden sein, denn er lächelte still und selbstvergnügt vor sich hin, ohne daß sein Blick aber dabei verfehlt hätte, die ihm Begegnenden zu mustern. Da fiel ihm plötzlich ein bekanntes Gesicht auf, das ihn veranlaßte, mitten auf dem Wege stehen zu bleiben.
Im ersten Augenblick wußte er nicht gleich, wo er es hinthun sollte, wie es uns ja oft so geht, wenn wir einer, sonst wirklich befreundeten Gestalt nach langer Zeit und in einem ganz andern Ort und in fremdartiger, nicht gewohnter Umgebung begegnen. Aber das dauerte nicht lange, Andreas Pech hatte ein zu vortreffliches Gedächtniß, und im nächsten Augenblick erkannte er schon in der kleinen, magern und nur dürftig gekleideten Figur seinen alten Freund und Gesellschafter.
„Bellermeier!" rief er erstaunt aus und streckte ihm die Hand entgegen - „Herr Chaussee-Einnehmer!"
Es war wirklich der seit kurzer Zeit hierher versetzte Bellermeier, von dem er natürlich nichts gehört, dieser aber dagegen desto mehr von ihm, wenn er die ganz verwandelte Persönlichkeit des früheren Dorfschulmeisters auch nicht gleich selber erkannte. Er mochte wohl dabei ein dem entsprechendes Gesicht gemacht haben, denn Andreas rief freundlich aus:
„Kennen Sie denn Ihren alten Andreas Pech nicht mehr?" Da sah ihn Bellermeier, ohne die dargebotene Rechte zu nehmen, von oben bis unten groß an, steckte dann seine beiden Hände vorsichtig in die Taschen, sagte einfach und ruhig: „Hol' Sie der Deubel!" und ließ den verblüfften Schulrath mitten auf der Straße stehen.
/37/
Der Friedensrichter.
1.
In der deutschen Ansiedelung.
Es war im Jahre 50 oder 51, daß der Staat Illinois in Nordamerika anfing, sich mehr und mehr zu besiedeln. Die Entdeckung des Goldes in Californien hatte diesem Theil der westlichen Staaten einen ganz besondern Aufschwung verliehen. Eisenbahnen durchzogen ihn schon nach verschiedenen Richtungen - Zweigbahnen wurden projectirt, und vorzüglich viele Deutsche siedelten sich in dem südlichen Theil von Illinois an, der durch dichte Waldstreifen mehr gegen die kalten, von den Seen herunterstreichenden Winde geschützt war, als der nördliche.
Ein District besonders, nicht übermäßig weit vom Ohiostrom und ziemlich gleich von den westlichen wie östlichen Grenzstaaten entfernt, hatte eine vollkommen deutsche Bevölkerung bekommen, und zwar so, daß wirklich nicht ein einziges englisches Wort dort gesprochen wurde. Die Leute brauchten die fremde Sprache auch nicht, denn mit Amerikanern kamen sie nur selten in Berührung, und wer von diesen etwas von ihnen haben oder kaufen wollte, ei, der mochte auch zusehen, wie er sich verständlich machte.
Die Häuser lagen allerdings - wie es Gebrauch in allen überseeischen Ländern ist, zerstreut auf dem verschiedenen Grundeigenthum jedes Einzelnen, und man brauchte oft viele hundert Schritt von einem zum andern. Etwa im Centralpunkt der ganzen Colonie hatte man aber doch eine Kirche gebaut, unfern /38/ von der sich noch eine Schmiede wie einige Bauern festsetzten, deren Grundeigenthum gerade daran stieß.
Selbstverständlich durfte aber auch ein Wirthshaus nicht fehlen, denn viele Leute hatten einen weiten Weg zur Kirche, und dann ging ein ziemlicher Verkehr dort vorüber, der täglich wenigstens einen kleinen Nutzen abwarf.
Dies eine Wirthshaus, das von einer noch rüstigen und überaus thätigen Wittwe - einer Frau Roßberg gehalten wurde, hätte nun ganz vortreffliche Geschäfte gemacht, denn die Lage war ausgezeichnet - wenn es ihr eben verstattet gewesen wäre, dieselbe auch allein und unbehelligt auszunutzen.
Leider aber wollte ein Anderer den Nutzen theilen, und kaum war das Ganze so weit geordnet, daß sie aus ihrem „Hotel zum goldenen Löwen" - wie sie das Haus nannte, eine hübsche Rente zu ziehen anfing, als ein Rheinbaier, der ebenfalls erst seit Kurzem herübergekommen und daheim ein ähnliches Geschäft betrieben hatte, ihr gerade gegenüber eine andere Loghütte aufsetzte und sein Haus, als ob er es ihr zum Possen gethan, gleichfalls mit einem Schild und goldenen Löwen verzierte, aber die Unterschrift darunter setzte: „Zum goldenen Affen." - Beide Thiere sahen auch in der Ausführung, während sie sich untereinander täuschend glichen, wirklich eben so viel einem Affen wie einem Löwen ähnlich, und die Colonisten hatten natürlich ihren Spaß daran.
Madame Roßberg freilich war außer sich über eine solche Nachahmung. - Das Wirthshaus dort zu halten, durfte sie dem Deutschen nicht verwehren. Und wenn sich noch sechs Andere zu dem nämlichen Zweck da niedergelassen hätten, so mußte es ruhig ertragen werden; aber das gleiche Schild war ein Mißbrauch mit ihrem Eigenthum, den sie nicht zu dulden brauchte. Sic rief sämmtliche Nachbarn zu Schiedsrichtern auf, um zu bestimmen, in wie weit ein Anderer berechtigt sei, ihr Schild, wenn auch mit einer andern Unterschrift, über seine Thür zu nageln, und dadurch die weit herkommenden Gäste, die nur das gelbe Thier sahen und gewiß nicht auf die Worte darunter achteten, irre zu führen und ihr abspenstig zu machen. Aber eine Entscheidung war darüber schwer.
Die Meisten behaupteten, die mit gelber Farbe von einem /39/ und demselben Künstler gemalten Thiere sähen weder einem Löwen noch einem Affen gleich und hätten weit mehr Aehnlichkeit mit einem Kalb oder Metzgerhund, und die Wahl mußte Einem da allerdings freigegeben werden, welchen naturhistorischen Namen man darunter setzen wollte. Der neue Wirth, Pechtels mit Namen, behauptete dabei, dem Künstler speciellen Auftrag gegeben zu haben, ihm einen Affen zu malen - und Meier, wie der Künstler hieß, erklärte eben so entschieden, das sei ein Affe und das andere ein Löwe, und nur Leute, die in ihrem ganzen Leben weder den einen noch den andern in Wirklichkeit gesehen hätten, könnten das Gegentheil behaupten.
Madame Roßberg verlangte jetzt, daß Pechtels sein Schild herunternehmen und sich entweder einen grünen Baum oder einen Anker oder eine Krone solle malen lasten, wo eine Aehnlichkeit, selbst unter Meier's Händen, nicht mehr möglich schien. Ja, sie erbot sich sogar, die Kosten des neuen Schildes zu tragen - vorausgesetzt, daß sie der Maler bei ihr abverzehre, worauf dieser auch sehr gern eingegangen wäre. Pechtels weigerte sich aber, in einer Sache nachzugeben, die er auf seiner Seite für eine gerechte hielt. Wenn sich Madame Roßberg durch das Schild beeinträchtigt glaubte, so konnte sie sich ja einen Baum oder einen Anker - eine Krone passe außerdem in keine Republik - malen und ihm den Affen lassen, dann kam die Sache auf das Nämliche heraus. Dagegen nun sträubte sich aber wieder Frau Roßberg's Stolz.
Sie sollte ihre Flagge einziehen und ihre alte Firma aufgeben, nur weil so ein hergelaufener Mensch ihr zum Aerger eine ähnliche aufgesteckt? - nie. Da müßte ja kein Recht und keine Gerechtigkeit mehr im Lande sein, wenn so etwas auch nur geduldet würde. Sie bezahlte ihre Steuern und Abgaben so gut wie jeder Andere, und wenn sie eine alleinstehende Frau wäre, so wollte sie doch sehen, ob sie nicht trotzdem Schutz finden könne. Nahmen die Nachbarn nicht ihre Partei und ließen den Wirth zum angeblichen „goldenen Affen" fallen - denn so wie sie dort nicht mehr einkehrten, mußte er ja doch von selber sein Geschäft aufgeben - so war sie entschlossen, die Sache vor die Gerichte zu bringen.
Die dortigen Colonisten sahen nun recht gut ein, daß /40/ Pechtels sein Schild nur aufgehangen hatte, um der Frau Roßberg, die sie als eine gute, wackere Frau kannten, zu schaden, und in einer französischen oder amerikanischen Kolonie würde Pechtels allerdings schlecht gefahren sein. Man hätte ihm entweder das Schild gewaltsam heruntergerissen, oder ihn doch vollkommen links liegen lasten und dadurch gezwungen, es selber abzunehmen. Leider Gottes herrscht nun aber einmal in unserem deutschen Stamm ein kleinlicher, gehässiger Geist, der die Deutschen, so brave, fleißige Menschen es sonst auch immer sein mögen, nie mit ihren Nachbarn in Frieden leben läßt. Mögen wir in einen Theil der Welt kommen, wohin wir wollen, Deutsche giebt es dort überall, aber auch, wo sie sich finden, Hader und Uneinigkeit, und oft der erbärmlichsten, nichtssagendsten Kleinigkeiten wegen. Sie können nun einmal nicht mit einander in Frieden verkehren, weder daheim noch draußen, und so konnte es denn auch natürlich nicht anders sein, als daß sich in der kleinen Kolonie schon ebenfalls zwei verschiedene Parteien gebildet hatten, die sich einander das Weiße im Auge nicht gönnten. Und nicht etwa Racenunterschiede waren es, die sie entzweit, nicht etwa der Glaube - denn zu beiden Theilen gehörten Protestanten und Reformirte, mit ein paar vereinzelten Katholiken dazwischen - nein, ein einmal flüchtig und unbedacht hingeworfenes Wort, das Alter-Weiberklatsch weiter getragen, oder irgend eine andere erbärmliche Kleinigkeit hatte genügt, um ganze Familien auseinander zu bringen und auf Leben und Tod zu entzweien, und die beiden verschiedenen Wirthshäuser leisteten ihnen darin nur gewünschten Vorschub und halfen den Riß weiter und weiter öffnen.
So lange die Wittwe Roßberg nur den „goldenen Löwen" gehalten, waren sie doch genöthigt gewesen, dort zusammen zu kommen; sie konnten sich wenigstens nicht ausweichen, und da es eine Menge von gemeinschaftlichen Interessen gab, so wurde auch dann und wann einmal ein Wort zwischen den feindlichen Parteien gewechselt, das eine Annäherung möglich machte. Jetzt aber, da ihnen durch den „goldenen Affen" die Gelegenheit geboten war, sich auszuweichen, ergriffen sie diese mit Vergnügen, und es dauerte in /41/ der That gar nicht lange, so haßten sich die Gäste, die das eine oder andere Wirthshaus besuchten, nicht gründlicher, als der Wirth des Affen und die Wirthin des Löwen einander selber. Ein einziges Glück nur war, daß es in der ganzen Ansiedelung auch nicht einen einzigen Advocaten gab, denn die Processe hätten sonst kein Ende genommen. So aber wohnte nur etwa fünf Meilen davon entfernt, in dem nächsten kleinen Städtchen Karthago ein amerikanischer Friedensrichter, und da Keiner von Allen so viel Englisch sprach, um sich diesem genau verständlich machen zu können, so trugen sie ihr Geld wenigstens nicht den Gerichten zu.
Durch diese gegenseitige Eifersucht gewannen die Zwistigkeiten unter den beiden Gasthöfen aber auch immer mehr Boden. Die Frau Roßberg nannte den Wirth Pechtels schon gar nicht mehr anders, wie den „gelben Affen" - goldenen klang ihr zu gut, und sie gerieth außer sich, als ihr die Gäste erzählten, Pechtels habe sie selber die „gelbe Katze" genannt, denn das Bild auf ihrem Schild sei doch weit eher eine Katze wie ein Löwe - und gelb statt golden waren alle beide.
Außerdem hatte sie den Nachtheil, daß der Weg aus den weiter abliegenden Kolonien gerade auf den Affen zu führte und „Fremde", wenn sie das Schild nur von Weitem sahen, das natürlich für das richtige hielten und dort einkehrten. Ueberhaupt von etwas reizbarem Charakter und nebenbei noch immer durch die eigenen Gäste aufgehetzt, wurde ihr dieser Zustand zuletzt so unerträglich, daß sie - als einzelne Frau doch schutzlos in der Ansiedelung und mit keinem Advocaten im Bereich - ihre natürliche Hülfe bei der Obrigkeit zu suchen beschloß, denn so konnte das, wie sie meinte, nicht mehr fortgehen.
Darin bestärkte sie ein „Pennsylvanisch-Deutscher", ein Amerikaner, aber in Pennsylvanien und zwischen lauter Deutschen geboren, wo sich die Leute dann eine eigenthümlich halb deutsche, halb englische Sprache gebildet hatten, so daß sie sich mit beiden wenigstens verständlich machen konnten. Der versicherte ihr, daß es ungesetzlich in den Staaten wäre, einem Wirthshausschild gegenüber genau das nämliche anzubringen. /42/ Wenn sie zum Friedensrichter ginge, müßte sie ihr Recht bekommen, denn sie habe das erste Schild gehabt, also damit auch ein preemton right oder Vorrecht erworben, und er zweifle keinen Augenblick, daß Pechtels gezwungen werde, sein Schild abzunehmen oder wenigstens anders zu malen.
Das war der erste Balsam für ihr lange gekränktes Herz; den Triumph wollte sie haben, und wenn sie auch den verhaßten Menschen nicht zwingen konnte, sein Wirthshaus aufzugeben - denn Pechtels war sonst ein ganz ordentlicher Mann, äußerst thätig und duldete nie eine Unordnung bei sich, so daß also darin keine Klage gegen ihn begründet werden konnte - so sollte er doch gezwungen werden, das Schild zu verändern. Sie wollte nicht länger das Herzeleid ertragen, ihren goldenen Löwen als Affen den ganzen Tag sich gegenüber zu sehen - sie konnte es nicht, denn sie fühlte, wie es ihre Nerven von Tag zu Tag immer mehr angriff, und fürchtete, wenn das noch viel länger dauerte, eine Gemüthskrankheit.
Ein Versuch in Güte sollte aber trotzdem noch gemacht werden; eine alte Base, die Frau Roßberg als Köchin im Haus hatte, wurde als Parlamentair hinüber geschickt in den „goldenen Affen", und Frau Roßberg hatte sich selber so weit überwunden, einen kleinen Brief an Pechtels zu schreiben (und auf ihre Handschrift war sie mit Recht stolz), worin sie ihn aufforderte, gutwillig den bestehenden Gesetzen nachzukommen und sein Schild ungesäumt zu verändern, oder sich bereit zu halten, mit ihr am nächsten Tag zu dem Friedensrichter nach Karthago hinüber zu reiten, um aus dessen Munde seinen Urtheilsspruch zu hören.
Pechtels lachte, als ihm die alte Base nur den Brief überreichte, und schüttelte schon im Voraus den Kopf.
„Es hilft doch nichts," sagte er, „der Affe bleibt, meine liebe Frau, und wenn sich Eure Madame da drüben vor Aerger auf den Kopf stellte. Ich habe dasselbe Recht, ein Schild an meinem Hause zu führen, wie sie, und wenn ich das Nämliche, was sie für einen Löwen hält, für einen Affen halte, so bin ich darüber Niemandem Rechenschaft schuldig." /43/ „Aber so lest doch nur den Brief," sagte die alte Frau, „und wenn Ihr denn einmal nicht gutwillig nachgeben wollt, so sollen die Gerichte entscheiden - die Frau schreibt Euch da drin Alles darüber, und dann wollen wir einmal sehen, wer Recht kriegt."
„Wenn Eure Frau gescheidt ist, so läßt sie die Gerichte zufrieden," sagte Pechtels, indem er aber doch den Brief öffnete, „denn helfen können die ihr doch nichts und nur Geld kosten. Aber Ihr Frauen seid wirklich unverbesserlich, und wenn Ihr Euch einmal auf 'was verbeißt, so laßt Ihr nicht wieder locker. Wenn Eure Frau nur so viel Vernunft hätte, so müßte sie lange begriffen haben, daß ich in meinem vollen Rechte bin, und den Friedensrichter in der Welt möchte ich sehen, der mir beweisen wollte, daß mein Affe ein Löwe ist. Hm!" setzte er dann hinzu, als er in den Brief hineinsah, „hübsch schreiben kann sie, das muß ihr der Neid lassen, aber es hilft ihr nichts - also zum Friedensrichter sollen wir? Na meinetwegen, daß das ewige Geschwätz doch einmal ein Ende nimmt. Mir ist's recht, und morgen, Mittwoch, haben wir Beide doch nicht viel zu thun - aber da müssen wir die beiden Schilder mitnehmen, Kathrine," setzte er lachend hinzu, „und wenn wir die zusammen auf einen Wagen thun, kratzen sich die beiden Bestien am Ende die Augen aus."
„Das ist nicht nöthig," sagte die Base, „der Friedensrichter mag nachher herüber kommen, dazu ist er da. Daß es Euch dann aber schlecht geht, Pechtels, darauf könnt Ihr Euch verlassen. Ihr habt die Frau eine gelbe Katze genannt - zehn Zeugen können wir bringen, wenn's verlangt würde, und Geld wird Euch die Geschichte kosten - viel Geld -"
„Und sie mich einen „gelben Affen", Kathrine, das hebt sich also; aber ich bin mit der Klage zufrieden, denn ehe ihr der Richter nicht einmal selber den Kopf zurechtsetzt, giebt die Frau da drüben doch keine Ruhe. Also um wie viel Uhr wollen wir dort eintreffen?"
„Um zehn Uhr, hat die Frau gesagt, so daß wir bis Mittag wieder zurück sein können."
„Und Ihr fahrt auch mit, Kathrine?"
„Das versteht sich, und einen Silber-Dollar zahl' ich in /43/ den Klingelbeutel, wenn sie Euch das Schild da oben vom Hause reißen, Pechtels, das kann ich Euch versichern. Es giebt keine bravere und fleißigere Frau in der Welt, als die Base, und keinem Kinde legt sie etwas in den Weg, Ihr aber habt sie so lange geärgert, bis ihr die Galle in's Blut getreten und sie ordentlich gelb geworden ist, und der Himmel mag's Euch vergeben, aber verdient hat sie's wahrlich nicht."
„Na," sagte Pechtels, den Kops ungeduldig herüber werfend, „geschwatzt haben wir nun genug, und krieg's selber satt. Wenn der Friedensrichter Eurer Frau den Kopf zurechtgesetzt hat, wird sie wohl wieder weiß werden, und nun sagt ihr, daß ich morgen um zehn Uhr ebenfalls in Karthago sein will; ich habe doch in der Nachbarschaft etwas zu thun; das paßt mir gerade," und ohne sich weiter um die Kathrine zu kümmern, drehte er ihr den Rücken zu und ließ sie stehen.
2.
Beim Friedensrichter.
Am nächsten Morgen, noch vor neun Uhr, sah Pechtels, daß gegenüber aus dem „goldenen Löwen" der kleine offene Wagen geschoben wurde, den die Frau Roßberg manchmal benutzte, wenn sie auswärts Besorgungen hatte, denn sich wie eine Amerikanerin auf ein Pferd zu setzen, hielt sie für unschicklich und würde cs nie gethan haben. Bald darauf wurden die beiden Braunen eingeschirrt - ein paar prächtige Pferde, die aber auch im Acker gingen, denn die Frau hatte eine kleine Farm dabei, und etwa zehn Minuten danach kam die Wirthin selber mit der alten Base hinter ihr drein; und was für eine Haube die Base trug und was für Schleifen daran - aber ohne ihren Sonntagsstaat wäre sie gewiß nicht in die Stadt gefahren.
Die Wirthin selber ging sehr sauber, aber in keiner /45/ Nationaltracht, sondern modern gekleidet. Es war noch eine ziemlich junge und ganz stattliche Frau, und hätte sich auch verschiedene Male wieder verheirathen können - aber sie wies alle Bewerber ruhig ab, weil sie erklärte, sie würde nie wieder zum zweiten Mal freien. Der erste Mann sollte sie nicht allein unfreundlich, sondern oft sogar roh behandelt haben, und sie wollte sich dem wohl nicht wieder aussetzen. Die Männer waren sich ja doch alle gleich, und sie befand sich so, als ihre eigene Herrin, viel besser und behaglicher.
Es war auch in der That eine brave und gutmüthige Frau und hatte bisher noch gegen Niemanden - selbst nicht gegen ihre verstocktesten Schuldner, Haß gezeigt; aber den „goldenen Affen" haßte sie trotzdem, und als sie an den Wagen trat und ihr Blick'auf das gegenüber befestigte Schild fiel, unter dem sich, wie zum Trotz, Pechtels ganz breit hingestellt und jetzt in spöttischer Ehrfurcht herüber grüßte, legte sich ein häßlicher Zug um ihre Lippen, und mit einem verächtlichen Blick auf den Frechen bestieg sie, ohne auch nur den Gruß zu erwidern, das Geschirr. Der Hannes, ihr Arbeiter, nahm die Zügel in die Hand, und fort rasselte der kleine leichte Wagen die Straße entlang, seinem Ziel entgegen.
Pechtels hatte einmal große Lust gehabt, sie allein fahren zu lassen und sich gar nicht weiter um die alberne Geschichte zu kümmern; einmal aber hatte er es versprochen - und sein Wort mußte er halten, - und dann hätte auch die Wirthin am Ende gar geglaubt, er fürchte sich, die Sache vor Gericht zu bringen. Lächerlich - kein Friedensrichter der Welt konnte ihn zwingen, sein Schild von der Thür zu nehmen, und wenn der in Karthago wirklich albern oder parteiisch genug sein sollte, etwas Derartiges anzuordnen, so war er fest entschlossen, sich dem nicht zu fügen, sondern höher hinauf zu gehen, und wenn es hätte bis zum Präsidenten selber sein müssen.
Nicht einmal zu spät wollte er kommen, ging also jetzt ohne Weiteres in den Stall, sattelte sich selber sein Pferd, zog sich dann an und folgte, etwa eine Viertelstunde später, in einem scharfen Trab dem vorangegangenen Geschirr. /46/ Das Ziel ihrer Tour hatte allerdings, wenigstens für unsere Ohren, einen etwas volltönenden Namen, Karthago, und der Europäer macht sich dabei vielleicht eine falsche Vorstellung. Es wird besser sein, es etwas näher zu beschreiben, noch dazu da Tausende ganz gleicher,,Städte" in dem weiten Lande mit ihren Namen Paris, London, Petersburg, Madrid u. s. w. den Fremden nicht selten überraschen.
Karthago war vor noch gar nicht so langer Zeit erst, und zwar in ziemlich günstiger Lage gegründet worden, denn dicht daran hin lief eine schon „abgesteckte" Eisenbahnlinie, und außerdem führte auch vom Ohiostrom aus der Weg nach dem Centrum des Staates und von da nach Chicago hinauf, so daß man fest darauf rechnen konnte, hier in späteren Jahren sogar eine Kreuzung zu bekommen.
Städte gründet man aber in den Wildnissen nicht eben durch Häuserbauen, wie es sich eigentlich vermuthen ließe, sondern nur durch Vermessen des Platzes und Auslegen oder Bezeichnen der verschiedenen Straßen. In der Prairie wurden dann in regelmäßigen Quadraten Pfähle eingeschlagen, und daran befestigte Brettchen trugen bald genug die Namen der für spätere Zeit beabsichtigten Straßen. Da las man denn auf einem Pfahl, der einsam in der Ebene stak, „Hauptstraße", auf einem andern „Marktstraße", „Washingtonstraße", „Illi- noisstraße" u. s. w., andere kleine Pfähle bezeichneten schon den Platz, wo einmal später das Postgebäude, das Theater, das Telegraphenamt, das Museum und der Gasometer hinkommen sollten, und nun versuchten die Eigenthümer des Ganzen, mit einem sauber gemalten Plan, in den Städten herum zu reisen und besonders Einwanderer abzufangen, denen sie sogenannte lots oder Baustellen in ihrer neuen Stadt verkaufen konnten.
Manchmal glückte auch eine solche Speculation ausgezeichnet, und Plätze, die eine vorteilhafte Stelle gefunden, wuchsen in rasender Schnelle zu großen Städten heran. Sehr häufig blieb aber auch eine solche Stadt nur einzig und allein auf dem Papier, und am „Marktplatz" stand vielleicht eine einzelne Logcabin mit ein paar niederen Maishütten, während hundert Schritt davon in Mainstreet oder der „Hauptstraße" ein Schenk-/47/laden stand, der an vorbeikommende Fremde Whisky, Kautabak und andere Delicatessen zu verkaufen suchte.
Ganz so traurig sah es nun allerdings in Karthago nicht aus, aber viel besser auch nicht, denn es war ja, wie vorerwähnt, nur eben erst im Entstehen, und da durfte man freilich seine Erwartungen nicht zu hoch spannen.
Die ganze Stadt bestand vorläufig noch aus sieben Häusern mit lauter amerikanischen Familien - einen einzigen Franzosen abgerechnet, der aber nur sehr wenig Ackerbau trieb und meistens von der Jagd lebte. Außerdem befand sich eine Schmiede und eine Grocerie oder eine Materialwaarenhandlung im Ort, d. h. ein Laden, in dem eben Alles zu haben war, was man nur in diesem abgelegenen Theil der Welt verlangen und gebrauchen konnte: Branntwein, Lebensmittel, Schuhe, fertige Kleider, Werkzeuge, Ackergeräth, Medicinen, Pulver, Blei, kurze Waaren, Schmucksachen, kurz Alles und Alles. Der Eigenthümer desselben, dem etwa die halbe Stadt gehörte, und möglicher Weise ein späterer Millionär, war auch zu gleicher Zeit Friedensrichter, Postmeister und Polizeidirector, und, einen Schreiber abgerechnet, der zugleich als Commis fungiren mußte und außerdem ein entfernter Verwandter und bucklig war, hatte er keine Hülfe und - brauchte keine.
Streitigkeiten kamen unter den wenigen Ansiedlern selten oder nie vor, Verbrechen gar nicht, denn wer sollte in einem Lande stehlen, wo er sich, mit nur einiger Arbeit, leicht sein Brod verdienen konnte, Briefe trafen ebenfalls nur sehr selten ein und wurden eben so selten geschrieben, und die Thätigkeit des Friedensrichters wurde, außer seinem Geschäft, nur dann und wann durch Trauungen junger Paare in Anspruch genommen, die allerdings in der letzten Zeit ziemlich häufig geworden waren und ihm dadurch auch einen hübschen Verdienst einbrachten. Jedes Paar mußte ihm nämlich fünf Dollars bezahlen, oder, wie er es nannte, zwei und ein halb per Kopf. Seine ganze Arbeit dabei war in etwa fünf Minuten abgemacht, und da die Ansiedelungen in der Nachbarschaft wuchsen und der ganze District umher noch zu wenig besiedelt blieb, um ihm einen andern Friedensrichter als Concurrenten hinzusetzen, so machte er dadurch schon allein ganz hübsche Geschäfte. /48/ Ein anderer Vortheil war aber auch noch der, daß er den einzigen wirklichen Laden in der ganzen Umgegend hatte, und ließ sich ein Brautpaar bei ihm trauen, so blieb dem Bräutigam doch selbstverständlich gar nichts Anderes übrig, als seiner Braut „im Laden" ein Geschenk zu kaufen. Fand sie aber etwas, das ihr gefiel, so durfte der Bräutigam natürlich nicht knausern und lange darum handeln. Boyles, der Friedensrichter, forderte dann in aller Gemüthlichkeit einen unverschämt hohen Preis, und der arme Teufel von neugebackenem Ehemann mußte eben in die Tasche greifen und bezahlen. Ob er nachher schimpfte oder nicht, blieb sich vollkommen gleich, denn er hatte sowohl die Frau als die Waare, und wurde eins so wenig wieder los wie das andere.
James Boyles war nun über Tag größten Theils mit seinem Factotum, dem buckligen Vetter, im Laden, kam aber irgend Jemand, der seine richterlichen Dienste in Anspruch nehmen wollte, sei das nun für eine Trauung oder in einer Streitigkeit, so schloß er den Laden so lange zu - wer etwas kaufen wollte, mußte warten, bis er wieder kam, - lud die Parteien in das dicht dahinter liegende kleine Haus, erledigte dort seine Geschäfte und führte sie dann wieder durch den Laden zurück, wo er schon dafür sorgte, daß sie nicht fortgingen, ohne Wenigstens einen Trunk Whisky zu nehmen, wenn sie nicht noch außerdem einige Dollars für Waaren sitzen ließen.
Auf dem breiten Weg hin nach Karthago rasselte das kleine leichte Fuhrwerk der Wittwe Roßberg, und die „Stadt" war schon in Sicht, als sie hinter sich, auf dem trockenen Wege, die Hufschläge eines Pferdes hörte. Sie drehte den Kopf zur Seite und erkannte im Nu den Wirth vom „goldenen Affen", der ganz keck und zuversichtlich herantrabte. Ja, als er vielleicht zehn Minuten später den Wagen passirte, um der „Erste" auf dem Platze zu sein, hatte er sogar die Frechheit, die Damen achtungsvoll zu grüßen.
Frau Roßberg konnte es nicht gut vermeiden, ihm zu danken, es wäre zu unhöflich gewesen, aber sie that das mit einer außerordentlichen und ihr sonst ungewohnt vornehmen Neigung des Kopfes, was die Kathrine täuschend ähnlich nach-/49/ahmte. Pechtels nahm aber nur wenig Notiz davon, gab seinem wackern Thier die Sporen und sprengte so stolz an ihnen vorüber, als ob er der König von Karthago gewesen und nur eben einmal umhergeritten wäre, um seine Maisfelder zu besichtigen. Er ließ den Wagen der Wirthin auch bald zurück, hing, in Karthago angekommen, sein Pferd an und ging ohne Weiteres in den Laden, wo er sich - für sich und den Händler-Friedensrichter - wie das dort überall Sitte ist - ein Glas Whisky geben ließ. Boyles trank mit, und Pechtels bezahlte, eine Sache, die ganz in der Ordnung war, und daß er indessen mit dem Friedensrichter über das, was ihn hierher geführt, kein Wort sprach, dafür hatte er zwei Gründe: erstlich wollte er die eigentliche Klage vollkommen der Wirthin vom „goldenen Löwen" überlassen, und dann - verstand er wohl eben Englisch genug, um einem Gaste daheim einen „Schluck" oder etwas zu essen zu verabreichen, aber auch nicht die Spur mehr - die Verhandlung später mußten sie ja denn doch, wenn der Friedensrichter nicht etwa Deutsch verstand, durch einen Dolmetscher führen.
Der kleine Wagen war übrigens viel rascher hinter ihm drein gekommen, als er anfangs erwartet haben mochte, denn nur erst wenige Minuten stand er mit dem Richter am Ladentisch, als das Fuhrwerk schon vor die Thür rasselte, und gleich darauf die Wittwe, fest entschlossen dem Gegner keinen Vorsprung und nicht das erste Wort zu lassen, mit der Base den Raum betrat.
So rasch trafen auch Beide hinter einander ein, daß Boyles wohl merkte, sie gehörten zusammen, und es führe sie eine gemeinschaftliche Sache hierher. Die Dame ließ ihn außerdem nicht lange im Zweifel, denn auf Pechtels zeigend, der wiederum seinen Hut lüftete, begann sie dem Yankee - natürlich in deutscher Sprache - zu erzählen, was sie hierher geführt, und Boyles horchte auf das Erstaunteste ihren Worten, von denen er aber keine Sterbenssilbe verstand.
Pechtels selber, obgleich schon seit acht Monaten im Lande, wie wir vorher erwähnt, war der englischen Sprache fast gar nicht mächtig. Er verstand einzelne Worte, die zu seinem Geschäft gehörten, weiter nichts, und als sich Boyles jetzt an /50/ ihn wandte und ihn frug, was die „Lady" von ihm wollte, nickte er nur mit dem Kopfe und sprach:
All right - lady and me - all right," wodurch er andeuten wollte, daß sie Beide eine Klagesache vorzubringen hätten.
Der kleine bucklige Schreiber befand sich natürlich mit in dem Laden, und an diesen wandte sich jetzt Boyles.
„Tom, verstehst Du, was die Beiden von mir wollen? Hol' der Teufel das Kauderwelsch! Wenn man's sprechen soll, bricht's Einem die Zunge entzwei, und wenn man's hört, klingt's gerade, als wenn ein alter Fensterladen im Winde knarrt, oder eine toll gewordene Mühle klappert."
„Na, das ist doch klar," sagte Tom, der gerade beschäftigt war, einem kleinen, eben eingetretenen Jungen einen Topf mit Syrup zu füllen, „Ihr sollt sie zusammenspließen - sie wollen sich heirathen - weiter nichts."
„Na ja, das dachte ich auch," sagte der Friedensrichter, „dann schafft mir nur den Jungen fort und schließt die Thür zu, damit wir in die Office gehen können; hier im Laden läßt sich's doch nicht machen," und der Frau zunickend, daß sie steh einen Augenblick gedulden und ihm folgen solle, sagte er zu Pechtels: „Kommt nur mit, das wollen wir Euch gleich besorgen," und schritt ihm dann, wobei er ihm noch einen Wink gab, voran.
Die beiden streitenden Parteien fanden es selbstverständlich, daß ihre Sache nicht im Laden ausgeglichen werden konnte, und während Pechtels den Damen den Vortritt ließ, folgten sie alle Drei dem Richter in das kleine Seitengebäude, das Boyles allein zu diesem Zweck aufgerichtet hatte und auch seine office nannte. Ein Zettel draußen an der Thür bezeichnete es sogar als solche.
In der Mitte des aus rohen Balken hergestellten Raumes, mit einem einzigen schmalen Fenstereinschnitt, stand ein viereckiger Tisch, mit vier oder fünf Holzstühlen darum her. Auf dem Tische befand sich ein Dintenfaß mit einigen Federn und ein kleiner Stoß Papier, was dem Ganzen etwas Feierliches gab. Ueber dem Fenster standen sogar, etwas sehr Ungewöhnliches in diesem Theil der Welt, auf einem aus zwei /51/ derben Pflöcken ruhenden Brett ein halb Dutzend in gelbes Leder eingebundener Bücher, angeblich juristische Werke, die aber wohl selten genug herunter genommen und noch seltener gebraucht wurden.
Tom hatte indessen den Jungen mit seiner Syrupskanne expedirt und den Laden nach dem üblichen Gebrauch geschlossen. Jetzt, während Boyles noch, ein wenig verlegen, wie er ein Gespräch anknüpfen könne, vor den Fremden stand, betrat er ebenfalls die Office und besorgte das „Geschäftliche".
Vor allen Dingen nahm er von dem Bücherbrett eine auf der äußersten Kante liegende und wahrscheinlich oft gebrauchte, wenn auch wohl festen geöffnete Bibel, denn sie diente nur dazu, um den üblichen Eingangsschwur abzulegen. Diese deponirte er auf dem Tisch, schob sich dann einen Bogen Papier zurecht, tunkte eine Feder ein und sah Boyles an, als ob er sagen wollte: „Nun kann's losgehen." Boyles mochte denn auch wohl einsehen, daß längeres Zögern nichts half, und als üblichen Eingang zu jeder Feierlichkeit mußte er vor allen Dingen die Namen der Betreffenden erfahren. Die Frage your name? verstand aber Pechtels und gab den seinigen, freilich sehr zur Bestürzung Tom's, der wohl über das erste Frederic sehr leicht wegkam, an dem spätern ch in Pechtels aber vollkommen hängen blieb.
„How do you spell that?" (Wie buchstabirt Ihr das?) frug er, allerdings wohl dreimal. Pechtels verstand aber gar nicht, was er mit dem Worte spell meinte, und da er wohl sah, daß der kleine Mann nicht wußte, wie er seinen Namen schreiben sollte, ging er zum Tisch, nahm ihm die Feder aus der Hand und that es selber. Mit dem Namen Mary Roßberg ging es besser.
Pechtels frug jetzt, ob Niemand im Orte sei, der Deutsch verstünde, und Tom begriff, was er meinte, schüttelte aber auf das Entschiedenste mit dem Kopfe, und Boyles, der nicht gern zu viel Zeit mit dem geschlossenen Laden versäumen mochte (draußen hatte er schon wieder einen Karren rasseln hören, und das konnten Fremde sein), sagte einfach zu seinem Secretär: /52/ „Schwör' sie ein, Tom, wir müssen machen, daß wir fertig werden."
Das geschah jetzt in aller Form, indem der Friedensrichter sie nur einfach frug, ob Keins von ihnen schon verheiratet sei, und da sie die Worte nicht verstanden und mit dem Kopfe schüttelten, reichte ihnen Tom die Bibel hin, die sie zur Bekräftigung des eben Gesagten küssen sollten.
Pechtels hatte nun schon einmal, bald nach seiner Ankunft in New-York, bei einem deutschen Friedensrichter gesehen, daß diese Formel jedesmal abgenommen wurde - Frau Roßberg wußte allerdings nichts davon, aber die Kathrina hatte ebenfalls schon als Zeugin vor Gericht gestanden, und da diese ihr jetzt zuflüsterte, das bedeute weiter nichts, als daß sie beschwöre, sie wolle bei ihrer Aussage nur die blanke Wahrheit angeben, nickte sie befriedigt mit dem Kopfe. Das wollte sie in der That; nicht ein Wort weiter, als die blanke reine Wahrheit, und mit der größten Bereitwilligkeit küßte sie ebenfalls das ihr dargereichte heilige Buch.
Frau Roßberg überlegte sich nun eben, daß es doch ganz außerordentliche Schwierigkeiten haben würde, dem Friedensrichter ihr Anliegen klar zu machen, denn sie fing an zu zweifeln, daß er den Unterschied zwischen einem goldenen Löwen und goldenen Affen mit ganz gleichen Bildern auch richtig verstehen würde.
„Hätten wir nur den Franz mitgenommen," sagte sie leise zur Kathrine. Der Franz war nämlich eine Art Hausknecht bei ihr, ein junger Bursche von kaum vierzehn Jahren, der aber schon vollkommen gut Englisch sprach, „oder wenn wir ihn nur könnten holen lassen. Ich dachte doch, wir würden hier Jemand finden, der Deutsch spräche."
„Das ginge ja noch am Ende," nickte die Kathrine, die jetzt auch merkte, daß sie mit ihren paar englischen Worten nicht auskam, „wenn wir nun gleich den Wagen zurückschickten. In anderthalb Stunden könnte er wieder hier sein, und da sind wir nun doch einmal."
„Wenn er uns micht versteht, sag' ich's ihm," erwiderte fest entschlossen die Frau, „und der Pechtels muß es sich eben-/53/falls gefallen lassen, daß er ein paar Stunden wartet. So geht's aber nicht, das merk' ich schon."
„Well," sagte der Friedensrichter jetzt, der die ganze Sache soviel als möglich abzukürzen wünschte, denn der nöthigen Form war genügt. Tom, der kleine bucklige Schreiber, hatte schon mit geschickter Hand die gewöhnlichen Notizen in ein großes, dazu gehaltenes Buch gemacht, und er wandte sich zuerst an Pechtels.
„Sind Sie willens, Sir, die Lady, die da neben Ihnen steht, zu Ihrem rechtmäßigen Weib zu nehmen?"
„Yes," sagte Pechtels, „die Lady hier will mich eben verklagen. Lassen Sie es sich von ihr auseinander setzen."
„Und sind Sie willens, Ma'm," wandte sich jetzt der Richter, der die Zwischenworte gar nicht verstand oder beachtete, wieder an die Frau, „diesen Herrn, der da neben Ihnen steht, zu Ihrem rechtmäßigen Gatten anzunehmen?"
„Ja wohl, Sir," nickte die Frau, „der ist's, den ich verklagen will, denn er hat mir in den letzten Monaten -"
Der Friedensrichter, der vielleicht glauben mochte, daß bei den Deutschen so viele Worte auf eine einfache Frage nöthig wären, konnte sich aber selber natürlich nicht damit aufhalten, und mit der Hand abwehrend, unterbrach er sie und sagte dabei: