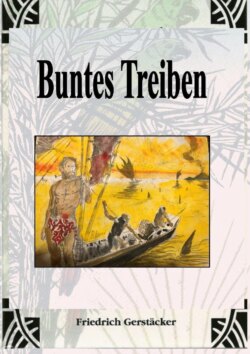Читать книгу Buntes Treiben - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление„Bitte, Madame, lassen Sie das Alles bis nachher. Für jetzt erkläre ich dieser Licenz nach, von dem Secretär unseres Gerichtshofes ausgestellt," und er deutete damit auf das Buch, „Sie Beide als verheirathet, als Mann und Frau. Niemand hat ein Recht, Ihre gültig geschlossene Ehe wieder zu trennen, und der liebe Gott gebe Ihnen seinen Segen."
Dabei reichte er zuerst der Dame dir Hand und schüttelte sie herzhaft, und dann ebenso Pechtels, und dieser, der von alledem nichts begriff, wurde endlich ungeduldig und sagte:
„Nun, Madame Roßberg, denk' ich, haben wir all' die üblichen und höchst langweiligen Formalitäten durchgemacht. Wollten Sie jetzt vielleicht so freundlich sein und Ihre Klage vorbringen, denn ich habe wirklich nicht lange Zeit." Er freute sich dabei schon im Voraus darauf, daß der Richter natürlich kein Wort davon verstehen würde. /54/ Der kleine Bucklige war indessen außerordentlich thätig gewesen, jede Spur der beendeten Feier wieder zu verwischen. Er sprang auf einen Stuhl und legte die Bibel zurück auf das Bücherbrett, schob das Register in die Tischschublade, rückte das Papier zusammen und öffnete dann mit einem all right, wieder die Thür.
„Fee is five dollars," sagte Boyles, indem er Pechtels die offene Hand entgegenstreckte, und five dollars verstand der Wirth vom goldenen Affen gut genug; daß er die aber schon im Voraus bezahlen sollte, wo die Klage, und zwar von seinem Gegenpart, noch nicht einmal anhängig gemacht worden, war ihm doch außer dem Spaß.
„Von mir?" sagte er und deutete auf sich. Der Friedensrichter nickte ihm vergnügt zu und sagte: „Sie wollen sich die doch nicht von Ihrer Frau bezahlen lasten?"
„Kann nicht aufgeführt werden," schüttelte Pechtels auf das Entschiedenste mit dem Kopfe, „ich klage gar nicht, und wer klagt, mag auch die Kosten bezahlen. Nicht fünf Cents geb' ich. Das fehlte auch noch."
„Confound it“, brummte der Richter, „es ist doch eine ganz verzweifelte Geschichte, wenn man es mit Leuten zu thun hat, die keine menschliche Sprache reden."
„Holla!" rief da sein kleiner Schreiber, der die Thür geöffnet hatte und auf den Hof hinaus sah, „da kommt Hülfe. Da ist der deutsche Pedlar (Krämer) wieder mit seinem kleinen Wagen, der spricht Amerikanisch. Heh Rosedale, Rosedale! oh Rosedale! kommt einmal einen Augenblick hierher, Mann, und helft uns mit Eurem Gibberisch aus; der Henker soll's verstehen, wir aber nicht."
Rosenthal, wie der kleine Mann mit entschieden israelitischer Physiognomie hieß, schlenderte langsam quer über den Hof herüber, wo er eben sein mageres Thier angebunden und ihm etwas Futter gegeben hatte, und Frau Roßberg selber rief, als sie ihn erkannte, erfreut aus:
„Gott sei Dank, da ist der Rosenthal, der Jud, der kann uns aushelfen, denn er spricht Englisch wie ein Amerikaner."
Pechtels ärgerte sich eigentlich, denn der Spaß war ihm zum Theil dadurch verdorben, aber was that's! Dadurch be-/55/kamen sie die Sache auch zu einem raschen Ende, und daß seine Widersacherin mit ihrer Klage nichts ausrichten konnte, verstand sich doch ohnedies von selbst.
Rosenthal, etwas erstaunt, den Wirth vom goldenen Affen und die Wirthin vom goldenen Löwen hier friedlich zusammen zu finden, denn er kannte die Verhältnisse in der Ansiedelung genau, kam langsam heran und begrüßte Beide, und Madame Roßberg wollte ihm jetzt vor allen Dingen auseinander setzen, was sie hierher geführt, als der Friedensrichter aber mit einem „I say, Rosedale, macht doch einmal Eurem Landsmann klar, daß er mir fünf Dollars fee (Gebühren) zu zahlen hat. Man kann in ihn hineinreden, was man will, er versteht's nicht."
„Was sagte er?" frug Pechtels, denn er sah wohl, daß der Friedensrichter auf ihn zeigte.
„Fünf Thaler sollen Sie ihm zahlen, Herr Pechtels," antwortete Rosenthal.
„Aber wofür?" frug der Wirth, „ich habe ja gar nicht geklagt, und wir müssen doch erst abwarten, wie Alles ausfällt."
„Der Herr fragt," wandte sich jetzt Rosenthal an den Richter, „wofür er die fünf Dollars zu zahlen hätte."
„Wofür?" rief der Richter wieder, „bless your soul, man, das sind die regelrechten Gebühren für jede Trauung, und daß die jedesmal der Ehemann bezahlt, versteht sich doch von selbst."
Rosenthal sah erst den Richter und dann Pechtels und die Witiwe erstaunt an, und dann wieder den Richter.
„Was sagt er?" frug Pechtels.
„Haben sich denn die Beiden trauen lassen?" frug aber der Krämer in vollem Erstaunen, denn vor kaum acht Tagen war er durch die Ansiedelung gekommen und wußte, wie grimmig feind sie da noch einander gewesen.
„Nun versteht sich," nickte Boyles, „sind nach allen Regeln zusammengegeben, und meine fee beträgt fünf Dollars; kann's auch gar nicht billiger thun und möcht's nicht."
Rosenthal zuckte die Achseln und sagte:
„Ja, lieber Herr Pechtels, das ist Alles in Ordnung, die fünf Dollars müssen Sie zahlen. Er kriegt das von jeder /56/ Trauung. Da kann man ja also wohl gratuliren, Madame Roßberg."
„Von jeder was?" schrie Pechtels und lachte laut auf, „Donnerwetter, ich will mich ja doch nicht verheirathen!"
„Na weiter fehlte mir gar nichts," rief Madame Roßberg und warf den Kopf stolz und vornehm zurück.
„Ja, aber was wollen Sie denn?" sagte Rosenthal.
„Ich bin hier, um eine Klage gegen den Mann da einzuleiten," nahm Madame Roßberg jetzt das Wort, „ich will einmal sehen, ob noch Gerechtigkeit im Lande ist, und ob er das nämliche Schild über seiner Thür aufhängen darf, was ich über der meinen habe, um seinen Mitmenschen das Brod vom Munde wegzuschnappen. Das sagen Sie dem Friedensrichter, geschworen haben wir schon, daß wir die Wahrheit sprechen wollen, und dann kann die Geschichte gleich losgehen."
„Was sagt sie?" frug der Friedensrichter.
„Ach Sir," lachte der Handelsmann, „das ist ein Irrthum. Die beiden Leute wollen sich gar nicht mit einander verheirathen, sondern einander gerade im Gegentheil verklagen, wegen eines Aushängeschilds, das -"
„Was?" rief Boyles und sah sein Factotum verblüfft an, „sie sind nicht hierher gekommen, um sich zu heirathen?"
„Ih Gott bewahre," lachte Rosenthal, „sie denken gar nicht daran und sind einander spinnefeind. Nein, sie wollten nur -"
„Ja, dann ist das Unglück geschehen," unterbrach ihn aber Boyles, also in die Enge getrieben, „und kein Teufel kann sie wieder auseinander bringen. Sie sind jetzt Mann und Frau."
„Na, das wär' nicht übel," lachte Rosenthal, „ohne daß sie Beide 'was davon wissen?"
„Ja, ich habe mir doch nichts Anderes denken können, und Amerikanisch sprechen sie auch nicht."
„Was ist das, was er sagt?" frug Frau Roßberg rasch, die auf ein paar Worte aufmerksam geworden war.
„Weiter nichts," lächelte Rosenthal, dem die Sache allerdings komisch genug vorkam, „als daß Sie einander wohl /57/ nicht mehr zu verklagen brauchen, Madame Roßberg, denn Sie sind jetzt alle Beide wirklich und ordentlich verheirathet und Mann und Frau."
„Nanu?" rief Pechtels, in die Höhe fahrend, während die Frau den Händler anstarrte, als ob sie einen Geist gesehen hätte.
„Seid Ihr verrückt?" rangen sich ihr zuletzt die Worte von den Lippen.
„Der Richter sagt's," zuckte Rosenthal mit den Achseln, „er hat geglaubt, Sie wollten sich trauen lassen, und die Sache ist abgemacht. Das kostet aber immer fünf Dollars, Herr Pechtels, und ist eigentlich billig genug."
„Jetzt freut mich aber mein Leben," sagte Pechtels und sah den Richter noch immer starr und erstaunt an, „das ist ja doch gar nicht möglich - in den paar Minuten."
„Wenn der Mensch verrückt genug gewesen ist, einen solchen Unsinn zu begehen," rief indeß Frau Roßberg, die sich zuerst wieder von ihrem Erstaunen, aber noch lange nicht von ihrer Entrüstung sammelte, „so mag er es auch wieder auflösen. Sprechen Sie mit ihm, Rosenthal, aber gleich, so lange mir noch hier sind. Nicht einen Fuß setze ich über die Schwelle hinaus, bis ich nicht wieder von dem Menschen geschieden bin."
Rosenthal wandte sich jetzt an den Friedensrichter und bat ihn, dem Verlangen der Dame nachzukommen. Dieser aber sagte achselzuckend:
„Sie sind doch nicht etwa schon anders verheirathet? Das wäre sonst eine verfluchte Geschichte, denn sie hätten in dem Fall einen Meineid geschworen."
„Nein," sagte der Händler, „die Frau ist Wittwe, und der Mann ist Junggeselle."
„Desto besser," nickte der Richter zufrieden, „an der Sache selber aber kann ich gar nichts thun, und wenn sie wieder geschieden werden wollen, so bleibt ihnen nichts Anderes übrig, als sich an die 8upreme Court zu wenden, und da wird's Schwierigkeiten und Umstände genug haben. Ich kann die Leute wohl verheirathen, aber nicht wieder scheiden, oder es gäbe eine Heidenconfusion in den Ehen und Arbeit genug." /58/ „Aber wenn es nun ein reines Versehen war?"
„Das könnte nachher ein Jeder sagen," bemerkte Boyles trocken. „Verheirathet sind sie und bleiben sie; daran läßt sich nichts mehr ändern."
3.
Nach der Hochzeit.
Frau Roßberg sah schon aus den Bewegungen des Friedensrichters, daß er sich weigere, dem Verlangen zu willfahren, und gerieth jetzt in der That fast außer sich. Es war ein Glück für sie, daß Boyles kein Wort von alledem verstand, was sie in ihrer Aufregung vorsprudelte, denn „Esel" und andere Thiernamen gehörten dabei noch zu den mildesten Ausdrücken. An der Sache selber aber ließ sich in der That nichts mehr ändern, und mit der größten Unbefangenheit bestand Boyles noch außerdem fortwährend auf der Bezahlung seiner fünf Dollars von Pechtels, und drohte sogar, diesen als widersetzlich gegen das Gericht einsperren zu lassen, bis er seiner Verpflichtung nachgekommen wäre.
Pechtels machte nun allerdings den Vorschlag, daß sie Beide, er und Madame Roßberg, den „erlittenen Schaden" gemeinschaftlich tragen sollten, aber die Dame, seine jetzige Frau, warf ihm nur einen verächtlichen Blick zu, verließ die Office, rief nach ihrem „Hannes" und rasselte kaum eine Viertelstunde später mit der alten Kathrine nach der Ansiedelung zurück.
Die Madame Roßberg war übrigens eine ganz entschiedene Frau und hatte schon ihren Plan entworfen. Hier konnte ihr natürlich Niemand helfen, denn die Männer hielten ja doch alle zusammen, aber an ihren Consul in Cincinnati wollte sie sich direct wenden, und der müßte und würde ihr auch Recht verschaffen. Das wäre doch noch schöner gewesen, wenn man /59/ nicht einmal zu einem Friedensrichter hätte gehen können, um eine Klage anzubringen, ohne gleich verheirathet zu werden.
Pechtels, wie er seine fünf Dollars bezahlt und den ersten Aerger überwunden hatte, mußte doch lachen; die Geschichte war eigentlich komisch, und daß er gerade mit der Wittwe vom „goldenen Löwen" so gewissermaßen heimtückisch zusammengegeben worden, ein zu wunderlicher und abnormer Fall. Boyles aber wurde, als ihn die „Ladies" verlassen, und er sein Geld in der Tasche hatte, gemüthlich. Er lud Pechtels und Rosenthal zu sich in den Laden und „tractirte", das heißt, er schob Jedem ein Glas und die Whiskyflasche hin, damit sie sich „selber helfen sollten", ließ sich dann noch einmal den Namen des Bräutigams sagen, den er aber hartnäckig mit k statt ch aussprach, und trank dann die Gesundheit der „Madame Pektels und einer Menge von kleinen Pektels, als Nachkommenschaft in der Ansiedelung".
Pechtels mußte natürlich gute Miene zum bösen Spiele machen, und nur das beruhigte ihn, daß Rosenthal nicht gerade jetzt in ihre Gegend fuhr, denn geschwiegen hätte der Bursche ja doch nicht, während er sich darin diesmal wohl sicher auf die beiden Frauen verlassen konnte. Dann fand sich ja wohl auch mit der Zeit eine Art und Weise, diese aus Versehen geschlossene Verbindung wieder zu lösen.
Allerdings versuchte er noch einmal mit Rosenthal's Hülfe den Richter zu bewegen, die fatale Sache ungeschehen zu machen. Er konnte ja „das Blatt einfach herausreißen", wer sah hier danach, und daß sie Alle reinen Mund halten würden, dessen durfte er sicher sein. Boyles aber schüttelte ganz entschieden mit dem Kopf, und selbst als ihm Rosenthal, auf Pechtels' Veranlassung, andeutete, daß es dem Wirth auch nicht auf zehn oder zwanzig Dollars ankäme, um ihm, dem Friedensrichter, „außergewöhnliche Mühe" zu vergüten, so weigerte sich der Yankee trotzdem hartnäckig. Er traute nämlich seinem Factotum nicht und wollte ihn nächstens fortschicken, und da dieser von der ganzen Sache wußte, hätte er ihn schlimm in Verlegenheit und noch schlimmer in Strafe und Verlust des Amtes bringen können.
Die Sache mußte jedenfalls vor der Hand so bleiben, und /60/ Pechtels konnte das nicht besonders zur Genugthuung dienen, daß ihm Rosenthal sagte, er wolle in etwa acht Tagen einmal in der Ansiedelung vorsprechen und sehen, wie sich Alles gemacht habe. Natürlich hielt er den Mund nicht, und der Wirth vom ,,goldenen Affen" wußte genau, was ihm nachher an Spott und Neckereien bevorstand.
Hier kam er übrigens nicht früher fort, als bis er ebenfalls „tractirt" hatte, und dann war Rosenthal daran, und dann wieder - als ,,glücklicher Gatte" der Wirth. Damit aber machte er sich doch von den Uebrigen los; er fühlte sich nicht in der Stimmung zu einem Gelage, am wenigsten mit diesen Menschen, und sein Pferd wieder aufzäumend, ritt er eine kleine Weile später, allein und keineswegs in besonderer Eile, nach der Ansiedelung zurück.
Bunte Gedanken waren es auch, die ihm dabei durch den Kopf gingen, und einmal zügelte er sogar unbewußt und plötzlich sein außerdem schon in langsamem Schritt gehendes Thier ein, als ihm die Möglichkeit durch den Sinn fuhr, daß ihm die Wirthin selber eine solche „Falle" gelegt habe, und er, albern genug, hinein getappt sei. Aber das war auch nur für einen Moment, denn er verwarf den Gedanken fast so rasch wieder, wie er ihn gefaßt hatte. Nein, die Wittwe Roßberg wäre die Letzte dazu gewesen, und er trug jedenfalls an der ganzen Sache genau so viel Schuld, als sie selber. Weshalb hatte er sich auch bis jetzt gar keine Mühe gegeben, um die englische Sprache zu erlernen; nun war das Unglück geschehen, und einen schönen Skandal würde die Geschichte in der Ansiedelung Hervorrufen, wenn sie erst erfuhren, daß sich der „goldene Affe" mit dem „goldenen Löwen" - verheirathet habe. Es war eigentlich zu toll, und kein vernünftiger Mensch hätte etwas so Wahnsinniges auch nur ahnen, viel weniger denn vermeiden können.
Und was jetzt? Das Gescheiteste war am Ende, daß er sein Wirthshaus geradezu verkaufte und in einen andern Staat, am liebsten über den Mississippi hinüber, zog; aber wie hätte der „goldene Löwe" nachher triumphirt, und blieb er hier - der Teufel sollte das Nachdenken und Grübeln holen, und seinem Thier plötzlich die Sporen gebend, sprengte /61/ er den Rest des Weges dahin und in seinen eigenen Hof hinein.
So vergingen die nächsten Tage, und Pechtels betrat in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal die Straße, aus Furcht, die Wirthin gegenüber am Fenster zu sehen. Deshalb brauchte er aber nicht besorgt zu sein, denn Frau Roßberg selber wagte sich, genau aus dem nämlichen Grunde, weder an eins ihrer Fenster noch an die Thür, und doch wußten Beide, daß sich ein Wiederbegegnen wohl künstlich hinausschieben ließ, zuletzt aber doch nicht mehr vermieden werden konnte. Ja, hätten sie in einer großen Stadt gelebt, so wäre es möglich gewesen; hier aber, wo die ganze Häusermasse der kleinen Ortschaft inmitten der Colonie aus der Kirche, zwei Wirthshäusern, einer kleinen Schmiedewerkstatt, einem Kram- und Spezereiladen und etwa fünf Bauerwohnungen bestand, während der Verkehr sämmtlicher Kolonisten nur auf diese angewiesen blieb, war ein längeres Ausweichen nicht gut möglich.
Frau Roßberg hatte indessen in ihrer hinten hinaus liegenden Schlafstube, die sie jetzt bewohnte, die Zeit nicht unbenutzt verstreichen lassen und einen Brief an ihren Konsul aufgefetzt, in welchem sie die ganzen Verhältnisse - auch die mit den beiden Wirthshausschildern - genau beschrieb und darin sowohl, wie in der widerrechtlichen Trauung, Consulatshülfe nachsuchte. Frau Roßberg war aber, wenn auch eine ganz tüchtige Frau und mit der Feder ziemlich gut vertraut, doch keine sehr rasche Briefschreiberin. Die Sache war außerdem zu wichtig und durfte nicht über's Knie gebrochen, sondern mußte klar und einfach, ohne unnöthige Worte ausgeführt werden, und dreimal schrieb sie den Brief über, und brauchte jedesmal dazu drei Stunden, was ihr dann, mit den anderen nöthigen Arbeiten, auch drei volle Tage nahm. Am dritten Tag aber hatte sie das Schreiben „postfertig". Der Mailrider (berittener Postbote) mußte außerdem den nächsten Tag, etwa zur Mittagszeit, durch die Ansiedelung kommen und wechselte da jedesmal Pferde im „goldenen Löwen", und in vierzehn Tagen spätestens konnte sie Antwort von Cincinnati haben. War es doch bis zum Ohiostrom kaum dreißig Meilen, und von da an nahmen die Dampfer die Briefe mit stromauf.
Von Pechtels hatte sie indessen gar nichts gehört, und merkwürdiger Weise war auch von der letzten Begebenheit in Karthago noch gar nichts in der Ansiedelung bekannt geworden. Man frug sie allerdings mehrmals, wie „die Klage" abgelaufen, da sie aber ausweichende Antworten gab: „so rasch ginge eine solche Sache nicht" und dergleichen mehr, so beruhigten sich die Deutschen vollkommen damit. Daß es bei den Gerichten nicht rasch ging, wußten sie alle gut genug aus eigener Erfahrung.
Mit merkwürdiger Verschwiegenheit wahrte aber sogar die Kathrine ihre Zunge, einestheils wohl der „Base" zu Liebe, anderntheils aber auch, weil sie, die gern Staat mit ihren paar Brocken Englisch machte, den Gedanken selber nicht ertragen konnte, daß in ihrer Gegenwart ein derartiges Mißverständniß habe stattfinden können.
Räthselhaft blieb übrigens beiden Frauen das Benehmen des „Affenwirths", denn wie sie anfangs gefürchtet hatten, daß er den unangenehmen Vorfall gegen den „goldenen Löwen" ausbeuten würde, so that er jetzt gerade das Gegentheil, ließ sich nicht einmal blicken und konnte keinenfalls ein Wort gegen irgend Jemanden über die Sache geäußert haben, oder es wäre ihr doch gleichfalls und zwar schnell genug zu Ohren gekommen. Was er freilich beabsichtigte, blieb noch in Dunkel gehüllt, aber - sie sollten an dem nämlichen Tage noch mehr in Erstaunen versetzt werden.
Es war Mittagszeit, die Frau aß gewöhnlich mit der Kathrine allein in ihrer Stube, und das Essen stand schon auf dem Tisch. Die Base war nur noch einmal hinaus gegangen, um das in der Küche vergessene Salz zu holen, als sie aber zurückkam, hatte sie es wieder vergessen und schlug die Hände zusammen und rief vor lauter Erstaunen:
„Nein, denkt Euch nur einmal, Base, nicht für menschenmöglich sollte man's halten, wenn ich's nicht mit eigenen Augen gesehen hätte -"
„Aber was ist denn geschehen, Base?" rief die Wirthin fast erschreckt.
„Was geschehen ist?" sagte aber die alte Frau, „Ihr glaubt's nicht und wenn ich's Euch auch erzähle, aber Ihr /63/ könnt Euch selber überzeugen - der Affenwirth hat seinen Affen abgenommen."
„Der Pechtels?" sagte die Wirthin erstaunt, „aber weshalb?"
„Ja, das weiß der liebe Gott: ich wahrhaftig nicht."
„Vielleicht will er ihn frisch übermalen lassen."
„Aber er war ja noch so gut wie neu."
„Dann steckt eine andere Lumperei dahinter," nickte die Wirthin mit finster zusammengezogenen Brauen, „dem trau' ich Alles zu; wir werden es sehen und erleben."
„Aber der Affe ist herunter," bestätigte die Alte, „so viel ist sicher, und wenn er ihn nicht wieder hinauf hängt -"
„Ja, wenn er," nickte die Wirthin, „und das müssen wir abwarten. Aber jetzt kommt zum Essen, es wird ja Alles kalt, und das Salz habt Ihr auch nicht mit herein gebracht."
Die Alte schoß wieder zur Thür hinaus, und als sie endlich mit der Base am Tisch saß, wollte sie immer wieder vom „Affenwirth" anfangen und sich wundern, was ihn dazu getrieben haben konnte. Die Wirthin aber wehrte ihr; sie mochte wahrscheinlich von der ganzen Sache gar nichts hören und verzehrte still und schweigend ihre Mahlzeit.
Der nächste Tag kam und mit ihm der Postbote, aber das Schild da drüben war in der That verschwunden, und wenn es der Wirth vom „goldenen Affen" nicht wieder festmachte, so konnte sie doch den Brief nicht abschicken, worin sie sich gegen den Konsul darüber beklagte. Das mußte sie jedenfalls wieder herausnehmen und deshalb die nächste Post abwarten, die drei Tage später ging. Der Mailrider passirte jede Woche zweimal die Ansiedelung, und der Brief kam deshalb wieder in ihren Nähtisch, um erst das Weitere abzuwarten.
Und wieder verging der Tag. Das Schild blieb entfernt, und die aus der Ansiedelung kommenden Deutschen, wie die Bewohner des kleinen Orts zerbrachen sich den Kopf darüber, was wohl die Ursache von Pechtels' Benehmen sein könne. Dieser schwieg nämlich hartnäckig darüber, und es blieb deshalb kaum noch einem Zweifel unterworfen, daß der Friedensrichter zu Gunsten der Wittwe entschieden haben mußte. Aber /64/ daß diese dann nicht wenigstens den Mund aufthat, setzte die Leute am meisten in Erstaunen.
Am sechsten Tage, gleich nach der gewöhnlichen Mittagsstunde, kehrte der Händler Rosenthal von einer Tour aus der Nachbarschaft zurück und wie gewöhnlich im „goldenen Affen" ein. Er hielt aber erst eine Weile vor der Thür, weil er das Schild nicht mehr sah, und erkundigte sich, ob das Wirthshaus noch bestehe. In dessen Einrichtung war aber nichts geändert, und der kleine Wagen rasselte in den Hof.
Frau Roßberg hatte durch die Base augenblicklich erfahren, daß der „Jude" eingetroffen sei, und das Herz klopfte ihr fast hörbar in der Brust, denn daß nun ihr Geheimniß bald kein Geheimniß mehr bleiben würde, ließ sich denken. Welches Interesse konnte der Affenwirth auch haben, es zu halten - merkwürdig genug, daß er überhaupt nur so lange geschwiegen hatte.
Die Kathrine war hinausgegangen, um den Kaffee zu besorgen, und die Wirthin saß allein in ihrem kleinen Zimmer, den Kopf in die Hand gestützt, am Fenster, das nach dem Hof hinaus führte, und das Herz war ihr recht zum Brechen schwer.
Da öffnete sich leise und fast geräuschlos die Thür, als sie sich aber doch dahin drehte, sah sie, wie die Kathrine nur den halben Kopf herein steckte und dann mit der äußersten Vorsicht flüsterte:
„Er kommt."
„Er kommt? Wer? Der Rosenthal?"
„Nein - der Affenwirth."
„Der Affenwirth?" rief die Löwenwirthin wirklich erschreckt von ihrem Stuhl emporspringend, „zu mir?"
„Er kommt jedenfalls hier in's Haus herein, und zu wem anders soll er wollen?"
„Der Pechtels?" sagte die Frau noch immer erstaunt.
„Da kommt er schon über den Hof," flüsterte die Base, drückte die Thür wieder zu und that, als ob sie Niemanden gesehen hätte und nur ihrer Arbeit nachgehen wolle, bis sie der Affenwirth selber anrief und nach etwas frug.
Wenige Minuten später klopfte es an der Wirthin Thür, /65/ und der Frau fehlte fast der Athem zu antworten. Aber sie brachte doch ein halblautes „Herein" über die Lippen, und als sich gleich darauf die Thür öffnete, stand Pechtels, den Hut in der Hand, auf der Schwelle und sagte freundlich: „Stör' ich, Frau Roßberg?"
„Nein," erwiderte die Frau, aber wieder kaum verständlich; es kam ihr gar so sonderbar vor, daß der Affenwirth jetzt zu ihr in die Stube trat, ohne daß sie eigentlich einen besondern Zweck mit ihm hatte - und was wollte er nur?
„Frau Roßberg," sagte der Wirth, während er noch immer an der Thür stehen blieb, bis sie ihn durch eine Bewegung mit der Hand nöthigte, näher zu kommen. „Sie sind vielleicht erstaunt über meinen Besuch - aber ich hätte etwas mit Ihnen zu sprechen."
„Bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen?"
„Danke Ihnen," sagte er, während er seinen Hut auf die Commode legte und sich selber einen Stuhl vorschob.
„Und womit kann ich Ihnen dienen?" Die Frau war merkwürdig artig heute, denn es that ihr wohl, daß er sich nicht auf die letzte Zeit bezog.
„Ich wollte Ihnen nur anzeigen," sagte Pechtels, „daß der Krämer, der Rosenthal, den wir neulich in Karthago trafen, heute hier in die Ansiedelung gekommen ist und - heute und morgen hier bleiben will."
„Ich weiß, daß er gekommen ist," sagte Frau Roßberg.
„Ja," meinte Pechtels, „Sie wissen aber nicht, was es für ein unausstehlicher Schwätzer ist, und so sorgsam ich bis jetzt unser - Geheimniß gehütet habe, so dürfen wir kaum hoffen, daß Rosenthal eben die nämliche Rücksicht nimmt."
Frau Roßberg zuckte die Achseln. „Und was läßt sich dagegen thun? Wir Beide sind jedenfalls unschuldig an dem fatalen Mißverständniß, und ich habe schon an unsern Consul geschrieben, der dann das Weitere verfügen wird, um den aus Versehen geschlossenen Act wieder aufzuheben."
Pechtels schwieg eine Weile und sah nachdenkend vor sich nieder, endlich sagte er leise:
„Ich hatte Ihnen noch einen andern Vorschlag machen wollen, muß aber natürlich vorher Ihre Meinung darüber hören." /66/ „Und welcher wäre das?"
„Sie wissen, Frau Roßberg," begann da der Wirth wieder, „in welchem unerquicklichen Streit wir eine ganze Weile gelebt haben -"
„Und wer trug daran die Schuld?" sagte die Frau scharf.
„Zum größten Theil ich selber," erwiderte Pechtels ruhig. „Daß ich das nämliche Schild wie Sie bekam, war allerdings nicht meine Absicht gewesen, und der erbärmliche Stümper von Maler hat das Kunstwerk zu verantworten. Da Sie aber dagegen eiferten, war es eine Art von - ich will es gern eingestehen - ungeschicktem Trotz von mir, es beizubehalten, und daß ich das bereue, habe ich Ihnen schon seit einigen Tagen bewiesen. Der „goldene Affe" existirt nicht mehr."
„Existirt nicht mehr?"
„Nein, ich habe ihn verbrannt und - werde gar kein Schild mehr führen."
„Sie wollen Ihr Wirthshaus aufgeben?" frug Frau Roßberg rasch.
„Das hängt von Umständen ab," sagte Pechtels, „aber Eins möchte ich Ihnen sagen, Frau Roßberg, und Sie recht freundlich bitten, es sich genau zu überlegen. Wir haben uns verfeindet gehabt, ohne uns gegenseitig zu kennen, jetzt hat' uns das Schicksal auf so wunderliche Weise versöhnt, ich wenigstens hege nicht mehr den geringsten Groll gegen Sie und habe ja auch in der Hauptsache schon nachgegeben. Wie wär's, wenn wir den albernen Friedensrichter in Karthago - nicht Lügen straften?"
Die Frau sah ihn erstaunt an, sie begriff nicht gleich, was er meinte; Pechtels aber fuhr fort:
„Sie haben ein hübsches Besitzthum in der Ansiedelung, ich ebenfalls. Sie sind etwa zwei oder dreiunddreißig Jahre alt (Frau Roßberg war sechsunddreißig und fühlte sich geschmeichelt), ich habe gerade so viel und noch ein paar mehr in den Vierzigen. Ebenso verstehen wir Beide die Wirthschaft und können bei Vereinfachung derselben den doppelten Nutzen ziehen. Außerdem bin ich ein halbwegs guter Mensch, ich trinke und spiele nicht, über meinen Charakter können Ihnen meine Leute Auskunft geben, es fällt nie ein hartes Wort /67/ zwischen uns vor. Umstände haben wir außerdem nicht mit unserer Hochzeit, die ganze Sache ist schon pränumerando abgemacht, und es liegt jetzt allein in unseren Händen, einer sehr unangenehmen Rederei und wahrscheinlich auch dem Spott der ganzen Nachbarschaft zu entgehen. Wir sind einmal verheiratet, Frau Roßberg, und ob wir's bleiben, liegt jetzt in Ihrer Hand. Ich," setzte er mit etwas leiserer Stimme hinzu, denn es war ihm, als ob er draußenan der Thür eine Bewegung gehört hätte, „biete Ihnen hiermit, wie es Pflicht des Mannes ist, feierlich meine Hand an. Wollen Sie sie ausschlagen, gut, dann bitte ich Sie nur, daß die Sache unter uns bleibt, und ich verspreche Ihnen noch außerdem, Sie nicht mehr mit dem goldenen Affen zu ärgern. Denken Sie aber günstig darüber, so geben Sie mir morgen Antwort. Ich will Sie nicht drängen, und bis dahin halt' ich Rosenthal ruhig, wenn ich auch nicht länger für ihn einstehen möchte. Also morgen früh um zehn Uhr hol' ich mir Antwort!" - und ohne der Frau auch nur Zeit zu lassen, ein einziges Wort zu erwidern, stieß er die Thür rasch auf, aber auch zu gleicher Zeit draußen gegen einen harten Gegenstand, dem ein lauter Schmerzensschrei folgte.
„Bitte tausendmal um Entschuldigung," sagte Pechtels, als er hinaustrat und die alte Kathrine da stehen sah, die sich den Kopf hielt und laut stöhnte, „wie unglücklich, daß Sie gerade da stehen mußten, haben Sie etwas verloren?"
„Ich suchte den Schlüssel, der heruntergefallen war."
„Thut mir wirklich leid, aber ich hatte keine Ahnung."
„Oh Du großer Gott, mein Kopf!"
„Legen Sie ein kaltes Messer auf, dann giebt's keine Beule," sagte Pechtels und schritt quer über den Hof hinüber, seinem eigenen Hause wieder zu.
Ich will den Leser nicht mit dem Schluß hinhalten.
An dem nämlichen Abend steckte Frau Roßberg den Brief, den sie an den Consul in Cincinnati geschrieben hatte, nicht in den Kasten der Postoffice, die der Händler schräg gegenüber hielt, sondern in den Feuerherd, und als am nächsten Morgen - denn Rosenthal hatte nicht länger schweigen können - ein Gerücht durch die kleine Ortschaft lief, das Pechtels und Frau /68/ Roßberg in außerordentlich nahe Verbindung brachte, ging der Erstere wieder hinüber, um sich seine Antwort zu holen, und daß dieselbe nicht ungünstig ausgefallen, zeigte sich schon an dem nämlichen Tage. Alle Kunden, die im „goldenen Affen" vorsprachen, wurden hinüber in den „goldenen Löwen" gewiesen - Rosenthal fiel mit seiner Neuigkeit förmlich in den Sand, und am nächsten Tage lud Pechtels die Nachbarn und Alles, was vorsprach, zu einem solennen Mittagessen in den Löwen ein, wonach er dann so ruhig Besitz und Führung der neuen Wirthschaft übernahm, als ob die Vereinigung schon seit Jahren vorbereitet und nicht eigentlich das Resultat eines reinen Zufalls gewesen wäre.
Und die Ehe war wirklich, unter so wunderlichen Anspielen sie begonnen, eine glückliche, ja als Mrs. Pechtels, jetzt Mutter eines vielversprechenden jungen Pechtels, einst davon sprach, das abscheuliche Schild mit dem gelben Ungethüm von der Thür zu nehmen, um es mit einem besseren zu vertauschen, nahm Pechtels sen. entschieden die Partei der Carricatur eines Löwen.
Das Schild war es ja doch eigentlich gewesen, was sie Beide zusammengeführt, und schon aus Dankbarkeit hätte er es nun und nimmer missen mögen.
So blieb denn der „goldene Löwe", wie er immer gewesen, aber die kleine Ansiedelung wuchs und gedieh dafür weit rascher, als man je erwartet haben mochte. Anstatt den Centralpunkt der Bahn nämlich nach Karthago zu verlegen, hatte die Eisenbahndirection diesen Platz für passender gehalten. Fünf Jahre später kreuzten sich dort zwei Schienenstränge, und das Grundeigenthum wuchs, je mehr Bewohner sich dorthin zogen, rasend schnell.
Lange noch war aber der „goldene Löwe" das einzige Wirthshaus in dem Ort gewesen, der schon anfing, sich zu einer Stadt heran zu bilden, und während sich Pechtels dabei außerordentlich gut befunden, hatte die Vereinigung der beiden Häuser auch einen wohlthätigen Einfluß aus die Kolonisten ausgeübt. Sie konnten sich nicht mehr ausweichen und mußten dort zusammentreffen, wo sich dann manches alte, lange gehegte Vornrthcil milderte oder auch ganz verschwand. /69/ Erst in der allerletzten Zeit verkaufte Pechtels, der sich viel Geld verdient hatte, ihre beiderseitigen Grundstücke mit dem „goldenen Löwen" zu einem sehr hohen Preis und zog sich dann mit Frau und Kindern nach Deutschland zurück, um hier das in Ruhe zu verzehren, was sie sich drüben über dem Ocean mit Fleiß und Sparsamkeit verdient.
Das Mädchen von Eimeo.
1.
Maita.
Ein blauer Himmel spannte sich über Tahiti - ,,der Perle der Südsee", und die Sonne glühte wohl auf die blitzende See und die bewaldeten Hänge und Spitzen des Gebirgsstocks nieder, oder funkelte in den schmalen Wasserfällen, die von den Klippbänken niedersprangen - aber ihre Gluth drang nicht zu den freundlichen Ansiedelungen nieder, die in dem Schatten zahlloser Fruchtbäume und Palmen lagen, und denen die Seebrise ihre Kühlung zufächelte. In ihrem milden Luftzug rauschten die langen gefiederten Wedel der Cocospalmen, raschelten die breiten, vom Winde ausgerissenen Blätter der Bananen, und tropften, wonnigen Duft verbreitend, die abgeblühten Blumen der Orange, deren Zweige aber trotzdem schon mit goldgelben Früchten bedeckt waren, auf den Boden nieder.
Es war einer jener wunderbaren, zauberschönen Morgen, wie wir sie, in dieser Pracht - in diesem Reichthum wirklich nur in den Tropen finden, und während das Land hier in all' seiner paradiesischen Schöne, so frisch und jung, wie eben aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen, lag, donnerte dazu draußen an den Korallenriffen die ewige Brandung ihr altes Schlachtenlied, das in früheren Jahrzehnten wohl das junge glückliche Volk zum Tanz gerufen, wenn sie im Tact der rollenden Wogen ihren Reigen bildeten. Jetzt aber darf es keinem solchen Zweck mehr dienen - denn die In-/71/sulaner sind Christen geworden, und alle heidnischen Gebräuche wurden von den Missionären streng verpönt.
Aber die Brandung donnert fort; ihre mit weißem blitzenden Schaum gekrönten Häupter schleudern noch, wie in vergangenen Jahrtausenden, die krystallenen Massen gegen den Korallen-Damm; an den sonnigen Ufern flüstert die Brise in den Wipfeln der Cocospalme und malt die Sonne ihre Regenbogen in den stürzenden Wassern ihrer Cascaden. Nur das Volk ist ein anderes geworden - ob besser? - wer kann das sagen? Unverdorbener gewiß nicht, als in seiner alten Heidenzeit, denn das Wesen der christlichen Religion verstanden sie nicht zu erfassen, aber die Laster und schlechten Gewohnheiten der Fremden nahmen sie willig an, und während sie den Glauben an ihre alten Götter verloren, fehlte ihnen Herz und Sinn für den neuen Gott, dessen Wirken sie nicht begriffen, und den sie deshalb weder fürchteten noch ihn liebten.
Dazu mochte wohl viel die starre Dogmatik der ersten Missionäre - zelotische Protestanten - beigetragen haben, die den ganzen Gottesdienst nur in der Form suchten und fanden. Da sie diesen Heiden aber nichts weiter brachten als eine - ihren ganzen Sitten und Gebräuchen, ihrer ganzen Natur nicht zusagende starre Form, so konnten sich die Indianer auch nur wenig damit befreunden. Wo sie die neue Religion annahmen, geschah es theils in dem Glauben, einen mächtigeren Gott zu bekommen, der sie in ihren Kriegen besser schützen konnte, als ihre Götzen es vermocht, theils aus Eigennutz, um sich ausgehaltene Geschenke anzueignen - selten - oh wie selten, aus wirklicher Ueberzeugung, und der Erfolg zeigte denn auch den Nutzen, den ihnen die neue Lehre brachte: sie genügten eben der vorgeschriebenen Form, und glaubten damit Alles gethan zu haben, was man von ihnen verlangte - und man verlangte auch in der That oft nicht mehr von ihnen.
Wohin die Missionäre freilich drangen, bildeten sie einen Kreis von Anhängern um sich her; aber Viele beharrten trotzdem auf ihrem alten, von den Voreltern ererbten und für heilig gehaltenen Glauben, und daß dadurch endloser Unfrieden in Familien gebracht und viele sonst für das Leben /72/ geknüpfte Bande zerrissen wurden, läßt sich denken. Auf manchen Inseln der Südsee - ja auf sehr vielen, bildeten sich zwei feindliche Parteien; die eine, von den Missionären dazu aufgefordert, verbrannte und zerstörte die Götzenbilder, und die andere, darüber entsetzt und empört, griff in blinder Wuth zu den Waffen, um ihre bisherigen Heiligthümer zu retten oder zu rächen. Blutige Kriege wurden dabei geführt und die milde, versöhnende Lehre des Heilands, wie auf dem amerikanischen Continent, mit Feuer und Schwert verbreitet und mit rauchendem Blut bekräftigt.
Die friedlichen Insulaner aber bekamen die ewigen Kämpfe bald satt. Ueberhaupt indolent in ihrem ganzen Wesen, und von der, ihre Gaben mit vollen Händen spendenden Natur verwöhnt, ermüdete es sie, für etwas ihr Leben einzusetzen, das ihnen bisher noch keine Unbequemlichkeit gemacht hatte. Die Meisten wurden Christen und würden auch wohl jedenfalls den christlichen Glauben für den besseren gehalten haben, wenn sie nicht die christlichen Missionäre selber darin irre gemacht hätten. Den protestantischen Geistlichen folgten nämlich katholische - oder auch umgekehrt, und lehrten dabei verschiedene Formen, indem sie die vorher von Anderen als heilig hingestellten verwarfen - ja die protestantischen Missionäre suchten sogar die Eingeborenen zu überreden, daß die Katholiken auch nichts Anderes wären als Götzenanbeter, und daß sie deren Glauben meiden sollten. Natürlich konnte das die Indianer nicht in ihrer neuen Religion befestigen. Sie mußten an einer Lehre zweifeln, über welche sich die Fremden selber noch nicht einmal geeinigt hatten, und Manche fielen heimlich wieder von dem neuen Glauben ab.
Am unwilligsten trug aber das junge Volk den Druck, besonders die jungen Mädchen, denn die zelolischcn protestantischen Missionäre verlangten von ihnen nichts als Entsagung und Beten. Ihre Tänze, denen sich die Jugend sonst mit aller Lust hingegeben, wurden als heidnisch und sündlich verpönt und verboten. Nicht einmal mit den prachtvollen Blumen ihrer Wälder sollten sie sich mehr schmücken dürfen, weil auch das an ihre heidnischen Aufzüge und Festlichkeiten erinnerte, und dafür, anstatt lustig bei dem Toben der Brandung herum /73/ zu springen, in großen und dicken, ihnen von den Fremden gebrachten Büchern lernen und lesen, deren Sinn sie doch nicht begreifen, deren Worte sie nicht einmal aussprechen konnten. Wenn sie es aber nicht thaten, dictirten ihnen die von den Missionären gewonnenen Häuptlinge Strafen, die ebenfalls ihrer ganzen Natur widerstrebten. Straßen mußten sie bauen, deren Bedürfniß sie nie gekannt, und steinerne Kirchen, wo ihnen wie ihren Göttern bis jetzt ein Palmendach Schutz und Schirm gegeben. Während sie so der Form nach Christen werden mußten, wurden sie im Herzen Heuchler und gaben sich dem wilden Leben, wo das ungestraft oder unbemerkt geschehen konnte, nur so viel zügelloser hin.
Aber den lästigen Zwang der Missionäre brach auf einigen Inseln die Ankunft der Feranis - wie sie die Franzosen nannten. Die protestantischen Geistlichen hatten, besonders auf Tahiti, ihnen gefährlich werdende katholische Priester selbst mit Gewalt entfernt und auf ein kleines Schiff bringen lassen, das sie an einer entlegenen Insel aussetzen sollte, und die französische Regierung hielt die Gelegenheit für passend, festen Fuß in diesen Gewässern zu fassen - Kriegsschiffe wurden abgesandt, die zuerst eine Entschädigung für die vertriebenen Priester verlangten, und dann ohne Weiteres ein Protectorat - dem Namen nach - über die Gesellschafts-Inseln anzutreten, in Wirklichkeit jedoch sich zum Herrn der von der Königin Pomaré beherrschten Inselgruppe auszuwerfen. Wie jetzt aber - was bis dahin nicht der Fall gewesen - jedem Indianer freigestellt wurde, zur katholischen Religion überzutreten, so brachten auch die lebenslustigen französischen Soldaten bald wieder einen neuen Geist - freilich nicht immer zum Guten - unter die Bevölkerung. Der starre, bigotte Zwang war aber wenigstens gebrochen - die harmlosen, gutmüthigen Indianer durften wieder frei aufathmen, die Mädchen wieder tanzen und sich mit Blumen schmücken, und wie Gespenster einer früheren Zeit gingen nur noch die jetzt blos geduldeten protestantischen Missionäre in ihren schwarzen Tuchröcken zwischen ihnen herum und drohten ihnen mit ewigen Strafen und Verdammniß.
Aber das leichtherzige Volk machte sich deshalb wenig Kummer. Nicht einmal um den morgenden Tag sorgen sie /74/ sich ja, wenn ihnen der heutige Alles bietet, was sie brauchen - wie sollten sie sich Sorgen um die Zukunft - um ein Leben nach dem Tode machen. Es lag das viel zu weit hinausgerückt, um auch nur daran zu denken.
So wogte auch heute das muntere, blumengeschmückte Volk in fröhlichem Treiben am Strande von Papetee - der Hauptstadt Tahitis und dem Sitz des französischen Gouvernements - auf und ab, denn die französische Regimentsmusik stand vor dem Hause des Gouverneurs und spielte ihre lustigen Weisen und Märsche, und die klangen ihnen freilich besser und melodischer in die Ohren, als die monotonen Psalmen und Kirchenlieder, die sie bis dahin hatten Stunden lang singen müssen.
Wie das herüber und hinüber wogte, und wie bunt die Schaar aussah, in ihren blauen, rothen, weißen, gelben, geblümten oder gestreiften langen Gewändern, und wie prachtvoll sich die jungen, bildhübschen Mädchen das schwarze, lockige und seidenweiche Haar mit Blumen und dem wehenden, künstlich geflochtenen und schneeweißen Bast der Arrowroot geschmückt hatten! Und wie das dem lebenslustigen sorglosen Volk in den Füßen zuckte, wenn der Tact der Musik die Erinnerung an ihre eigenen Tänze in ihnen wach rief, und wie sie dabei fröhlich mit einander lachten und plauderten!
Aber auch die männliche Bevölkerung war, und zwar zahlreich, am Strand vertreten; eine Menge von französischen Soldaten und selbst Officieren schlenderten am Ufer herum und plauderten mit den Mädchen, und dazwischen schritt mancher tahitische Stutzer, den bunten Pareu kokett um die Lenden geschlagen, das Schultertuch malerisch umgeworfen, und die Locken mit Streifen von ineinander geflochtener weißer Tapa und rothem Flanell durchwunden, was ihnen zu den bronzefarbenen Gesichtern gar nicht so übel stand.
Und wie sich die leichtfertigen Franzosen amüsirten, wenn manchmal ein indianischer Mitonare (Missionär - wie Alles von ihnen genannt wird, was mit der Religion der Christen in Berührung steht, ja sogar ihr Wort für „fromm" bildet) langsam und gravitätisch zwischen ihnen durchschritt, einen vorwurfsvollen Blick auf die Mädchen warf, und dann seufzend das Auge nach oben drehte, als ob er Feuer und Schwefel /75/ auf die sündhafte Bande herab erbitten wolle. Aber die Burschen sahen auch gewöhnlich so komisch aus, daß man schon über ihre persönliche Erscheinung lachen konnte, ohne sie gerade in ihrem Glauben zu verspotten. Die protestantischen Missionäre hielten nämlich den schwarzen Frack und Cylinderhut unerläßlich für eine geistliche Stellung in der Welt, und dazu brachten sie auch die von ihnen angelernten Mitonares - aber nicht zu Hosen und Stiefeln oder Schuhen, zu welchen sie sich unter keiner Bedingung verstehen wollten. So kam es denn, daß sie nach oben, wie ehrbare Christen - sogar oft mit weißer Weste und Cravatte, nur etwas braunen Gesichtern herumliefen, während ihnen nach unten noch der bunte Kattun-Pareu um die nackten und meistentheils tätowirten Beine hing, was ihnen natürlich, besonders mit den schwarzen Frackzipfeln auf dem bunten Kattun, ein höchst wunderliches und originelles Aussehen gab.
Allerdings war es den Eingeborenen, seit sie Christen geworden, auf das Strengste untersagt worden, sich zu tätowiren, weil das ebenfalls mit ihren altheidnischcn Gebräuchen in Beziehung stand. Aber die alten Tätowirungen ließen sich eben nicht wieder wegbringen, sie mußten nun einmal so „aufgebraucht" werden, und zeigten jetzt höchstens, mit einem Blick nach unten und nach oben, was der Träger derselben früher gewesen - und was er jetzt war.
Im Ganzen blieb aber doch ein inländischer Mitonare in diesem fröhlichen Gewirr nur eine höchst vorübergehende Erscheinung, die, wie eine dunkle Wolke an der Sonne, rasch vorbeizog und dann wieder Licht und Leben auf allen Gesichtern blicken ließ. Manche der Eingeborenen freilich - die früher vielleicht zu eifrigen und frommen Christen gezählt worden und sich jetzt wieder in den alten Strudel gestürzt hatten, zogen sich scheu hinter die Anderen zurück, wenn sie seiner ansichtig wurden. Sie mochten seinem vorwurfsvollen Blick nicht begegnen, die Mehrzahl aber kümmerte sich gar nicht um ihn, und mit dem Bewußtsein, von einer stärkeren und dabei weit nachsichtigeren Macht beschützt zu werden, boten sie Allem keck die Stirn.
Die Militärmusik war beendet und das Musikcorps wieder /76/ nach seinem Sammelplatz oder in seine Quartiere abmarschirt, aber das Menschengewoge am Strand verlief sich noch immer nichr, und durch die Musik angeregt, bildeten sich hier und da kleine Gruppen von Singenden, die, fast immer vierstimmig und in reinster Harmonie, entweder die eben erst gehörten Melodien nachzusingen suchten, oder auch dann und wann wieder in ihre alten Hymnen fielen, während Schaaren von Zuhörern sie umstanden und, wenn sie schlossen, mit rauschendem Beifall in die Hände schlugen.
Während so noch Männer und Frauen bunt durcheinander gemischt und mit mancher blauen Uniform dazwischen dort standen, kam ein einzelnes junges Mädchen den Weg herab, der von der sogenannten „Besenstraße" - dem großen prachtvollen Weg, der um einen Theil der Insel läuft - niederführte.
Es war eine schlanke, edle Gestalt, noch voll Jugendfrische; aber gar so ernst schauten die schönen dunkeln Augen um sich her, und die scharfgeschnittenen Brauen waren fest zusammengezogen, ebenso die feinen Lippen geschlossen. Nicht eine einzige Blume oder ein anderer Tand schmückte ihr Haar oder ihren Körper, ja sie schien sogar die Kleidung oder die Stoffe zu verschmähen, die ihnen von den Weißen, den verhaßten Fremden, herübergebracht worden. Ein Pareu von weicher gelbbrauner Tapa, der ihr nur wenig über die Kniee reichte, umschloß ihre Hüften und zeigte die tadellos schönen Formen ihres untern Beines, während ein kurzer Ueberwurf von demselben Stoff, der tehei, ihre Schultern und den Oberkörper verhüllte. Voll und lockig hing ihr dabei das rabenschwarze Haar am Nacken nieder, von keiner Blume geziert, von keiner Faser Arrowroot gehalten. Wie sie die Arme untergeschlagen trug, wanderte sie - jedenfalls eine Fremde - still und finster zwischen den geputzten fröhlichen Menschen hin, und nur ihr Blick überflog forschend die Gruppe, als ob sie irgend Jemanden suche. Sie hielt sich aber deshalb nicht auf - sie blieb nicht stehen, wo sic einen dichteren Knäuel Menschen versammelt traf. Nur im Vorbeigehen musterte sie die ihr Begegnenden, und als ein paar Fremde, von der wirklich auffallenden Schönheit des Mädchens, vielleicht auch /77/ durch ihre, jetzt und hier, auffällige Kleidung angezogen, sie in ihrer Bahn aufhalten und anreden wollten, blitzte sie die Frechen mit den großen, dunkeln Augen trotzig an und eilte dann nur um so rascher vorwärts.
Eben wollte sie auch in eine der Seitenstraßen rechts einbiegen, denn hier am eigentlichen Strand liegen nur die Häuser der reicheren Europäer, der Missionäre, der Consule und einiger Häuptlinge, und erst eine Strecke dahinter, mitten in einem wahren Wald von Brodfruchtbäumen, Orangen und Cocospalmen, beginnen die eigentlichen Bambushütten der Eingeborenen, in denen sie sich eher heimisch fühlen konnte. Da hielt sie plötzlich in ihrem raschen Gang inne - ihr Auge haftete stier und erschreckt auf einer kleinen Gruppe von Eingeborenen, die sich ebenfalls um ein ähnliches Quartett gesammelt hatten und so zusammengedrängt standen, daß sie von dem, was außer ihrem Kreise vorging, gar nichts sahen, und auch wohl nichts sehen wollten.
Noch schien die Fremde nicht fest überzeugt zu sein, ob sie den, den sie wahrscheinlich gesucht, auch wirklich vor sich habe. - Sie schritt langsam und wie zögernd näher, und wandte sich jetzt etwas zur Seite, daß ihr Blick das Angesicht - wenigstens das Profil des dort Stehenden überfliegen könne; aber bald mußte auch ihr letzter Zweifel gehoben sein, denn jetzt schritt sie auf ihn zu, und dicht hinter ihm stehen bleibend, haftete ihr Auge in Zorn und Schmerz auf der schlanken Gestalt des Mannes.
Es war ein Eingeborener, aber in der vollen Tracht seines Volkes, nur in den bunten und sogar grellgefärbten Kattun gekleidet, den ihnen die Fremden gebracht und durch das weiche und auch festere Gewebe dieses Stoffes bald die alte, sonst gewohnte Tapa verdrängt hatten. Seine langen lockigen Haare trug er aber sorgfältig eingeölt und gekämmt und mit einem der vorher beschriebenen Bänder zurückgehalten, und das Schultertuch war von der linken Schulter zurückgeschoben, weil er mit dem linken tätowirten Arm ein neben ihm stehendes bildhübsches und noch blutjunges Mädchen umschlossen hielt, das sich dicht an ihn schmiegte. Beide waren aber so in den vor ihnen ausgeführten Gesang vertieft, daß sie die Fremde gar /78/ nicht bemerkten, bis diese endlich ihre Hand auf die Schulter des Mannes legte und mit leiser, von innerer Erregung bebender Stimme sagte:
„Patoi - find' ich Dich so, falscher Tanate, der Du mich aus meiner Heimath fortgelockt, um mich elend verderben zu lassen? Und war es nicht genug, daß Du mich zu Grunde richtetest - hast Du Deine gierige Hand schon wieder nach einer andern Blume ausgestreckt? Oh, hüte Dich vor ihm, Schwester, hüte Dich. - Die Hand Atua's, des starken Gottes, liegt auf ihm, und er wird Dich verderben, wie er selber seinem Verderben entgegengeht."
Erstaunt hatten sich die übrigen und nächststehenden Eingeborenen, während das Quartett ruhig seinen Gesang fortsetzte, nach der Fremden umgedreht, und während Patoi - eben wohl nicht angenehm überrascht, einen Schritt zurücktrat, drängte das junge Wesen an seiner Seite, das er aber jetzt plötzlich losgelassen, gegen die Fremde vor und rief zornig:
„Was willst Du von ihm, Wahine? Ich bin sein Weib."
„Sein Weib?" lachte da höhnisch die Fremde. - „Und gestatten Euch Eure Mitonares, Patoi, zwei Frauen auf den Inseln zu nehmen? - Aber nein! fort von ihm, Du Falsche - Du lügst - hier steht sein Weib, dem er vor den Schädeln unserer Voreltern Treue geschworen. – Eita anei oe a faarue i ta oe vahina?1 frugen ihn die Priester, und er antwortete eita. Das Zuckerrohr in dem geheiligten Mirozweig hat unsere Häupter berührt und zwischen uns gelegen - und hundertmal log er mir vor, wie glücklich er sich an meiner Seite fühle."
„Patoi?" rief das junge Weib entsetzt, indem sie fort von seiner Seite trat. Patoi aber, der mit finster zusammengezogenen Brauen die Anschuldigung gehört, hatte indessen Zeit bekommen sich zu sammeln, und den Arm ausstreckend, sagte er finster:
„Geh fort von hier, Frau - ich kenne Dich nicht - ich weiß nicht, woher Du kommst, noch wo Deine Eltern /79/ wohnen, oder ob Dich die Brandung an den Strand gespült - geh fort! Diese hier ist mein Weib, mir von einem heiligen Mitonare angetraut. Was gehen mich die Schädel Deiner Vorfahren an - ich bin ein Christ!"
Die ganze Gestalt des jungen Weibes zitterte und bebte, als die kalten Worte dessen, der sie verrathen, zu ihren Ohren drangen. Unwillkürlich erhob sich ihr Arm - ihre Augen blickten stier auf ihn - ihre Lippen theilten sich, und mit fast heiserer Stimme preßte sie die Laute vor:
„Du kennst mich nicht, Patoi? Du kennst die Frau nicht, die Du in Deinem Canoe von Eimeo hier herübergebracht - der Du vorgelogen, daß Deine Eltern hier in Tai arabu große Besitzungen hätten, und die Du dann heimlich - niederträchtig verlassen, daß sie sich an fremden Thüren ihre Brodfrucht betteln und mühsam zurück den Weg suchen mußte, der sie ihrer Heimaths-Insel näher brachte?"
„Sagt sie die Wahrheit, Patoi?" rief aber auch jetzt das junge Weib erschreckt, indem sie den Arm des Mannes faßte - „sagt sie die Wahrheit?"
„Nein," erwiderte Patoi kalt, „sie lügt - sie ist nicht mein Weib. Welcher Mitonare hat unsere Hände zu dem heiligen Bunde ineinander gelegt, der nie mehr getrennt werden kann? - frage sie!"
„Oro's Zorn über Deine Mitonares!" zischte aber jetzt die Fremde zwischen den zusammengebissenen Zähnen durch - „daß sie Atua verderbe und vernichte und das Land Pomare's rein von ihnen fege! Was kümmern sie mich, was hast Du mit ihnen zu thun?"
„Sie ist wahnsinnig!" rief Patoi den jetzt immer mehr heranpressenden Eingeborenen zu. - „Die bösen Götter sprechen aus ihr. Ich habe nichts mit ihr zu thun - ich bin ein Christ."
„Und Du willst nicht mit mir zurückkehren nach Eimeo?" rief die Fremde, und das bleiche, schöne Antlitz derselben bekam einen fast dämonischen Ausdruck. - „Du willst Deinen Schwur, den die Götter gehört, brechen und Dein Weib verstoßen?"
„Du bist nicht mein Weib!" sagte der Eingeborene finster, /80/ indem er den Arm seiner jungen Frau ergriff, „komm, Alùa, laß uns gehen. Sie ist rasend.“
„Ha, falscher Abtrünniger!" rief da das junge fremde Weib, indem es sich hoch und stolz emporrichtete - „kannst Du den Blick des Wesens nicht ertragen, das Du so schändlich hintergangen und betrogen? Aber selbst die Feranis, die mordend in unser Land kamen, haben Gesetze und strafen den Schuldigen, und sogar Deine Mitonares müssen Dich verdammen, wenn sie erfahren, wie Du einen Schwur gebrochen. Halt! laßt ihn nicht fort!" schrie sie aber laut über die jetzt von allen Seiten herbeidrängende Menge der Neugierigen hin - und selbst die Sänger hatten ihr Quartett unterbrochen - „Wo ist Euer Häuptling, daß ich ihn spreche und meine Klage vorbringe? Da steht der Verbrecher - eines Eidbruchs schuldig, und ich will zwischen Euch treten und es beweisen."
Patoi hatte allerdings versucht, sich der ihm unbequem werdenden Anklage zu entziehen, indem er mit seiner jungen Frau der Zornigen aus dem Wege ging. Aber schon der herbeiströmende Menschenschwarm machte das unmöglich, denn wie das überall so ist, drängte von rechts und links Alles herzu, was sich nur in der Nähe befand, und selbst aus der Seitenstraße liefen die Eingeborenen heran, um zu sehen und zu hören, was es da gäbe. Patoi sah sich denn solcher Art bald von der Menschenmasse eingeschlossen, und da die Polynesier gerade so neugierig sind, wie unser eigener Volksstamm - besonders die Frauen, die lieben Geschöpfe - so suchte Alles zu ihm zu gelangen, um zu erfahren, was da eigentlich vor sei, und selbst die fremde Frau, um die sich besonders die Mädchen schaarten, sollte erzählen.
„Gut! gut!" rief da Patoi - nur in dem Wunsche, jetzt hier weg zu kommen und seine Frau aus dem Bereich einer weiteren Enthüllung dieser Sache zu bringen, - „hier ist nicht der Platz, ich will Euch vor dem Richter Rede stehen - bestimmt die Zeit - was hab' i ch zu fürchten, ich bin ein Christ. - Gebt Raum da, Freunde - gebt Raum! Patoi wird sich sicher stellen, wenn man ihn ruft - Ihr wißt, wo er zu finden ist," - und damit drängte er sich durch die ihm jetzt wirklich Raum gebende Menschenmasse hindurch, um nur /81/ erst einmal seine eigene Hütte, oder die seiner Frau zu gewinnen. Es kamen immer mehr Menschen, besonders viel Fremde hier zusammen, und denen wollte er doch, so rasch als möglich, aus dem Wege gehen.
2.
Ein Häuptlings-Gericht auf Tahiti.
Patoi verließ nun allerdings den Strand von Papetee und war bald in dem Schatten der Orangen- und Brodfruchtbäume verschwunden, aber desto mehr drängte jetzt das neugierige Insulaner-Volk um die fremde Frau her, und vorzüglich die Mädchen hatten bald einen festen Kreis um sie gebildet und schienen entschlossen, der Sache, um welche es sich hier handle, auf den Grund zu kommen.
Das junge schöne Weib zeigte aber nicht die geringste Lust, sich hier in einen Straßenklatsch einzulassen; das Herz war der Armen auch wohl zu schwer. Mit sichtbarer Mühe hatte sie die Thränen zurückgezwungen, die ihr in die Augen steigen wollten, und sie sagte ernst, aber nicht unfreundlich:
„Was wollt Ihr von mir? was soll ich Euch sagen? - er hat mich aus dem Hause meiner Eltern fortgelockt und den heiligen Schwur gebrochen, der uns für ewige Zeiten binden sollte. Ich bin auch nicht die einzige Verrathene hier," setzte sie düster hinzu. „Die Fremden haben Sünde und Verbrechen in dies Land getragen, daß sie sich ausbreiteten, wie die Guiaven am Strand, und ihre Wurzeln frech in jede Heimath schlugen. Es ist das jetzt eine Gewohnheit geworden, was sonst die Rache der Götter und die Strafe der Häuptlinge auf sie niedergezogen hätte. Doch laßt mich! ich will sehen, ob noch Recht und Gerechtigkeit unter diesen Palmen herrscht, oder ob die neue Lehre mit der neuen Sünde Hand in Hand geht. /82/ Ich verlange nichts als mein Recht, und das muß mir werden. Wo wohnt der Häuptling?"
,,Komm, Wahine!" sagte einer der jungen Burschen, der sich zu ihr durcharbeitete - „ich will Dich zu ihm führen. Aber wie heißt Du und wo kommst Du her? Du bist fremd hier."
„Ich heiße Maita und stamme von Eimeo2 - aber die Palmen meines Vaters liegen drüben gegen Sonnenuntergang."
„Und hast Du keine Freunde auf Tahiti?"
„Keinen, als den, der jetzt mein schlimmster Feind geworden," sagte das junge Weib düster. - „Nie im Leben habe ich vorher mein Heimathland gekreuzt, oder mein Canoe aus den Riffen hinausgelenkt - bis der Falsche kam, der mich hinweglockte - aber fort! Wo ist das Haus des Häuptlings? Laßt mich mit ihm sprechen."
„So komm," sagte der junge Bursche wieder und ergriff ihre Hand, die sie ihm überließ, und während ihr die Uebrigen den Weg frei ließen, dann aber sich ihr anschlossen und ihr folgten, bogen sie ebenfalls rechts ein in die eigentliche indianische Stadt, um dort die Hütte des „Richters" aufzusuchen, denn die Fremde gedachte nicht die Hülfe der weißen Feranis anzurufen, um den Schuldigen zu strafen. Gegen ihre eigenen Gesetze hatte er gesündigt, und der eigene Häuptling des Districts oder der Insel sollte deshalb auch entscheiden.
Diesen fanden sie allerdings nicht daheim - die Mitonares hatten eine Versammlung, der er, da er den Eingeborenen selber das Evangelium predigte, beiwohnen mußte. Es war auch eine gefährliche Zeit für die „Kirche", denn die englischen Missionäre sahen plötzlich ihren ganzen Einfluß untergraben und bedroht, und während früher viele der von ihnen „bekehrten" Heiden zum Katholicismus übertraten, fielen sogar andere wieder in ihr altes Heidenthum zurück und gaben dadurch den anderen ein entsetzliches Beispiel. Und nicht einmal einschreiten konnten sie gegen diese Sünder, denn die brauchten sich nur unter den Schutz des französischen Gouver-/83/nements zu stellen, um vollkommen sicher zu sein, daß die protestantischen Missionäre keine Hand an sie legen durften.
Die heutige Conferenz galt dem Gegenstand, wie es möglich sei, einen andern Zustand herbei zu führen, und ob es nicht gerathen wäre, unverweilt Einen aus ihrer Mitte nach England zu senden, um von dort wirksame - das heißt bewaffnete Hülfe gegen die Uebergriffe der Franzosen zu erbitten, die ja schon im ganzen Land die Herren spielten.
Das arme und fremde junge Weib wurde aber nichtsdestoweniger von der Gattin des „Mitonare Mahova", wie der würdige Geistliche uud Friedensrichter hieß, auf das Freundlichste aufgenommen. Die Gastfreundschaft dieser Inseln kennt keine Grenzen, und selbst die ärmsten Eingeborenen theilen willig das Letzte mit dem Fremden, wenn er ihre Hütte betritt.
Maita bekam Speise und Trank - eine milchgefüllte Cocosnuß wurde ihr gebracht, gebackene Brodfrucht und kleine saftig gebratene Fische. - Auch eine weiche, zartgeflochtene Matte breitete die alte gute Frau für sie aus, auf der sie ruhen konnte von ihrem langen Marsch, nnd dann erst mußte sie erzählen, was sie hierher geführt. Freilich machte die alte Indianerin, die Frau des Mitonare, große Augen, als sie erfuhr, daß ihr junger Gast noch zu denen gehöre, die ihre „Irrthümer" nicht abgeschworen und an ihren früheren Götzen hingen, und sie fürchtete deshalb fast die Rückkehr ihres Gatten, der in solchen Dingen entsetzlich streng war. Aber ihrer Gastfreundschaft konnte das keinen Abbruch thun: die Fremde - ob Heidin oder Christin - mußte erst ausruhen und Trank und Speise zu sich nehmen, und alles Andere fand sich dann nachher, wenn ihr Gatte, der Mitonare, kam - sie war jedenfalls eine bessere Christin als wahrscheinlich der Mitonare selber.
Der fromme Mann kam endlich, und es war ein strenges Examen, das er mit dem armen jungen Weibe anstellte. Er frug sie auch weit weniger nach dem, was sie hergeführt, nach dem Leid, was ihr angethan, sondern mehr, viel mehr nach der Veranlassung, daß noch Eingeborene auf der Nachbarinsel, auf welcher die frommen weißen Männer schon so lange gewirkt, dem bösen heidnischen Glauben anhängen könnten, /84/ und ob sie denn gar nicht die einstigen Strafen des Himmels fürchteten.
Maita wich den Fragen aus. Nicht deshalb war sie hergekommen, um über die alte Lehre zu streiten, der treu anhängend ihre Eltern und Voreltern gestorben waren; nur ihr Recht wollte sie au einem Abtrünnigen verfolgen, der den Eid gebrochen, und kein Vergehen war von den Göttern mit strengeren Strafen belegt worden, als gerade dieses. Dem Friedensrichter blieb denn auch, da sie hartnäckig auf ihrem Verlangen bestand, eine öffentliche Gerichtssitzung zusammen zu berufen, nichts Anderes übrig, als ihr zu willfahren. Er durfte es - wie er recht gut wußte - nicht zurückweisen, ohne sich selber in Mißcredit zu setzen, und seine Boten eilten deshalb bald nachher durch ganz Papetee, um diejenigen der Eingeborenen, die berechtigt waren, in einem solchen Rath zu sitzen, dazu einzuladen. Auch der Verklagte, dessen Namen und jetzige Familie die gute Frau des Mitonare schon lange vor dem indeß zahlreich eingetroffenen Besuch herausbekommen, wurde vorgefordert, um sich gegen die Anschuldigung der Fremden zu vertheidigen, und die Familie von dessen Frau eilte natürlich ebenfalls herbei.
Alúa's Eltern waren reich und angesehen in Papetee. Ein großer Cocospalmenhain gehörte ihnen, ebenso eine neu angelegte Zuckerplantage; ihr Vater besaß sogar einen kleinen Kutter, auf welchem er mit den zu windwärts gelegenen Inseln Handel trieb und dort Cocosnußöl und beech la mar3 eintauschte, während er ihnen von den Missionären oder landenden Walfischfängern eingetauschte europäische Stoffe und Schmuck oder Eisenwaaren - ja man sagte: auch heimlich spirituöse Getränke brachte. Es verstand sich von selbst, daß den Nachbarn eine solche Klage nicht gleichgültig sein konnte, die sich gegen eine der angesehensten Familien des Orts richtete und schon durch ihre Öffentlichkeit den bösen Zungen der Insel Gelegenheit gab, üble Nachreden über sie durch das Land zu tragen. Wenn das Gericht sich aber auch nicht umgehen ließ, so hatte die arme Fremde doch, außer in dem Mitgefühl des weiblichen Theils der Bevölkerung - nur auf geringe Unterstützung zu rechnen. Die ganze Sache war dem /85/ aristokratischen Theil der Bevölkerung unangenehm, und je eher und rascher sie deshalb beigelegt wurde, desto besser.
Trotzdem vergingen noch immer wenigstens einige Stunden, bis die nöthige Zahl der Beisitzer herzugerufen, und der kaum hundert Schritt von der Berathungshütte entfernt wohnende Verklagte - der Indianer Patoi herbeigeholt werden konnte, um der Klage der Fremden Rede zu stehen.
Welch ein wunderliches und doch wie malerisches Bild bot aber die Versammlung dieser einfachen Insulaner, die hier über das Vergehen Eines ihrer Landsleute zu Gericht sitzen und ihn in der nächsten Stunde entweder freisprechen oder verurteilen sollten.
Die Sonne stand zu hoch am Himmel, um das Verhör in der eng eingeschlossenen und nur wenig dem frischen Luftzug offenstehenden Hütte abzuhalten. Draußen, im Schatten einer Anzahl von Brodfrucht-, Manga- und Orangenbäumen war es kühler, und dorthin konnte auch die frische Seebrise streichen, die von Point Venus herüberwehte.
Man konnte sich keinen prachtvolleren Gcrichtssaal denken. Gerade über der Stelle, auf welcher Mahova, der eingeborene Missionär und Friedensrichter, Platz genommen, stieg der schlanke Stamm einer mächtigen Cocospalme weit über das viel niedrigere Wipfelwerk der Fruchtbäume empor und wölbte seine gefiederte Krone im Sonnenlicht. Ein kleines Gestell war hier von Bambus aufgerichtet, auf dem Mahova, etwas erhöht über die Menge, saß und sie dadurch übersehen konnte. Rechts und links kauerten auf Matten die verschiedenen vornehmeren Eingeborenen, die zu einem solchen Verhör gewöhnlich zugezogen wurden - eine Art von Geschworenen, und um diese her und vor ihnen einen Ring bildend, standen in kleinen Trupps und Gruppen die verschiedenen Nachbarn und sonstigen eingeborenen Bewohner von Papetee, zumeist Frauen und Mädchen, die aber den lebendigsten Antheil an dem Allen nahmen.
Noch weilte die Fremde in Mahova's Hütte, denn der Verklagte war noch nicht erschienen, er zögerte eigentlich ein wenig lange und mißbrauchte die Geduld seiner Richter. Aber das hatte nicht viel zu sagen, denn es giebt kaum etwas auf der /86/ weiten Welt, was ein Indianer lieber thäte, als gerade warten. Einen Verlust an Zeit, so lange er nicht hungrig oder durstig ist, kennt er nicht. Sein größtes Vergnügen ist dabei, unter einem Baum zu liegen und zu dem Wipfel hinauf zu sehen; was that es deshalb, wenn sie hier vielleicht eine halbe Stunde länger in Gesellschaft sitzen blieben und sich angenehm mit einander unterhielten. Es war nicht der Mühe werth, auch nur ein Wort deshalb zu verlieren.
Jetzt trat Patoi in den Kreis. Die Mädchen gaben ihm Raum und flüsterten mit einander. Er war ein hübscher schlanker Mann und ordentlich stutzerhaft gekleidet. Er trug keine europäische Mode, sondern ging einfach in die indianische Tracht gehüllt: einen Pareu von hellblauem gestreiften Baumwollenzeug, der bei uns allerdings den Gedanken au einen Bettüberzug geweckt haben würde - ein tehei oder Schultertuch von dunkelblauem, mit weißen Sternen überstreutem Kattun, aber einen eigenthümlichen Schmuck von rothen bibidios und den Auswüchsen der reifenden Pandanusfrucht diademartig in den mit Cocosnußöl erst frisch und fast zu reich getränkten Locken, auch ein paar große weiße Sternblumen hinter den Ohren, wie es sonst eigentlich nur die Mädchen gebrauchen.
Es war augenscheinlich, er hatte sich zu diesem Verhör recht eigentlich herausgeputzt, um jedenfalls einen besseren Eindruck auf die Richter zu machen und besonders vornehm auszusehen. Ein beifälliges Murmeln lief auch durch die Versammlung, als er den Ring betrat, was ihm wohl schwerlich entging. Er nahm aber trotzdem eine vollkommen gleichgültige Miene an, und sich mit einer leichten Verbeugung au Mahova wendend, sagte er freundlich, aber doch auch mit einem gewissen vornehmen Blick:
„Mitonare Mahova, ich bin vorgefordert, um hier auf die Klage einer fremden Frau zu antworten. - Wo ist sie, daß ich ihre Anschuldigungen zurückweisen kann?"
,,Hier! Patoi," sagte da plötzlich - ehe Mahova nur ein Wort darauf erwidern konnte, Maita, die jene Aufforderung gehört hatte und keinen weiteren Ruf abwartete. - In ihr tehei fest eingehüllt, die Arme auf der Brust gekreuzt, trat sie ruhig vor, und ihre Locken mit einem raschen Wurf des /87/ Kopfes aus der Stirn schleudernd, ihm fest und mit finsterem Blick entgegen.
„Und wessen beschuldigst Du den Fremden?" frug Mahova, der die trotzige Gestalt der Frau mit eben nicht freundlichem Blick betrachtete.
Maita schwieg einen Moment, und während lautlose Stille in dem Kreis herrschte, flog ihr Blick rasch und forschend über die Versammelten, ob sie vielleicht dort unter Allen ein befreundetes Gesicht entdecken könne. Umsonst, nur fremde Züge starrten sie neugierig an, und während kaum bemerkbar ein Seufzer ihre Brust hob, richtete sie sich plötzlich stolz empor und sagte mit fester und lauter Stimme:
„Des Eidbruches und Verrathes! Ich bin sein Weib, und er hat mich schändlich und hinterlistig verlassen."
„Und was sagst Du dazu, Patoi?"
„Ich leugne es," erwiderte kalt der Indianer, „sie ist nicht mein Weib."
„Lügner und Meineidiger!" schrie das junge Weib in Schmerz und Entrüstung auf, aber Mahova unterbrach sie.
„Halt!" sagte er, „Deine Scheltworte helfen Dir nichts. Woher stammst Du, und wer sind Deine Eltern?"
„Zwischen Tamai und der Oponuho-Bai auf Eimeo liegt ihre Hütte," sagte das Mädchen und sah den alten Mitonare fest an - „Pemotomo ist der Name meines Vaters - bekannt auf dem ganzen Eiland und einst gefürchtet, denn sein tapferer Arm widerstand den Fremden, die unser Land überschwemmten, und die Götter waren mit ihm."
„Pemotomo," nickte Mahova, „wohl kenn' ich ihn! wohl kenn' ich ihn, und wenn es einen Menschen auf den Inseln giebt," setzte er salbungsvoll hinzu, „der hartnäckig sein Ohr den guten Lehren verschloß und die Sünde des alten Götzenthums nicht abwerfen wollte, so ist er es."
„Und was hat das mit dem Verrath des Mannes zu thun?" sagte das junge Weib finster - „ich bin seine Tochter und trete hier vor Euch, um mein Recht zu verlangen; mein Recht von jenem verrätherischen „Christen", der Treu' und Glauben brach und sich mit schmeichlerischer Lüge in das Herz meines Vaters - in das meine stahl." /88/
„Und hast Du Zeugen?" sagte Mahova ruhig.
„Nein - nicht hier!" rief das junge schöne Weib, indem ihr dunkles Auge wieder den Kreis fremder Gestalten maß - „aber leugnet er, daß ich die Wahrheit rede - will er auch Euer Ohr mit seinen Lügen füllen, so gebt mir ein Canoe - ich bin arm und besitze hier kein eigenes - und in zwei Tagen schaffe ich Euch von Eimeo die Zeugen herüber, die jedes Wort meiner Klage bekräftigen werden."
Noch während sie sprach, war einer der dort ansässigen englischen Missionare - eine lange, magere und bleiche Gestalt, in einen schwarzen Frack eingeknöpft und nach rechts und links freundlich und mit einer außerordentlichen Milde und Sanftmuth grüßend, um den Kreis herumgegangen und hatte sich dem Stuhl Mahova's genähert. Der eingeborene Richter schien nicht übel Lust zu haben, von seinem eigenen Ehrensitz aufzustehen und neben dem bleichen Mann zu stehen; dieser aber, mit dem süßesten Lächeln, winkte ihm nur, seinen Sitz zu behaupten, und blieb hinter seinem Stuhl, um dort, wie es schien, dem beginnenden Verhör beizuwohnen und den Erfolg abzuwarten.
„Aber wie bist Du überhaupt von Eimeo herübergekommen, Wahine?" frug jetzt Mahova. „Wer hat Dich gefahren, wenn Du kein eigenes Canoe besitzest?"
„Fraget den Mann da, er könnte es Euch sagen," rief das junge Weib - „und laßt ihn wagen, auch das Lügen zu strafen, was ich jetzt Euch erzähle. Er kam in meines Vaters Hütte und warb um mein Herz. Er log, daß er in Taiarabu, an der Morgenseite von Tahiti, reiche Besitzthümer habe. Mein Vater willigte ein - ich wurde sein Weib, und er nahm mich - nachdem er Monate lang bei uns gelebt - in sein Canoe, um mich in seine eigene Heimath zu bringen. In Waiuru landeten wir; dort gingen wir an's Ufer, weil er mir sagte, dort wohne noch Jemand, der ihm eine Schuld zu zahlen habe. Ich blieb in einer Hütte am Strand; er verließ mich, und ich wartete dort geduldig Tag nach Tag - aber er kehrte nicht zurück. Die Leute waren freundlich gegen mich, aber die Angst verzehrte mein Herz um den Gatten, den, wie ich damals fürchtete, ein Unglück betroffen haben /89/ mußte. Ich suchte ihn überall, ich stieg in die Berge hinauf und rief angsterfüllt seinen Namen. Nur das Echo antwortete mir, und jetzt, in der Sorge um sein Leben, wollte ich sein Canoe nehmen und nach Taiarabu fahren - aber es war fort. Ein Eingeborener hatte es genommen und, wie er sagte, von Patoi gekauft. Ich verfolgte meinen Weg zu Fuß über den brennenden Korallensand am Strand - aber in Taiarabu war Patoi nicht, und die Leute lachten, als ich sie frug, wo sein Besitzthum läge. Jedenfalls „zu windwärts", meinten sie, denn in Taiarabu habe er keins - nicht eine Cocospalme gehöre ihm - nur eine verfallene Hütte in den Bergen drin, die er erst abbrechen und neu bauen müsse, wenn er darin wohnen wolle.
„Ich kehrte nach Waiuru zurück," fuhr das junge Weib fort, nachdem sie wohl eine halbe Minute, wie erschöpft, inne gehalten. „Ich hoffte noch immer, ihn jetzt dort zu finden - umsonst. Die Frau, bei der ich wohnte, zog ebenfalls Erkundigungen ein - er sollte auf der Straße nach Westen im Innern gesehen worden sei. Dorthin folgte ich und erreichte endlich, zum Tod erschöpft, Papara. Dort wurde ich krank und lag Monate lang in heftigem Fieber - bei fremden Menschen, bis endlich meine Kräfte wiederkehrten und ich beschloß, nach Papetee zu wandern. Ich hoffte kaum mehr, den Verlorenen zu treffen, aber von hier aus wollte ich zurückkehren in die Heimath - zu meinem Vater. Ich glaubte nicht, daß mich Patoi verlassen habe - noch immer fürchtete ich, daß ihn ein Unglück betroffen, und meinen Vater wollte ich bitten, nach Waiuru zu fahren, um dort ihm nachzuforschen. Wie konnte das ein alleinstehendes schwaches Weib? Da traf ihn mein Blick hier in Papetee - seinen Arm um ein anderes Weib geschlungen. Sein Auge begegnete dem meinen - ich sah, wie er erbleichte - aber er leugnete mich zu kennen - er log."
„Halt!" rief da Patoi, der bei der Erzählung nur vergebens gesucht hatte, seine Unbefangenheit zu bewahren, „ich habe nicht geleugnet, daß ich sie kenne, ich habe nur geleugnet, daß sie mein Weib ist - und das leugne ich noch! Kein christlicher Bund ist zwischen uns geschlossen." /90/ „Welcher Mitonare hat Euch getraut, Maita?" sagte der Mahova, „kannst Du ihn nennen?"
„Mitonare!" rief das junge Weib trotzig, „was kümmern mich Eure Mitonares? Weder mein Vater noch ich sind ihrer falschen Lehre beigetreten, mit der sie uns unseren alten Göttern abtrünnig machen wollten. Aber deren Segen haben wir angefleht, und jeder Gebrauch ist beobachtet worden, den die Gesetze vorschreiben; laßt ihn das leugnen, wenn er es vermag, und straft er mich Lügen, so gebt mir Zeit, daß ich meinen Vater herbeirufe. Er wird kommen, so rasch ein Canoe im Stande ist, ihn herüber zu bringen."
„Ich leugne es nicht," sagte Patoi ruhig, dem auch wohl der Gedanke nicht angenehm sein mochte, den alten wilden Pemotomo als Zeugen gegen sich zu haben. „Ich leugne auch nicht," fuhr er mit erhobener Stimme fort, „daß ich selber meine Ohren lange den guten Lehren der weißen Mitonares verschlossen habe und in Blindheit und Unglauben fortlebte, wie es Pemotomo von mir haben wollte. Um mich darin auch für mein ganzes Leben fest zu binden, damit ich nicht schwankend werden sollte, wollte er, daß ich sein Kind zum Weib nehme."
„Lügner!" donnerte ihn das junge Weib an, und wild emporfahrend flog der Tehei von ihrer Schulter zurück, der nackte Arm der Zürnenden streckte sich gegen ihn aus, und wie sie so, majestätisch und zu ihrer vollen Größe emporgerichtet, mit in der Brise wehenden Locken, mit blitzenden Augen vor ihm stand, glich sie einer zürnenden Göttin ihrer Heimath, die nieder gestiegen war, einen Abtrünnigen zu strafen.
Mahova hatte indessen mit dem hinter ihm stehenden Missionär geflüstert, und dieser wandte sich jetzt an Patoi mit der Frage:
„Und weshalb hast Du die Frau verlassen, die doch mit Dir von Eimeo gekommen? Wäre es nicht ein gutes Werk gewesen, wenn Du versucht hättest, sie von ihren Irrthümern zu überzeugen und dem Glauben des rechten Gottes zu gewinnen?"
„Das habe ich gethan, Mitonare," sagte Patoi, „an jedem Gotteshaus, an dem wir vorüber kamen, bat ich sie, mit mir /91/ einzutreten und zu hören, was die guten Männer sagten - sie weigerte sich; ja als ich mehr und mehr in sie drang, verspottete sie mich und höhnte, ich sei schlimmer als ein Weib, daß ich den Lügen lauschen wollte, die von den Lippen der schwarzen Männer kämen."
„Ist das wahr, Maita?"
„Es ist wahr," erwiderte trotzig das junge Weib, indem sic ihren Tehei wieder um sich herzog. „Meines Vaters Tochter wird nie den Glauben ihrer Eltern abschwören."
Der hinter dem Stuhl des Richters stehende Missionar hob seufzend das Auge zu dem über ihm wehenden Palmenwipfel und flüsterte dann wieder Einiges mit Mahova.
„Und was verlangst Du jetzt?" frug dieser das Mädchen von Eimeo.
„Was ich verlange?" rief Maita erstaunt, - „und fragt Ihr das noch? Ich bin das Weib dieses Mannes, das er schändlich verlassen, aber ich will es vergessen, wenn er reuig mit mir zu meinem Vater zurückkehrt. Ist er arm? wohl - es schadet nichts - wir haben Haus und Feld und Palmen, und die Brodfrucht ist so süß in Eimeo als in Tahiti - und süßer noch," setzte sie weich und fast wehmüthig hinzu, „denn sie ist ja das Brod der Heimath."
„Und willst Du mit ihr zurückkehren, Patoi?"
„Ich zurückkehren?" rief aber dieser, wie entrüstet über die Frage. „Bin ich nicht hier jetzt mit dem Segen der christlichen Kirche verheirathet an Alúa - Arowia's Tochter? - Hat nicht jener heilige Mann, der gerade jetzt hinter Deinem Stuhl steht, Mahova, unsere Hände ineinander gelegt, und kann das Band wieder zerrissen werden, das der neue und allein mächtige Gott geschlossen hat, weil die in den Staub getretenen und verbrannten alten Götter bei einem andern angerufen wurden?"
Ein weher Schmerz zuckte durch Maita's Züge, aber sie erwiderte kein Wort mehr. Fest hüllte sie sich wieder in ihr Schultertuch, und unter den zusammengezogenen Augenbrauen funkelte ihr Blick nur düster, aber in verächtlichem Schweigen nach dem Verräther hinüber. Wohlgefällig hatte aber indessen der Missionär den Worten Patois gelauscht und mit dem /92/ Kopfe genickt, während Mahova, dem die Bewegung nicht entgangen, ausrief:
„Er hat Recht, wahrlich, er hat Recht! Gegen den wahren Glauben müssen die Verbindungen mit den alten falschen Göttern in nichts zusammenfallen - gut gesagt, Patoi - Du darfst Dein christliches Weib nicht verlassen, um in den Unglauben zurückzukehren."
Die Zuschauer hatten sich bis jetzt merkwürdig ruhig bei dem ganzen Verhör gehalten, und Alle waren mit der gespanntesten Aufmerksamkeit dem Verlauf gefolgt. Jetzt aber schienen doch einzelne Frauen nicht ganz mit dem eben gegebenen Urtheilsspruch einverstanden, und wenn sie auch nicht, dem weißen Missionär gegenüber, Maita's Partei zu ergreifen wagten, rief es doch von da und dort:
„Aber weshalb hat Patoi seine Frau heimlich verlassen? Ist es recht, daß er sie ihren Eltern wegnimmt und allein auf der fremden Insel läßt? - Und darf ein Christ denn auch zwei Frauen haben?" rief eine Dritte - „in der heiligen Schrift steht nichts davon!"
Ein paar alte Damen nahmen dagegen wieder die Partei des Mitonare, und nun ging der Lärm los, denn die Vertreter des armen fremden Weibes hatten es nicht mehr mit dem Mitonare selber, sondern mit ihres Gleichen zu thun, und denen waren sie im Zungenkampf immer gewachsen.
Mahova kümmerte sich nicht darum. Er sprach angelegentlich mit dem Missionär, und indessen zog sich der Ring der Streitenden immer enger zusammen, so daß sie die Klägerin und den Verklagten schon fast dicht umgaben. - Das junge Weib achtete nicht darauf. Während Patoi die auf ihn einstürmenden Vorwürfe von sich abzuwenden suchte und sich immer wieder darauf berief, daß er Christ, daß er Mitonare geworden, und alle heidnischen Verbindungen deshalb abschütteln müsse, stand sie regungslos und unbewegt, und nur ihre Augen bohrten sich fest in den Verräther, daß er sich abwenden mußte, weil er dem Blick nicht begegnen, ihn nicht ertragen konnte.
Da hob plötzlich Mahova den Arm.
„Ruhe!" schrie er über das Toben hinaus - „zurück, Ihr Männer - zurück, Wahines, auf Euern Platz. Was habt /93/ Ihr da zu lärmen und zu zanken, wo das Gericht noch sitzt und die Häuptlinge und Kirchenältesten erst ihre Meinung sagen müssen? Bis jetzt habe ich nur gesprochen, jetzt hört auch, welches Urtheil die sprechen. Ihr habt gar nichts hinein zu reden, fort mit Euch!"
Das Publikum schien allerdings nicht recht mit der Zurückweisung einverstanden, aber gesetzlich hatte Mahova, wie sie sehr gut wußten, Recht, und es blieb ihnen deshalb nichts weiter übrig, als eben zu gehorchen. Daß übrigens der weiße Mitonare mit dem, was Mahova gesagt, vollkommen einverstanden war, sahen die „Kirchenältesten" wohl. - Jener schien in der That den Ausspruch gethan zu haben, und sie dachten gar nicht daran, ihm feindlich entgegen zu treten. Was kümmerte sie auch die Fremde von Eimeo? Ihr Ausspruch lautete deshalb mit dem, was der Richter schon gesagt, vollkommen übereinstimmend, und der Urtheilsspruch über die arme Verrathene war gefällt: sie hatte keine Ansprüche an einen Christen, wenn sie nicht selber ihre alten Irrthümer abschwören wollte, und selbst dann sei Patoi jetzt gebunden, da Alúa, Arowia's Tochter, vor dem heiligen Altar sein Weib geworden. - Das Band könnte nicht zerrissen werden. Allerdings, setzten Einige von ihnen hinzu, habe Patoi darin nicht ehrlich gehandelt, aus seiner früheren Verbindung ein Geheimniß zu machen, aber strafbar sei er doch nicht, da die Mitonares keine heidnischen Formeln und Gebräuche anerkennten. Es sei eben eine Sünde seines früheren Lebens gewesen, und er müsse suchen, sich durch Buße und Gebet davon zu reinigen.
Maita verzog bei diesem Urtheilsspruch keine Miene. Regungslos und wie aus Stein gehauen stand sie in der Mitte des bunten Kreises und schien die zu ihr gesprochenen Worte kaum zu hören. Zuletzt, als Alle geendet und selbst die lärmenden Eingeborenen sich nicht regten, weil sie die Antwort der Fremden hören wollten, sagte sie leise, aber doch mit vollkommen deutlicher Stimme:
„Und was wird jetzt aus mir?"
„Was aus Dir wird, Wahine?" wiederholte Mahova, aber doch wohl etwas gerührt von der schmerzlichen und stillen Resignation, die in den Worten lag - „kehre ruhig nach Eimeo /94/ zurück - es darf Dich keine Seele auf Tahiti kränken - oder wenn Du noch weilen willst, so sei willkommen. - Du findest eine Matte in Mahova's Hütte und Fisch und Brodfrucht genügend, um Dich zu sättigen. Vielleicht ist es doch noch möglich, Dich zu überzeugen, daß Du wirkliche Ruhe nur in dem wahren Glauben findest."
„Wenn Euer Glaube so richtet, wie er jetzt gerichtet hat," sagte das junge Weib ruhig, „so kaun er nie der meine sein. Laßt mich in Frieden ziehen. - Aber Eins verlange ich von Euch - von Patoi," setzte sie mit gehobener Stimme hinzu, „und Ihr müßt es mir zusprechen, denn es verstößt weder gegen die Gesetze Eures neuen Gottes, noch hat es mit denen unserer alten Götter etwas gemein."
„Und was ist es, Wahine?"
„Patoi," sagte die junge Frau, und wieder suchte ihr Blick den abtrünnigen Gatten, „hat mich von Eimeo nach Tahiti gerudert und hier verlassen. Ob er daran recht gethan oder gesündigt, mag Euer Gott richten. - Er will hier bleiben - gut. Er hat mir das Herz gebrochen, aber ich werde nicht weiter klagen, auch nicht länger hier seinen Frieden stören mit seiner jungenFrau. Doch Eins verlange ich von ihm: er soll mich in seinem Canoe wieder hinüber an die Küste von Eimeo rudern - nicht an das westliche Ufer," setzte sie rasch hinzu, „in dessen Nähe mein Vater wohnt - nur hinüber nach Afareaita oder an irgend einen der nächsten Punkte, von dem aus ich meinen Weg zu Fuß fortsetzen kann. - Er mag dann zurückkehren. Nur wenige Stunden Arbeit sind es, die ich von ihm verlange - es ist nicht viel gegen das lange Leben, das ich jetzt allein verbrüten muß."
Todesschweigen herrschte rings umher. Die Forderung war wunderlich, denn jedes andere Canoe hätte sie eben so gut hinüber gebracht. Jetzt aber brachen die Frauen, deren Herz noch immer auf die Seite der Mißhandelten trat, auf's Neue los. Das war, wie sie riefen, die geringste Strafe, die den Mann treffen konnte, der seine Frau verlassen hatte: daß er sie wieder an die Küste und in die Binnenwasser ihres eigenen Ufers bringen mußte, und er könne und dürfe das nicht weigern. /95/ Der Missionär und Mahova sprachen leise mit einander. Es schien dem ersteren selber nicht viel daran zu liegen, daß Maita, jetzt mit dem Mitgefühl für sie erweckt, und dabei eine starre Heidin, länger als nöthig hier auf Tahiti blieb, wo die Franzosen schon Viele in ihrem „Glauben" erschüttert und ihren alten Missionären abwendig gemacht hatten. Ja, wer wußte denn, ob nicht die Feranis selber am Ende die Sache in die Hand nähmen und dann einen ganz andern Urtheilsspruch fällten. - Es war ihnen in der Hinsicht Alles zuzutrauen und deshalb jedenfalls besser, daß die Fremde Tahiti so rasch als irgend möglich wieder verließ.
Patoi selber schien der Vorschlag nicht sonderlich zu behagen; die hier gegen ihn herrschende Stimmung konnte ihm aber auch kein Geheimniß sein, und er wagte nicht, sie zu verschlimmern - wollte er doch zwischen den Bewohnern von Tahiti leben. Nur seine Bedenken konnte er nicht alle unterdrücken.
„Du willst nur, daß ich Dich hinüber nach Eimeo rudern soll, Maita," sagte er, „um unterwegs mein Herz mit Deinen Klagen zu bewegen und mich dem neuen Glauben zu entfremden. Es hilft Dir aber nichts. - Ich bin ein Christ und bleibe es."
„Hab' keine Furcht," sagte das junge Weib demüthig - „bei meinen Göttern schwöre ich Dir, daß ich auf dem ganzen Weg von hier bis Eimeo, und bis ich dort an's Land gestiegen bin, kein Wort, keine Silbe zu Dir reden werde. Genügt Dir das?"
„Ja," sagte Patoi nach kurzer Pause - es war auch in der That das Aeußerste, was er erwarten konnte. - „So komm, ich werde Dich nach Eimeo rudern. Du sollst nicht sagen können, daß ich Dich hier auf der fremden Insel ohne Hülfe gelassen."
„Das ist gut, das ist recht gut von Dir," sagte die junge Frau leise und schaute still zur Erde nieder, und Patoi blickte stolz im Kreis umher, als ob er fragen wollte: „Handle ich nicht edel? - ich thue es, ehe mich der Mitonare dazu gezwungen." Er sah nicht das bittere Lächeln, das um Maita's Lippen zuckte. - Er kannte überhaupt die Frau noch nicht, /96/ die da so demüthig und wie in ihr Schicksal ergeben vor ihm stand, und welche Leidenschaften in ihrem Herzen glühten. Ihres Vaters heißes Blut rollte in ihren Adern, und nur unwillig fügte sie sich jetzt dem Zwange.
3.
Maita' s Rache.
Mahova, der Richter, schien mit der gütlichen Beilegung dieses Streites außerordentlich zufrieden, denn daß viele der Eingeborenen, besonders fast alle Frauen, auf Seiten des verlassenen jungen Weibes standen, konnte ihm nicht gut entgehen, und doch durfte er als Mitonare nicht heidnischen Gebräuchen irgend ein Recht über christliche zugestehen, noch dazu da der weiße Mitonare an seiner Seite in solchen Dingen keinen Spaß verstand. Jetzt war das Alles erledigt, und er bot Patoi denn auch rasch sein eigenes Canoe an, um damit über den, etwa anderthalb deutsche Meilen breiten Seearm, der Eimeo von Tahiti trennt, hinüber zu rudern. Ja mit der jetzt wehenden Brise konnte er vielleicht sogar hinüber segeln, und dann noch an dem nämlichen Abend oder in der Nacht zurückkehren. Die See war still und ruhig, und eine Gefahr nicht zu fürchten.
Die Vorbereitungen nahmen nicht viel Zeit weg. Allerdings wollten fast alle Frauen Maita erst in ihrer Hütte haben, um sie mit Speise und Trank zu erfrischen, aber sie schlug Alles ab. - Nur etwas gebackene Brodfrucht, ein paar Orangen und Cocosnüsse nahm sie an, welche ihr die Kinder hineintrugen.
Dann schritt sie zum Strand hinunter und kauerte sich, ohne von irgend Jemand Abschied zu nehmen, vorn im Bug des Canoe nieder. Sie war eine Ausgestoßene, wer kümmerte sich um sie - um wen brauchte sie sich zu kümmern? /97/ Patoi säumte ebenfalls nicht, das Canoe in Stand zu setzen; das leichte Mattensegel wurde gebracht und gehißt, und mit der von Osten am Ufer hinwehenden Brise glitt das schlanke Fahrzeug rasch durch das stille Binnenwasser der Bai, immer der Nordküste Tahitis folgend, bis sie eine mehr westlich gelegene Durchfahrt durch die Riffe erreichten und dann Eimeo gerade gegenüber hatten.
Das Canoe war eins der hier stets gebräuchlichen Fahrzeuge, einfach aus einem Stamm ausgehauen und mit rundem Boden. Dadurch segelte es rascher, wäre aber auch leicht umgeschlagen, wenn nicht ein sogenannter „Ausleger" (outrigger) ihm volle Sicherheit gewährt hätte.
Diese Ausleger bestehen in zwei, fest an dem Canoe, und zwar querüber befestigten Stangen oder Hölzern, die nach rechts hinaus einen leichten, kufenartig geschnittenen Balken halten. Dieser schwimmt dadurch, etwa vier Fuß vom Rande des Canoe entfernt und mit diesem parallel, auf dem Wasser, und ist natürlich fest mit Bast an die Querhölzer geschnürt. Ein Umschlagen des Fahrzeuges, ja selbst ein Schaukeln wird dadurch unmöglich gemacht, denn nach links hinüber kann es nicht, weil es dann den ganzen, noch dazu vier Fuß abstehenden Balken aus dem Wasser heben müßte, und nach rechts zu eben so wenig, da sich der Balken von leichtem Holz nicht auf die Entfernung und mit den Stangen unter Wasser drücken läßt. Selbst bei unruhiger See fahren deshalb diese Canoes außerordentlich sicher. Ohne den Ausleger freilich würde man sich nur sehr vorsichtig darin bewegen müssen, da der runde Boden der geringsten Neigung des Körpers folgt.
Patoi wußte, wie alle Insulaner, vortrefflich mit einem solchen Canoe umzugehen, und wie das Segel nur erst einmal gesetzt war, hatte er auch weiter nichts zu thun, als eben nur sein kurzes Ruder als Steuer in das Wasser zu halten, wobei er bequem hinten im Stern seines kleinen Fahrzeugs, und fast ausgestreckt ruhen konnte.
Vorn im Bug saß Maita, ihres Versprechens eingedenk. Kein Wort kam über ihre Lippen, die Hände um das rechte Knie gefaltet, suchte sie nicht einmal mit dem Blick den Un-/98/getreuen und Abtrünnigen, sondern schaute nach dem lieblichen Bilde, an dem sie jetzt rasch und leicht vorbei getragen wurden.
Noch konnte sie, da sie rückwärts im Bug saß, die freundlichen und selbst reichen Wohnungen erkennen, die rings am Strand von Papetee standen und die schöne Bai fast einschlossen. Dahinter stieg ein dichter Laubwald von Fruchtbäumen empor, über dem die stolzen Palmen ihre Wipfel neigten, und hinter dem Ganzen thürmten sich die dicht bewaldeten Hänge des Gebirgsrückens auf mit seiner scharf eingeschnittenen Schlucht, mit seinen Abhängen und schroffen Wänden, über welche hier und da ein kleiner Wasserfall herniederschoß, während selbst dort oben einzelne Cocospalmen Wurzel gefaßt und ihre zarten Blattwipfel deutlich gegen den blauen Himmel abzeichneten.
Und dann zur Linken die herrliche Bai mit den vielen bewimpelten Schiffen, und darinnen die prachtvolle kleine Insel Motu Otu, der alte Königssitz der Pomaren, mit ihren Palmen und schattigen Büschen. - Es war ein Paradies, an dem sie vorüber glitten, und doch trug das junge Weib die Hölle im Herzen. - Aber sie sprach trotzdem kein Wort; sie rührte und regte sich nicht, und nur ihr Athmen, ihr funkelndes Auge verrieth, daß sie lebe.
Das Canoe glitt indessen rasch in dem Binnenwasser der Riffe am Ufer hin - die Palmen traten weiter davon ab - das Ufer wurde sandiger, und nur Guiavenbüsche deckten es hier. - Weiter und weiter verfolgte das schlanke Fahrzeug seinen Weg, und jetzt hatten sie die westliche Einfahrt erreicht, die einen breiten Kanal, der See zu, öffnete - und dort drüben lag Eimeo, Maita's Heimathland. Aber sie beachtete es nicht - keinen Blick warf sie hinüber, und wie in's Leere starrte ihr Auge, den ganzen langen Weg.
Selbst Patoi wurde das Schweigen zuletzt peinlich, und er war selber ein paar Mal nahe daran, es zu brechen; aber er bezwang sich doch. Es war besser, sie verfolgten so ihren Weg. Was hätten sie sich auch sagen können, welches andere Wort konnte von den Lippen der Armen, Verrathenen kommen, als nur ein Vorwurf über ihr zerstörtes Glück. Aber sie gab /99/ dem keinen Laut, und wie abgeschlossen mit dem Leben saß sie im Canoe.
Die Brise hielt wohl noch an, wurde aber immer schwächer, und als Patoi den Meeresarm endlich gekreuzt und in die Einfahrt der Eimeo-Riffe biegen wollte, starb sie ganz weg. Er mußte das Segel niederlegen und zu dem Ruder greifen, um nicht durch die Strömung gefährdet und gegen die Brandung getrieben zu werden.
Vorn im Canoe lag noch ein Ruder, und er hätte gern Maita aufgefordert ihm zu helfen, desto schneller wären sie vorwärts gekommen - aber er wagte es nicht, und das junge Weib selber bemerkte wohl kaum, daß eine Veränderung mit dem Segel vorgenommen worden, so stier hing ihr Blick jetzt an der über die Riffe stürzenden Brandung, zwischen der sie hinglitten. Der Weg lag ja aber nun auch nicht mehr weit. Allerdings war die Sonne schon hinter den kühngerissenen Felskuppen Eimeos verschwunden, aber die Entfernung zwischen der Einfahrt und dem Land auch nur gering, und schon ließen sich deutlich die einzelnen, in schattigen Fruchtbäumen halb versteckten Bambushütten Afareaitas erkennen.
Patoi schien indessen nicht gesonnen, gerade an dem Hauptort der Insel zu landen, wo, wenn auch nicht die Wahrscheinlichkeit, doch die Möglichkeit vorlag, daß er den am entgegengesetzten Theil der Insel wohnenden Pemotomo treffen konnte. Der Gefahr durfte er sich natürlich nicht aussetzen. Er hatte überdies auch nur versprochen, Maita in Eimeo an's Land zu setzen; ja sie nicht einmal mehr von ihm verlangt. Hütten lagen hier überall zerstreut am Ufer hin, und sie konnte allerorten ein Unterkommen finden. Früchte gab es ebenfalls im Ueberfluß, mehr noch als selbst auf Tahiti, er erfüllte also vollkommen sein gegebenes Wort, wenn er sie an einer der etwas abgelegenen Stellen landete, und Maita schien auch nicht das Geringste dagegen einzuwenden, als ihr die neue Richtung nicht mehr entgehen konnte, die das Canoe verfolgte.
Immer seichter wurde hier das Wasser; schon seit sie die Einfahrt passirt, konnte man überall deutlich aus dem Grunde die wunderlich geformten Korallen erkennen, aus denen alle diese Riffe, ja ein großer Theil der Südsee-Inseln selber, be-/100/stehen. Hier und da ragten sogar einzelne über die Oberfläche hervor, und Patoi mußte genau aufpassen, um nicht mit seinem Fahrzeug aufzurennen; doch dauerte es nicht lange mehr, so scheuerte sein Bug, nicht weit von dort, wo zwei andere Canoes an einer Liane befestigt lagen, und dadurch die Nähe einer menschlichen Wohnung verriethen, den Korallensand.
„Maita," brach da der Indianer das Schweigen - „hier bist Du auf Eimeo - soll ich Dich an's Ufer geleiten?"
Das junge Weib war aufgestanden, und ihr Blick streifte zum ersten Mal die befreundete Küste, aber sie erwiderte keine Silbe. Ihr linker Fuß ruhte einen Moment auf dem Rande des Bugs, dann sprang sie leicht und flüchtig, ohne auch nur den Kopf nach ihrem Führer zurück zu drehen, an's Land.
„Willst Du die Früchte nicht mitnehmen, Maita?"
Keine Antwort.
„Willst Du mir nicht ein Joranna sagen, Maita?" rief Patoi, dem es doch jetzt beklommen um das Herz wurde, als er die Frau so scheiden sah - aber er erhielt auch jetzt keine Antwort. Ihren Tehei fest um sich gezogen, schritt sie auf die nächsten Büsche zu und war wenige Secunden später in dem Gesträuch seinem Blick entschwunden.
„Stolzes Ding," murmelte der Indianer zwischen den Zähnen durch - „nicht einmal eine Antwort hat sie für mich. Aber was thut's?" setzte er leicht hinzu - „vielleicht ist's besser so und war jedenfalls desto rascher abgemacht. Joranna, Maita! wir passen doch nicht zu einander, Du und Dein Vater, die nur immer von der Wiederherstellung ihrer verlorenen Freiheit träumen und danach drängen, während ich mich nach einem ruhigen Leben sehne. Joranna, Joranna! kehre in Deine Wildniß zurück und vergiß den armen Patoi, dem Du einstmals Dein Herz geschenkt."
Eingeborene kamen am Ufer langsam herab, wohl nur um zu sehen, wer da in einem Canoe gelandet wäre. Patoi mochte ihnen aber auch nicht begegnen und sich am liebsten vor Niemandem auf Eimeo sehen lassen. Je schneller er deshalb nach Tahiti zurückkehrte, desto besser, und das konnte er noch recht gut in der nämlichen Nacht bewerkstelligen. Die Sonne ging allerdings unter, aber es war noch hell genug, um sicher /101/ aus den Riffen hinaus zu kommen, und erst einmal draußen auf der ruhigen See, durfte er sich Zeit lassen und langsam nach Tahiti hinüber rudern. Außerdem hatte er ja auch noch die von Maita verschmähten Früchte und Lebensmittel im Canoe, um unterwegs davon zu zehren, und wenn er erst das Binnenwasser von Tahiti erreichte, so trug ihn gegen Mitternacht die Fluth, ohne daß er sich weiter anzustrengen brauchte, von selber nach dem Hafen zu.4
Noch einen Blick warf er auf das Ufer und die Stelle zurück, an welcher Maita in den Büschen verschwunden; aber es war kein lebendes Wesen dort zu erkennen, und sein Ruder wieder gegen den Sand stemmend, schob er sein Canoe in tiefes Wasser und ruderte dann rasch dem Eingang der Riffe zu. Die Leute am Ufer kümmerten sich nicht um ihn; Eingeborene landeten zu allen Tageszeiten und fuhren auch wieder ab, theils um zu fischen, theils um drüben in Tahiti Producte zu verkaufen - wer frug nach Einem von ihnen? Wenn er etwas von ihnen wollte, kam er schon selber.
Patoi näherte sich jetzt der Einfahrt - noch einmal schaute er sich um. - Die kleine friedliche Bai lag still und einsam, und nur etwas weiter oben, am Dorf Afareaita selber, herrschte lautes fröhliches Leben, und sogar der Schall einer Trommel, die das junge Volk zum Tanze rief, klang zu ihm herüber. Aber Patoi fühlte sich nicht davon angelockt; er hatte in Eimeo nichts mehr zu suchen und mochte sich noch weniger zwischen die Bewohner mischen. Sein Weg lag hinüber nach Papetee und aus dem Binnenwasser dieser Insel hinaus, und je rascher er den zurücklegte, desto besser. Es dauerte auch nicht lange, so hatte er die Einfahrt erreicht, ruderte zwischen den sich überstürzenden Brandungswellen hindurch und hielt nun erst eine Strecke draußen, und jetzt in offener See angekommen, um erst einmal etwas Nahrung zu sich zu nehmen. /102/ Er war durch die lange Fahrt hungrig und durstig geworden und mußte sich erst wieder stärken.
Zu dem Zweck legte er sein Ruder in das Canoe, öffnete mit dem kleinen Messer, das er bei sich trug, eine der jungen Cocosnüsse, trank daraus in langen, durstigen Zügen, und legte sich dann die gebackene Brodfrucht auf die Ruderbank, um beim Arbeiten davon zu zehren. Er durfte nämlich nicht zu lange ruhig sitzen, denn die Fluth hatte schon begonnen; sie fing an, ihn langsam gegen die Riffe zurück zu treiben, und erst wenn er die Höhe des zwischen Eimeo und Tahiti liegenden Meeresarms erreichte, mochte er darauf rechnen, durch die Strömung begünstigt zu werden.
Von hier ab, wo er sich jetzt befand, konnte er aber die innere Bai in den Riffen von Eimeo nicht mehr übersehen, und doch rüstete sich dort ein kleines Canoe, um ihm hinaus auf die See zu folgen.
Kaum war nämlich sein Fahrzeug hinter den Brandungswellen verschwunden, als Maita, von einer alten Frau gefolgt, wieder aus den Büschen trat und zu der Stelle hinabeilte, wo die beiden kleinen Canoes befestigt lagen. Sie hielt eine Ruthe in der Hand, an der etwa zwanzig oder dreißig kleine Fische hingen, und warf sie, dort unten angekommen, in eins der Fahrzeuge.
„Und Du sendest mir das Canoe wieder zurück, Kind?" sagte die alte Frau besorgt. „Ich muß mich fest darauf verlassen können, denn es gehört dem Mitonare, und der würde entsetzlich böse werden, wenn er es erführe. Du weißt, Dein Vater steht sich nicht gut mit ihnen - er ist ein arger Trotzkopf und will nun einmal nicht glauben, was sie ihm vorerzählen."
„Ihr könnt Euch darauf verlassen, Mutter, morgen Abend vor Sonnenuntergang wird es Anoui, mein jüngster Bruder, wieder hier an derselben Stelle angebunden haben."
„Und Du willst in der Nacht fahren und ganz allein? Kind, Kind, in der Nacht hat ein junges Mädchen eigentlich nichts in den Binnenwässern zu suchen, ausgenommen, es fährt mit seinen Eltern auf den Fischfang. Bleib heut Abend bei /103/ mir, und morgen früh kannst Du, meinetwegen mit Tagesanbruch, Deine Reise antreten."
„Ich muß fort, Mütterchen - es geht nicht anders," entgegnete Maita -- „kenne ich doch die Bahn, die ich zu nehmen habe, so genau, und der Vater möchte sich um mich sorgen."
„Nun meinetwegen, Herz; Du folgtest überhaupt von klein auf nur Deinem eigenen Kopf - ich weiß es, was für Noth Deine Mutter mit Dir gehabt hat, also geh in des Himmels Namen! Was willst Du aber nur mit den Fischen? Deren giebt's doch bei Euch wahrhaftig genug. Hättest Du dafür lieber etwas mehr gegessen."
„Ich danke Euch - ich bin satt - laßt mir die Fische und lebt wohl. Atua möge Euch für den Dienst segnen, den Ihr mir erzeigt."
„Atua? oh mein süßer Heiland!" rief die alte Frau, „wenn das der Mitonare gehört hätte, und ich weiß nicht einmal, ob Dich sein Canoe trägt, sobald Du so gottlose Worte darin sprichst. Ach, was soll einmal aus Dir werden, wenn Du stirbst, Maita? - was soll nur einmal aus Dir werden? denke Dir, wenn Du für ewig in der Hölle braten müßtest, und der Mitonare schickt Dich hin, der Mitonare schickt Dich heilig hin!"
Maita lächelte - es war das erste Mal, daß ihr Gesicht wieder einen freundlichen Ausdruck zeigte, und sie sah gar so lieb damit aus.
„Sorgt Euch nicht um mich, Mütterchen," nickte sie, indem sie das Canoe vom Bande löste und hineinsprang, „der alte bleiche Mitonare wird wohl selber dorthin gehen müssen, wohin er geschickt wird, und niemand Andern senden können. Ich folge den Geboten der Götter, und sie werden mich schützen. - Joranna! Joranna!" und ihr Ruder einsetzend, glitt sie rasch über die unbewegte klare Wasserfläche, während die alte Frau ihr eine Weile kopfschüttelnd nachschaute und dann selber in ihre Hütte zurückkehrte. Es wurde dunkel, und sie konnte außerdem nicht viel mehr draußen erkennen.
Indessen stand Maita in ihrem Canoe, das leicht und scharf gebaut war und rasch mit ihr über die Fluth schoß; /104/ aber sie handhabte ihr Ruder auch mit allen Kräften, als wenn es gälte, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nicht nur um in aller Ruhe nach Hause zurückzukehren. Die alte Frau würde sehr besorgt um sie gewesen sein, wenn sie gesehen hätte, daß sie nicht das Binnenwasser der Riffe hielt, in dem sie gefahrlos die ganze Insel umrudern konnte, sondern keck in ihrem schwanken Boot der Einfahrt entgegen hielt. Wollte sie wieder nach Tahiti hinüber?
Jetzt hatte sie diese erreicht und hörte, aber nur wenige Secunden, mit rudern auf, um einen der größeren Fische von der Ruthe zu nehmen, den sie dann an ein Stück Bast band und über Bord warf. Der Bast war aber im Canoe selber befestigt, und der Fisch schleifte solcher Art im Wasser nach. Was wollte sie damit?
Jetzt hatte sie das Ruder wieder aufgegriffen und arbeitete sich hinaus in See. - Wie warm die Luft hier draußen wehte! Den Tehei hatte sie abgeworfen - nur der Pareu umschloß ihre schlanken Hüften, und während sie das Canoe scharf vorwärts trieb, suchte ihr Blick forschend, fast ängstlich hinaus über die weite See.
Ha dort! sie zuckte ordentlich zusammen, als ihr Auge an einem dunkeln Punkt haftete, der, eigentlich etwas außer dem Cours, auf dem Wasser sichtbar wurde. Es war Patoi's Canoe, der dadurch, daß er seine Mahlzeit zu lange ausgedehnt, von der eintretenden Fluth etwas aus seiner Richtung getrieben worden. Es war aber indeß so dunkel geworden, daß sie es kaum noch erkennen konnte.
Fast unwillkürlich lenkte sich ihr Bug dem entdeckten Fahrzeug zu, das, weit größer und schwerer als das ihrige, von dem einen Ruder lange nicht so rasch vorwärts getrieben werden konnte. Sie rückte näher und näher, aber erst als sie in Rufs Nähe gekommen, warf sie ihren Tehei wieder über die Schultern und gewann jetzt mit jedem Ruderschlag an dem voran gegangenen Boot.
Da - als sie es schon fast erreicht, bekam ihr Canoe plötzlich einen leichten Stoß, als ob es auf einer Korallenbank gescheuert hätte. Blitzesschnell drehte Maita den Kopf zurück, und ihr Auge blitzte, als sie in dem phosphorescirenden /105/ Schein des Seewassers den wie funkelnden Körper eines Haifisches erkannte. Jedenfalls hatte er die Witterung des angehangenen Fisches bekommen und ihn abgerissen.
,,Aha, mein Bursche, bist Du da?" lachte sie ingrimmig in sich hinein - „hat Dir der Köder geschmeckt? Du kannst mehr bekommen," und zwei von den mitgenommenen todten Fischen warf sie in die See, während sie einen dritten rasch wieder an dem Bast befestigte. Dann nahm sie das Ruder auf's Neue auf, und kaum zehn Minuten mochte sie noch gearbeitet haben, als sie - dem Ausleger von Patoi's Canoe etwas Raum gebend, langseit desselben lief und ihre Hand darauf legte.
Patoi hatte indessen mit immer wachsender Unruhe bemerkt, daß ihm ein Canoe folge. Wer konnte es führen? - etwa Maita's Vater? - Er hätte Keinem weniger als dem Manne hier draußen auf dem Wasser begegnen mögen, und ruderte deshalb aus Leibeskräften, um ihm aus dem Weg zu kommen. Aber das ihn verfolgende Canoe war schneller als das seinige; er vermochte die Strömung nicht so rasch damit zu stemmen. Angst und ein böses Gewissen lähmten auch vielleicht seine Kräfte, und der Glaube an den neuen Gott war nicht stark genug in ihm, um ihn die Furcht vor der Rache der alten vergessen zu lassen. Kein Wort war auch zwischen den beiden Fahrzeugen gewechselt worden, bis sich Maita's Canoe langseit legte.
„Wer ist nur das?" rief aber jetzt Patoi, der wohl bemerkt hatte, daß es nicht die kräftige und fast riesige Gestalt Pemotomo's sein konnte. „Wer bist Du, mein Bursch, und wo kommst Du her?"
„Patoi," sagte da die weiche, melodische Stimme Maita's - „ich bin es, und Dir nachge-kommen, um noch eine Frage an Dich zu richten."
„Maita!" rief der Insulaner, wirklich in unbegrenztem Erstaunen - „Mädchen, was ficht Dich an? Wie kommst Du hier allein und bei Nacht hinaus in die offene See?"
„Ich hatte Dir versprochen," fuhr das junge Weib fort, „auf der Ueberfahrt nach Eimeo kein Wort mit Dir zu reden - ich habe mein Wort gehalten; aber eine Frage muß ich noch an Dich richten, und deshalb bin ich Dir gefolgt." /106/ „Aber welche Frage, Schatz? - Laß mein Canoe los - die Fluth setzt uns sonst wieder zurück -"
„Ich werde Dich nicht lange aufhalten. Hast Du mich wirklich für immer verlassen, Patoi? Soll die Tochter Pemotomo's mit Schmach und Schande beladen, und dem Spott der Nachbarn ausgesetzt, in ihre Heimath zurückkehren? - Noch ist es Zeit," fuhr sie weicher fort - „noch weiß Niemand auf Eimeo, wie Du an mir gehandelt, welches schwere Leid Du mir angethan, und wie ich heute, von den Christen dort drüben, gedemüthigt und ausgestoßen wurde. Es braucht es auch Niemand zu wissen - meine Lippen sollen schweigen wie das Grab, und bist Du arm, fehlen Dir die Felder und Cocoshaine, die Du meinem Vater beschrieben, was schadet es? Ich bin reich - der Götter Segen ruht auf dem weiten Land, und still und glücklich können wir in der Heimath leben."
„Es geht nicht, Maita," sagte Patoi finster - „es ist zu spät. Des Mitonare Spruch hat mich an Alúa gebunden."
„An Alúa.," murmelte Maita leise, und in demselben Moment hatte der nachfolgende Hai wieder den ausgehangenen Fisch erfaßt und abgerissen, während er auch blitzesschnell, und selbst unter dem Ausleger von Patoi's Boot durch und zwischen den beiden Canoes hin - vorüberschoß. Auch Patoi hatte ihn bemerkt, aber nicht weiter darauf geachtet, gab es doch eine Masse derartiger Raubfische gerade in diesem Theil der See; was hatte er in seinem Canoe von ihnen zu fürchten? Maita aber bückte sich und warf wieder ein paar kleine Fische über Bord, und jetzt konnte sie sehen, daß zwei glühende Strahlen unter ihr durch die Fluth schossen. Der erste Hai hatte noch einen Gefährten gefunden, der die Beute mit ihm theilen wollte.
„Laß das Canoe los," sagte da Patoi freundlich, - „es thut mir leid, daß Alles so gekommen, und ich habe vielleicht unrecht gehandelt. Ich hätte offen mit Dir reden sollen; aber es ist nun einmal geschehen. Kehre zu Deinem Vater zurück; Patoi wird Deiner immer freundlich gedenken; zürne auch Du ihm nicht." /107/ „Und Du willst nicht mit mir zurückkehren? Du willst mich allein meine freudlose Bahn gehen lassen - Alúa's wegen?"
„Nicht Alúa's wegen," sagte Patoi, „aber der alleinige Gott will es so, denn ich bin jetzt ein Christ und darf, schon meines Seelenheils wegen, nicht mehr mit den Anbetern von Götzen verkehren. Sei vernünftig, Maita."
„Nur Deines Seelenheils wegen?" lachte Maita bitter, „sonst zieht Dich nichts von mir fort - nicht einmal Alúa -"
Das junge Weib warf die letzten Fische über Bord, die noch in ihrem Canoe lagen, und rechts und links plätscherten die gefräßigen Ungeheuer der Tiefe, als sie danach herausfuhren und sie einander wegzuschnappen suchten. Patoi drehte unwillkürlich den Kopf nach ihnen. Maita's Hand aber, mit einem kleinen haarscharfen Messer bewehrt, glitt über den Bast, der die ihr nächste Auslegerstange an den Ausleger selber band, und trennte diesen vollständig los. Zu gleicher Zeit und fast unmerklich schob sie ihr Canoe etwas weiter nach vorn, um auch den andern zu erreichen. Patoi glaubte, daß sie im Begriff sei abzustoßen, und sagte freundlich:
„Joranna, Maita - laß uns nicht im Zorn scheiden - ich sage Dir, es schmerzt mich, Dich so allein Deine Bahn ziehen zu sehen, aber ich kann es nicht mehr ändern. Meine Seele gehört Gott, mein Körper Alúa."
Maita hatte noch gezögert - war es Mitleiden, das ihr stolzes Herz durchzuckte - die letzten Worte machten es verschwinden. Mit Gedankenschnelle zuckte ihr Messer auch über den Bast der zweiten Auslegerstange.
„Das lügst Du, falscher Verräther!" rief sie dabei - „laß Deine Seele zu dem Gott gehen, um dessentwillen Du die alten Götter verleugnet, Atua würde sein Antlitz doch von Dir wenden, aber Dein Körper gehört nicht Alúa - Dein Körper gehört den Fischen des Meeres -"
„Was thust Du, Maita?" rief Patoi erschreckt, denn er bemerkte jetzt ihre geschäftige Hand an dem doppelt umgeschnürten Bast des Auslegers. „Zurück da, Wahnsinnige!" und das Ruder hebend, wollte er einen Schlag nach ihr /108/ führen. In demselben Augenblick aber schnellte sich das zürnende Weib empor, und ihre Hand hielt dabei krampfhaft die Auslegerstange, mit der sie, wie mit einem gewaltigen Hebel, das schwanke und jetzt nicht mehr durch den Balken geschützte Boot mit dem linken Rand unter Wasser drückte.
,,Fort mit Dir!" schrie sie dabei - „Verderben über Dich - herbei, Ihr Rächer, die Oro gesandt, um den Verräther zu vernichten!"
Sowie sie die Auslegerstange in die Höhe hob, mußte sie das Canoe, über dessen beide Borde sie querüber und fest geschnürt war, rettungslos umkippen. Patol auch, der die Gefahr erst zu spät erkannte, war nicht im Stande, den Schlag zu führen, da er selber das Gleichgewicht verlor. Erschreckt ließ er das Ruder fallen, um sich nur anzuklammern und rasch auf die andere Seite zu werfen - aber das half ihm nichts, denn das Canoe füllte sich, und während Maita die Stange von sich stieß und ihr eigenes kleines Fahrzeug damit außer ihren Bereich brachte, schnellten beide in die Höhe, und das Canoe schlug um.
Patol schwamm wie ein Fisch, aber mit lähmendem Schreck traf ihn die Erinnerung an die Raubfische, die er noch vor wenigen Secunden in unmittelbarer Nähe gesehen, und angstvoll griff er nach dem umgedrehten Fahrzeug, an das er sich klammerte und aus das er zu klettern versuchte.
„Maita!" rief er dabei - „Mädchen! zu Hülfe! die Fische! Du willst mich doch nicht tödten? - Rette mich! sie nahen! Oh, um des Heilands willen!"
Ein unheimlich glühender Strahl schoß an ihm vorüber durch die Fluth und kreuzte sich mit einem andern.
Maita stand aufrecht in ihrem Canoe, das Ruder fest, und zu augenblicklichem Gebrauche bereit, in beiden Händen. Der Tehei war wieder von ihren Schultern gefallen; ihre langen Locken umgaben wild ihr Haupt, aus dem die Augen in Zorn, aber auch in Angst hervorfunkelten, denn sie hatte der Götter Rache angerufen, und der Augenblick nahte, in dem sie sich erfüllen sollte.
„Maita, um Deiner Seele willen, Mädchen, rette mich!" stöhnte Patoi und suchte sich auf das schlüpfrige Canoe /109/ hinauf zu schnellen. In dem Moment schoß wieder der eine feurige Strahl heran. Ein gellender, furchtbarer Schrei kreischte über die Fluth, die in demselben Augenblick gurgelte und aufschlug, daß sie mit ihren Gluthfunken das Meer ringsum erleuchtete - dann war Alles todtenstill. – Drüben von dem Ufer Eimeos her, über das Donnern der Brandung herüber, tönte noch aus weiter Ferne der muntere Trommelschlag und verrieth die Stelle, wo sich das junge Volk am Tanz vergnügte - und unter ihr? - Maita schauderte zusammen, als sie im Geist ihrem Opfer in die Tiefe folgte - aber es war geschehen! Oro, der wilde Gott, hatte ihr Gebet erhört - er war mächtiger gewesen als der Gott der Bleichgesichter - fort von hier. Ein eisiges Gefühl umspannte ihr Herz, fast unwillkürlich senkte sich das Ruder wieder in die klare Fluth, und über die Schreckensstelle hinweg glitt der Kahn seine einsame, stille Bahn entlang.
Patoi kehrte nie wieder nach Tahiti zurück. Die Missionäre forschten nach ihm - Niemand konnte ihnen Auskunft geben. Maita war allein zu ihrem Vater zurückgekehrt, und am nächsten Morgen hatte die Seebrise Stücke eines zerschmetterten Canoe, das an den Riffen zerschellt sein mußte, an die Küste von Eimeo geworfen. - War er mit diesem verunglückt? Niemand wußte oder erfuhr es, und die Missionäre suchten nur sein junges Weib mit der Versicherung zu trösten, daß, was auch aus dem Körper geworden, seine Seele doch wenigstens gerettet wäre.
Die Privat-Lotterie.
In Memphis - nicht etwa in dem alten, zerstörten egyptischen, sondern in dem neuen, blühenden amerikanischen - dicht am Ufer des Mississippi, aber auf der dort sehr hohen Uferbank, dem sogenannten Bluff, gebaut, gab Tom Scissors eine neue Zeitung heraus, den Memphis Advertiser, die aber, wie das bei neuen Zeitungen und alten Uhren sehr häufig geschieht - nicht recht gehen wollte.
Tom war ein liebenswürdiger, gescheidter Bursch, außerordentlich gewandt mit der Feder und dabei voll von humoristischen Einfällen, sobald er sich in lustiger Gesellschaft und hinter einem Glase Wein befand. Sowie er derartige Sachen aber zu Papier bringen wollte, gerieth er in eine Art von stilistischer Schnörkelei, die auch die besten Ideen und Einfälle abschwächte und langweilig machte und deshalb dem größeren Publikum unverdaulich blieb. Sein Advertiser kam deshalb nicht in Gang und Schwung; die paar Abonnenten, die er hatte, zahlten ihm die Kosten nicht, und wenn er gleich durch Colportage noch Einiges absetzte, gerieth er doch sehr bald dermaßen in finanzielle Schwierigkeiten hinein, daß er sich schon überlegte, ob er mit einem stromauf- oder stromabgehenden Dampfer durchbrennen solle, denn daß er überhaupt durchbrennen müsse, schien außer aller Frage. /111/
Früher hatte er sich einmal um Hülfe an einen Freund gewandt, der in Vicksburg ebenfalls eine Zeitung redigirte und Richard Chalker hieß. Mit Geld konnte ihn dieser zwar ebenfalls nicht unterstützen, machte ihm aber einen andern Vorschlag, und zwar den, als Mitarbeiter in seine Zeitung einzutreten, da er fest überzeugt war, daß Scissors unter vernünftiger Leitung ein ganz brauchbarer Hülfsarbeiter sein würde, wenn er auch nicht im Stande war, selbstständig etwas durchzuführen. Um das zu betreiben, fuhr er endlich, da die Korrespondenz in's Stocken gerieth, selber nach Memphis hinauf und war ziemlich fest überzeugt, daß Scissors den Vorschlag annehmen würde, denn er sicherte ihm doch wenigstens vor der Hand einen Lebensunterhalt, und das Weitere fand sich später.
Chalker erreichte Memphis, stieg den etwas beschwerlichen Weg von der untern Landung bis zum „Bluff" hinauf und betrat endlich das kleine, sehr bescheidene Holzhaus des Freundes, das eigentlich an der Front nur wie ein großes Anzeige-Schild aussah, denn es enthielt auf weißem Grund mit schwarzen Riesenlettern die Ankündigung, daß dort der Memphis Advertiser nicht allein geschrieben, sondern auch gedruckt und ausgegeben würde und Annoncen durch ihn die „weiteste Verbreitung" fänden. Chalker blieb übrigens sehr erstaunt in der Thür stehen, denn er hatte natürlich erwartet, den armen Teufel in einer fast mehr als bedrängten Lage und sehr niedergeschlagen anzutreffen, und statt dessen saß Tom jetzt neben seinem Schreibpult an einem kleinen Tisch und frühstückte - und zwar nicht etwa ein Glas Wasser mit einem Stück trockenen Schiffsbiscuit dazu, wie er ihn das letzte Mal überraschte - sondern hinter einer Flasche Champagner, mit einer offenen Büchse Sardinen und einem delicat aussehenden Häringssalat, während ein kleiner Negerbursch eben mit einem Eimer voll Eisstücken in's „Comptoir" keuchte, um den Champagner darin kalt zu stellen.
„Chalker, alter Junge!" schrie Scissors, von seinem Stuhl emporspringend, als er den Freund erkannte. „Nein, das ist wunderbar! Eben in dem Moment dachte ich mir, wenn Du jetzt ein Zauberer wärst, so würdest Du einen Kreis /112/ ziehen, eine richtige Beschwörung machen und Deinen Vicksburger Dick hierher citiren, und wie aus dem Boden heraufgewachsen stehst Du plötzlich auf der Schwelle. Hierher, old boy, hierher - da rück‘ Dir den Stuhl zum Tisch. Du, Sip, gieb noch ein Glas aus dem Schrank dort, und Messer, Gabel, Teller. So, und nun trink erst einmal vor allen Dingen und stoß mit mir an: Es lebe die Intelligenz!“
„Höre einmal, tom“, sagte Chalker, der sich von seinem Erstaunen noch immer nicht erholen konnte. „Wenn wir in Californien wären, so würde ich die Sache ganz natürlich finden und glauben, Du wärst über irgend einen kürbisgroßen Goldklumpen gefallen, der Deine Umstände so mit einem Schlag verbesserte. Da aber, so viel ich weiß, in Tennessee noch keine Goldlager entdeckt sind, so muß ich Dir aufrichtig gestehen -“
„Du begreifst nicht, wie ich zu dem Champagner komme, heh?“ lachte Tom – „hier, sto9ß an, alter Junge, Du sollst Alles erfahren – Sip, Du kannst jetzt verschwinden und – aber da kommt der Postbote, warte einen Augenblick, Dick – ich will nur ein halbes Dutzend Geldbriefe in Empfang nehmen, nachher darf uns Niemand stören, und wir frühstücken con amore.“
Der Briefträger kam wirklich und brachte eine ganze Hand voll Briefe – sämmtlich mit Geld, die eer quittiren mußte, und als er sie vor Dick auf den Tisch warf, bemerkte dieser zu seinem Erstaunen, daß keiner weniger als zwanzig Dollars, manche aber auch vierzig – einer sogar hundert enthielt, die Scissors mit eine rnonchalance behandelte, als ob er von Jugend auf nichts Anderes gethan hätte, als derartige Werthbriefe in Empfang zu nehmen. Er brach sie nicht einmal auf, sondern warf sie nur in eine Schublade, und seinen Stuhl wieder zum Tisch rückend, rief er aus:
„So - und nun den Champagner, der sich indessen wird abgekühlt haben. Nach gethaner Arbeit ist gut ruhen.“
„und was arbeitest Du jetzt, wenn man fragen darf?“
„Geldbriefe quittieren“, erwiderte Scissors mit der ruhigsten Miene von der Welt, indem er dem Freund den Schaumtrank in das Glas füllte – „weiter nichts, denn meine /113/ Zeitung bersorgt mir jetzt ein junger Deutscher, den ich dafür engagirt habe.“
„Nun löse mir aber auch einmal das Räthsel.“
„Mit dem größten Vergnügen – ich begreife nur nicht, daß es für Dich ein Räthsel ist. Hast Du denn meine Annonce in dem Memphis Advertiser nicht gelesen, in welcher ich mich als junger Ehemann mit einem Vermögen von zehntausend Dollars selber ausgespielt habe?“
„Ach, mach‘ keinen Unsinn – der alte schlechte Witz. Du hast keine zehntausend Cents im Vermögen und, ich glaube sogar, auch noch nie gehabt.“
„Hast Du es nicht gelesen?“
„Gewiß hab‘ ich, und darüber gelacht. Bei Mangel an Stoff war es ein famoses Mittel, um den Raum auszufüllen.“
„Mein lieber guter Freund“, rief Tom, „da bist Du verwünscht auf dem Holzweg, denn es war mehr als das, und ich versichere Dir, es giebt gar nichts so Unsinniges in der Welt, wofür ich nicht eine Anzahl von Gläubigen gewinnen könnte.“
„Höre, Tom, ich vermuthe, Du hast mehr Gläubiger als Gläubige.“
„Früher ja, aber jetzt nicht mehr; doch hör‘ mich nur weiter, denn hier war von keinem Unsinn die Rede, sondern von einer ganz bestimmten und wirklichen Geschäftssache, die ich - wenn ich aufrichtig sein will, eigentlich in einer Art von verzweifelter Laune entrirte, die aber bald so ernsthafte Dimensionen annahm, daß ich an einem Erfolg nicht mehr zweifeln konnte.“
„Du willst mich zum Besten haben.“
„Ich gebe Dir nachher die Beweise. Du erinnerst Dich doch, daß ich vor etwa zwei Monaten der einen Nummer des Advertiser meine Photographie beigab?“
„Ich habe sie allerdings bekommen, aber ich glaubte, Du hättest Dir nur einen Scherz mit mir gemacht. Du kannst sie doch nicht allen Nummern beigelegt haben?“
„Bah, die Auslage war nicht so groß, denn der Advertiser erscheint – bei einem Absatz von 150 in einer Auflage von 250 Exemplaren. Ich machte einen Contract mit /114/ einem Photographen und ließ die eine Nummer in 500 Exemplaren abziehen. Die versandte ich geschickt, und der Erfolg zeigte sich als ein überraschender."
„Du willst mir doch nicht weis machen, daß die Damenwelt angebissen hätte?"
„Hier ist von „weismachen" gar keine Rede, denn Thatsachen sprechen. Du wirst mir nicht leugnen, daß ich ein hübscher Kerl bin?"
„Es hieße Dir das Letzte und Einzige absprechen, was Du noch hast," lachte Chalker - „Du siehst leidlich gut aus."
„Well, das half," nickte Tom. „Ich muß Dir aufrichtig gestehen, daß ich mir anfangs von der ganzen Sache keinen Erfolg versprach. Ja, unter uns: die frevelhafte Idee stieg sogar in mir auf, doch möglicher Weise ein halbes Dutzend oder so auf den Leim gehen zu sehen und dadurch wenigstens ein kleines Capital in die Hand zu bekommen, mit dem ich eine Erholungsreise nach Mexiko, Californien oder irgend einer andern sehr schönen, aber sehr entfernten Gegend antreten konnte - aber die Sache kam anders. In den ersten acht Tagen wurde allerdings kein einziges Loos verlangt - ich hatte die Loose zu fünfzehn Dollars angesetzt. Da fiel ich auf den glücklichen Gedanken, einrücken zu lassen, daß ich unter zwanzig Dollars kein Loos mehr abgeben könne, da sich die Anmeldungen zu sehr häuften, und von dem Augenblick an blühte mein Weizen.
„Schon an dem nämlichen Nachmittag bekam ich aus hiesiger Stadt allein einundzwanzig Briefe mit einliegenden zwanzig Dollar-Noten - allerdings anonym und der Aufgabe, die Loose unter bestimmten Chiffern auf die Post zu legen. Das geschah. Ich hatte ausgeführt, daß ich durch diese Privat-Lotterie ein Capital von zehntausend Dollars zusammenbringen wolle - aber mit nur einem Gewinn, und daß die Glückliche, der das große Loos zufiel, damit nicht allein mich als treuen Gatten, sondern auch die zehntausend Dollars in Besitz nehmen solle. Ein guter Freund in New-York besorgte mir dabei, daß meine Photographie in einem vortrefflichen Holzschnitt in einem der dortigen illustrirten Blätter erschien, und wenn ich dadurch auch in New-York, das uns ein wenig zu /115/ fern liegt, nur etwa fünfzig Loose absetzte, so zeigte sich der Erfolg hier in der Nachbarschaft, als jenes Blatt Verbreitung fand doch ganz außerordentlich. Aus dem innern Land häuften sich die Anmeldungen. Von Nashville besonders kam Brief über Brief, selbst von Little Rock, und wie sich nun der Mississippi-Staat ebenfalls dem Unternehmen anschloß, war der Erfolg gesichert. Es kamen Briefe an mit Aufträgen auf zehn Loose - Zwischenhändler verlangten sogar gratis Loose - was ich aber mit Entrüstung zurückwies, und jetzt habe ich sogar die Zahl von fünfhundert Loosen schon überschreiten müssen und bin scharf in das sechste Hundert eingerückt, wodurch natürlich einige Champagnerflaschen frei wurden."
„Und das soll ich Dir glauben?"
„Glauben?" rief Scissors, indem er aufsprang und eine große Schublade öffnete, die in der That nichts als Couverte von Geldbriefen enthielt - „da - hier hast Du den Beweis, wenn Dich der Champagner nicht schon überzeugt hat, daß ich jetzt über andere Mittel verfügen muß als früher, wo ich mich Morgens kaum getraute, ein Glas Brandy und Wasser zu trinken."
Chalker blätterte kopfschüttelnd die Couverte durch, und diese ließen allerdings keinen Zweifel mehr.
„Sollte man es denn für möglich halten," rief er endlich, „daß es so viel verrückte Wesen in der Welt geben könnte!"
„Bitte," rief Scissors lachend aus. „Wenn mein Bild einen guten Eindruck gemacht hat, so kannst Du diesen Damen, die allerdings manchmal sehr unorthographische Adressen schreiben - keinenfalls einen guten Geschmack absprechen, und dann bedenke auch - steht nicht allein ein hübscher Mann, sondern auch ein Capital von zehntausend Dollarn mit aus dem Spiel, was also, bei nur einigermaßen vernünftiger Behandlung, eine gesicherte Lebensexistenz bietet? Die Sache ist an sich gar nicht etwa so unsinnig, wie sie vielleicht im ersten Augenblick erscheint, und daß die Amerikanerinnen praktischen Verstand haben, wird ihnen kein Mensch der Welt abstreiten können. Es ist schon für Viele schwierig, nur einen Mann zu bekommen, viel weniger denn gleich ein Vermögen mit in /116/ den Kauf, und was sind, bei einer solchen Aussicht, zwanzig Dollars. Sie können gar nicht in Betracht kommen."
„Und wann ist die Verlosung?"
„Du bist zur glücklichen Zeit gekommen," rief Scissors, „ich kann den schon zweimal verzögerten Termin nicht länger hinausschieben, und in meiner heutigen Nummer wird der bestimmt festzuhaltende Tag der Verlosung angegeben - und der fällt auf den 1. December - heute haben wir schon den 22. November, also kaum noch acht Tage, die Du es Dir bei mir mußt gefallen lassen. Ich brauche überhaupt Deine Hülfe in verschiedenen Dingen."
„Und Du willst Dich wirklich und wahrhaftig auslosen lassen, Tom?"
„Gar kein Zweifel."
„Hast Du Dir denn aber schon überlegt, was aus Dir wird, wenn Dich so ein recht alter Drachen gewinnt und Du dann moralisch verpflichtet bist, das heilige Band der Ehe mit ihm zu knüpfen?"
„Hm," sagte Tom schmunzelnd, „das habe ich mir allerdings überlegt, und in solcher Zeit schwankte dann die Schale mit den zehntausend Dollarn bedeutend. Wo aber das Glück zweier Menschen auf dem Spiele steht - ich meine mich und meine künftige Frau - da, denk' ich, kann eine gelinde Nachhülfe auch eben nicht Sünde sein, und ich habe so einen kleinen Plan, bei welchem Du mir vielleicht von außerordentlichem Nutzen sein könntest."
„Ich verstehe nicht was Du meinst."
„Ich werde natürlich deutlicher reden müssen - aber bitte, nimm Dir eine Cigarre; die Kiste steht gleich hinter Dir - die Verlosung selber beabsichtige ich nämlich in Sawer's Hotel drüben abzuhalten, und Du kannst Dir etwa denken, daß es ein Festtag für ganz Memphis wird."
„Wenn auch kein Festtag, doch jedenfalls ein Feiertag," lachte Chalker, „denn neugierig werden sie natürlich Alle sein, die Braut kennen zu lernen, oder doch wenigstens ihren Namen zu erfahren."
„Ja, das Komische ist nur das," sagte Scissors, „daß ich eine Menge Loose unter Chiffre ausgegeben habe und /117/ dann die Glückliche erst annonciren müßte - wenn wir es eben nicht so einrichten können, daß - wir sie hier im Orte haben."
„Das wird schwer sein," lächelte Chalker, „denn Fortuna ist eine sehr unzuverlässige Dame."
„Hm, ja - blind, und wenn man ihr deshalb ein wenig unter die Arme greift?"
„Du willst falsches Spiel treiben?"
„Der Ausdruck ist zu hart. - Ich will einer bestimmten jungen Dame, auf die der Zufall doch jedenfalls auch das Loos werfen konnte, die gewinnende Nummer in die Hand zu spielen suchen, und da die Sache vollkommen privatim getrieben wird, denke ich es mir nicht so schwer."
„Und nennst Du das nachher eine Lotterie?"
„Bah - so viel für den Namen! Indem ich das Schicksal ein wenig controlire, bewahre ich vielleicht zwei Menschen - das heißt mich und irgend eine alte unangenehme Dame, vor bitterer Reue und Unglück. - Sie hat dann für ihre zwanzig Dollars eine Zeit lang die angenehme Aufregung, sich als Gewinnerin zu denken, und ich - habe eine hübsche Frau und zehntausend Dollars Capital -"
„Und wie willst Du's machen?"
„Der Negerjunge, den Du vorher gesehen hast, mein Sip, ist ein durchtriebener schlauer Bursch und mit allen Hunden gehetzt - der wird als „Waisenknabe" ziehen. Ich selber lese, in einer entfernten Ecke des Zimmers, um jeden Verdacht eines Betrugs unmöglich zu machen - die verschiedenen Nummern ab, wie sie mir in die Hand fallen - Sip wird durch ein schon mit ihm verabredetes Zeichen aufmerksam gemacht, und die nächste Nummer, die dann folgt, und zwar 325 - erhält mit lauter Stimme den Namen Thomas Scissors' - dessen Zettel er schon die ganze Zeit versteckt im Aermel trägt."
„Und wenn es entdeckt wird?"
„Wer kann es beweisen?"
„Und wer ist Nr. 325 ?"
„Ein reizendes Wesen, sage ich Dir, ein wahrer Engel, /118/ die sich selber das Loos bei mir geholt hat und gar so lieb und verschämt aussah, als sie mir das Geld einhändigte."
„Und Du hast es von ihr genommen?"
„Lieber Freund, in Geldsachen hört - allen bekannten Erfahrungen nach - die Gemüthlichkeit auf, und ich nahm es ja außerdem auch nur deshalb, um es ihr vielhundertfältig wieder zurück zu erstatten."
Chalker saß auf seinem Stuhl, rauchte, trank Champagner dazu und schüttelte unaufhörlich mit dem Kopf.
„Du kannst aber die Verlosung doch nicht etwa heimlich abmachen," sagte er endlich, „und nachher nur die betreffende Nummer in Deinem Blatt anzeigen?"
„Gott bewahre - ich denke gar nicht daran," rief Scissors. „Wenn Du Dich auf die verschiedenen Ankündigungen besinnst, so mußt Du ja aus denen schon ersehen haben, daß die ganze Verlosung vollkommen öffentlich betrieben wird. Sämmtliche Interessenten werden feierlichst eingeladen, Theil an dem Actus zu nehmen - je mehr Menschen wir dabei haben, desto besser, denn desto öffentlicher wird dann gleich das Resultat und ein Widerspruch von vornherein zur Unmöglichkeit. Glaube mir, Dick, ich habe mir das Alles reiflich überlegt, und Du kannst Dir doch wohl denken, daß ich in einer Sache, bei der Alles für mich auf dem Spiele steht, nicht so leicht einen dummen Streich machen werde."
„Na, wir wollen's hoffen," sagte Chalker - „ein Betrug bleibt's aber immer."
„Aber doch nicht für mich!" rief Scissors - „ich bekomme doch jedenfalls zu den zehntausend Dollarn, die ich schon habe, eine Frau, mit der ich das Capital theile, nicht wahr?"
„Allerdings -"
„Also ich thue weiter nichts, als unbemerkt dem Schicksal die Hand zu führen, damit es nicht etwa blind und dann auch wahrscheinlich höchst ungeschickt in die Urne greift, sondern mir den Namen der Richtigen herauszieht. Wenn ich jetzt mit dem Gelde, ohne Frau, davonliefe, ja dann hättest Du Recht, dann wäre es ein Betrug, den ich nicht einmal vor mir selber verantworten möchte, aber so doch wahrhaftig nicht!" /119/
„Und lebt Deine Auserwählte hier in Memphis?"
„Nein. Sie muß irgendwo im innern Land zu Hause sein und befand sich hier nur eine Zeit lang bei einer alten Tante zum Besuch. Ich habe mich aber, wie Du Dir wohl denken kannst und begreiflich finden wirst, gar nicht nach ihr erkundigen dürfen. Ich bin ihr sogar einmal, mit ihrer Tante, auf der Straße begegnet und habe sie - Du wirst gewiß meine Zurückhaltung bewundern - nicht einmal gegrüßt. Mich kannte sie aber, denn als ich an ihr anscheinend gleichgültig vorüberging, merkte ich gut genug, daß sie bis hinter die Ohren roth wurde. Ich sage Dir, es ist ein himmlisches Mädchen."
Chalker lachte. - „Jetzt ist sie nicht mehr hier?"
„Ich weiß es nicht - ich habe sie wenigstens seit vierzehn Tagen nicht mehr gesehen und kenne auch ihre Wohnung nur von außen - dicht neben der Bank in dem neuen Backsteinhaus. Es müssen wohlhabende Leute sein."
„Vielleicht eine arme Verwandte."
„Und wenn auch, was schadet das? Wir haben zusammen ein Capital, mit dem man hier in Amerika schon etwas anfangen kann, und wenn wir das zusammenhalten, so müßte es mit dem Bösen zugehen, oder ich bringe es noch zu etwas Bedeutendem in den Staaten. Jedenfalls denke ich, die Zeitung gleich nach der Lotterie aufzugeben und meine advocatorische Praxis wieder aufzunehmen. Der Advertiser hat seine Schuldigkeit gethan - er kann gehen, wie jener Nigger in dem deutschen Drama sagt."5
„Und Du willst hier in Memphis bleiben?"
„Gewiß. Hier bin ich durch die Lotterie bekannt geworden. Mein Name ist seit den letzten vier Wochen in Aller Munde, und ich mag jetzt anfangen, was ich will, ich muß reussiren."
„Hast Du die zehntausend Dollars beisammen?"
„Ich sage Dir ja, ich bin - nach Bezahlung meiner sämmtlichen Schulden, schon im elften Tausend und somit ein gemachter Mann."
„All right then," rief Chalker, der als ächter Yankee auch gerade nichts besonders Unrechtes in einer derartigen Täuschung sah. Die Sache war jedenfalls smart angelegt, die /120/ Hauptsache in allen amerikanischen Unternehmungen, und das entschuldigte eben so gut hölzerne Schinken und Muskatnüsse, wie Unterschiebung eines Looses in einer solchen Lotterie. Die weitere Unterredung mit dem Freunde betraf auch von da ab nicht mehr die rechtliche Seite des Unternehmens, sondern nur die verschiedenen Mittel und Wege, um es geschickt durchzuführen, und darüber verständigten sie sich bald und leicht.
*
Es sind merkwürdigere Unternehmungen in Amerika in's Leben gerufen und durchgeführt worden, als die Auslosung eines jungen hübschen Mannes, und die Sache an sich war nicht einmal neu. Aber das schadete nichts, sie blieb jedenfalls pikant, und daß sich ganz Memphis dafür auf das Lebhafteste interessirte, läßt sich denken.
Wie der Tag heranrückte, machte denn auch der Wirth des Hotels, in welchem die Verlosung stattfinden sollte, die nöthigen Vorbereitungen, um dem Ganzen einen würdigen und zugleich freundlichen Anstrich zu geben. Das Hotel wurde von oben bis unten mit grünen Büschen besteckt, und der Saal besonders, in welchem dieselbe stattfinden sollte, auf das Geschmackvollste decorirt. Scissors arrangirte das selber mit und baute vorzüglich an dem Platz, an welchem die verhängnißvolle, aber von ihm nicht mehr gefürchtete Urne aufgestellt werden sollte, eine ordentliche Laube von Buschwerk und tropischen Pflanzen auf, hinter welcher der kleine Negerjunge schon allein halb versteckt stand. Erst als Alles beendet und die Zeit auf Nachmittags halb zwei Uhr festgestellt war, da um ein Uhr noch die Post von Nashville eintraf, und diese möglich ankommender Theilhaber wegen abgewartet werden mußte, verließ er das Hotel wieder, um mit Chalker in der untern Stadt - dem sogenannten Memphis below the bluff - sein Mittagsmahl zu verzehren. Er war oben in der Stadt zu viel geneckt worden und wollte dem leichtfertigen und übermüthigen jungen Volk etwas aus dem Wege gehen.
„Sage einmal, um was ich Dich schon immer die letzten /121/ Tage fragen wollte," meinte Chalker, indem sie zusammen den ziemlich steilen Fahrweg hinabschritten, „hast Du Deine Dulcinea noch nicht wieder gesehen?"
„Heute," rief Scissors, indem er den Arm des Freundes preßte - „vor kaum einer Stunde, als ich eben eigenhändig ein paar Blumentöpfe in das Hotel trug. - Sie ist da - sie ist bei Gott gekommen, und ich gebe Dir mein Wort, sie sah zum Anbeißen aus. Es ist eins der hübschesten Mädchen in ganz Tennessee, und wenn sie nicht schon früher Gefallen an mir gefunden hätte, ohne daß ich selber etwas Derartiges ahnte - so würde sie doch wahrhaftig kein Loos genommen haben, denn wenn es Eine im ganzen Staat nicht nöthig hat, auf solche Art unter die Haube zu kommen, so ist sie das gewiß."
„Und wie heißt sie?"
„Ich glaube, sie heißt Mary Brown, obgleich ihr Zuname nur Vermuthung ist. Ich hörte neulich von einer Miß Mary Brown, die in dem nämlichen Hause zum Besuch gewesen sein sollte, und den Namen Mary hat sie mir selber angegeben; weiter wollte sie mir aber nichts sagen und meinte nur mit ihrer silberhellen lieben Stimme, ich solle ein Kreuz dahinter machen; das genüge vollkommen, um das Loos nachher zu constatiren, wenn - Du hättest sehen sollen, wie lieblich sie dabei erröthete - es wirklich gewönne."
„Nun," meinte Chalker, „auf den Namen kommt allerdings nichts an, denn das Loos, oder vielmehr dessen Nummer entscheidet Alles. - Uebrigens ist das ein gutes Zeichen, daß Du sie wieder in Memphis gesehen hast, denn es beweist jedenfalls, daß sie ein reges Interesse an dem Erfolg nimmt - sie wäre sonst nicht dazu herüber gekommen. Hast Du sie gegrüßt?"
„Heute konnte ich mir nicht helfen," versicherte Scissors - „ich hätte beinah den einen Blumentopf fallen lassen. Sie kam mir auch zu unerwartet - sie bog gerade um eine Ecke, und wie ich sie vor mir und in ihr liebes herziges Gesicht sah, rief ich unwillkürlich aus: Wie geht's, Miß Mary - freue mich unendlich, daß Sie gekommen sind!"