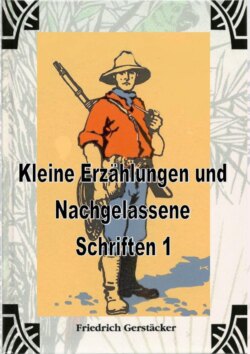Читать книгу Kleine Erzählungen und Nachgelassene Schriften 1 - Gerstäcker Friedrich, Jurgen Schulze - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGesammelte Schriften
von
Friedrich Gerstäcker.
Kleine Erzählungen und nachgelassene Schriften. I.
Volks- und Familien-Ausgabe, Zweite Serie
Band 20 der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Ungekürzte Ausgabe nach der von Friedrich Gerstäcker für die Gesammelten Schriften,
H. Costenoble Verlag, Jena, eingerichteten Ausgabe „letzter Hand“, herausgegeben von Thomas Ostwald für die Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Hinweis: Die im 19. Jahrhundert verfassten Texte Friedrich Gerstäckers enthalten Bezeichnungen, die heute nicht mehr in dieser Form verwendet werden.
In dieser unbearbeiteten Werkausgabe wurden sie unverändert übernommen.
Ausgabe letzter Hand, ungekürzt, mit den Seitenzahlen der Vorlage
Gefördert durch die Richard-Borek-Stiftung und Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. und Edition Corsar, Braunschweig, 2021
Geschäftsstelle: Am Uhlenbusch 17, 38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten! © 2016 / © 2022
Meine Selbstbiographie zu einem Bilde in der Gartenlaube.
Erstveröffentlichung: Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt, Nr. 16, Seiten 244-24, 1870
Mein lieber Keil!
Sie verlangen von mir eine Art von Biographie zu meinem eigenen Bilde, aber das ist eine gefährliche Arbeit. Soll ich mich selber denunciren und eigenhändig bestätigen, daß ich ein Menschenalter hindurch einer der größten Herumtreiber gewesen bin, die es überhaupt giebt, und schon lange polizeilich eingesteckt sein würde, wenn ich mein „ungeordnetes“ Leben nur auf einen kleinen Kreis beschränkt hätte, während ich es, im Gegentheil, nach allen Kräften und Seiten ausgedehnt?
Sie werden mir allerdings einwerfen, daß ich mich ja selber schon in meinen Reisebeschreibungen verrathen habe – aber glauben Sie das nicht. Es giebt factisch noch verschiedene Menschen, die alles Ernstes wissen wollen, daß ich meine zahlreichen Reisen gar nicht wirklich gemacht, sondern sie nur beschrieben hätte. Herbert König behauptet sogar, ich wohne, in der Zeit meiner angeblichen Abwesenheit, bei einem Bäcker in Magdeburg im dritten Stock hinten heraus.
Doch was thut’s? Die Sache läßt sich weder mehr leugnen noch bemänteln – vielleicht nur in etwas entschuldigen.
Was mich so in die Welt hinausgetrieben? – Will ich aufrichtig sein, so war der, der den ersten Anstoß dazu gab, ein alter Bekannter von uns Allen, und zwar niemand Anders als Robinson Crusoe. Mit meinem achten Jahr schon faßte /2/ ich den Entschluß, ebenfalls eine unbewohnte Insel aufzusuchen, und wenn ich auch, herangewachsen, von der letzteren absah, blieb doch für mich, wie für tausend Andere, das Wort „Amerika“ eine gewisse Zauberformel, die mir die fremden Schätze des Erdballs erschließen sollte.
Ewig unvergeßlich bleibt mir dabei ein preußischer Landrath, ein Herr von P., mit dessen Söhnen ich sehr befreundet war. Er betrachtete natürlich jeden Menschen, der nach Amerika wollte, als einen mit den vortrefflichen deutschen Verhältnissen Unzufriedenen, und sprach sich entschieden mißbilligend über meine Absicht aus. Als ich aber trotzdem darauf bestand, redete er mich plötzlich Französisch an. Die französische Sprache ist meine schwache Seite, noch bis auf den heutigen Tag, wenn ich auch seitdem oft gezwungen war, darin zu verkehren. Die plötzliche Anrede brachte mich außerdem in Verlegenheit; ich antwortete nur stotternd, und der Landrath, auf’s Aeußerste indignirt, sagte verächtlich: „Und Sie wollen nach Amerika gehen und können nicht einmal Französisch?“
Ich ging trotzdem und führte nun dort drüben in den westlichen Staaten, nachdem mich freundliche Landsleute im Osten erst vorsichtig um Alles betrogen, was ich mitgebracht, ein allerdings genügend wildes und abenteuerliches Leben. Ich durchzog zuerst die ganzen Vereinigten Staaten quer durch von Kanada bis Texas zu Fuß, arbeitete unterwegs, wo mir das Geld ausging, und blieb endlich in Arkansas, wo ich ganz und allein von der Jagd lebte, bis ich dort halb verwilderte. Ich weiß mich noch recht gut der Zeit zu erinnern, wo meine sämmtliche Wäsche in einem einzigen baumwollenen Hemd bestand, das ich mir selber wusch, und bis zu dessen Trockenwerden ich so herumlief; nur dann und wann trieb mich die Sehnsucht wieder einmal in civilisirte Staaten zurück, aber auch nur auf so lange, bis ich mir mit schwerer Arbeit wieder etwas Geld verdient hatte, um dann, mit einer neuen Ausrüstung, mein altes Leben von Frischem zu beginnen.
Aber es war das doch nur ein zweckloses Umhertreiben, denn zu verdienen ist auf der Jagd nichts. Wo es viel Wild giebt, hat es keinen Werth, und wo es Werth hat, ist es zu mühsam und zeitraubend, es zu erbeuten. Sechs und /3/ ein halbes Jahr hatte ich aber doch in solcher Art verbracht, bis mich das Heimweh nach dem Vaterlande packte, und ich beschloß, dahin zurückzukehren. Was ich da wollte? – Nur meine Mutter und Geschwister einmal wiedersehen und dann in den Wald zurückkehren – was hätte ich auch in Deutschland gesollt? In ein geregeltes und besonders in ein abhängiges Leben paßte ich nicht mehr hinein, und daß ich einst Schriftsteller werden sollte oder könnte, wäre mir nicht im Traum eingefallen.
Geschrieben hatte ich in Amerika natürlich nichts, als Briefe an meine Mutter, und um diese in einem regelmäßigen Gange zu halten, eine Art von Tagebuch geführt. Wie ich mir nun erst in Louisiana das Geld zu meiner Heimreise verdient, nahm ich in New-Orleans Passage auf einem deutschen Schiff, erreichte Bremen und blieb nur einen Tag in Braunschweig, um dort, wo ich den größten Theil meiner Knabenjahre verlebt, alte Freunde zu besuchen. Dort wurde ich gefragt, ob ich der Gerstäcker sei, der seine Reise in den damals von Robert Heller redigirten „Rosen“ veröffentlicht habe. Ich verneinte das natürlich mit gutem Gewissen, denn ich kam frisch aus dem Wald heraus und kannte weder „die Rosen“ noch irgend eine andere der neueren deutschen Zeitungen; aber die Leute, die jene Artikel gelesen hatten, erzählten mir jetzt Scenen aus meinem eigenen Leben und setzten mich dadurch in nicht geringes Erstaunen, denn woher konnten sie das wissen?
In Leipzig erst, wo ich meine Mutter wiederfand, wurde mir das Räthsel gelöst. Sie hatte mein Tagebuch an Robert Heller gegeben und dieser den größten Theil desselben in seinen „Rosen“ aufgenommen. So hat mich denn Robert Heller eigentlich zum Schriftsteller gemacht und trägt die ganze Schuld, denn in Dresden wurde ich später veranlaßt, diese einzelnen Skizzen zusammen zu stellen und ein wirkliches – mein erstes Buch – zu schreiben.
Die schriftstellerische Thätigkeit sagte mir allerdings in sofern zu, als ich dabei ein vollkommen unabhängiges Leben führen konnte, aber ich hatte selber kaum eine Idee, daß ich je etwas Selbstständiges schaffen könne – die einfache Erzählung /4/ meiner Erlebnisse ausgenommen. Ich war damals achtundzwanzig Jahre alt, wandte mich Übersetzungen aus dem Englischen zu, und verdiente mir dadurch wenigstens meinen Lebensunterhalt. Allerdings kam mir manchmal bei der Uebertragung einzelner Erzählungen wohl der Gedanke, daß ich etwas Derartiges auch wohl selber schreiben könne, denn in den vielen Nächten am Lagerfeuer im Walde hatte ich derartige Dinge oft gehört und im Gedächtniß bewahrt, auch viele wunderliche Charaktere selber kennen gelernt. Meine ersten Versuche dahin erzielten aber nur einen sehr geringen Erfolg; ich mußte mit meinem Manuscripte von Redaction zu Redaction laufen, und dann immer wieder das verwünschte Achselzucken!
Meine erste Erzählung druckte die Brockhaus’sche Buchhandlung im damaligen „Pfennig-Magazin“ ab, dann nahm die damalige „Wiener Zeitschrift“ eine größere Erzählung: „Die Silbermine in den Ozark-Gebirgen“ wie eine zweite: „Pantherjagd“ an und zahlte mir dafür ein Honorar von – fünf Gulden. Bäuerle von der „Theaterzeitung“ wollte dagegen eine andere, die er sich jedoch nicht einmal Mühe nahm zu lesen, selbst nicht umsonst in sein Blatt aufnehmen, und mir lag doch damals hauptsächlich daran, nur bekannt zu werden. Es ist mir später die Genugthuung geworden, daß Herr Bäuerle diese nämliche Erzählung, die später in das Englische übersetzt wurde und von da in die „Indépendance belge“ überging, aus dem Französischen in das Deutsche zurückübersetzt (natürlich ohne meinen Namen) in sein Blatt aufnahm und dann auch noch für die jetzt verstümmelte Erzählung jedenfalls Uebersetzungshonorar bezahlen mußte.
Im Jahr 1845 schrieb ich meinen ersten Roman: „Die Regulatoren“, der freundlich vom Publikum aufgenommen wurde, aber ich bekam, nachdem ihn ein paar Buchhandlungen abgelehnt (jetzt ist er stereotypirt worden), nur ein sehr geringes Honorar dafür, und das Jahr 1848 legte nachher fast jede belletristische Unternehmung lahm.
Ich hatte mich unter der Zeit verheirathet, fühlte auch, daß ich unter solchen Umständen, mit harter Arbeit, wohl meine kleine Familie ernähren könne – aber weiter nichts, /5/ und lebenslang Uebersetzer bleiben? der Gedanke war mir entsetzlich. Ich fühlte jetzt die Kraft in mir, etwas zu schaffen, und faßte den allerdings kecken Entschluß – denn ich war ohne alle Mittel und hatte Weib und Kind –, die todte Zeit in Deutschland zu benutzen und – eine Reise um die Welt zu machen. Ich trat augenblicklich mit der Cotta’schen Buchhandlung in Unterhandlung, um Correspondenzen für das Beiblatt der Augsburger Zeitung zu liefern – die Herren gingen endlich darauf ein, mir vierhundert Thaler Vorschuß zu zahlen. Das damalige Reichsministerium bewilligte mir außerdem (und die Leute sagen, ich sei der Einzige, der damals etwas vom deutschen Reich gehabt) fünfhundert Thaler, um die verschiedenen deutschen Colonien im Auslande zu besuchen, und mit neunhundert Thalern trat ich guten Muths eine Reise, die neununddreißig Monate dauerte, an.
Indessen hatte ich einen Roman: „Pfarre und Schule“ beendet, für den ich von der Georg Wigand’schen Buchhandlung vierhundert Thaler (in Raten an meine Frau während meiner Abwesenheit zu zahlen) erhielt; für das Weitere verließ ich mich, wie schon oft im Leben, auf den lieben Gott und mein gutes Glück – und beide haben mich nicht im Stiche gelassen. Daß ich von den neunhundert Thalern nicht die ganze Reise machen konnte, ist natürlich, aber wo mir auch das Geld ausging, und das geschah verschiedene Male – bekam ich, doch jedenfalls allein auf mein ehrlich Gesicht, an allen fremden Plätzen von deutschen Kaufleuten die nöthige Summe auf Wechsel an die Cotta’sche Buchhandlung, der ich denn auch fleißig Berichte schickte, durch die ich der Sorge für meine Familie enthoben ward. Erst in Australien fand ich wieder fünfhundert Thaler, die Kaufmann Schletter in Leipzig dort für mich deponirt hatte, und wenn ich auch in Java wieder eine frische Summe aufnehmen mußte, hatte ich doch von da an gewonnen.
Im Jahr 1852 kehrte ich nach Deutschland zurück und fand nicht allein die Meinen wieder, sondern auch die Verlagsbuchhändler (eine sehr wichtige Menschenklasse für einen jungen Schriftsteller) viel freundlicher, als sie sich mir je gezeigt. Ich selbst hatte durch diese Reise einen fast übermäßig reichen /6/ Hintergrund für meine Novellen und Romane gewonnen, und arbeitete jetzt acht Jahre unverdrossen fort, bis mich 1860, nicht etwa Mangel an Stoff – denn ich hatte damals schon genug, um für mein Leben auszureichen, – doch neue Wanderlust und das Bedürfniß erfaßte, die schwächer werdenden Bilder jener fremden Welt auf’s Neue aufzufrischen. Ich machte eine achtzehnmonatliche Tour durch Südamerika, wobei ich mein Augenmerk besonders auf früher noch nicht besuchte oder neu entstandene Kolonien richtete, wie vorzüglich in Ecuador, Peru, Chile und Brasilien.
Im Jahr 1861 kehrte ich nach Europa zurück; ich hatte lange keine Briefe von daheim gehabt – meine Frau war krank geworden und – gestorben; eine trübe Wiederkehr. Es litt mich auch nicht lange in Deutschland. Schon im Frühjahr 1862 ging ich mit dem Herzog von Coburg nach Egypten und Abyssinien, machte dann in den Jahren 1867 und 1868 meine letzte Reise nach Nordamerika, Mexiko und Venezuela und bin jetzt scharf daran, meine Erinnerungen auszuarbeiten.
Was ich Alles geschrieben? ich will Ihren Raum hier nicht mit der Aufzählung meiner verschiedenen Schriften füllen – und wie ich es geschrieben? – Es ist mir von verschiedenen Seiten, und oft sehr vornehm, vorgehalten worden, daß ich ein rein praktischer Mensch wohl, aber kein Gelehrter sei – lieber Gott, es muß auch solche Käuze geben und ich räume das gern ein. Ich habe mich nie in rein wissenschaftlicher Art mit Pflanzen-, Stein- oder Thierkunde beschäftigt, meine Augen dagegen fest auf den Punkt gehalten, der von den meisten Naturforschern auf das Gründlichste vernachlässigt ist – auf die Menschen, und zwar auf die Völker, wie sie jetzt auf der Erde leben. Ebenso durchzog ich vorzugsweise die Länder, denen sich unsere deutsche Auswanderung zugewandt, und daß ich es nicht ganz nutzlos gethan, hat mir jetzt wieder so mancher warme Händedruck da draußen in fremden Ländern und an Stellen bewiesen, wo ich nicht einmal hoffen durfte, einen entfernten Bekannten zu treffen, und trotzdem überall warme Freunde fand.
„Und wollen Sie nicht wieder bald einmal auf Reisen gehen?“ /7/ werde ich von vielen Leuten, die mich als eine Art von Perpetuum mobile zu betrachten scheinen, gefragt. Quien sabe! Ich bin allerdings, wie Sie wissen, noch in den „besten Jahren“ und gerade etwa vierundfünfzig, habe also „nichts versäumt“, will es aber doch jetzt noch eine Weile abwarten und nur erst den Stoff verarbeiten, der mir zunächst auf dem Herzen liegt, – was dann weiter wird? – es ist das Unglücklichste, was ein Mensch auf der Welt thun kann: Pläne auf Jahre hinaus zu machen, wo er nicht einmal Herr über den nächsten Tag ist. – Was kommen soll, kommt. Ich habe völlig Zeit, es ruhig abzuwarten, und die verfliegt mir außerdem rasch genug, denn ich lebe ja jetzt in meinen Erinnerungen.
So alt bin ich freilich geworden, daß ich das Leben, was ich geführt, nicht noch einmal von Anfang an durchkosten möchte, aber ich würde es auch gegen kein anderes der ganzen Welt eintauschen, denn bunt und mannigfaltig war es zur Genüge – ich habe Jahre lang in großen Städten, von Comfort umgeben, und ebenso im wilden Urwalde von Wildfleisch und zu Zeiten sogar von Sassafras-Blättern oder einem alten Kakadu gelebt – ich bin Gast von gekrönten Häuptern und Feuermann auf einem Mississippi-Dampfer wie Tagelöhner gewesen, aber ich war stets frei und unabhängig wie der Vogel in der Luft, und mit Lust und Liebe zu meinem Berufe, den ich mir nicht gewählt, sondern in den ich eigentlich hineingewachsen bin, mit einer Fülle von Erinnerungen und noch genug Schaffenskraft, mich ihrer zu erfreuen, ja auch mit dem Bewußtsein, manches Gute gethan und manchem Menschen genützt zu haben, fühle ich mich hier an meinem Schreibtische genau so wohl, als ob ich da draußen auf flüchtigem Renner durch die Pampas hetzte oder unter einem Fruchtbaum am Meeresstrande der donnernden Brandung gegen die Korallenriffe lauschte.
Da haben Sie meine Lebensbeschreibung, lieber Keil. Ich bin, wie gesagt, kein Gelehrter, aber
„Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Wald, in Strom und Feld“;
/8/ und in diesem Sinne kann ich mich wirklich und wahr einen „Schriftsteller von Gottes Gnaden“ nennen, als der ich mich zeichne
Ihr alter getreuer
Friedrich Gerstäcker.
Braunschweig, im März 1870.
Der Herr von der Hölle.
Erstveröffentlichung 1869: Im Mondenschein [Der Herr von der Hölle. Eine verzweifelte Geschichte.]
Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft. Herausgegeben von Ernst Dohm und Julius Rodenberg. Band 5, Seiten 385-412. Leipzig: A. H. Payne
1. In Verzweiflung.
Ueber dem freundlichen Lahnthal stand der Mond1 und warf sein mildes Licht auf die bewaldeten Höhen, auf den blitzenden kleinen Strom und auf einen von Menschen schwärmenden Platz nieder, der sich aber dort unten seinen eigenen Lichterglanz gebildet hatte und wahrlich den sanften Schmelz nicht achtete, der da draußen, in unbeschreiblichem Zauber, auf der Landschaft lag.
Wunderliche Welt! Wunderliches Menschenvolk darin, das sich überall einnistet und ausbreitet und die Natur selber seinen Leidenschaften dienstbar macht.
Oben auf den Bergen lag der stille Frieden Gottes. Versteckt auf der in Myriaden von Thauperlen funkelnden Wiese, die schlanken, geschmeidigen Körper scharf in dem Schatten der Mondenstrahlen abgezeichnet, äste sich ein kleines Rudel Rehwild, und darüber hin strich die Nachtschwalbe mit ihrem melancholischen Ruf – die Grille zirpte, und leise rauschte in der vom Rhein herüberwehenden Brise das junge saftige Buchenlaub. Unten aber im Thal, aus der Erde Grund /10/ herauf, quoll geheimnißvoll aus rätselhafter Tiefe der heiße Quell – noch Blasen werfend in der kühlen Abendluft, wie er sich den unterirdischen Gluthen eben entrungen, und daneben, ja sogar darüber hatte das Menschenvolk seine Wohnungen selbst in den starren Fels hineingebohrt und hauste da nach Herzenslust.
Wie ein Palast hob es sich dort mit hohen, luftigen und jedem nur erdenkbaren Luxus ausgestatteten Räumen, von rauschender Musik durchströmt, von zahllosen Lampen erhellt, und mitten darin, das Centrum des Ganzen bildend – der eigentliche Blocksberg, zu dem in der Nacht des ersten Mai der böse Feind seine Anhänger zieht, sie dort zu einem wilden Fest vereinigend, – standen die grünen Tische mit Gold, Silber und Banknoten bedeckt. Das Auge der Opfer, die sich um die gefährlichen Stellen drängten, sah aber nicht den milden Mondenglanz, der draußen an den Hängen lag – ihr Ohr vernahm nicht einmal die rauschende Musik umher, viel weniger noch das geheimnißvolle Murmeln der unterirdischen Quellen, denn nur an dem blitzenden, klingenden Gold auf den Tischen hingen die Sinne. Was kümmerte sie die Welt, und wenn sie sich in ihrer ganzen Pracht entfaltet hätte!
Aus den hell erleuchteten Räumen in die Mondnacht hinein schritt eine kleine schmächtige Gestalt, das Antlitz todtenbleich, das dünne röthliche Haar wirr um die Schläfe hängend und dabei so vollständig rath- und gedankenlos, daß er selbst ohne Hut hinaus in’s Freie wollte. Der Portier an der Thür wußte aber besser, was sich schickt; er war außerdem Menschenkenner und hatte die kleine dürftige Gestalt schon aufmerksam betrachtet, als sie die erleuchtete Halle nur betrat – ja sogar dem fadenscheinigen Rock den Eintritt verweigern wollen. Jetzt reichte er ihm schweigend und mit einem bedauernden Achselzucken – denn ein Trinkgeld stand nicht in Aussicht – den Hut, und der kleine blasse Mensch stürmte hinaus – fort. Und nicht einen Blick warf er umher – zwischen den Bänken, Tischen und Stühlen, die draußen unter den Schattenbäumen im Freien standen, wand er sich hindurch, der schmalen eisernen Brücke zu, die über die Lahn führt. Diese überschritt er; /11/ an dem Bassin vorüber, in welchem die heißen Wasser abgekühlt werden, ging er, den Blick fest auf den Boden geheftet, – drüben passirte er das letzte Haus und schlug sich dann, hügelan, in ein kleines Wäldchen hochstämmiger süßer Kastanien hinein, das, von Blüthen bedeckt und wie mit Silber übergossen, seine ganze Pracht entfaltete.
Aber was kümmerte den Unglücklichen die herrliche Mondnacht und der Schmelz der Blüthen! Finstere Gedanken zerquälten sein Hirn, und mit festverschränkten Armen schritt er durch den kleinen Kastanienhain bis zum obern Rand hinan, wo er sich aus Sicht von jeder menschlichen Wohnung, von jedem begangenen Wege befand. Dort erst hielt er an und warf den scheuen Blick umher.
Es dauerte übrigens nicht lange, bis er das gefunden, was er zu suchen schien: einen starken, gerade ausgehenden Ast eines der stärkeren Kastanienbäume, und dort – wie an einem Ziel angelangt, die Stirn in finstere Falten gezogen, das Auge düster drohend, schleuderte er seinen Hut zu Boden und begann seine Vorbereitungen zu einem letzten, verzweifelten Schritt.
Er knöpfte seine Weste auf und schlang ein nicht dickes, aber sehr festes Seil los, das er sich um die Taille gewunden hatte. Dann, ohne sich auch nur einen Moment zu besinnen, machte er mit kundiger Hand an dem einen Ende eine Schleife und warf das andere Ende über den Ast.
Hier aber traf er auf eine Schwierigkeit, auf die er anfangs nicht gerechnet haben mochte. Der Ast stand vortrefflich aus, aber er war für seine kleine Statur zu hoch, wie der Baum ebenfalls zu dickstämmig, um ihn zu erklettern – der angehende Selbstmörder schien wenigstens in solchen gymnastischen Künsten nicht geübt.
Er hielt jetzt einen Moment in seiner Arbeit inne, um sich zu überlegen, wie er dies Hinderniß am besten überwinden könne. Es war auch in der That nicht so leicht, und er dachte gerade daran, sich vielleicht einen bequemeren Baum auszusuchen, als er plötzlich zusammenschrak; denn dicht und unmittelbar neben sich hörte er eine Stimme, die mit der größten Ruhe und Unbefangenheit sagte:
/12/ „Der Baum ist ein bischen unbequem – Sie hätten sich einen etwas niedrigeren Ast aussuchen sollen. Ich glaube, der dort drüben wäre besser geeignet.“
Der Selbstmörder fuhr wie von einer Natter gestochen herum und sah unter den Bäumen, aber gerade von einem Strahl des hindurchbrechenden Mondlichtes getroffen, die Gestalt eines anständig gekleideten Herrn, der dort mit dem Rücken an dem Stamm einer Kastanie lehnte und allem Anschein nach schon dort gewesen sein mußte, als er selber den Platz betrat, denn die Schritte eines Nahenden hätte er jedenfalls gehört. Der aber doch zur Verzweiflung getriebene junge Mensch war nicht in der Stimmung, Rücksicht auf irgend Jemanden zu nehmen. Was hatte der Lauscher hier zu thun? Ihn an seinem Vorhaben zu verhindern? Die Folgen über ihn, und mit seiner rechten Hand blitzesschnell in die Tasche greifend, zog er ein kleines Einschlagmesser heraus öffnete dasselbe rasch und sagte dann mit drohender Stimme:
„Was wollen Sie hier? Wie sind Sie hierher gekommen? Beim Himmel, wenn Sie versuchen wollten, mich hier zu stören, so haben Sie sich an den falschen Mann gewandt. Wo ich im Begriff bin, mein eigenes Leben in die Schanze zu schlagen, können Sie sich wohl denken, daß ich keine Rücksicht auf das eines Fremden nehme. Fort von hier! Wenn Sie nur den geringsten Versuch machen sollten, mir zu nahen, so renne ich Ihnen dies Messer in den Leib.“
„Aber, verehrter Herr,“ sagte der Fremde, ohne sich durch die Drohung einschüchtern zu lassen, oder auch nur eine Bewegung zu machen, als ob er dem Gebot Folge leisten wolle, „ich habe nicht die entfernteste Absicht Sie zu stören, oder Ihnen in einem guten Vorsatz hinderlich zu sein. Ich stehe Ihnen im Gegentheil mit Vergnügen zu Diensten, wenn ich Ihnen dabei in irgend etwas nützen kann.“
Der Unglückliche betrachtete ihn noch immer mißtrauisch. Es war eine nicht übermäßig große, schlanke Gestalt mit regelmäßigen, aber blassen Gesichtszügen – oder gab ihm nur das grelle Mondlicht diese Färbung? Nach der neuesten Mode gekleidet, quollen unter seinem Cylinderhut volle rabenschwarze Locken vor, und indem er jetzt den leichten Ueberrock zurück /13/ schlug – als ob ihm etwas warm darunter würde, zeigten sich verschiedene bunte Decorationen auf seiner Brust. Er gehörte jedenfalls den höheren – wenigstens den bevorzugten Ständen an.
„Ich verstehe Sie nicht,“ sagte der Unglückliche, nachdem er den Fremden ein paar Momente in düsterem Schweigen betrachtet hatte; „Sie wollen mir helfen, meinem Leben ein Ende zu machen, das ich nicht im Stande bin, länger zu ertragen? Weshalb?“
„Sie nennen gleich den Grund mit,“ sagte der Fremde mit einer leichten Handbewegung. „Wenn Sie wirklich nicht im Stande sind, es länger zu ertragen, so ist es Ihnen doch eine Last, und was sollte mich da abhalten, Ihnen zu nützen? Weil die Handlung vielleicht ungesetzlich ist? Die Sache würde komisch sein, wenn sie nicht auch ihre ernste Seite hätte – aber entschuldigen Sie,“ unterbrach er sich selber, „wenn ich Sie durch mein Geschwätz so lange aufhalte. Der Ast da ist Ihnen ein wenig zu hoch, ich habe aber, als ich hierher kam, dort drüben eine kleine Leiter stehen sehen, die der Gärtner wahrscheinlich zu irgend einem Zweck benutzt; ich glaube, daß dieselbe Ihrem Zweck vollständig genügen wird, und wenn Sie erlauben, hole ich Ihnen dieselbe – ich bin den Augenblick wieder hier.“ – Ohne auch nur eine Antwort abzuwarten, ging er vielleicht zwanzig Schritt unter den Bäumen hin und kehrte wirklich gleich darauf mit einer kleinen Leiter zurück, die er neben dem Unglücklichen mit der unbefangensten Miene von der Welt an den Baum lehnte.
Der Selbstmörder hatte ihn noch immer im Verdacht, daß alles dieses nur ein Vorwand sei, um an ihn hinan zu kommen, damit er plötzlich auf ihn springen und ihn an der That verhindern könne; er trat auch ein paar Schritte von dem Manne zurück und hielt das gezückte Messer noch immer in der Hand – fest entschlossen, keiner menschlichen Gewalt zu weichen. Der Fremde aber achtete nicht einmal auf die drohende Bewegung, und als er die Leiter so gestellt hatte, daß man jetzt von ihr aus bequem den Ast erreichen konnte, wandte er sich wieder ab, ging zu seiner alten Stelle und sagte dann ruhig:
/14/ „So, lieber Freund, jetzt sind Sie nicht im Geringsten mehr gehindert; wenn Sie die Schlinge gemacht und um den Hals gelegt haben, brauchen Sie nur die Leiter mit den Füßen umzustoßen, und das Resultat wird ein vollständig befriedigendes sein. – Bitte, geniren Sie sich auch nicht etwa meinetwegen; ich bin schon sehr häufig Zeuge solcher oder ähnlicher Handlungen gewesen und vollständig daran gewohnt.“
Der junge Mensch war, als er diese Stelle betrat, fest entschlossen, seinem wahrscheinlich verfehlten Leben ein Ende zu machen, und er hätte auch alle Schwierigkeiten, die sich ihm da in den Weg stellen konnten, in seiner doch nun einmal verzweifelten Stimmung überwunden. Dieses Entgegenkommen eines Fremden aber, diese wahrhaft entsetzliche Gefälligkeit, mit der er die Hand lieh, einen Mitmenschen zum Selbstmörder zu machen, ja das kalte, ironische Lächeln, das auf seinen Zügen lag, strich ihm doch wie ein eisiger Reif über die Seele, und starr den Blick auf ihn geheftet, rief er:
„Mensch oder Teufel, der Du bist – hebe Dich weg von mir! – Eine eigene Angst überkommt mich in Deiner Nähe – fort und laß mich allein sterben!“
Ein Lächeln flog über die Züge des Fremden.
„Es ist sehr freundlich von Ihnen,“ sagte er, „daß Sie mich mit dem vertraulichen Du anreden, und wenn Sie nicht in solcher entsetzlichen Eile wären, die mondbeschienene Erdoberfläche zu verlassen, so könnte es vielleicht zu einer näheren Bekanntschaft führen – doch die Menschen sagen: des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und wer sich aus diesem Himmelreich selber eine Hölle machen will, dem,“ setzte er achselzuckend hinzu, „kann man es natürlich nicht wehren. Ich störe außerdem nie ein Vergnügen – also à revoir mon cher, denn – wenn Sie Ihren Vorsatz ausführen, soupiren wir vielleicht heut Abend noch zusammen.“
Damit lüftete er leicht den Hut, drehte sich ab und wollte den Platz eben verlassen, als der junge Verbrecher, vielleicht durch die Verzögerung und das Zusammentreffen mit einem Fremden – möglicher Weise auch durch die furchtbare Bereit /15/ willigkeit wankend gemacht, mit der dieser ihn in seinem Vorsatz zu bestärken schien, ihn noch einmal anrief:
„Und ist das alle Hülfe, die Sie mir leisten wollten?“
Der Fremde drehte sich lachend um und sagte:
„Wünschen Sie vielleicht Geld von mir zu borgen?“
„Teufel!“ knirschte der junge Verbrecher zwischen den Zähnen, wandte sich ab und ergriff jetzt entschlossen die Leiter – was auch hatte er auf Erden noch zu suchen – aber der Fremde schien sich anders besonnen zu haben. Er ging nicht, sondern kehrte um, kam bis auf fünf Schritt etwa, wo der junge Mann schon die Schlinge befestigte, heran und sagte:
„Hören Sie einmal, lieber Freund. Sie scheinen mir ein nicht unbedeutendes Ahnungsvermögen zu besitzen. Warten Sie noch einen Augenblick mit Ihrer Abreise, es wär’ doch möglich, daß ich auch hier auf Erden noch eine Beschäftigung für Sie fände.“
„Sie? für mich?“ sagte der junge Selbstmörder mit finsterem Blick. „Wer sind Sie denn überhaupt?“
„Der Teufel,“ sagte der Fremde ruhig – und nur mit einem leisen spöttischen Zug um die Lippen. „Sie nannten ja vorhin meinen Namen.“
„Der Teufel?“ rief der Unglückliche, und ein eigenthümliches Zittern flog über seinen Leib – die stille Nacht – der fahle Mondschein, der einsame Ort, ja die unheilige Absicht selbst, in der er sich hier befand, das alles mochte zusammenwirken, um sein Herz mit einem unbestimmten Schauder zu erfüllen – aber das konnte doch nur Momente dauern, und mit heiserer Stimme lachte er wild auf:
„Das wäre in der That ein vortrefflicher Gesellschafter für meine Reise – wenn es überhaupt einen Teufel gäbe. – Nur so viel ist sicher, ein Herz haben Sie nicht, oder Sie könnten nicht mit einem Menschen in meiner Lage Ihren Scherz noch treiben. Fort! Sie sind nicht im Stande, mir zu helfen.“
„Das käme auf einen Versuch an,“ sagte der Fremde. „Sie brauchen jedenfalls Geld, weiter nichts.“
„Und selbst eine kleine Summe könnte mir nichts nützen,“ sagte der junge Spieler finster, „mein Unglück liegt tiefer – /16/ ich habe meinen Beruf verfehlt, und jede Hülfe jetzt würde nur dazu dienen, mein Schicksal um Monate – ja vielleicht Wochen hinaus zu zögern.“
„Ihren Beruf verfehlt? Caramba!“ sagte der Fremde (und der Teufel soll allerdings immer nur spanisch, aber dabei anständig fluchen) „an solchen Leuten habe ich eigentlich von jeher ein Interesse genommen. Ich verkehre am allerliebsten mit Menschen, die ihren Beruf verfehlt haben. Kommen Sie herunter und lassen Sie uns ein halbes Stündchen mit einander plaudern; wollen Sie sich nachher noch absolut hängen, so haben Sie die ganze Nacht vor sich, und kein Mensch wird Sie daran verhindern. Was sind Sie eigentlich?“
„Zuerst beantworten Sie mir die nämliche Frage, die ich vorhin an Sie gerichtet,“ sagte da der junge Mann, der jetzt von der Leiter wieder herabstieg, aber trotzdem noch mit einem heimlichen Grausen in das bleiche Antlitz des Fremden sah.
„Und habe ich das nicht schon gethan?“ sagte dieser ruhig. „Ich bin wirklich der Teufel.“
„Sie treiben Ihren Spott mit mir,“ rief der junge Mann, indem er aber doch die Gestalt des Fremden mit einem scheuen Blick überflog.
„Wie soll ich mich legitimiren?“ erwiderte achselzuckend der Fremde; „glauben Sie etwa, daß ich mit Hörnern und Pferdefuß herumlaufe, wie mich einzelne alberne Menschen schildern, um Kinder und Schafsköpfe damit fürchten zu machen? Mit einer solchen Gestalt könnte ich mich natürlich vor Niemandem blicken lassen. Am Tag aber von Geschäften überladen, besuche ich gern Abends im Mondenschein die Erde und gehe dann eben mit dem Monde; denn irgendwo scheint er doch die ganze Nacht.“
„Und was wollen Sie von mir?“ sagte der junge Mann scheu, und fühlte wie ein Zittern durch seine Glieder lief – „meine Seele?“
Der Fremde lachte laut auf. „Glauben Sie wirklich, daß ich mich einer einzigen lumpigen Seele wegen hier eine Stunde zu Ihnen gesellt hätte? Das wäre der Mühe werth! Ich habe meine Freude an ganz anderen Dingen und, wie gesagt, viel mehr Vergnügen daran, Leute, die ihren Beruf /17/ verfehlt haben, in die richtige und passende Bahn zu bringen, als sie abfahren zu sehen, ohne daß sie der Welt – und mir etwas genützt hätten. Wie heißen Sie?“
„Guido Lerche.“
„Und Ihr bisheriger Beruf?“
Guido Lerche schwieg und sah düster nach dem Fremden hinüber, endlich sagte er: „Schriftsteller – Dichter – aber wenn Sie der wirklich wären, für den Sie sich ausgeben, so müßten Sie doch auch mich und meinen Beruf kennen.“
Achselzuckend erwiderte der Fremde: „Die Menschen sagen allerdings häufig: „Der Teufel soll alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen Deutschlands kennen“; es ist das aber nur eine ganz gemeine Schmeichelei – ich bin es nicht im Stande. Sie müssen mich deshalb entschuldigen. – Wahrscheinlich schreiben Sie anonym?“
Guido Lerche biß sich auf die Unterlippe; er stand schon gewissermaßen mit einem Fuß in einer andern Welt, aber die kleine Eitelkeit dieser hatte ihn trotzdem noch nicht ganz verlassen; der Fremde aber, der es bemerken mochte, sagte etwas freundlicher:
„Kommen Sie, lieber Herr Lerche – lassen Sie vor der Hand noch den Strick los und uns Beide einmal vernünftig mit einander sprechen. Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich schon vielen Leuten geholfen habe, und sobald Sie sich nur ein klein wenig anstellig zeigen, ist die Sache auch gar nicht etwa so schwer. Nur mit dummen Menschen mag ich nichts zu thun haben, oder die brauchen mich vielmehr nicht. Sie arbeiten mir auch sehr häufig durch ihre Dummheit in die Hände, und anfangen läßt sich doch nichts mit ihnen – man muß sie eben einfach gehen lassen.“
„Und Sie wollen mir helfen?“ sagte Lerche, ohne aber bis jetzt noch seine Stellung zu verändern – „und wie das anfangen? Soll etwa meine unsterbliche Seele der Preis sein?“
„Seien Sie nicht kindisch,“ erwiderte der Fremde; „wenn mir etwas an Ihrer ‚unsterblichen Seele‘ läge, so brauchte ich Sie ja nur nicht zu stören. Sie machen sich überhaupt von Ihrer Seele und meinem Verlangen danach einen total falschen Begriff und beurtheilen die Sache einfach wie /18/ der große Haufe nach den verschiedenen Märchen, die sie darüber hören, und die gewöhnlich geradezu abgeschmackt sind.“
In Guido Lerche’s Herzen dämmerte in dem Moment zuerst wieder eine Hoffnung. War es denn nicht möglich, daß er hier einen reichen – und dann natürlich verrückten Engländer gefunden hatte, der zufällig Zeuge seines beabsichtigten Selbstmordversuchs gewesen, und nun in seiner barocken Weise ihm zu helfen wünschte? Er mußte wenigstens wissen, was der Fremde, der sich für den Teufel ausgab, eigentlich von ihm wolle und ob er in ihm einen Retter gefunden – der letzte Ausweg blieb ihm ja dann noch immer unverwehrt. Er ließ den Strick los, trat von den untersten Sprossen der Leiter herunter und die Arme verschränkt auf den Fremden zu, der ihn ruhig, wo er stand, erwartete. Jetzt sagte er freundlich:
„Kommen Sie, Herr Lerche, wir wollen uns da drüben, am Rand des kleinen Wäldchens, unter einen Baum setzen, wo der Thau das Laub nicht getroffen hat, und dort erzählen Sie mir einfach – aber, wenn ich bitten darf, so kurz als möglich, Ihre Schicksale. – Ich bedarf nur der Andeutungen und verstehe ganz vortrefflich zwischen den Zeilen zu lesen.“
Lerche betrachtete ihn aufmerksam. Wie ein Engländer sah er eigentlich nicht aus – schon die schwarzen, gelockten Haare sprachen dagegen – weit eher wie ein Italiener oder Spanier; er hatte auch außerordentlich weiße und zarte Hände, und in der seidenen feuerrothen Cravatte funkelte ein prachtvoller Diamant. Ohne eine Antwort abzuwarten, schritt aber der Fremde der bezeichneten Stelle zu, und es war in der That ein wundervoller Platz, wie man ihn sich nicht reizender hätte aussuchen können.
Voll und klar stand der Mond am blauen, sternbesäeten Himmel; nur hier und da zogen lichte und durchsichtige Wolkenschleier darüber hin und warfen für Momente einen Halbschatten auf die Erde. Ueber ihnen wölbte sich das breite Dach des Kastanienbaumes – vor ihnen lenkte sich allmälig der leise ablaufende Hang dem kleinen Strom entgegen, unfern von dem, aus eingeschlossenen Mauern hervor, die weißen Dämpfe der dort zum Abkühlen gesammelten /19/ heißen Quelle stiegen. – Drunten im Thal aber und drüben auf dem andern Ufer der Lahn blitzten die Lichter der zahllosen Hotels, und von dort her tönte auch noch die rauschende Melodie eines lustigen Galopps, zu der sich die geputzten Paare auf dem Parket des Saales im Kreise schwenkten. Still und majestätisch aber lagen dahinter die mondbeschienenen und dicht bewaldeten Hänge der Berge, und stiller, heiliger Frieden ruhte über dem ganzen Bilde.
Der Fremde schien die prachtvolle Scenerie selber mit Wohlgefallen zu betrachten. Er warf sich auf das weiche Laub nieder, und den rechten Ellbogen auf den Boden stützend, sagte er:
„Allerliebste Gegend hier – und so kühl und frisch heut Abend. Bitte, Herr Lerche, nehmen Sie Platz, und nun erzählen Sie mir einmal, was Sie eigentlich zu einem Schritt getrieben, den Ihr Menschen doch nur einmal im Leben wagen könnt, während Ihr dabei völlig und unrettbar in das Dunkel einer geheimnißvollen Zukunft hinausspringt. – Merkwürdig – nicht einmal ein unvernünftiges Pferd springt über eine Bretterwand, wenn es nicht sehen kann, wo es drüben im Stande ist, die Füße hinzusetzen.“
„Und weshalb nehmen Sie ein solches Interesse an mir?“ sagte Lerche düster, indem er aber doch der Einladung Folge leistete und sich neben dem Fremden auf das wie aufgeschüttete Laub niederwarf.
„Werden Sie nicht langweilig,“ erwiderte der Fremde – „woher vermuthen Sie, daß ich überhaupt Interesse an Ihnen nehme? Ich will nur sehen, ob Sie sich hier aus der Welt nicht noch nützlich machen können – wäre das nicht der Fall, so würde ich Sie nicht weiter belästigen. Also erzählen Sie frisch von der Leber weg; es ist noch früh, und Sie haben übrig Zeit.“
„Aber,“ sagte Lerche.– „wenn ich mich einem vollkommen Fremden anvertrauen soll, so muß ich doch wenigstens im Ernst wissen, mit wem ich es zu thun habe. Wer sind Sie? Wie heißen Sie?“
„Wer ich bin, habe ich Ihnen schon vorhin gesagt. Wie ich heiße? Ihre Nation hat zahllose Namen für mich – /20/ manche sogar beleidigender Art, wenn mich die kindliche Einfalt derartiger Menschen überhaupt beleidigen könnte.“
„Sie treiben Ihren Scherz mir mir,“ sagte Lerche – „Ihr gutes Herz verleitet Sie, einem Unglücklichen zu helfen, ohne ihn zu Dank verpflichten zu wollen.“
„Mein gutes Herz?“ lachte der Fremde jetzt wirklich grell und unheimlich auf. – „Das ist vortrefflich, Herr Lerche, ich fange wirklich an zu glauben, daß Sie ein Dichter sind, denn Sie haben Phantasie. Mir ist schon viel im Leben nachgesagt, aber ein gutes Herz – hahahaha – das ist in der That äußerst komisch! Aber bitte, beginnen Sie. – Mit wem Sie es zu thun haben, wissen Sie jetzt. Doch geniren Sie sich nicht. Neues können Sie mir nicht berichten, denn im Leben der Menschen wiederholen sich ja derartige Dinge, und nur von Ihrem sechzehnten Jahre fangen Sie an – die Kindergeschichten brauche ich nicht zu wissen. Wer war Ihr Vater?“
„Ein Weinhändler,“ sagte Lerche, der sich doch nicht recht behaglich fühlte – aber es mußte ein Engländer sein, denn ein anderer Mensch wäre gar nicht auf den Gedanken gerathen, sich direct für den Teufel auszugeben.
„Ein Weinhändler! – hm – das ist gut,“ nickte sein Nachbar zufrieden – „und zu welchem Lebensberuf wurden Sie bestimmt?“
„Ich sollte demselben Geschäft folgen,“ sagte Lerche – „hatte aber keinen besondern Trieb dazu. Der harten Arbeit als Küper war mein schwächlicher Körper nicht gewachsen – ich fühlte immer einen Hang zur Poesie und ging frühzeitig zum Theater.“
„Sehr gut,“ nickte der Teufel – „aber damit ging es nicht.“
„Nein,“ sagte Lerche zögernd – „Intriguen und Chicanen wurden gegen mich gesponnen.“
„Natürlich,“ lächelte sein Nachbar – „Sie finden nie einen schlechten Schauspieler, gegen den nicht die bösartigsten Intriguen angezettelt werden.“
„Aber ich war kein schlechter Schauspieler,“ fuhr Lerche auf.
/21/ „Bitte, fahren Sie fort,“ nickte der Andere. „Sie verließen die Bühne, weil der schlechte Geschmack des Publikums Ihre Verdienste nicht zu würdigen wußte, und gingen – ?“
„Nach Amerika –“
„Caramba,“ sagte der Fremde wieder – „das ist weit! Aber es gefiel Ihnen auch dort nicht?“
„Nein – das materielle Volk da drüben hat keinen Sinn für Poesie – in der That keinen andern Gedanken, als immer nur Geld – Geld – Geld. – Wenn ich hätte mit Spitzhacke und Schaufel arbeiten wollen –“
„Aber das wollten Sie nicht!“
„Nein, es drängte mich nach Deutschland zurück –“
„Sie borgten das Geld zur Ueberfahrt –“
Herr Lerche sah ihn überrascht an. – „Es blieb mir nichts Anderes übrig,“ sagte er.
„Selbstverständlich,“ nickte der Fremde.
„Hier in Deutschland warf ich mich auf die Schriftstellerei,“ fuhr Lerche fort, dem der Gegenstand unangenehm sein mochte, „aber der Teufel soll die Buchhändler holen!“
„Bitte!“ sagte der Fremde.
„Es ist nichts als Protection, Schwindel oder Betrug. – Ich habe Romane geschrieben, bei denen mir selber die Haare zu Berge stiegen – Gedichte, die ich vorgelesen und bei denen mich die Zuhörer zuletzt um Gottes willen baten, aufzuhören, weil ihre Nerven zu sehr angegriffen wurden und sie die Thränen nicht mehr zurückhalten konnten – umsonst, ich fand keinen Verleger. – Dann warf ich mich auf die dramatische Kunst – ich schrieb Dramen, die von einer ergreifenden Wirkung hätten sein müssen, wenn ich eine einzige Direction gefunden, die sie aufgeführt – Operntexte – Alles vergebens – ich wurde der Verzweiflung preisgegeben.“
„Und wovon lebten Sie die ganze Zeit?“ frug der Fremde.
„Ich – suchte mich so ehrlich als möglich durchzubringen –“
„Natürlich durch weitere Schulden –“
„Ich mußte allerdings Gelder aufnehmen,“ sagte wieder zögernd Herr Lerche – „ich – konnte nicht verhungern.“
/22/ „Hm – ich weiß jetzt genug,“ sagte der Fremde trocken, „und es bleibt mir noch übrig, Sie um Auskunft zu bitten, was Sie zu diesem letzten verzweifelten Schritt getrieben?“
„Mein Unglück ist bald erzählt,“ sagte Herr Lerche. „Ich hatte einen Band meiner besten Gedichte zusammengestellt – den Extract meiner Poesie, wenn ich es so nennen könnte – eine 59er Auslese Cabinetswein – der Buchhändler wollte mir kein Honorar geben, verstand sich aber dazu, den Band in Commission zu verlegen und hübsch auszustatten. – Jahre vergingen – ich schrieb endlich an den Geldmenschen und bat ihn um Abrechnung – die Abrechnung kam. Sie enthielt auf der einen Seite den genauen Kostenüberschlag für Druck, Papier, Buchbinder, Insertionsgebühren, auf der andern Seite den Absatz – es blieben noch sechs Gulden Saldo zu seinen Gunsten.“
„Das war kein brillantes Geschäft,“ sagte achselzuckend der Fremde.
„Nein,“ fuhr Lerche düster fort, „da trieb mich die Verzweiflung, und ich nahm die sechs Gulden und ging damit zum grünen Tisch –“
„Entschuldigen Sie,“ sagte der Fremde, „Sie müssen sich da versprochen haben. Sie sagten mir vorher, daß die sechs Gulden zu seinen, also des Verlegers, Gunsten gewesen wären. Folglich waren Sie ihm dieselben noch schuldig; wie konnten Sie also damit zur Spielbank gehen?“
„Ich borgte mir die sechs Gulden vom Wirth auf meinen Reisesack,“ sagte Herr Lerche.
„Sehr gut,“ nickte der Fremde. „Sie arbeiteten dadurch mit doppelt negativem Capital – vortrefflich! Also Sie gingen zur Spielbank – verloren aber natürlich.“
„Auch den letzten Gulden,“ bestätigte Lerche, „und die Verzweiflung trieb mich endlich hier heraus.“
„Aber wo bekamen Sie den Strick so geschwind her?“
Herr Lerche zögerte diesmal sehr lange mit der Antwort, endlich sagte er: „Da ich Ihnen nun doch einmal Alles gebeichtet habe, sollen Sie auch das erfahren. Ich hatte ihn mir gekauft, um mich daran im Hotel aus dem Fenster zu /23/ lassen, wenn ich, wie voraussichtlich, meine Wirthshausrechnung nicht bezahlen konnte.“
Der Fremde richtete sich bei den Worten im Nu in die Höhe, und dem jungen Mann die Hand hinüberreichend, sagte er freundlich:
„Herr Lerche, ich kann Sie meiner vollen Hochachtung versichern. Sie haben unbestreitbar Talent, denn daran hätte ich selber nicht gleich gedacht. – Ich müßte mich auch sehr irren, oder Ihre Zukunft ist gesichert. Erlauben Sie mir jetzt nur noch eine Frage, und glauben Sie nicht, daß ich sie indiscret thue; aber ich muß es zu Ihrem eigenen Besten wissen. – Wie viel Schulden haben Sie, und vor allen Dingen, wem schulden Sie?“
Herr Lerche schwieg, aber nicht aus Zurückhaltung, denn allerlei Gedanken kreuzten ihm das Hirn. Der großmüthige Fremde wollte jedenfalls seine Schulden bezahlen, und er machte sich nun im Geist einen Ueberschlag, wie viel er angeben sollte, ohne dabei etwas zu vergessen. Endlich schien er damit im Reinen und sagte:
„Meinem Schneider schulde ich dreißig Thaler –“
„Selbstverständlich!“ lautete die Antwort.
„Meinem Schuhmacher fünfzehn, sind fünfundvierzig. – Meinem Wirth für Essen und Wohnung hundertundsechzig, macht zweihundertundfünf, dem Buchhändler acht Thaler, sind zweihundertunddreizehn – im Frühstückskeller zweiundvierzig Thaler etwa, macht zweihundertfünfundfünfzig. – Meiner Wäscherin elf Thaler – gleich zweihundert-sechsundsechzig, und dann – habe ich noch zweihundertfünfzig Thaler baar Geld aufgenommen.“
„Von wem?“ frug der Fremde.
„Von der ersten Liebhaberin unseres Theaters.“
„In der That? Eine Herzensneigung?“
„Nein.“
„Auf Wechsel?“
„Nein.“
„Also auf Ehrenwort?“
„Ja,“ sagte Herr Lerche zögernd, während der Fremde einen Blick nach dem Baum hinüberwarf, an dem der Strick noch /24/ hing. „Was sich also mit meiner Schuld hier in Ems auf etwas über fünfhundert Thaler belaufen würde.“
„Also einem Wucherer sind Sie nichts schuldig?“
„Nein – fünfhundert Thaler könnten mich retten.“
„Was nennen Sie retten?“ sagte der Fremde verächtlich. „Wenn Sie die fünfhundert Thaler bekämen und Ihre Schulden wirklich damit bezahlten, so wären nur Ihre Gläubiger besser daran, Sie selber aber genau auf dem alten Fleck wie vorher. Nur in dem Fall, daß Sie dieselben nicht bezahlten,“ setzte er langsamer hinzu – „wären Sie gebessert, aber auch nur für eine kurze Zeit, denn das alte Elend würde doch immer wieder über Sie hereinbrechen. Um Ihnen wirklich zu helfen, Herr Lerche, dazu gehört mehr als fünfhundert Thaler.“
„Oh, Sie sind so gütig!“ sagte Lerche, wirklich betroffen von den Worten.
„Dazu gehört,“ fuhr aber der Fremde fort, ohne von dem Lob die geringste Notiz zu nehmen, „daß Sie selber den Beruf finden, der für Sie paßt, und darin will ich Ihnen behülflich sein. Alles Andere ist nur ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein und hält Sie allein ein paar Monate länger am Leben, womit, nebenbei, Niemandem besonders gedient wäre.“
„Aber was verstehen Sie unter einem Lebensberuf?“ sagte Lerche, dessen Hoffnungen bei den Worten einen gelinden Stoß bekamen; denn baar Geld wäre ihm viel lieber gewesen, als ein Lebensberuf.
„Lassen Sie mich aufrichtig sein,“ sagte der Fremde, „denn nur dadurch kann ich Ihnen beweisen, daß ich es gut mit Ihnen meine – Sie haben nichts gelernt und von einem Beruf zum andern übergewechselt; Sie können auch nichts Selbstständiges und Vernünftiges schaffen, sonst würden Sie jedenfalls einen Verleger für Ihre Arbeiten gefunden haben. Ihr sonstiger Charakter läßt nichts zu wünschen übrig, und ich würde Ihnen ohne Weiteres eine Auswanderungs-Agentur vorschlagen, wenn Ihnen Ihre poetische Neigung darin nicht im Wege stünde. So weiß ich nur noch einen Ausweg für Sie, auf dem Sie sich Ihr Brod jedenfalls verdienen können: /25/ Sie müssen Theaterrecensent werden und sich wo möglich an einer Theaterzeitung und Agentur betheiligen.“
„Aber die mißglückten Versuche, die ich selber –“ sagte etwas schüchtern Herr Lerche.
„Bester Freund, die lassen Sie dann Anderen entgelten,“ lachte sein freundlicher Rathgeber; „denn wer selber etwas schreiben kann, wird natürlich nicht Recensent. Ihre Gewissenhaftigkeit steht Ihnen doch hoffentlich nicht dabei im Wege? – Und überdies,“ fuhr der Fremde leichthin fort, „werden Sie mit der Zeit auch so verbittert werden, daß Ihnen die Galle schon von selber kommen wird, und nichts in der Welt nährt besser als Galle –“
„Ich habe immer das Gegentheil geglaubt,“ wagte Lerche eine schüchterne Entgegnung; denn wenn ihm der Fremde nichts weiter geben wollte, als den Rath, so hätte er ihn eben so gut können sich selber überlassen, und dann wäre jetzt Alles überstanden gewesen.
Der Fremde würdigte ihn keiner Antwort; er hatte still vor sich nieder gesehen und leise dazu mit dem Kopfe genickt.
„Eine Auswanderungs-Agentur würde Ihnen nicht genügen,“ sagte er endlich – „je mehr ich mir die Sache überlege, desto mehr bin ich davon überzeugt. Daß Sie aber als Recensent Ihr Glück machen werden, ist gewiß. Wir sprechen uns wieder.“
„Verehrter Herr,“ bemerkte Lerche endlich, „das ist Alles recht schön und gut, aber wie soll ich dazu gelangen, selbst nur darin einen Anfang zu bekommen?“
„Ich gebe Ihnen einen Empfehlungsbrief mit an die Theater-Agentur in X.,“ sagte der Fremde, „die bringt Sie in die rechte Bahn – ich stehe mit ihr in Geschäftsverbindung.“
„Aber womit käme ich selbst nach X.?“ seufzte Lerche; „ich habe keinen rothen Heller mehr im Vermögen. Wenn Sie mir nur wenigstens die fünfhundert Thaler auf mein ehrliches Gesicht borgen wollten. – Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort –“
Der Fremde lachte laut auf. „Die Menschen,“ sagte er endlich, nennen mich immer einen „dummen Teufel“, aber so /26/ dumm ist der Teufel denn doch wahrhaftig nicht, daß er einem deutschen Dichter Geld borgen sollte. – Caramba, die Idee ist nicht übel!“
„Sie nennen sich immer den Teufel,“ sagte Lerche, dem es doch anfing, unheimlich in der Nähe des blassen Mannes zu werden, noch dazu, da sich dieser direct weigerte, ihm irgend welchen Vorschuß zumachen; „wenn Sie nun wirklich der Herr wären – und ich muß Ihnen gestehen, daß ich mir bis dahin ein solches Wesen anders gedacht habe –“
„Mit feuersprühenden Augen und Hörnern, wie?“ lächelte der Fremde.
„Wenn auch vielleicht nicht so – aber doch –“
„Und was wollten Sie vorhin sagen?“
„Wirklich also den Fall genommen,“ wiederholte Lerche, „so wäre es doch für Sie ein Leichtes, mir auch ohne directen Vorschuß zu Geld zu verhelfen. Sie brauchten mir nur einen einzigen Thaler anzuvertrauen, und drüben an der Spielbank könnte ich –“
„Das geht nicht,“ unterbrach ihn kopfschüttelnd der Fremde; „ich – habe mit den Herren da drüben einen ganz bestimmten Contract und kann nicht gegen mein eigenes Geld spielen.“
„Aber wie soll ich hier fortkommen?“
„Hm,“ sagte der Fremde und sah ihn von der Seite an – „und wenn ich Ihnen nur die geringste Summe anvertraute, so machten Sie doch Dummheiten, liefen wieder hinüber und wären Ihr Geld in einer Viertelstunde los – denn Segen ist nicht darin.“
„Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort –“
Der Fremde pfiff durch die Zähne. – „Sie halten mich für eben so leichtgläubig wie Ihre erste Liebhaberin,“ sagte er; „aber ich will Ihnen wenigstens von hier forthelfen,“ setzte er hinzu. „Ich muß Ihnen aufrichtig gestehen, daß mir nicht viel daran liegt, wenn Sie sich hier hängen, denn es entsteht dadurch immer ein unangenehmes Gerede für die Bank. Was Sie dann im Land drin thun, kümmert mich nicht. Uebrigens sehe ich ein, daß Sie sich nicht selber zu helfen wissen, denn zum directen Stehlen scheinen Sie mir zu ungeschickt. Sie müssen deshalb etwas Geld in die Hand /27/ bekommen – aber so viel sage ich Ihnen, werfen Sie ein einziges Stück des von mir erhaltenen Geldes auf den grünen Tisch, so verschwindet es im Nu, hinterläßt nichts als einen häßlichen Fleck und – die Folgen haben Sie sich nachher selber zuzuschreiben.“
„Und wie viel würden Sie die Güte haben –“
„Hier sind zwanzig Gulden,“ sagte der Fremde, indem er in die Tasche griff und die Silberstücke Herrn Lerche hinreichte, „das wird gerade hinreichen, um Sie nach X. zu bringen.“
„Und dort dann?“
„Geben Sie diese Karte in der Redaction des Theaterblattes ab; der Eigenthümer ist ein guter Freund von mir.“
„Und wie soll ich hier im Hotel meine Rechnung bezahlen?“
„Bester Freund,“ lachte der Fremde, „die Idee mit dem Strick ist viel zu ausgezeichnet, als daß ich dazu beitragen möchte, sie zu vereiteln. Wenn Sie aber meinem Rath folgen, so befestigen Sie das Seil so, daß Sie es, wenn Sie unten sind, nachziehen können – es wird lang genug sein, und Sie können es vielleicht noch einmal gebrauchen.“
Lerche schauderte zusammen – war es die Berührung des Geldes oder der Gedanke an einen nochmaligen Selbstmordversuch, auf den der Fremde so kalt und fast höhnisch anspielte – aber das Geld brannte ihm nicht in der Hand, wie er anfangs in der That gefürchtet hatte, und scheu und leise sagte er nur:
„Verlangen Sie einen Schein dafür?“
Wieder legte sich der Zug von kaltem Spott über die unheimlichen Züge des Fremden.
„Glauben Sie, daß ich lumpiger zwanzig Gulden wegen einen Pact mit Ihnen eingehen würde, oder daß mich etwa gar nach Ihrer Seele verlangt? – Reisen Sie vollkommen ruhig, ich werde Sie nicht weiter beunruhigen; denn daß selbst mir ein Schein von Ihnen nichts hülfe, wissen Sie genau so gut wie ich.“
„Und wie soll ich Ihnen danken?“
„Daß Sie augenblicklich in Ihr Hotel zurückgehen, Ihre /28/ Sachen in Ordnung bringen und dann gleich den Nachtzug nach Gießen benutzen.“
Lerche hatte sich bemüht, den auf der Karte fein gestochenen Namen bei Mondenlicht zu lesen, aber war es nicht im Stande – die Karte selber schien schwefelgelb und trug einen grellrothen schmalen Rand.
„Es steht nur mein Name darauf,“ sagte der Fremde, der es bemerkte, „Edler von der Hölle – also auf Wiedersehen, lieber Freund!“ Und rasch richtete er sich empor, nickte dem jungen Mann vertraulich zu und war schon in den nächsten Secunden in den dunkeln Schatten des Kastanienwäldchens verschwunden.
2. In Ruhe.
Lange Jahre waren nach den oben beschriebenen Vorfällen verflossen – lange, bewegte Jahre, und wenn auch die Welt im Allgemeinen ruhig weiter ging, so verbitterte sich doch das rastlose Menschenvolk indessen die kurze, ihm hier vergönnte Spanne Zeit nach besten Kräften. Nationen schlugen sich mit Nationen und vertrugen sich wieder, und nur im ganz Kleinen bohrten sich die einzelnen Exemplare der „Gesellschaft“ hartnäckig ihren Weg. Was auch da draußen im Großen und Ganzen geschehen mochte, es kümmerte sie nicht, denn nur ihr eigenes Interesse trieb sie weiter, um – in dem allgemeinen Drängen und Treiben nach vorwärts – noch womöglich für sich selber einen Sitzplatz zu bekommen.
Selbst nicht, während auf dem Welttheater große Effect- und Sensationsstücke gegeben wurden, hatte das Stadttheater zu X. aufgehört, den geschichtlichen Dramen mit Offenbach’schen Opern und Possen Concurrenz zu machen, und auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“, ging es mit In /29/ triguen und Vorwärtsdrängen, mit diplomatischen Ränken und Kniffen, ja oft mit offenem Kampf und Hader genau so zu, wie draußen in der Weite.
In einer der Hauptstraßen in X., aber weit hinten in einem nicht besonders reinlich gehaltenen Hofe, von dem aus man noch zwei dunkle, schmale Treppen hinaufsteigen mußte, befand sich das Redactionsbureau der X-er Theaterzeitung, und wenn das Entrée schon nicht besonders versprechend war, das Innere des Bureaus sah eigentlich noch ungemüthlicher aus.
Es bestand aus einem einzigen langen Gemach mit drei Fenstern nach dem dunkeln Hof hinaus und mochte einmal in früherer Zeit geweißte Wände und weiße Gardinen gehabt haben, die aber jetzt nur ein etwas lichteres, brochirtes Muster auf dunkelbraunem Grunde zeigten. An jedem Fenster stand ein doppeltes Stehpult, von denen aber nur zwei einfach besetzt waren – das obere stand leer, obgleich darauf gehäufte offene Briefe und kleine Broschüren auch die zeitweilige Benutzung dieses anzeigten.
An den beiden anderen arbeiteten zwei – an jedem ein Einzelner – etwas dürftig aussehende Individuen mit bleichen Gesichtern und Schreibärmeln – blutjunge Menschen, die sich hier für ihr kärgliches Brod die Finger wund schrieben, und dafür, wenn auch nur indirect, in die Kunst eingeweiht wurden, ein solches Geschäft zu führen. Sie waren nämlich stete Zeugen der dort eintreffenden Besuche – geschäftlicher wie „freundschaftlicher“ Art, und wenn sie weiter nichts dabei lernten, so gewannen sie doch dort in einer Woche mehr Menschenkenntniß, als wenn sie sich Jahre lang in dem Strudel der großen Welt herum getrieben hätten.
Der Raum selber sah wüst genug aus; eine Unmasse von Broschüren lag über den Boden, theils zusammengebunden, theils einzeln, zerstreut, so daß sich die Hausmagd sogar nicht einmal mehr mit dem Besen dazwischen getraute. Möbel gab es dabei fast gar nicht, zwei Rohrstühle ausgenommen und ein altes, steinhartes Sopha mit einem Ueberzug, von dem sich schon seit Jahren die Farbe nicht mehr erkennen ließ. Der „älteste Mann“ im Geschäft erinnerte sich auch nicht, je ge /30/ sehen zu haben, daß irgend Jemand gewagt hätte, sich darauf zu setzen.
Sonst hingen noch an den Wänden eine Anzahl von Lithographien, Photographien und Stahlstichen berühmter Künstler, an denen man auch genau wissen konnte, ob sie dem Bureau mit oder ohne Rahmen geschenkt waren. – Die ohne Rahmen waren nämlich nur einfach mit Stiften an die Wand genagelt, und wenn den Betreffenden daran lag, ihr Bild hier erhalten zu sehen, nun so mochten sie einen Rahmen nachliefern.
Der Briefträger kam und legte ein Paket Briefe auf den Schreibtisch des Principals, Herrn Cuno Köfer’s, der aber noch nicht erschienen war, denn er liebte Morgens seine Ruhe. Unter den Briefen befanden sich zwei unfrankirte; der Postbote zeigte sie aber nur lächelnd Einem der jungen Leute und schob sie dann wieder in die Tasche zurück. Er kannte die Geschäftsordnung im Hause – unfrankirte Briefe wurden nie angenommen, denn man hatte zu bittere Erfahrungen mit deren Inhalt gemacht. Gewöhnlich waren sie in einem mehr als groben Styl geschrieben und wimmelten von Injurien, enthielten aber stets, statt der Unterschrift, die Photographie des Betreffenden, und auf die ließ sich nicht klagen; denn die konnte ein Jeder einkleben.
Uebrigens kamen solche „kleine Unannehmlichkeiten“ auch zuweilen in frankirten Briefen vor, wanderten dann aber gleich in den Ofen, denn – dem Papierkorb durfte man sie nicht anvertrauen, oder die Schreiber hätten sich darüber lustig gemacht.
Trotz der frühen Morgenstunde saß aber schon ein „Besuch“ im Comptoir, dem Einer der jungen Leute das Sopha angewiesen, der aber trotzdem einen Rohrstuhl vorgezogen hatte. Es war ein noch blutjunger Mensch, etwas auffallend gekleidet. Er trug seine braunen lockigen Haare, sorgfältig gebrannt, in einem großen Toupet auf der rechten Seite, vollkommen moderne Kleidung, eine himmelblaue seidene Cravatte, eine große Tuchnadel, eine goldene Uhrkette und ziegelrothe Glacehandschuhe. So zuversichtlich er sich aber auch sonst seinem ganzen Aeußern nach benehmen mochte, hier schien er sich in einer etwas gedrückten Stimmung zu befinden. Er saß – /31/ die Füße eingezogen und den wohlgebürsteten Hut zwischen den Knieen, auf seinem Rohrstuhl, als ob er fürchtete, daß derselbe jeden Augenblick mit ihm zusammenbrechen könne. Er sah auch verschiedene Male nach seiner Uhr – die Zeit verging ihm jedenfalls sehr langsam, aber er wagte nicht, den entschiedenen Wunsch auszusprechen, Herrn Köfer gleich zu sprechen – er wußte recht gut, daß er den betreffenden Herrn dann in böse Laune gebracht hätte, und das wollte er vermeiden.
Wohl dreiviertel Stunden mochte er so gesessen haben, ohne daß aber die Schreiber die geringste Notiz von ihm nahmen, als plötzlich die eine Seitenthür aufging und Herr Köfer selber, ohne weitere Anmeldung, auf dem Schauplatz erschien.
Die beiden Schreiber verbeugten sich mit einem achtungsvollen „Guten Morgen“, und der Besuch erhob sich ebenfalls rasch von seinem Sitze. Herr Köfer hatte aber keinen Blick für sein „Bureau“. Den gewöhnlichen, selbstverständlichen Morgengruß seiner „Leute“ beantwortete er mit einem grunzenden, unarticulirten Laut, der wahrscheinlich „Morgen“ heißen sollte, aber eben so gut jedes andere Wort bedeuten konnte. Von dem Besuch nahm er gar keine Notiz, sondern trat nur zu seinem Pult, wo er die dort liegenden Briefe aufnahm und mit überreifer Erfahrung in derartigen Correspondenzen flüchtig sortirte, ehe er daran ging, einen oder den andern zu erbrechen.
Dann öffnete er den ersten, sah nur nach Ueber- und Unterschrift, dann den zweiten ebenso, und nahm eben den dritten auf, als der Besuch sich doch glaubte bemerkbar machen zu müssen, und deshalb sich räusperte und ein paar Schritte vortrat.
Herr Köfer war kein hübscher Mann. Schon in den Fünfzigen, mit einem Kopf voll dünner Haare, die jetzt mit Weiß gesprenkelt waren, mit den fast zu deutlich hinterlassenen Spuren von Pockennarben, mit kleinen grauen, etwas wässerigen Augen und einem fast zahnlosen Munde, lag ein gewisser Zug von Verbissenheit in dem fetten Gesicht – den man freilich seinem ganzen Geschäft zu Gute schreiben mußte. Das brachte der Aerger über die Undankbarkeit der Menschen im Allgemeinen /32/ und der Bühnendichter und Schauspieler im Besondern zur Genüge mit sich.
Auch sein Aeußeres war nicht sehr versprechend, denn geistig thätige Menschen verwenden gewöhnlich nicht viel auf das – Herr Köfer verwandte sogar nur ein Minimum darauf. Er war noch in seiner „Morgentoilette“, d. h. er hatte sich noch nicht einmal gewaschen und gekämmt und nur einen Schlafrock übergezogen – und was für einen Schlafrock! Neu mußte er allerdings einmal ein Prachtstück gewesen sein, mit rothem, ächt gefärbtem Futter, mit wollenem, großblumigem türkischen Damast und einer hellblauen Schnur, mit eben solchen riesigen Quasten daran, aber, Du lieber Gott, der Zahn der Zeit nagt sogar an felsigem Gestein – an Granit und Porphyr – weshalb nicht auch an einem Schlafrock, so unappetitlich derselbe auch aussehen mochte. Der türkische Damast starrte von Schmutz, sowohl an den Aermeln wie an den Taschen und vorn herab, die Ränder glänzten ordentlich. Auch ein altes rothbaumwollenes Taschentuch, das ihm rechts mit einem langen Zipfel heraushing, erschien nur wie eine nichts verbessernde Draperie. Das Hemd, welches er außerdem ohne Halstuch und nur vorn mit einem Band zugebunden trug, gehörte – wenn nicht einer andern Generation, doch jedenfalls einer andern Woche an, und der große goldene Siegelring, der ihm dabei am rechten Zeigefinger stak, konnte nicht dazu dienen, die Toilette zu erhöhen.
Als er des jungen Fremden ansichtig wurde, warf er einen eben nicht freundlichen Blick auf ihn, erwiderte seinen Gruß auch nur durch ein ähnliches Knurren wie vorher, und sagte dann mürrisch:
„Sind Sie denn noch in X., Herr von – Wie heißen Sie gleich?“
„Von Goldstein, Herr Köfer.“
„Ja so – also Herr von Goldstein – ich habe Ihnen doch gesagt, daß Sie hier den Erfolg unserer Anfragen nicht abwarten sollten!“
„Aber ich kann nicht fortkommen, verehrter Herr,“ sagte der junge Mann schüchtern – „wenn Sie nur im Stande /33/ wären, mir hier zwei oder drei Gastrollen auszuwirken – ich würde mich ja mit einem sehr mäßigen Honorar begnügen.“
„Und weshalb sprechen Sie nicht selber mit dem Director?“
Der junge Schauspieler zuckte mit den Achseln. „Es war Alles vergeblich,“ sagte er, „dreimal habe ich schon den Versuch gemacht.“
„Und was soll ich Ihnen denn nützen?“ frug Herr Köfer barsch; „habe ich ein Theater, oder soll ich Sie hier im Comptoir spielen lassen? Sie sehen, ich bin beschäftigt, Herr von – von Goldstein, und kann auch in der That nichts weiter für Sie thun.“
„Wenn Sie nun,“ bemerkte der junge Schauspieler schüchtern, indem der Agent schon wieder einen Brief aufbrach – „mir auf die künftige Gage, von der ich Ihnen ja doch die ausbedungenen Procente schulde, nur einen kleinen Vorschuß leisten wollten – nur so viel, als ich nothwendig brauche, um –“
„Ein Austernfrühstück zu geben – heh?“ sagte Herr Köfer mit einem malitiösen Lächeln – „glauben Sie, daß ich ein Millionär bin, um den herumvacirenden Herren Schauspielern mit Darlehen unter die Arme zu greifen, und habe ich nicht etwa schon genug Verlust durch Ihre ewigen Störungen gehabt?“
„Aber an wen sonst soll ich mich wenden?“ sagte Herr von Goldstein in halber Verzweiflung. „Sie kennen meine Familie – Sie wissen, daß Ihnen das Geld unverloren ist, wenn sie sich auch jetzt von mir losgesagt.“
„Thun Sie mir den Gefallen und lassen Sie mich ungeschoren,“ bemerkte Herr Köfer, indem er wieder einen Brief öffnete. „Glauben Sie denn, daß ich von der Luft lebe, und habe ich schon das Geringste von Ihnen gehabt – Scherereien und Abhaltungen und Correspondenzen ausgenommen? – Sie waren bis jetzt nicht einmal im Stande, mir das ausgelegte Porto zu vergüten, und glauben dann auch noch, man soll da Lust und Liebe zur Sache behalten und mit Eifer darangehen?“
,,Aber ich weiß nicht einmal, wie ich hier fortkommen soll!“
/34/ „Das geht mich nichts an,“ brummte Herr Köfer, indem er den jungen Mann gar nicht mehr ansah, „verkaufen Sie Ihre goldene Bummelage an der Uhr, man kann auch ohne das ein guter Schauspieler sein – oder machen Sie sonst, was Sie wollen.“
Der Setzerjunge kam in diesem Augenblick in’s Bureau und brachte eine Correctur der Theaterzeitung, auf der aber noch eine halbe Spalte weiß gelassen war und ausgefüllt werden mußte, und Herr Köfer frug:
„Ist denn Herr Doctor Lerche noch nicht dagewesen?“
„Nein, Herr Köfer,“ lautete die Antwort des einen Schreibers zurück.
„Wo bleibt denn nur der verzweifelte Mensch heute so lange? Der Junge mag warten – er muß gleich kommen, und es ist die höchste Zeit, daß die Nummer fertig wird.“
Von Herrn von Goldstein nahm Niemand mehr Notiz, und der unglückliche Künstler entfernte sich endlich, ohne daß ihm auch nur Jemand für seinen Gruß gedankt hätte.
Auf der Treppe noch begegnete er einem andern Herrn, der aber weit zuversichtlicher auftrat. Er war ebenfalls etwas auffallend gekleidet, hatte aber ein intelligentes, scharfgezeichnetes Gesicht und jedenfalls Selbstvertrauen. Er klopfte auch gar nicht an, sondern öffnete die Thür und schritt direct auf den immer noch mit Durchsehen der Briefe beschäftigten Köfer zu, ohne selbst seinen Hut abzunehmen.
„Lieber Köfer – guten Morgen.“
„Ah, Herr Bomeier,“ sagte Herr Köfer, indem er ihm die noch ungewaschene Hand reichte, die der Fremde aber im Schutz seiner Glacehandschuhe kräftig schüttelte – „sehr angenehm, Sie bei mir zu sehen, ging ja famos gestern Abend, wie ich gehört habe – und noch dazu ein neues Stück – allen Respect, die Direction wird glücklich sein, Sie zu gewinnen.“
„Bitte, lieber Köfer – keine Complimente,“ sagte der gefeierte Künstler lächelnd – „es machte sich. Habe auch mein Engagement schon gestern Abend noch mit der Direction abgeschlossen, eben Contract unterzeichnet und wollte Sie nur bitten, mich von jetzt an als Abonnenten Ihres geschätzten /35/ Blattes zu betrachten. – Hier im Couvert finden Sie meine Adresse – nicht wahr, das Abonnement wird vierteljährlich pränumerando bezahlt?“
„Ist so Usus, verehrter Herr.“
„Schön – ich habe für das erste Quartal den Betrag gleich eingeschlossen.“
Herr Köfer befühlte mit seinen zwei Fingern das Couvert.
„Sehr dankbar – soll Ihnen pünktlich zugesandt werden.“
„Also guten Morgen, lieber Köfer – ich habe noch viel zu thun.“
„Das glaub’ ich, Herr Bomeier – das glaub’ ich – sehr angenehm gewesen,“ und mit seiner linken Hand den Schlafrock vorn etwas zuhaltend, begleitete er den Herrn bis halb durch sein Comptoir, oder ging wenigstens mit einer achtungsvollen Verbeugung hinter ihm her, was den beiden Schreibern so imponirte, daß sie ebenfalls von ihren Drehstühlen aufstanden und sich verbeugten.
Herr Köfer hatte kaum Zeit gehabt, auf seinen Platz zurückzukehren und einen Blick in das Couvert zu werfen, aus dem ihm eine angenehm gelbe preußische fünfundzwanzig Thalernote entgegenlächelte, als sich die Thür schon wieder öffnete und das schwere Rauschen eines Kleides den beschäftigten Mann auf einen Damenbesuch vorbereiten konnte. – Herr Köfer war nun eigentlich noch nicht in Toilette, und jeder andere Mensch wäre dadurch in Verlegenheit gerathen, nicht aber der Theateragent. Damenbesuch war bei ihm etwas viel zu Allgewöhnliches, um irgend welche Rücksicht darauf zu nehmen, und wenn selbst niemand Geringeres als die gefeierte Primadonna zu ihm hereinrauschte.
Herr Köfer, der seine Briefe wieder aufgenommen hatte, blieb ruhig an seinem Pulte stehen. Da aber die Dame in einem wahren Sturm durch das Comptoir fegte, wußte er auch, daß wieder irgend ein Wetter im Anzug sei, und bereitete sich mit der größten Kaltblütigkeit vor, dem zu begegnen.
„Herr Köfer,“ sagte die Dame, ohne nur einen Morgengruß für nöthig zu halten, und suchte dabei in ihrer etwas geräumigen Ledertasche nach einem Stück Zeitung, das sie endlich zu Tage brachte – „Sie entschuldigen mich, wenn ich /36/ Ihnen mit der Thür in’s Haus falle, aber ich muß auf die Probe.“
„Mein Fräulein,“ sagte Herr Köfer trocken – „es sollte mir ungemein leid thun, Sie aufzuhalten.“
Fräulein Ostachini, wie die Dame hieß, oder wie sie sich vielmehr nannte, denn ihr eigentlicher Name war „Gelbholz“, hielt dem Theateragenten das Papier vor und sagte:
„Kennen Sie diese Zeitung?“
„Es wäre merkwürdig, wenn ich sie nicht kennte,“ erwiderte Herr Köfer mit einem flüchtigen Blick darauf, denn es war seine eigene, und der Herr wußte jetzt schon vollkommen genau, was die enragirte Sängerin von ihm wollte.
„Und diese Recension haben Sie in Ihr Blatt aufgenommen?“ rief die Dame, die sich augenscheinlich Mühe gab, ihr italienisches Temperament (Gelbholz) zurück zu halten. – „Diese Recension über den – Backfisch – über diese Mamsell Bergen, die eine Stimme hat wie eine Trompete und aussieht wie ein Bauermädel – wie eine Kuhmagd mit ihren dicken rothen Backen und ihrer aufgedunsenen Gestalt? Und hat sie nur eine Idee von Gesang, Tremoliren– ja wohl, das bringen wir nicht fertig – nicht ein einziges Mal in der ganzen Oper – und die Gans will auch noch von „getragenem“ Gesang reden!“
„Aber, mein bestes Fräulein,“ sagte Herr Köfer, der indessen seinen Brief ruhig weiter gelesen hatte, denn die Dame kam jede Woche zweimal in einer ähnlichen Angelegenheit – „wenn Fräulein Bergen wirklich ausgezeichnet singt und von dem Publikum drei-, viermal an einem einzigen Abend herausgerufen und mit Kränzen beworfen wird, so werden Sie uns doch wenigstens gestatten, daß wir das einfach referiren!“
„Aber wer hat sie denn mit Kränzen beworfen?“ schrie die lebhafte Italienerin. – „Jedes Stück kostet ihr zwanzig Groschen bei der Gemüsehändlerin, und die übrigen hat ihr der verrückte Graf, der Engländer, besorgt, mit dem sie ein Verhältniß hat.“
„Mein verehrtes Fräulein!“ sagte Herr Köfer vorwurfsvoll, die Dame verstand aber die Andeutung nicht, und da sie /37/ sich einmal in ihren Grimm hineingearbeitet hatte, fuhr sie unerbittlich fort:
„Und einer solchen Person streuen Sie in Ihrem Blatte Weihrauch und nennen sie einen „Stern“, der das Größte ahnen ließe? – eine zweite Schröder-Devrient2 und Sontag? und das mir in’s Gesicht, der ich ihr nur aus alberner Gutmüthigkeit die Rolle abgelassen habe? – Eine zweite Sontag – es ist wahrhaftig zu lächerlich, und nicht etwa weil die Sontag wirklich das war, was die Recensenten aus ihr machten, sondern nur weil sich das Publikum jetzt, das sie nie gehört hat und also auch nicht darüber urtheilen kann, das Außerordentlichste darunter denkt. Was wollen Sie denn nachher noch über mich schreiben?“
Herr Köfer hatte wirklich mit einer merkwürdigen Gemüthsruhe diese heftigen und leidenschaftlichen Aeußerungen angehört, oder vielmehr über sich ergehen lassen, weil er doch recht gut wußte, daß er diesen Strom nicht dämmen konnte. Er mußte ruhig ablaufen. Jetzt, nachdem die Dame schwieg – und er öffnete indessen einen Brief nach dem andern – sagte er:
„Verehrtes Fräulein, ich schreibe überhaupt gar nichts – Briefe an meine Correspondenten ausgenommen – also mir können Sie keine Vorwürfe machen. Ich lese nicht einmal meine eigene Zeitung und gehe nicht in’s Theater – was ich aber über Fräulein Bergen gehört habe, klang sehr lobenswerth, und ihre Jugend –“
„Jugend – bah! –“ sagte Fräulein Ostachini – „sie ist noch nicht hinter den Ohren trocken und schon die größte Kokette, die es auf der Welt geben kann. Die versteht’s – und was muß die Welt denken, wenn neben mir ein solches – Geschöpf in der Weise herausgestrichen wird?“
„Aber, mein bestes Fräulein,“ sagte Herr Köfer, „was wollen Sie? – wie ich gehört habe, hat es vorgestern Abend wirklich Kränze und Bouquets geregnet, und wenn sich das Publikum selber –“
„Reden Sie nicht, als ob Sie eben erst auf die Welt gekommen wären,“ unterbrach ihn Fräulein Ostachini mit einer wegwerfenden Bewegung des Kopfes – und sie that Herrn /38/ Köfer darin Unrecht, denn mit seinem unrasirten Gesicht und den grauen Bartstoppeln sah er wahrhaftig nicht so aus – „als ob man nicht wisse, woher die Kränze und Bouquets kommen und wie billig das ist, wenn man es geschickt gemacht hat. Wenn ihr nur jeder ihrer Courmacher ein Bouquet geworfen hätte, wäre sie im Grünen erstickt. – Soliden Damen (Fräulein Ostachini zählte achtunddreißig Jahre) – sind allerdings solche Hilfsquellen verschlossen – aber desto scheußlicher ist es,“ fuhr sie gereizt fort, „wenn sich die unabhängige Presse auch noch dazu hergiebt, Vorspann an dem Triumphwagen einer solchen – Person zu nehmen. Sängerin, bah! – sie hat keine Spur von Koloratur; der eine Triller war eine wirkliche Parodie auf jeden Gesang, und bei den hohen Tönen erfaßte mich fortwährend eine unsagbare Angst, daß sie jetzt umkippen müsse – und das Spiel – wie eine Wahnsinnige fuhr sie auf der Bühne herum, und das heißt nachher ein Kunsttempel – man möchte verrückt darüber werden.“
„Und womit kann ich Ihnen eigentlich dienen?“ sagte Herr Köfer, indem er eben seinen letzten Brief aufbrach; die gelesenen hatte er auf verschiedene Haufen sortirt.
Fräulein Ostachini gerieth wirklich in Verlegenheit um eine Antwort, denn eigentlich hatte sie nur schimpfen und ihrem Herzen Luft machen wollen – einen weiteren Zweck konnte ihr „Besuch“ natürlich nicht haben.
„Mir?“ sagte sie endlich – „mir sollen Sie gar nicht dienen; aber dem Publikum, indem Sie nicht solche wahnsinnige Recensionen hinaus in die Welt werfen, die diese Mamsell vergöttern und einen Stern aus einem völlig talentlosen Dinge machen. Wer soll denn da noch Liebe zur Kunst haben, wenn man sieht, daß die größte Mittelmäßigkeit in solcher Weise verherrlicht wird? Meiner Meinung nach erheischte doch schon die Würde Ihres Blattes, daß Sie nicht einer solchen Profanation zugänglich wären.“
„Die Würde unseres Blattes?“ sagte Herr Köfer, und selbst ihm kam diese Behauptung komisch vor; „aber, mein liebes Fräulein, wir recensiren oder geben vielmehr der Stimme des Publikums Ausdruck – unparteiisch versteht sich /39/ und allein im Sinne der Kunst, – und darin werden Sie mir doch gewiß Recht geben, daß junge aufstrebende Talente unterstützt werden müssen.“
„Junge Talente!“ sagte Fräulein Ostachini; „die Person hat sich schon auf drei, vier Theatern herumgetrieben. Doch Sie werden es erleben! Am Sonntag singt sie die Julia, und eine schöne Vorstellung mag das werden! Das sage ich Ihnen aber, wenn Sie in diesen Lobhudeleien fortfahren, so sind wir die längste Zeit Freunde gewesen. Ich verlange von einer Theaterzeitung ein unparteiisches, durch keine Rücksichten oder Protectionen beeinflußtes Urtheil.“
„Fräulein Ostachini!“ sagte Herr Köfer.
„In der That,“ rief aber die aufgeregte Dame – „und nicht die geringste Rücksicht für mich selber – aber auch ebenso für Andere, und Ihrem Herrn Lerche bitte ich das von mir auszurichten.“
„Und sonst kann ich Ihnen mit nichts dienen?“ sagte Herr Köfer, während die Dame ihren Shawl fester um die Schultern zog.
„Heute nicht,“ sagte Fräulein Ostachini, nicht in der Stimmung, höflich zu sein; „guten Morgen, Herr Köfer!“ und mit den Worten fegte sie zum Bureau hinaus und nahm alle die Papierschnitzeln, Bindfaden, Nußschalen und sonstigen Gegenstände mit, die in ihrer Bahn lagen und die die alte Kathrine in den letzten Tagen versäumt hatte auszukehren.
Herr Köfer sah ihr über seine Brille nach – ohne sie zu begleiten, wie er es vorher bei Herrn Bomeier für nöthig befunden; dann aber, als sie die Thür hinter sich zuschlug, murmelte er leise:
„Ja wohl – nicht die geringste Rücksicht für mich selber, und das Unglück möchte ich erleben, wenn wir nur ein einziges Mal sagten, daß ihre Stimme – die so scharf geworden ist, daß sie Einem durch Mark und Bein schneidet, ein wenig belegt gewesen wäre – Herr Du meine Güte, ich glaube sie drehte das Comptoir um!“
Der eine Schreiber, der sich kurz vorher ein Paket Briefe geholt hatte, die ihm Herr Köfer bei Seite gelegt, kam damit wieder zu seinem Pult.
/40/ „Aber ich muß in die Druckerei zurück,“ sagte der Setzerjunge, der noch immer in der Ecke stand.
„Und der Doctor kommt noch immer nicht!“ rief Herr Köfer und fuhr sich mit der Hand durch die ungekämmten Haare. „Springen Sie doch einmal hinüber, Splitzner, und sehen Sie, wo er bleibt.“
Der „erste“ Commis legte die Briefe auf. –
„Doctor Hesbach wünscht Abrechnung über sein hier in Commission befindliches Stück,“ sagte er, indem er den einen Brief vorschob; „er behauptet, in den Zeitungen gelesen zu haben, daß es in Breslau, Köln, Cassel, Dresden, Frankfurt a. M. und Wiesbaden gegeben sei.“
„Ist denn das Honorar dafür eingekommen?“
„Ja, Herr Köfer.“
„Schön, dann schreiben Sie ihm, sobald es käme, sollte er augenblicklich Abrechnung erhalten.“
„Es ist eingekommen, Herr Köfer,“ sagte der junge Mann.
„Esel,“ erwiderte Herr Köfer, „haben Sie nicht gehört, was ich Ihnen gesagt habe? Und die anderen Briefe?“
„In diesem hier verlangt ein Herr Pleschner ebenfalls Abrechnung. Er sagt, daß er –“
Herr Köfer nahm den Brief, riß ihn auseinander und warf ihn in den Papierkorb – „weiter! –“
„Noch ein solcher Brief von Doctor Rabener. Sein Lustspiel wäre auf sieben Bühnen zur Aufführung gekommen, und er hätte noch nichts davon gehört.“
„Ich auch nicht,“ sagte Herr Köfer, nahm den Brief, knitterte ihn zusammen und steckte ihn in die Tasche.
„Herr Blesheim wünscht ebenfalls Abrechnung,“ fuhr der junge Mann fort. „Er behauptet, Sie hätten ihm auf seine vier letzten Briefe gar nicht geantwortet.“
„Das ist sehr leicht möglich,“ sagte Herr Köfer – „die Herren scheinen weiter gar nichts zu thun zu haben, als Briefe zu schreiben – wir müssen ihnen das abgewöhnen. Stecken Sie den Wisch in den Papierkorb. Was sonst noch?“
„Anmeldung von neuen Stücken.“
„Bekannte Namen?“
/41/ „Nein.“
„Fort damit!“
Die Thür ging wieder auf, und Herr Guido Lerche trat, von dem zweiten Commis gefolgt, der ihm auf der Treppe begegnet war, in’s Zimmer.
„Aber, Herr Lerche – der Setzerjunge wartet schon zwei Stunden auf Sie,“ sagte Herr Köfer vorwurfsvoll.
„Kann ich Armeen aus der Erde stampfen?“ citirte Herr Lerche und ging ohne Gruß an seinen Platz, Herrn Köfer gerade gegenüber; „ich bin die Nacht erst um halb Drei nach Hause gekommen und habe trotzdem schon heute Morgen den Artikel beendet. Ich muß ihn nur noch einmal durchlesen, nachher kann ihn der Junge mitnehmen.“
Herr Guido Lerche hatte sich in den Jahren, in denen wir das Vergnügen nicht hatten, ihm zu begegnen, sehr zu seinem Vortheil verändert, was wenigstens sein physisches Selbst betraf. Er war dick und rund geworden, trug einen kleinen, aber sehr buschigen Schnurrbart, leinene Vorhemdchen und papierne Vatermörder, sah also immer sehr reinlich aus und zeigte einen nicht unbedeutenden Ansatz zu einer mühsam erworbenen rothen Nase.
„Wo waren Sie denn bis halb drei Uhr?“ sagte Herr Köfer, der in sofern Interesse daran nahm, als Herr Lerche schon seit fünf Jahren als Gatte seiner Schwester sein Schwager und dabei „stummer“ Theilhaber des Geschäfts geworden.
„Wo ich war?“ sagte Guido – „Bomeier gab ein famoses Champagner-Souper nach dem Theater, und wir haben uns köstlich amüsirt. Ist ein ganz famoser Kerl!“
„Sind Sie mit der Recension fertig?“
„Gewiß.“
„Darf ich Sie bitten?“
Lerche reichte ihm das Blatt hinüber, und Herr Köfer warf kaum den Blick darauf, als er ausrief:
„Aber, bester Lerche – Sie reißen ja das Stück furchtbar herunter, und es hat ausgezeichnet gefallen! Der Autor ist beinah nach jedem Act gerufen geworden, und der Regisseur hatte alle /42/ Hände voll zu thun, ihn nur zu entschuldigen. Das Publikum war ganz außer sich.“
„Lieber Schwager,“ sagte Herr Lerche verächtlich, „thun Sie mir den einzigen Gefallen und nennen Sie mir nur gar nicht das Wort Publikum. Was ist Publikum? Eine Masse, die Entrée bezahlt, um das Institut zu erhalten und sich ein paar Stunden Abends zu amüsiren. Für ihr Eintrittsgeld haben sie dann allerdings Sitz, aber wahrhaftig keine Stimme, und mit Ihrer Erfahrung müssen Sie doch schon lange wissen, daß eine solche Masse wohl steuerpflichtig sein kann und sein muß, aber nie die geringste Rücksicht auf ihr Urtheil verlangen darf.“
„Aber der Autor hat einen so bekannten Namen!“ sagte Herr Köfer, doch noch nicht vollständig überzeugt.
„Und was thut das?“ rief Herr Lerche. „Das Urtheil über dramatische Productionen haben wir in der Hand, nicht das Publikum, und wer ist der Autor überhaupt? Kennen wir ihn? Hat er es auch nur der Mühe werth gefunden, uns einen Anstandsbesuch zu machen? – heh?“
„Das allerdings,“ sagte Herr Köfer.
„Gut,“ bemerkte Herr Lerche, „den Herren müssen wir wenigstens Lebensart lehren und sie davon überzeugen, daß sie ohne uns nichts sind – nachher werden sie zahm und fressen aus der Hand. Ueberlassen Sie das mir, Schwager. Ich weiß, wie man mit derartigem Gelichter umspringen muß.“
Herr Köfer hatte indessen die Recension über das gestern gegebene Stück weiter verfolgt. – „Hm,“ sagte er dabei – „Bomeier wird damit zufrieden sein – kann nicht mehr verlangen, aber – haben Sie sich da verschrieben? – Was bedeutet denn der letzte Satz?“
„Welcher?“
Herr Köfer las: „Fassen wir aber das Ganze in wenige Worte zusammen und bewundern wir fortan sein großes Talent für Form, für Stilistik – seine Begabniß, sich das Außerordentlichste anzueignen – seine reizende, schöne Factur, seine zarten Fühlhörner und seine ernsthafte – ich /43/ möchte fast sagen passionirte Indifferenz ... das verstehe ich nicht.“3
„Lieber Schwager,“ sagte Herr Lerche, mit der linken Hand eine abwehrende Bewegung machend – „überlassen Sie das mir. Sie verstehen das allerdings nicht, aber es drückt in höherer Weise aus, was unser geistiges Ich bei einer solchen Leistung empfindet. Bomeier ist in der That ein Künstler erster Klasse, und ich hoffe nur, daß er unserem Institut erhalten bleibt. Etwas Rohes, das er noch an sich hat, wollen wir dann schon abschleifen und poliren.“
„Na,“ sagte Herr Köfer – „dann geben sie nur dem Jungen da das Manuscript, daß er in die Druckerei kommt, denn er wartet schon eine ewige Zeit. Ich will hinüber gehen und mich rasiren lassen – mein Barbier kommt jetzt,“ und ein viereckiges Stück Marmor mit einer Lyra darauf als Handgriff auf seine verschiedenen Briefschaften stellend, verließ er das Bureau, um sich auf kurze Zeit in seine eigenen Räume zurückzuziehen.
Herr Lerche hatte indessen den Setzerjungen abgefertigt und die verschiedenen eingelaufenen Zeitungen aufgegriffen, in deren Lectüre er sich vollkommen vertiefte. – Die Schreiber waren ebenfalls in voller und eifriger Arbeit, und so mochte es geschehen, daß ein Fremder, von ihnen Allen unbemerkt, das Comptoir betrat und durchschritt. Herr Lerche hatte wenigstens nicht das Geringste gehört, als plötzlich dicht neben ihm eine Stimme sagte:
„Guten Morgen, Herr Lerche!“
Guido fuhr in der That zusammen; als er aber über das Zeitungsblatt hinwegsah, erkannte er einen sehr anständig gekleideten Herrn vollkommen in Schwarz, mit sehr sauberer Wäsche, der dicht vor ihm stand und ihm freundlich, ja fast vertraulich zunickte.
Lerche starrte ihn überrascht an, denn die Züge des Fremden kamen ihm so merkwürdig bekannt vor, und doch konnte er sich in dem Augenblick um’s Leben nicht besinnen, wo er ihn /44/ nur je gesehen hätte. Der Fremde aber, der ihn lächelnd betrachtete, fuhr ruhig fort:
„Also glücklich im Hafen der Ruhe angelangt? – Sie sehen gut aus, lieber Lerche, und haben sich ordentlich herausgemacht. Das Unterkinn steht Ihnen vortrefflich, und ich hätte Sie beinah gar nicht wiedererkannt.“
„Mit wem habe ich die Ehre?“ sagte Herr Lerche, der durch das vornehm nachlässige Wesen und diese anscheinende Vertraulichkeit ganz aus seiner gewohnten Rolle fiel und gar nicht grob wurde – „ich muß Ihnen gestehen, daß ich mich nicht erinnern kann, jemals das Vergnügen gehabt zu haben –“
„Erinnern sich nicht?“ lächelte der Fremde freundlich – „ja, läßt sich denken. Erstlich ist es auch eine Reihe von Jahren, her, daß wir uns trafen, und dann verändert das Glück die Menschen oft wunderbar. Ich selber konnte mir aber doch die Freude nicht versagen, Sie wieder einmal aufzusuchen, und da ich hier gerade ganz in der Nachbarschaft Geschäfte hatte –“
„Aber wer sind Sie?“ rief Herr Lerche, dem plötzlich eine Ahnung dämmerte, indem er dabei ganz blaß wurde.
„Ich?“ lachte der Fremde – „der Teufel! Kennen Sie mich nicht mehr?“ –“
„Jesus, Maria und Joseph!“ sagte Herr Lerche.
„Seien Sie nicht kindisch,“ erwiderte der Fremde – „die Schreiber werden schon aufmerksam – ich will auch gar nichts von Ihnen, sondern freue mich nur, daß es Ihnen gut geht und – daß mein Rath bei Ihnen angeschlagen ist. – Sie befinden sich wohl?“
„Danke Ihnen,“ sagte Herr Lerche in der größten Verlegenheit, denn er wußte wahrhaftig nicht, wie er mit dem Manne daran war. Er erkannte jetzt auch die Züge desselben wieder, die er damals allerdings nur undeutlich im Mondenlicht gesehen; es war das nämliche bleiche, aber in nichts veränderte Antlitz – die Jahre waren spurlos an ihnen vorübergegangen, und noch wie damals ruhten die dunkeln, ausdrucksvollen Augen aus ihm und schienen sich fest in ihn hinein zu bohren.
„Ihr Schwager ist wohl nicht zugegen?“ sagte der Fremde /45/ endlich, als Herr Lerche noch immer keine Worte fand, ihn anzureden.
„Nur einen Augenblick auf sein Zimmer hinübergegangen; er muß gleich wieder zurückkommen,“ sagte Lerche mit der größten Zuvorkommenheit. „Sie kennen ihn?“
„Wir sind alte Freunde,“ lächelte der Fremde, „und stehen auch in Geschäftsverbindung.“
„Wollen Sie denn nicht einen Augenblick Platz nehmen?“
Es lag ein eigener, malitiös-humoristischer Zug um die Lippen des Fremden. Lerche fühlte sich aber dabei um so unbehaglicher, als er sich bewußt war, ihm noch zwanzig Gulden zu schulden, die er nur höchst ungern zurückgezahlt hätte. – Und wer war der räthselhafte Mensch überhaupt? – Der, für den er sich ausgab, konnte er nicht sein, und jetzt stand er auf einmal mitten in der Stube, und Keiner hatte ihn kommen hören.
„Herr Lerche,“ sagte der Fremde nach kurzem Nachdenken, „ich möchte allerdings Herrn Köfer erwarten – er wird sich freuen, mich wieder zu sehen. – Bleibt er lange?“
„Er muß augenblicklich wiederkommen.“
„Schön,“ sagte der Fremde – „dann wart’ ich,“ und einen der Rohrstühle benutzend – selbst er getraute sich nicht auf das Sopha – nahm er an der Seitenwand Platz, ohne aber auch nur für einen Moment den Blick von Herrn Lerche abzuwenden, den dieser fühlte, ohne ihm zu begegnen.
„Merkwürdig,“ nahm dann der Besuch das Gespräch wieder auf, „wie sich doch die Zeiten und Menschen verändern! Erinnern Sie sich noch, Herr Lerche, wie wir uns damals in Ems trafen? Damals waren Sie ein junger schlanker Mensch – etwas abgemagert vielleicht und etwas reducirt ebenfalls, am Leben verzweifelnd, und jetzt? Ich habe mir eben das Vergnügen gemacht und Ihre Familie besucht –“
„Sie waren drüben bei mir?“ sagte Herr Lerche rasch und fast wie erschreckt.
„Ich glaubte Sie noch zu Hause zu finden. Was für eine prächtige Frau Sie haben – so wohlbeleibt und so resolut – Sie scheinen ein wenig unter dem Pantoffel zu stehen, Lerche – wie?“
/46/ „Ich?“ sagte Herr Lerche und wurde blutroth – „woher vermuthen Sie das?“
„Oh,“ lächelte boshaft der Fremde – „nur nach einigen kleinen Andeutungen. Sie werden es mir auf mein Wort glauben, daß ich darin einige Erfahrung besitze. Ich spielte nur zum Scherz darauf an, daß Sie vielleicht heute Mittag nicht zum Essen kommen würden –“
„Alle Wetter!“ rief Herr Lerche erschreckt– „wir waren gestern Abend etwas lange auf –“
„Ihre Frau Gemahlin deutete etwas Derartiges an,“ lachte der Fremde, „so daß ich nicht weiter in sie drang. Ich selber streite mich nicht gern mit älteren Damen, denn man zieht stets den Kürzeren. Aber Sie scheinen sich sehr wohl zu befinden – eine sehr hübsche Einrichtung, eine ganze Reihe von Kindern mit so prächtigen rothen Haaren – und die liebenswürdige Gattin!“
„Ich glaube, da kommt Herr Köfer,“ sagte Lerche, dem das Gespräch anfing unangenehm zu werden, indem er nach einer draußen gehenden Thür horchte. Es dauerte auch nicht lange, so trat der Principal in das Zimmer, ohne aber den Besuch gleich zu bemerken, oder auch zu beachten; denn er ignorirte grundsätzlich alle Leute, die geduldig auf ihn warteten.
„Donnerwetter,“ sagte er, wie er nur den Raum betrat, „was riecht denn hier nur so furchtbar nach Schwefel?“
„Sie müssen mich entschuldigen, Herr Köfer,“ sagte der Fremde, „ich habe mir eben eine Cigarre angezündet. Es ist wahrscheinlich das Streichhölzchen.“
Herr Köfer blieb mit halboffenem Munde vor ihm stehen und sah ihn so stier an, als ob er einen Geist gesehen hätte.
„Von der Hölle,“ stammelte er endlich, und sein sonst aufgedunsenes rothes Gesicht war merklich bleich geworden – „wo kommen Sie einmal wieder her? Ich – habe Sie in ewig langer Zeit nicht gesehen?“
„Geschäftsreisen, lieber Freund,“ sagte der Fremde leichthin, indem er den Dampf seiner Cigarre von sich blies – „die mich auch wieder in Ihre Nähe gebracht haben, und doch einmal in X., konnte ich mir natürlich das Vergnügen nicht versagen.“
/47/ „Ich weiß nicht, ob sich die Herren kennen,“ bemerkte etwas verlegen Herr Köfer – „Herr Lerche – mein Schwager und jetziger Theilhaber des Geschäfts – Herr von der Hölle – mein erster Compagnon, lieber Lerche, mit dem ich das Bureau gegründet habe – aber ich erinnere mich jetzt, Sie brachten mir ja selber seine Karte.“
„Ja,“ sagte von der Hölle, „und ich freue mich wirklich, zwei so würdige Leute zusammengeführt und befreundet zu haben. Ihr Geschäft muß jetzt blühen, lieber Köfer. Wenn Ihre Charaktere auch ziemlich ungleich sein mögen, so ergänzen sich doch Ihre Eigenschaften – und dann der versprechende Nachwuchs. Ich bin ganz glücklich, Alles so vortrefflich gedeihen zu sehen, und kann jetzt befriedigt X. wieder verlassen.“
„Und weiter hat Sie nichts hierher geführt?“ sagte Herr Köfer, doch etwas erstaunt.
„In Ihr Haus? nein. Einige andere Geschäfte bleiben natürlich noch zu erledigen. Allerdings hatte ich schon früher öfter versucht, einmal mit Ihnen abzurechnen, lieber Köfer (Herr Köfer wurde leichenblaß), aber ich glaube nicht, –“ setzte er gutmüthig hinzu – „daß ich gerade jetzt zur gelegenen Stunde komme.“
„Die Geschäfte sind in der letzten Zeit so schlecht gegangen –“ versicherte der Agent, mit einem unwillkürlichen Blick auf seinen Schwager.
Von der Hölle lächelte. „Ich weiß es, verehrter Herr, aber Sie wissen auch, daß ich mehr auf die Zinsen als das Capital rechne. Für jetzt bin ich vollkommen zufrieden. – Lieber Herr Lerche, es war mir außerordentlich angenehm, Sie wieder einmal gesehen zu haben – bitte, empfehlen Sie mich nochmals Ihrer liebenswürdigen Frau Gemahlin! – Lieber Köfer – ich hoffe doch, daß wir im nächsten Jahr unser kleines Geschäft reguliren können, wie?“
„Ich hoffe bestimmt,“ sagte Herr Köfer, und es war augenscheinlich, daß er sich Mühe gab, in Gegenwart seiner Schreiber ein etwas würdevolles Ansehen zu behaupten.
„Also auf Wiedersehen – bitte, keine Komplimente,“ und mit raschen Schritten glitt er mehr als er ging durch das Comptoir, der Thür zu.
/48/ Als Köfer – der unter keiner Bedingung gerade bei diesem Herrn die nöthige Artigkeit außer Acht lassen wollte – hinter ihm drein schoß und die Thür wieder öffnete, war er schon fort – und ganz unten auf der Treppe. –
Im nächsten Jahr – ziemlich um dieselbe Jahreszeit – machte ein Vorfall in X. viel Aufsehen. Herr Köfer nämlich, der Eigenthümer des Theaterbureaus, wurde vermißt, überall gesucht und nirgends gefunden, und die verschiedensten Gerüchte kamen darüber in Umlauf. Einige behaupteten, er sei im Fluß verunglückt – nach Anderen sollte er in Hamburg gesehen worden sein, um sich nach Amerika einzuschiffen – Gewisses konnte man aber nirgends über ihn erfahren, und nur die Schauspieler in X. versicherten auf das Bestimmteste: „daß ihn der Teufel geholt habe“.
Wie dem auch sei – er kam nicht wieder zum Vorschein, und Herr Lerche setzt unter der alten Firma das Geschäft fort.
Die Blatternimpfung.
Erstveröffentlichung 1872, Fliegende Blätter. Band 57.- München: Braun & Schneider. Nr 1407-1410.
1.
Doctor Julius Forbach war ein alter Junggeselle, der, und wenn auch nur in seiner eigenen Meinung, von der Zeit vergessen und weit über ein halbes Jahrhundert, trotz grauer Haare, Runzeln im Gesicht und eines nichtswürdigen Rheumatismus im linken Bein, noch jung geblieben war.
Morgens brauchte er, genau nach der Zeit lebend, wenigstens zwei Stunden zu seiner Toilette, zum Arrangiren seiner falschen Zähne, zum Brennen seiner, immer noch von Zeit zu Zeit gefärbten Haare, zum Rasiren, zum Anziehen, und tänzelte er mit einem kleinen Spazierstöckchen nachher aus, so besuchte er noch immer die Damen, für die er vor langen Jahren geschwärmt und die sich dann im Laufe derselben verheiratet hatten und Mütter, ja Großmütter geworden waren. Mit dem Schlag zwölf Uhr saß er aber jeden Morgen regelmäßig am Stammtisch bei Röhrichs am Markt, um sein Glas Bier zu trinken, speiste im Hotel, las nach Tisch im Café die Zeitungen, verbrachte seine Abende im Theater oder Concert, oder auch im Casino bei einer Parthie L´hombre und kehrte, genau um zehn Uhr, in sein wohl freundliches, aber doch auch sehr einsames Logis zurück, wo ihm eine alte Haushälterin die Wirthschaft führte und ein etwas sehr fauler Bursche in einer Art von Livréerock die anderen nöthigen Dienste leistete.
/50/ Uebrigens galt er bei allen seinen Bekannten und Freunden als eine Art von Factotum, das, mit gar keiner bestimmten Beschäftigung, von ihnen zu allerlei kleinen Diensten zweckmäßig verwendet werden konnte: Besorgungen in der Stadt, besonders von Theater- und Concertbilleten, Briefe in den Briefkasten zu stecken, einen Wagen zu bestellen, Annoncen in die Zeitungen zu rücken, Bücher in der Leihbibliothek umzutauschen, ein Recept in der Apotheke abzugeben, daß es das Mädchen nachher holen konnte, und andere dem ähnliche Dinge wurden ihm von den verschiedenen Damen mit dem größten Vertrauen übergeben, und irgend einen solchen Dienst zu verweigern, gestattete ihm schon sein gutes Herz und seine wirklich unermüdliche Gefälligkeit nicht.
Dafür war er aber auch überall gern gesehen; die Kinder jubelten, wohin er nur kam, denn er trug stets die Taschen voll Bonbons, und die Frauen lächelten ihm freundlich entgegen; war nämlich etwas in der Stadt passirt. so erfuhren sie es jetzt. Er kannte alle kleinen Familiengeheimnisse, da sich kein Mensch vor ihm genirte, und überraschte er auch wirklich einmal eine Dame seiner Bekanntschaft zu etwas früher Stunde noch in ihrem Morgenrock, so erschrak sie wohl im ersten Augenblick darüber, beruhigte sich aber rasch, sobald sie ihn erkannte, mit einem: „Ach, es ist nur der Doctor,“ und dies „nur der Doctor“ sicherte ihm zu jeder Stunde und aller Orten einen freundlichen und ungehinderten Empfang.
Doctor Julius Forbach war übrigens nicht etwa Arzt, obgleich er zahllose kleine unschuldige Hausmittel für jedes Leiden wußte und gewisse Pillen z. B. auch stets bei sich trug, sondern einfacher Doctor der Philosophie und einer von den Tausenden von Menschen, die auf der Welt „ihren Beruf verfehlt haben“. Er liebte die Wissenschaft, ja, aber mehr noch als sie, seine eigene Bequemlichkeit; er machte allerdings früher einige Versuche, in irgend welche Thätigkeit einzutreten, aber es ging nicht – er hatte zu viele Bekannte, die er nicht vernachlässigen durfte, kurz mit einem Worte: er verbummelte, und da er ein kleines Vermögen besaß, von dem er zur Noth sorgenfrei leben konnte, so gab er endlich alle weiteren Bemühungen /51/ auf und wurde, was er jetzt war: Doctor Julius Forbach, der gute Freund aller Welt.
In der Ferdinandsstraße der kleinen, aber ziemlich belebten Stadt Buntzlach wohnte der Notar Erich, noch nicht sehr lange mit seiner allerliebsten Frau verheirathet, in deren Eltern Hause Forbach seit langen Jahren aus- und einging und Elise Erich, als damaliges Lieschen Bertram, noch als kleines Kind gekannt und oft auf dem Arm herumgetragen oder auf dem Knie geschaukelt hatte. Er nannte sie deshalb auch jetzt noch Du und Lieschen, und war dort, wie fast überall wo er verkehrte, wie zu Hause.
Es ging auf elf Uhr Morgens, als er an einem freundlichen Sommertag, und eben von einem kleinen Spaziergang zurückkehrend, Erich’s Wohnung passirte und, da er doch keine weitere Beschäftigung hatte, beschloß, einmal vorzufragen, wie es ginge. Die kleine Frau war vor etwa drei Monaten von einem allerliebsten Mädchen entbunden worden, und er hatte die Kleine eigentlich noch gar nicht recht bewundert – was die Mütter doch sämmtlich verlangen; so gern er aber Kinder von etwa zwei Jahren an leiden mochte, so wenig machte er sich aus Säuglingen und ging ihnen lieber etwas aus dem Wege.
Er kam heute aber – für seine Bequemlichkeit wenigstens – zu nicht sehr günstiger Zeit, desto willkommener aber, wie es schien, der jungen Frau, die er schon vollständig angezogen und zum Ausgehen gerüstet traf. Sie rief ihm wenigstens, wie sie nur seiner ansichtig wurde, erfreut entgegen:
„Ach, bester Doctor! Sie hat mir der Himmel gerade jetzt geschickt, Sie müssen mir einen Gefallen thun!“
„Aber, mein bestes Lieschen,“ sagte der freundliche Mann, „Du weißt ja doch, wie gern ich Dir zu Liebe thue, was in meinen Kräften steht – aber vor allen Dingen, wie geht’s hier zu Hause und was macht die Kleine? Ich muß aufrichtig gestehen, ich bin eigentlich heute Morgen ganz besonders hierher gekommen, um ihr meine erste Visite zu machen und mich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen.“
„Das ist sehr freundlich von Ihnen, lieber Doctor,“ sagte die junge Mutter, „und Sie sollen sie auch gleich sehen. Noch geht’s ihr auch, Gott sei Lob und Dank, vollkommen /52/ gut, aber Sie wissen doch, welche furchtbare Krankheit jetzt in der Stadt herrscht: die entsetzlichen Blattern, und diese gräßliche Epidemie tritt plötzlich, ja eigentlich erst seit gestern so bösartig auf, daß ich mich vor Angst gar nicht mehr zu fassen weiß.“
„Du hast sie doch impfen lassen?“
„Das ist es ja eben! noch nicht,“ rief die junge Mutter besorgt, „ich habe es noch immer hinaus geschoben, weil mir das Kind so zart schien und ich den Gedanken nicht ertragen konnte, daß ein fremder Mann mit einem scharfen Messer meinem armen herzigen Schatz in den Arm schneiden sollte, aber jetzt geht es ja nicht länger.“
„Nun, es ist damit auch jetzt noch nichts versäumt,“ sagte Forbach gutmüthig, „denn in diesem Stadttheil sind ja, so viel ich weiß, noch gar keine Krankheitsfälle vorgekommen. Ich habe mich übrigens erst im vorigen Jahr noch einmal impfen lassen, die Blattern sind aber nicht gekommen – ich habe keinen Stoff dafür in mir.“
„Ach Du lieber Gott!“ klagte die kleine junge Frau, „denken Sie nur, gleich neben uns an sind sie ausgebrochen; Helenchen, die Tochter vom Commerzienrath Sommer, hat sie bekommen, und in den Häusern hinter uns liegen zwei Familien daran krank. Es ist ja ganz schrecklich, und sie sollen so bösartig auftreten wie noch nie. Ich weiß mir vor Angst gar nicht zu helfen.“
„Aber so schicke doch zu dem Arzt und laß ihn herkommen, das ist ja das Einfachste, dann kann er gleich das ganze Haus impfen und Du bist nachher jeder Sorge ledig.“
„Das wollte ich ja auch,“ klagte Elise, „aber das Unglück ist, daß der Einzige, der jetzt gute Lymphe besitzt, der Stadtphysikus Baumann, so viel zu thun hat, daß er seine Wohnung gar nicht verlassen kann. In der allgemeinen Angst stürzt aber nun Alles zu ihm, und erst vor einer Viertelstunde hat er mir sagen lassen, er habe eben wieder frische Lymphe bekommen, wenn wir aber geimpft sein wollten, müßten wir zu ihm kommen, denn er hätte schon so Vielen abgeschlagen, in das Haus zu gehen, und auch wirklich keine Zeit, eine Ausnahme zu machen.“
/53/ „Das ist freilich unangenehm,“ sagte Forbach, „hat aber auch bei dem herrlichen Wetter nicht so viel zu sagen. Außerdem wohnt Stadtphysikus Baumann gar nicht so weit von hier entfernt, und Du kannst das rasch genug abmachen.“
„Ja, das wollte ich ja auch, bester Doctor,“ klagte Elise, „und mein Mann war eben im Begriff mit mir zu gehen, als er zu einem Sterbenden gerufen wurde, um dessen Testament aufzusetzen.“
„Das konnte er nicht verweigern,“ sagte Forbach, „denn da that Eile noth.“
„Nein, das weiß ich ja auch,“ rief Elise; „aber nun kommt auch noch die Angst dazu, daß der Sterbende die Blattern hat und mein unglücklicher Mann von ihm angesteckt wird.“
„Aber, bestes Kind,“ beruhigte sie der Doctor, „was machst Du Dir jetzt für ganz unnöthige Sorgen – wer war es denn?“
„Ja, das weiß ich nicht, in der Angst habe ich den Namen nicht gehört und Karl, als er eilig seinen Hut nahm und fortlief, auch nicht einmal danach gefragt.“
„Aber, Schatz, kann der Mann nicht eben so gut eine ganz unschuldige Lungenentzündung, oder die Schwindsucht, oder irgend eine andere Krankheit haben? Wer denkt denn nur gleich an das Schlimmste, und Du quälst Dich nur ganz unnützer Weise selber damit. Doch welchen Gefallen sollte ich Dir thun? Du sprachst vorhin davon.“
„Ach ja, lieber Doctor,“ sagte die junge Frau bittend; „ich erwähnte schon vorher, daß mich Karl eben begleiten wollte, als er abgerufen wurde, und ich fürchte mich jetzt, so allein zu dem Stadtphysikus zu gehen. Da sind gewiß recht viele Leute, und wenn ich dort mit dem Mädchen so lange zwischen so vielen fremden Menschen sitzen muß – ich sage Ihnen, ich habe eine schreckliche Scheu davor!“
„Und ich soll mitgehen?“ frug Forbach gutmüthig.
„Ach, wenn Sie so freundlich sein wollten, Sie thäten mir einen großen Gefallen!“
„Von Herzen gern,“ sagte Forbach lachend, „ich habe doch gerade nichts Besonderes vor und sehe mir dort dann gleich /54/ die Geschichte einmal mit an. Aber Du willst Dich doch auch impfen lassen?“
„Gewiß, gewiß!“ rief Elise, „und das Kindermädchen ebenfalls, und die Köchin soll heute Nachmittag hingehen und mein Mann, sobald er nur zurückkehrt. Die Angst ließe mich ja sonst keinen Augenblick ruhen – also Sie begleiten mich?“
„Versteht sich Kind, versteht sich,“ nickte ihr Forbach gutmüthig zu. „Macht Euch dann nur zurecht, denn sonst wird es am Ende heute Morgen zu spät, und um zwölf Uhr – muß ich einen Herrn an einem bestimmten Platz treffen, mit dem ich etwas Wichtiges zu besprechen habe.“ – Der bestimmte Platz war nämlich Röhrich’s Restauration am Markt, wo er, pünktlich, wie er in Allem war, sich jeden Mittag um zwölf Uhr einfand.
„Oh!“ rief die junge Frau erfreut, „wir können gleich gehen, denn ich bin schon fertig angezogen und die Rieke sitzt drüben und wartet auf uns. Nur meine Handschuhe muß ich mir noch holen, ich bin aber gleich wieder da –“ und hinaus huschte sie, um, wie sie versprochen hatte, gleich wieder zu erscheinen.
Es ist das aber ein eigenthümliches Ding mit Damen, die, wenn sie ausgehen wollen, sonderbarer Weise noch außerordentlich viel zu thun haben und grundsätzlich nie fertig werden. In der Schlafstube lagen noch einige Sachen auf dem Stuhl, die sie natürlich erst wegräumen mußte, dann hatte Elise vorher den Sonnenschirm, wie sie bestimmt wußte, auf das Bett gelegt, jetzt war er nicht da und fand sich erst nach längerem Suchen draußen neben dem einen Schrank, wo sie ihn hingestellt, als sie den Hut herausnahm. An dem Hut hingen aber, wie sie jetzt bemerkte, noch einige Fasern, mit denen sie doch nicht auf die Straße gehen konnte; die mußte sie also vorher noch abbürsten. Die Köchin äußerte ebenfalls noch einige Wünsche – eine Hausfrau wird ja so sehr in Anspruch genommen. Dann konnte sie den Schlüssel zu ihrem Schreibtisch nicht gleich finden, aus dem sie Geld nehmen mußte, denn daran hatte sie vorher doch nicht gedacht. – Und nun die Handschuhe – aus Versehen bekam sie, als sie dieselben aus dem Kasten nahm, zwei rechte und /55/ mußte dann wieder zurück, Alles noch einmal aufschließen und den passenden linken erst heraussuchen und an dem fehlte nachher ein Knopf.
Doctor Forbach wartete indessen mit einer wahrhaft rührenden Geduld eine viertel, eine halbe Stunde lang; endlich waren alle Schwierigkeiten besiegt; Elise mußte sich nur noch erst die etwas sehr engen Handschuhe anziehen. Das Mädchen trug indessen das Kind auf dem Arm herum, das den Vorbereitungen nicht so geduldig zusah und zu schreien anfing.
„Bisch, bisch, bisch, bisch, bisch,“ suchte das Mädchen das Kind zu beruhigen – „bisch, bisch, bisch, bisch“ – das kleine Ding begann Zeter zu kreischen und Forbach etwas nervös zu werden.
Endlich setzte sich der Zug in Bewegung. Elise bemerkte allerdings noch zur rechten Zeit, und wie sie schon unten an der Treppe war, daß sie ihr Portemonnaie oben auf dem Tisch hatte liegen lassen, aber sie war schnellfüßig, eilte rasch zurück, holte es, und nun stand ihrem Gange nichts weiter im Wege. Forbach bot ihr unterwegs den Arm, das Kindermädchen wanderte mit der Kleinen hinterher, und so schritten sie den Weg ziemlich rasch hinab, um den Impfplatz, vor dem sich Elise aber immer noch fürchtete, aufzusuchen.
2.
Das Local, in dem der Stadtphysikus die ihm gebrachten Kinder in wirklich geschäftsmäßiger Weise impfte, lag allerdings nicht sehr weit von Erich’s Wohnung entfernt. Das Einzige war nur, daß die Kleine, die das Mädchen dicht hinter Forbach hertrug, unterwegs weiterschrie und Elise fortwährend stehen blieb, um es mit – „ja, mein Herzchen, wir sind jetzt gleich da, mein süßes Leben – mein Wonnekindchen“ und /56/ andere Schmeichelnamen zu beruhigen. Das verzögerte den Gang allerdings etwas, und Forbach sah dabei vergebens wieder und wieder nach seiner Uhr. Zu ändern war aber an der Sache nichts, es mußte eben geduldig ertragen werden, und endlich traten sie in das Haus selber ein, wo er ja nicht mehr der Gefahr ausgesetzt war, daß ihm seine zahlreichen Freunde und Bekannten unterwegs begegneten und sich über sein „Familienleben“ lustig machten.
Das Haus, in welchem Stadtphysikus Baumann seine jetzige Impfstube eingerichtet, war ein altes städtisches Gebäude, die sogenannte „alte Waage“, in deren erste Etage eine ziemlich enge steinerne Wendeltreppe hinaufführte; dort trat man dann in einen geräumigen luftigen Saal, und Forbach bemerkte zu seinem Schrecken, daß eine ziemliche Anzahl von jungen und älteren Damen, wie Dienstmädchen, zwei Drittel von ihnen ein kleines Kind auf den Armen tragend, schon warteten und die Sitzung also eine sehr ausgedehnte zu werden versprach. Er sah auch verstohlen nach seiner Uhr, deren Zeiger schon auf elf Uhr zeigte. Noch war Hoffnung, daß er hier zur rechten Zeit abkam, um punkt zwölf zu Röhrichs zu gelangen; aber die schon vor ihnen Eingetroffenen mußten dann sehr rasch erledigt werden, und hielt er dort nicht seine bestimmte Zeit ein, so fühlte er sich nachher den ganzen Tag unbehaglich.
Seine angeborene Gutmüthigkeit verhindert ihn aber auch, sich der übernommenen Verpflichtung zu entziehen; er durfte seine kleine Frau Erich nicht wie ein ungetreuer Kavalier im Stiche lassen, und es hieß aushalten. Eins auch beruhigte ihn dabei: das Mädchen mit dem Kinde bekam, als sie eintraten, eine Marke, um die Reihenfolge zu sichern, übergangen konnten sie also nicht werden, und Alles nimmt ja auf der Welt einmal ein Ende, warum auch nicht eine Impfung.
Da Frau Erich übrigens, sowie sie in den Saal trat (die Impfung selber fand in einem Nebenzimmer statt), eine Bekannte traf, so knüpfte sie mit dieser augenblicklich ein Gespräch an, und Forbach bekam dadurch Zeit, sich seine immerhin interessante, wenn auch etwas sehr laute Umgebung zu betrachten. Die Hälfte der Kinder schrie nämlich, und die Mädchen, um sie zu beruhigen, machten dabei noch weit mehr Lärm als die /57/ kleinen Störenfriede selber. In dem sehr hohen und geräumigen Saal schwamm aber doch dieses wilde Concert zu einem so massenhaften Gewirr von Tönen zusammen, daß man nur selten einmal die Stimme eines urkräftigen jungen Staatsbürgers einzeln daraus hervorgellen hörte, und die Ohren bald vollkommen dagegen abgestumpft wurden.
Interessanter waren für Forbach die Damen selber, die sich in diesem Chaos von Gebrüll mit einander unterhielten als ob sie sämtlich taub wären und nun einander in die Ohren schreien müßten.
Die Rieke der jungen Frau Erich machte allerdings den unausgesetzten, aber hier völlig verzweifelten Versuch, ihr Kind in den Schlaf zu bringen, und Elise Erich theilte anfangs ihre Aufmerksamkeit noch zwischen der Freundin und dem „Wonnekind“, das sich hier entschieden für berechtigt hielt, seine Stimme ebenfalls mit abzugeben. Es half nichts: der Paroxysmus mußte erst vorübergehen, und ging auch, sobald die Kinder selber anfingen, ihren eigenen Heidenlärm zu hören, und dann, wie erstaunt darüber, schwiegen.
Forbach fand hier übrigens sehr gemischte Gesellschaft. In der allgemeinen Calamität, welche die Stadt durch die Epidemie heimsuchte, war Alles herbeigeeilt, um den Schutz der Impfung zu suchen – vornehme Damen und arme Frauen mit ihren Kindern, und der Stadtphysikus durfte schon gar keinen Unterschied machen, oder irgendwen begünstigen, denn die Bürgerschaft selber hätte da augenblicklich Lärm geschlagen. Wie die Leute eintrafen, so wurden sie abgefertigt, und eine bunter gemischte Gesellschaft ließ sich deshalb kaum denken, als sie dort auf den Bänken saß, oder sich auf- und abgehend dazwischen herumtrieb.
Das allein beruhigte Forbach, daß der Stadtphysikus mit einer wirklich fabelhaften Schnelligkeit arbeitete. Es befanden sich stets drei Parteien in seinem Zimmer, von denen die eine geimpft wurde, während sich die anderen dazu vorbereiteten, oder nach der Impfung die Kleider wieder ordneten. Er ließ sich auch dabei nicht stören, ging auf keine Fragen der darin sonst unersättlichen Mütter ein, und trieb das Ganze allerdings /58/ vollkommen geschäftsmäßig, aber dafür auch mit rascher und geschickter Hand.
Uebrigens war Forbach eine in der Stadt zu bekannte Persönlichkeit, um nicht auch hier eine Menge von bekannten Persönlichkeiten zu finden.
„Ei, nun sehen Sie einmal an,“ sagte ein altes, eingerunzeltes Fräulein, Namens Simprecht, die in der Stadt in dem Rufe einer sehr bösen Zunge stand – ,,wollen sich der Herr Doctor ebenfalls impfen lassen? Daran thun Sie vollkommen recht; ich selber habe den Entschluß gefaßt, mich der Operation noch einmal zu unterziehen, und erwarte nur noch eine Freundin. Es ist jetzt eine schwere und gefährliche Zeit!“
„Ach, Fräulein Simprecht – sehr erfreut, Sie zu sehen. Nein, Sie entschuldigen, ich bin nur in Begleitung der jungen Frau Notar Erich hierher gekommen, und hoffe, daß uns bald die Reihe trifft – Fräulein Schwester befinden sich doch wohl?“
„Oh, ich danke Ihnen vielmals, vortrefflich – das heißt, sie hat sich vor acht Tagen den Fuß vertreten und die Rose im Gesicht und muß das Bett hüten.“
„Oh, das bedauere ich ja sehr – aber Sie entschuldigen, mein werthes Fräulein, ich muß mich doch jetzt einmal nach meiner Schutzbefohlenen umsehen, denn ich glaube, unsere Zeit kommt bald.“ Er drückte sich dabei auf die Seite und dankte Gott, der Unterhaltung der Dame diesmal noch so rasch entkommen zu sein. Sie stand wenigstens in dem Rufe, daß sie ihre Opfer sonst so leicht nicht wieder los ließ.
Ein paar junge Damen, die sich gerade hatten impfen lassen und eben wieder aus der Stube heraus kamen, redeten ihn übrigens auch noch an und frugen ihn lachend, ob er sich vor den Pocken fürchte – seiner Schönheit wegen; der Frau Stadträthin Liebert lief er in den Weg und der Frau Kreisbaumeister Wölmerding, und dankte seinem Gott, als er von der jungen Frau Erich endlich erfuhr, daß ihre Nummer jetzt gleich daran kommen würde, und sie also nicht mehr lange zu warten brauchten. – Es war schon halb zwölf Uhr vorüber.
Endlich kam die Zeit, wo sie ihren „süßen, zuckrigen Fettengel“ – junge Mütter erfinden manchmal die wunderlichsten Beinamen für ihre Erstgeborenen – der „Schlachtbank“ über /59/ liefern sollte, wie sie zitternd sagte, aber es half eben nichts – es mußte ja sein, um den süßen Schatz vor der furchtbaren Krankheit zu schützen, und der liebenswürdige, zu Allem bereite und jeder Aufopferung fähige Doctor wurde nur noch gebeten, auf Mantille und Sonnenschirm und die Flasche der Kleinen – was in dem Saal zurückgelassen wurde, Acht zu geben, als auch schon der Ruf „Nr. 172“ durch den Saal schallte und sie sich eilig dort hinüber verfügten.
Doctor Forbach war sich jetzt für kurze Zeit allein überlassen, da er aber das alte Fräulein Simprecht, die außerdem eine Toilette wie ein junges Mädchen trug, wieder durch den Saal streichen sah und sie in dem vielleicht nicht unbegründeten Verdacht hatte, daß sie ihn aufsuche, drückte er sich in eine der entfernteren Ecken, wo besonders die ärmeren Leute saßen, und von wo er die Thür des Impfzimmers auch im Auge behalten konnte, um dort gegen jeden Angriff mehr geschützt zu sein. Seine Lage hier wurde ihm fatal, und nur das tröstete ihn dabei, daß er jetzt bald daraus erlöst würde. Stadtphysikus Baumann arbeitete außerordentlich rasch, und in höchstens zehn Minuten durfte er darauf rechnen, daß Alles vorüber war.
Um seine Nachbarschaft hatte er sich indessen wenig bekümmert. Es waren meist Frauen aus den unteren Klassen, die, jede ihr Kind auf dem Arme, zusammen ein lebhaftes Gespräch unterhielten. Ihrer Unterhaltung nach schienen auch Einzelne davon gar nicht mit der Impfung einverstanden zu sein und es nur für eine neue Steuer zu betrachten, die ihnen der Stadtrath auferlegte. Wenn Andere das nun widerlegten, ließen sie sich trotzdem nicht überzeugen und murrten, was jetzt Alles von einem armen Manne verlangt würde, und wie die Lebensmittel von Tag zu Tag im Preise stiegen, und wie das eigentlich noch einmal Alles werden sollte.
Die Reihe herunter war eine junge, sehr anständig gekleidete Frau gekommen, die ebenfalls, wie alle Uebrigen, ein kleines herziges Kind auf dem Arme trug, aber ganz merkwürdig bleich und angegriffen aussah. Sie hielt auch mit keiner der übrigen Frauen Verkehr, sprach wenigstens mit keiner und schien sich nur allein mit ihrem Kinde zu beschäftigen, das sie oft an sich /60/ drückte und küßte, während das kleine liebe Ding zu ihr auflächelte und nicht die geringste Lust zeigte, an dem Concert der Uebrigen Theil zu nehmen.
Forbach beachtete sie anfangs nicht; da er jetzt aber gar nichts zu thun hatte, fiel sein Blick wiederholt auf die lieben Züge der jungen Frau, in denen ein unverkennbarer Schmerz lag. Fürchtete sie für ihr Kind? Aber dazu schien keine Veranlassung, denn das kleine muntere Ding sah wohl und gesund genug aus, und die großen blauen Augen blitzten klar in die Welt hinein.
Unwillkürlich flog sein Blick aber immer wieder nach der Thür der Impfstube, denn seine kleine Frau Erich mußte ja jetzt bald kommen. Es war außerdem schon halb zwölf Uhr vorbei und seine Stunde rückte immer näher.
Während Forbach nach seiner Uhr und wieder nach der Thür sah, hing der Blick der jungen Frau für Momente forschend an seinen Zügen, als ob sie fast einen alten Bekannten in ihm zu sehen glaubte; aber sie mußte sich getäuscht haben, denn jetzt wandte sie sich wieder ab, schritt an ihm vorüber, etwa zehn Schritt in der Reihe, und setzte sich dann, wie ermüdet, auf den einen Stuhl, wo sie einen Moment den Kopf in die Hand stützte.
Aber es dauerte nicht lange, so erhob sie sich wieder – ihr Gesicht zeigte Marmorblässe – sie sah sich wie scheu im Kreise um – ihr Blick fiel wieder auf Forbach, und zu ihm tretend, sagte sie mit leiser angstgepreßter Stimme:
„Ach, dürfte ich Sie wohl bitten, mein Herr, die Kleine nur einen Augenblick für mich zu halten! Sie wird gewiß ruhig sein – nicht wahr, Herz?“ und sie küßte die Kleine auf die Lippen.
„Ich, Madame?“ sagte Forbach, von der Bitte doch etwas überrascht, indem er in seiner Gutmüthigkeit aber schon von seinem Stuhl emporsprang, „ich weiß nur nicht recht mit Kindern umzugehen.“
„Oh, nur einen Augenblick,“ bat das junge allerliebste Frauchen, „ich bin ja im Moment wieder da. Ich – fühle mich nicht wohl“ – und als ob sie gar keine Widerrede gelten ließ, legte sie das Kind in Forbach’s Arm, küßte es /61/ noch einmal, huschte dann den Saal entlang und verschwand gleich darauf durch die Thür.
Wer über den neuen, so unverhofft gekommenen Auftrag und die übernommene Pflicht allerdings etwas verblüfft zurückblieb, war Doctor Forbach.
Er hatte ja aber auch gar keine Zeit zum Ueberlegen gehabt; das junge Frauchen sah dabei so lieb und gut aus, das Kind lag so sauber und nett in seinem weißen Bettchen, und lächelte ihn dabei so freundlich an.
Wenn Frau Erich zurückkam und fand ihn so – wie herzlich hätte sie ihn ausgelacht!
Es war auch in der That eine etwas komische Situation für einen alten Junggesellen, der nicht einmal wußte, ob das Kind recht lag, oder vielleicht anders gehalten werden mußte. Er warf den Blick nach den anderen Frauen hinüber, deren Blicke jetzt alle auf ihn gerichtet waren, und sah allerdings, daß diese die Kinder in verschiedener Weise trugen.
Einmal hatte er indeß bei einem Freunde Pathe gestanden und erinnerte sich jetzt, daß ihm das Kind damals ebenso übergeben worden, und die paar Minuten konnte er es ja auch so halten. Wenn es nur ruhig blieb – heiliger Gott, wenn es jetzt zu schreien anfing – was hätte er dann, in aller Welt, mit ihm machen sollen!!
3.
Die Frauen umher waren allerdings auf den Herrn mit dem Kinde aufmerksam geworden, ohne jedoch darin etwas Außerordentliches zu finden, daß er es hielt – desto mehr interessirte sie aber die Mutter, und sie flüsterten auch schon heimlich mit einander.
Doctor Forbach wartete indessen und wartete, und die Situation fing schon an ihm peinlich zu werden. Die unselige Frau kehrte nicht zurück, sie mußte doch wenigstens schon zehn /62/ Minuten abwesend sein, und er stand hier mit dem Kinde, das schon anfing, verschiedene Zeichen von Ungeduld zu geben. Es schrie allerdings noch nicht, aber es war nahe daran, und was wurde dann?
Die ihm nächsten Frauen waren indessen aufgestanden und der Thür der Doctorstube zugegangen, weil ihre Nummer jetzt gleich kommen mußte, und zu seiner großen Beruhigung entdeckte er endlich Elise Erich, die eben mit Kind und Kindermädchen aus der Doctorstube trat und, wie sie ihn bemerkte, auf ihn zueilte. Sie hatte auch wohl gesehen, daß er etwas trug, aber nicht weiter darauf geachtet. Jetzt erst, als sie dicht an ihn hinan war, rief die muntere Frau überrascht und lachend aus:
Aber, bester Doctor, was haben Sie denn da? ein kleines Kind? Oh, das steht Ihnen prächtig! So sollten Sie sich photographiren lassen. Hahahaha, wo haben Sie denn das in der Geschwindigkeit herbekommen?“
„Ja, bestes Kind,“ sagte Forbach, mit einem etwas sehr verlegenen Lachen – „das ist eine ganz sonderbare Geschichte. Ein junges Frauchen hat mir das Kind in den Arm gelegt, sie wollte sogleich wiederkehren, und nun ist sie schon fast eine Viertelstunde fort und läßt sich nicht wieder blicken. Aber sie muß im Augenblick zurückkommen. Wenn Du nur eine Minute warten wolltest, Kind!“
„Von Herzen gern – aber ist das ein liebes Ding – ein Knabe oder ein Mädchen?“
„Ja, mein Schatz, das weiß ich nicht.“
„Was es für schöne, große blaue Augen hat,“ fuhr die junge Frau rasch fort, indem sie das Kind aber doch schärfer und aufmerksamer betrachtete. „Doch was ist das? – sehen Sie einmal die kleinen rothen Punkte auf der weißen Haut – das sieht ja ganz sonderbar aus!“
„Es werden ein paar Blüthchen sein,“ erwiderte der Doctor, der sich indeß vergeblich nach der Mutter seines Schutzbefohlenen umschaute – „ich begreife wahrhaftig nicht, wo sie bleibt!“
„Nein, lieber Doctor,“ sagte aber Elise Erich, indem sie fast scheu von dem kleinen Wesen zurücktrat – „das sind /63/ keine Blüthchen – sehen Sie nur, das ist ja fast wie ein schwarzer Schein um den einen Punkt – um des Himmels willen,“ flüsterte sie ihm dann leise und furchtsam zu: „das arme, unglückselige Kind hat ja die Blattern!“
„Alle Teufel!“ rief Forbach fast unwillkürlich aus, denn die Blattern waren ja im vorigen Jahr nicht bei ihm „gekommen“ und er fühlte sich deshalb keineswegs so ganz sicher.
„Aber wo ist denn nur die Mutter?“ frug Elise.
„Das weiß der Himmel,“ stöhnte Forbach, indem er sich halb verzweifelt umsah, „aber sie muß gleich wiederkommen; wenn Du nur das kleine Wesen einen Augenblick nehmen könntest – ich komme mir gar so unglückselig damit vor!“
„Ich? Gott soll mich bewahren!“ rief Elise erschreckt schon bei dem Gedanken aus – „mein kleines Engelchen ist allerdings geimpft, aber das kann jetzt noch nicht wirken, und wenn das wirklich bei dem armen Kind die Blattern sind, woran ich keinen Augenblick mehr zweifle, könnte ich uns ja Alle unglücklich machen. Geben Sie das Kind nur ab, wenn die Mutter nicht gleich wieder kommt. Ich muß machen, daß ich mit meinem Engelchen nach Hause komme, damit es sich nicht erkältet – komm, Rieke – adieu, lieber Doctor!“
Die junge Frau hatte nun einmal in unbesiegbarer Furcht vor der Seuche den Verdacht gegen das arme Wesen gefaßt, daß es schon von der Krankheit berührt sei, und in ihrer Angst, das eigene Kind davon angesteckt zu sehen, eilte sie, so rasch sie ihre Füße trugen, fort, um aus dessen unmittelbarer Nähe zu kommen – an Doctor Forbach dachte sie dabei gar nicht.
Dieser blieb indeß in ziemlicher Verlegenheit zurück, denn die Mutter kam nicht wieder, und was nun, wenn sie – ein plötzlicher jäher Schreck zuckte ihm durch die Glieder – wenn sie gar nicht wieder kam und mit tückischer Vorberechnung ihn dazu ausersehen hatte, sich des Kindes anzunehmen. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen, und jetzt erst fiel ihm ihr verstörtes Aussehen, und wie sie das Kind wiederholt geküßt – schwer auf’s Herz. – Er sah nach der Uhr – es fehlten nur noch wenige Minuten an Zwölf. Wenn er sich nun – ein verzweifelter Entschluß reifte in ihm. Seine bis /64/ herige Umgebung hatte schon lange wieder gewechselt – wenn er das Kleine nun ganz ruhig in die Ecke der einen Bank legte? Dort mußte sich zuletzt Jemand des Kindes annehmen, und er kam mit guter Manier hier aus einer sehr fatal werdenden Lage – die Hauptsache, noch zur rechten Zeit zu Röhrichs.
„Nein, aber bester Doctor!“ rief da plötzlich eine Stimme, die, wie Forbach zu seinem Schrecken bemerkte, niemand Anderem, als dem ältlichen Fräulein Simprecht zugehörte – „das sieht ja himmlisch aus – Sie mit einem Kind auf dem Arme. Woher haben Sie denn das kleine allerliebste Wesen? – Aber um Gottes willen, Sie verstehen es ja gar nicht zu halten!“
Ein teuflischer Gedanke zuckte durch des sonst so gutmüthigen Doctors Forbach Hirn. Er fürchtete allerdings Fräulein Simprecht, das in der ganzen Stadt als ein böser Drache galt, jetzt aber konnte sie ihm, wenn es geschickt angefangen wurde, ein rettender Engel werden, und wie ein Ertrinkender nach dem üblichen Strohhalm, griff er danach.
Einmal die Angst, daß die Mutter ihm das Kind gelassen haben könne und jetzt vielleicht schon auf der Eisenbahn das Weite suche, dann die Furcht, daß der ihm gespielte Streich stadtkundig würde, wonach bei Röhrich der Neckerei natürlich kein Ende gewesen wäre, ebenfalls die späte Stunde – gerade hob die Domglocke aus, um die zwölfte Stunde zu schlagen – trieben ihn zum Aeußersten.
„Ja, mein bestes Fräulein, sagte er, indem er die Dame mit einem recht kläglichen Blick ansah – „ich – weiß allerdings nicht, wie man das macht, – das Köpfchen rutscht immer so herunter, und dann der kleine Wurm.“
„Aber wo ist denn nur die Mutter? Sie müssen es ein wenig hin und her wiegen, und dann bisch, bisch, bisch machen.“
„Die Mutter kommt den Augenblick zurück, das Kind soll eben geimpft werden – wenn Sie es nur einen Moment nehmen wollten!“
„Ich habe nicht lange Zeit,“ sagte Fräulein Simprecht, „ich wollte mich mit einer Freundin hier treffen, die aber entsetzlich lange ausbleibt.“
/65/ „Ach nur einen Augenblick, damit ich auch sehe, wie es gemacht wird!“
„Recht verstehen thue ich es auch nicht,“ sagte Fräulein Simprecht verschämt, indem sie das Kind aber nahm, „besser als Sie kann ich es freilich – sehen Sie, so müssen Sie es nehmen – hier das Köpfchen in den linken Arm, daß es etwas höher zu liegen kommt, und dann so ein wenig hin und her schaukeln. Es wird jetzt schon ruhiger.“
Das Kleine hatte allerdings mit Schreien aufgehört. Es sah ja ein fremdes Gesicht über sich gebeugt, von welchem außerdem zwei lange Schmachtlocken niederhingen und sich bei dem Schaukeln ebenfalls bewegten und hin und her schwangen.
„Sie verstehen das wirklich meisterhaft,“ rief Forbach entzückt aus, „aber die Mutter muß draußen sein – wenn Sie das kleine liebe Wesen nur einen Moment halten wollten – ich hole sie augenblicklich herein!“
„Aber nicht lange,“ rief das Fräulein ihm nach. Doch er hörte schon gar nicht mehr, was sie sagte, griff seinen neben ihm auf der Bank stehenden Hut auf und schoß wie ein Wetter aus der Thür. Draußen – und er athmete tief auf, als er die frische Luft um sich fühlte – warf er allerdings den Blick umher nach der jungen Frau, die ihm das Kind überlassen, da er sie aber nirgends entdecken konnte, hielt er sich auch keinen Moment länger auf und eilte, so rasch er konnte, zu Röhrichs hinüber, um dort mit einem Glas Coburger Exportbier den gehabten Schrecken hinunter zu spülen. Erst in der Nähe des bekannten Hauses, ging er langsamer, und leise vor sich hin sagte er zu sich selber:
„Julius, Julius, ich glaube fast, du hast dich diesmal mit außerordentlicher Geschicklichkeit aus einer höchst mißlich werdenden Lage herausgeschält – aber Fräulein Simprecht, wird die eine Wuth auf mich bekommen – aber was schadet’s – gut ist sie doch keinem Menschen, und mir trägt sie es außerdem immer noch nach, daß ich sie nicht schon vor zwanzig Jahren geheirathet habe. Na, die wird ein Gift haben, wenn die Mutter nicht wieder kommt! Das soll mir aber eine Warnung sein“ – und wie ein Wiesel glitt er in das Haus und in das Restaurationszimmer hinein, wo er indeß kein /66/ Wort von dem eben bestandenen Abenteuer erzählte. Er war froh, wenn hier kein Mensch etwas davon erfuhr.
_____________
Fräulein Aurelie Simprecht hatte dem davoneilenden Doctor Forbach allerdings etwas erstaunt nachgesehen, dachte aber nicht im Entferntesten daran, was sie übernommen und jetzt durchzuführen gezwungen war. Im ersten Moment fühlte sie sich auch gewissermaßen stolz mit dem kleinen allerliebsten Kinde, und hatte gar nichts dagegen, daß neu eintretende Frauen sich um sie sammelten und das Kleine bewunderten. Es war für sie etwas Neues, und sie gab sich dem in der ersten Zeit mit Vergnügen hin – aber die Mutter des Kindes kam nicht, und Doctor Forbach kehrte ebenfalls nicht zurück. Außerdem ließ sie ihre Freundin, auf die sie hier gewartet, im Stiche, und Fräulein Simprecht, die einen nichts weniger als fügsamen und geduldigen Charakter besaß, fing an, mit jeder Minute mehr auf ihrer Bank umher zu rutschen und verlangende Blicke nach der Thür zu werfen. Das kleine Kind hatte ihr im Anfang allerdings Spaß gemacht und sich auch ruhig verhalten, weil es vielleicht durch die fremdartige Erscheinung ihrer neuen Wärterin überrascht und dadurch beschäftigt wurde, jetzt aber nahm das ein Ende. Es war vielleicht durstig geworden und verlangte nach der Mutter, oder lag – wie die Dame mit Entsetzen fürchtete, gar – naß, kurz es wurde unruhig und begann wenige Minuten später einen nicht mißzuverstehenden Hülfsschrei, der durch den ganzen Saal schallte und sich durch das beschwichtigende bisch, bisch der neuen Wärterin nicht mehr eindämmen ließ. Es schrie, was eben aus der Kehle heraus wollte, und Fräulein Simprecht erschrak zuerst und wurde dann indignirt.
Es war vollkommen rücksichtslos von Doctor Forbach, daß er sie hier auf diese Weise incommodirte. Sie hatte ihm aus Gefälligkeit das Kind für einen Moment abgenommen, und er ließ sie jetzt so lange warten. Dazu war sie nicht verpflichtet – wenn ihr jetzt das kleine Wesen ihr neues Kleid verdarb, so zahlte ihr der Doctor wahrhaftig kein anderes – und wo /67/ außerdem die Mutter blieb! Eine Frau, die ihr Kind wollte impfen lassen, mußte auch dabei bleiben und durfte nicht davonlaufen – es war, das Wenigste zu sagen, rücksichtslos. Und was hatte sie außerdem mit dem Balg zu thun?
Fräulein Simprecht arbeitete sich nach und nach in eine Gift- und Dolchstimmung hinein, wozu sich ihre etwas herbe Natur überhaupt neigte. Das Kind schrie jetzt mit einer merkwürdig starken Stimme, aus voller Kehle, kein Mensch bekümmerte sich dabei um sie, und nur den neugekommenen und umhersitzenden Frauen war sie aufgefallen, und sie unterhielten sich zusammen. Diesen Zustand ertrug sie natürlich nicht lange, und sich an die ihr nächste Frau wendend, sagte sie:
„Oh, möchten Sie wohl die Kleine einen Augenblick nehmen? Die Mutter ist hinausgegangen und muß gleich zurückkommen. Ich habe aber keine Zeit, hier länger zu warten!“
Die Frau war eine Hökerin aus der Stadt, mit einem ziemlich resoluten Gesicht und gar keiner Taille, auch eben erst hereingekommen, und sah die Sprechende voll und erstaunt an.
„Ich soll Ihr Kind halten?“ sagte sie endlich, „ich hab’ ja selber eins.“
„Aber es ist mein Kind nicht, liebe Frau,“ bemerkte Fräulein Simprecht, und hatte es dabei durch das „liebe Frau“ gründlich verdorben.
„Und was geht das mich an,“ sagte die Dame, „ob das Ihr Kind ist oder nicht? Geben Sie es der, der es gehört – mein’s ist es auch nicht!“
Das Fräulein biß sich auf die Lippen. Sie wußte aus Erfahrung, daß sie sich, so scharf ihre eigene Zunge sein mochte, mit derartigen Leuten doch nicht in einen Wortkampf einlassen durfte, denn sie hatte da schon verschiedene Male den Kürzern gezogen. Sie nahm deshalb auch das Kleine und trug es nach einer andern Seite hinüber, um sich dort seiner zu entledigen – aber vergeblich. Im Nu hatte es sich unter den neu Angetroffenen Frauen dieser Klasse im Saal ausgesprochen, daß die „vornehm aufgeputzte Dame“ das Kind „abgeben wolle“, und um nicht länger damit belästigt zu werden, wandte sie sich endlich an den Diener, der die Nummern abrief, und sagte zu diesem:
/68/ „Lieber Freund, eine Frau hat dies Kind hier gelassen und wird gleich wieder zurückkommen. Möchten Sie wohl so gut sein, es so lange in Obhut zu nehmen?“
„Iche?“ sagte der Mann und sah sie mit einem halbpfiffigen Lächeln an, „ne, ich habe schon sieben Würmer zu Hause und möchte das achte nicht dazubringen!“
„Aber die Mutter kommt gleich wieder, um es abzuholen!“
Der Mann ging auf keine weiteren Auseinandersetzungen ein. „Herr du meine Güte,“ sagte er ruhig, „schreit der Balg – der hat vielleicht eine Stecknadel verschluckt. Sehen Sie ihm nur einmal in den Hals!“ – und damit drehte er sich ab und ging wieder seinen Geschäften nach.
Fräulein Simprecht biß ihre Lippen fest aufeinander, aber sie war nicht gesonnen, sich auf solche Art mißhandeln zu lassen. Wer konnte sie zwingen, das jetzt Zeter schreiende Kind, das sie gar nichts anging, auf dem Arm herum zu tragen! Sie hatte allerdings versprochen, es auf einen Moment zu hüten – und das nicht einmal, denn Doctor Forbach war ihr auf heimtückische Art durchgegangen, aber damit war ihre Verpflichtung auch zu Ende. Sie hatte mehr zu thun, als hier fremde Kinder zu warten, und ohne sich um weiter Jemanden zu bekümmern, schritt sie durch den Saal, um einen passenden Platz auszusuchen, und legte dann das kleine schreiende Kind, so gut es eben gehen wollte, in eine Ecke nieder.
Wenn sie aber dabei glaubte, daß das unbemerkt geschah, so irrte sie sich. Möglich auch, daß sie sich gar nicht darum kümmerte, denn was ging sie das Kind an, aber die anderen Frauen waren da entschieden anderer Ansicht, und während sie ihr aufmerksam mit den Blicken folgten, sahen sie kaum, daß sie das Kind auf die Erde legte und dann der Thür zueilte, als ein paar von ihnen mit einem ordentlichen Wuthschrei emporsprangen und ihr nacheilten.
„Halt’t sie!“ schrieen sie dabei – „halt’t sie! die will hier ein Kind im Stich lassen – halt’t sie! halt!“
Fräulein Simprecht, die den Ruf hören mußte, warf einen Zornblick hinter sich, ließ sich aber dadurch nicht aufhalten und wollte eben zur Thür hinausfahren, als der dort stationirte /69/ Polizeidiener, der auch schon den Halteruf gehört hatte, ihr entgegentrat und frug, was es da gebe.
„Das Frauenzimmer,“ rief die Eine der sie Verfolgenden, „hat da eben im Saal ihr Kind in die Ecke gelegt und will sich jetzt aus dem Staube machen. Lassen Sie sie nicht fort – der arme Wurm geht ja da zu Grunde, und schreit schon jetzt, als ob er am Spieße stäke!“
„Was?“ sagte der Polizeidiener in moralischer Entrüstung – „ihr Kind?“
„Die Person ist verrückt!“ rief aber Fräulein Simprecht zornig aus. – „Es ist das Kind einer fremden Frau, die es hier gelassen hat und zu lange wegbleibt – was geht das mich an!“
„Sie hat es die ganze Zeit auf dem Arm herumgetragen,“ rief die Hökerin, „und mich wollte sie auch schon dran kriegen, daß ich es halten sollte, aber die Art kennen wir. Auskneifen, nicht wahr – pfui, in Ihre Seele hinein sollten Sie sich ‘was schämen!“
„Vor Ihnen aber noch lange nicht,“ rief das eben auch nicht sanfte Fräulein Simprecht in aufkochendem Zorn. „Das Kind kenn’ ich nicht und es geht mich nichts an. Lassen Sie den Weg frei, Herr Polizeidiener, oder ich gehe den Augenblick zum Herrn Polizeidirector!“
„Da bring’ ich Sie selber hin,“ lachte der Mann vergnügt, „deshalb machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt seien Sie nur so gut und nehmen Sie das arme kleine Ding wieder auf, denn es schreit sich ja sonst den Hals ab.“
„Und was kümmert das mich?“ rief Fräulein Simprecht erbost. „Ich habe es aus Gefälligkeit Herrn Doctor Forbach abgenommen, der behauptete, es von einer Frau bekommen zu haben.“
„Aha – von Doctor Forbach!“ rief die Hökerin – „und wie klug, legt es hier in den Saal, weil sie hofft, daß sich schon Jemand des unglücklichen Wesens annehmen wird. So eine Rabenmutter!“
Dem Fräulein wurde es zu bunt, und mit Gewalt wollte sie sich in’s Freie drängen, aber da fühlte sich der Polizeidiener in seiner Würde gekränkt.
/70/ „Na,“ sagte er, indem er ihr voll in den Weg trat – „damit ist’s nun einmal nichts – so kommen Sie nicht fort, und wenn Sie ein gutes Gewissen hätten, so scheuten Sie sich nicht, mit auf die Polizei zu gehen. Wenn Sie das Kind mit hergebracht haben, so müssen Sie’s auch wieder mit fortnehmen. – Hier ist kein Findelhaus!“
„Oho, ich habe es ja gar nicht mit hergebracht!“ schrie die Dame, der schon vor Zorn die Thränen in die Augen traten.
„Und was wollten Sie sonst hier?“
„Eine Freundin treffen.“
„Ja, das kann Jeder sagen,“ lachte der Mann des Gesetzes – „ne, mein liebes Madamchen, das hilft Ihnen Alles nichts – nehmen Sie nur das Kleine und kommen Sie mit auf die Polizei!“
„Aber Sie müssen mich ja doch kennen!“ rief da Fräulein Simprecht in voller Verzweiflung aus, denn jetzt überkam sie zum ersten Mal die Angst, daß sie am Ende gar mit dem Kind über die Straße transportirt werden sollte – oh, dieser unselige Doctor Forbach – „mein Name ist Simprecht, Aurelie Simprecht, mein Vater ist der Commerzienrath Simprecht an der hohen Brücke, mein Bruder ist Kanzleirath Simprecht –“
„Und Ihr Schwager der König, nicht wahr? weiter fehlte jetzt gar nichts mehr,“ rief der Polizeidiener entrüstet aus, indem er sich von der vermeintlichen Delinquentin abdrehte – „wo ist das Kind! na? es hat doch eben noch da gelegen – wo ist es denn jetzt hin?“
„Was denn für ein Kind?“ sagte eine Frau, die eben erst auch mit einem Säugling auf dem Arm eingetreten war und noch gar nicht wußte, was der Lärm bedeutete.
„Das Kind, was da auf der Erde lag.“
„In so weißen, hübschen Windeln?“
„Ja, ganz recht – haben Sie etwas davon gesehen?“
„Ja, was soll denn aber mit dem Kinde sein?“ sagte die junge Frau verwundert – „seine Mutter hat es mit fortgenommen – die Frau Paulmann – ihr Mann ist Photograph. /71/ Es wurde ihr vorhin schlecht hier oben, so schwindlig, und sie ließ das Kind hier, weil sie fürchtete, daß es ihr am Ende aus den Händen glitte. Nebenan bei uns wurde sie auch richtig ohnmächtig und konnte uns nicht einmal gleich sagen, wo das arme kleine Ding war. Jetzt hat sie’s wieder und ist damit nach Hause gegangen, weil sie sich heute zu schwach fühlte, um hier länger zu warten.“
„Hm,“ sagte der Polizeidiener, doch etwas verblüfft – „das ist ja merkwürdig – kennen Sie die Madame hier?“
„Fräulein Simprecht? – gewiß, die Tochter des Herrn Commerzienraths Simprecht –“
„Und die augenblicklich zum Polizeidirector fahren wird, um Ihr tölpelhaftes Benehmen anzuzeigen,“ rief aber die betreffende Dame empört und rauschte mit ordentlich Funken sprühenden Blicken zur Thür hinaus.
4.
Der Polizeidiener machte, als sie den Saal verlassen hatte, allerdings ein etwas sehr verdutztes Gesicht, denn er wußte jetzt gut genug, welche Nase ihm von oben bevorstand. Daß er in seinem vollen Rechte gewesen, kam dabei natürlich nicht in Betracht, aber Fräulein Simprecht dachte vor der Hand noch gar nicht daran, Genugthuung für die von dem Polizeibeamten erlittene Behandlung zu fordern, denn ihr ganzer Haß und Ingrimm wandte sich in diesem Augenblick gegen den eigentlichen Urheber jener Scene, den Doctor Julius Forbach, und würde sich noch mehr gesteigert haben, wenn sie ihn in diesem Augenblick gesehen hätte, wie er in aller Gemüthlichkeit bei Röhrichs in der Gaststube und vor einem Glas prachtvollen Bieres saß, das er gerade gegen das Licht hielt und sich an seinem Glanz erfreute.
Neue Gäste traten ein. – „Habt Ihr’s schon gehört?“ rief der Eine von ihnen, indem er seinen Hut über einen /72/ Nagel und sich selbst auf einen leeren Stuhl neben Forbach warf – „eben eine famose Geschichte in der alten Waage passirt, wo die Kinder heute geimpft werden –“
„So? – was denn?“ rief es von allen Seiten, und Forbach sah sich überrascht nach seinem neuen Nachbar um.
„Oh,“ lachte dieser, „nichts weiter, als daß eine Frau bei dieser günstigen Gelegenheit ihr Kind los zu werden hoffte, es ruhig in eine Ecke auf die Erde legte und sich dann eben aus dem Staube machte, als sie noch glücklich von der Polizei erwischt wurde.“
„Alle Wetter!“ rief ein Anderer, „so eine Rabenmutter!“
„Sie leugnete auch ganz frech, daß es das ihre sei,“ fuhr der Erzähler fort, „aber es half ihr nichts, und sie wird wohl ein paar Monate Arbeitshaus bekommen.“
Noch ein neuer Gast trat ein, der das Letzte gehört hatte.
„Und wissen Sie denn, wer die vermeintliche Mutter war?“ rief dieser, während er sich ebenfalls einen Stuhl herbeiholte.
„Nein,“ sagte der Erzähler, „ich hörte es nur eben unten auf der Straße, als ich hierher ging.“
„Fräulein Aurelie Simprecht.“
Ein rasendes Gelächter brach in der ganzen Stube aus, denn jene Dame war eine zu bekannte Persönlichkeit in der Stadt, und das Absurde traf deshalb in’s Centrum. Nur Forbach lachte nicht mit, denn er bekam für sich einen Privatschreck. Jedenfalls war die Dame in eine höchst unangenehme Verwickelung, und nur durch seine Schuld gerathen, und welch’ böse Zunge sie hatte, wußte jedes Kind in Buntzlach – und er selber aus Erfahrung. Aber an der Sache war vor der Hand nichts zu thun, und er selber nur froh, daß er hier nicht mit genannt worden. Das Bier schmeckte ihm aber doch nicht mehr und – er fühlte sich auch, nach den eben gemachten Erfahrungen, nicht mehr so ganz sicher. Er stand deshalb in dem allgemeinen Lärm und Lachen auf – sonderbarer Weise fühlte er gar kein Bedürfniß, jetzt die näheren Einzelnheiten zu hören – zahlte sein Bier, griff seinen Hut auf und wollte das Local eben verlassen, als ein anderer gerade eintreffender Stammgast ihn laut anrief:
/73/ „Hallo, Forbach – wollen Sie wieder auf die alte Waage und Kinder tragen? Famose Beschäftigung für einen alten Junggesellen – machen Sie nur, daß Sie hinkommen – heilloser Lärm dort – die Leute sagen, daß Sie ausgekniffen wären und Ihr Kind im Stich gelassen hätten!“
„Unsinn!“ rief aber der Doctor gereizt – „ganz Buntzlach scheint verrückt geworden zu sein,“ und ohne sich weiter aufhalten zu lassen, stürmte er aus der Thür.
_____________
An dem Tage liefen die nur denkbar tollsten Gerüchte durch Buntzlach, und Doctor Forbach’s und Fräulein Simprecht’s Namen wurden dabei besonders in den außergewöhnlichsten Combinationen genannt, ja ein boshafter Buntzlacher schickte – natürlich anonym, aber mit den beigefügten Insertionsgebühren, eine Verlobungsanzeige der beiden Persönlichkeiten ein, die um ein Haar durch den Factor aufgenommen worden wäre. Glücklicher Weise entdeckte die Redaction noch zu rechter Zeit den Namensmißbrauch und beugte dadurch einem heillosen Skandal vor.
Und woher rührten alle diese traurigen und in nichts begründeten Mißverständnisse? Einzig und allein von Doctor Julius Forbach’s Angewohnheit, seine Zeit pünktlich am Stammtisch bei Röhrichs einzuhalten und dort sein Glas Bier vor Tisch zu trinken. Er hatte eben um die Zeit keine Zeit, und Fräulein Simprecht war in ihrer Engelsnatur die Unschuldige gewesen, die dafür büßen mußte.
Ein paar Tage sah sie auch der Doctor nicht und – war vielleicht selber daran schuld, denn er hielt sich ängstlich von allen jenen Orten fern, an welchen er ihr möglicher Weise hätte begegnen können. Am vierten Tage traf er sie zufällig auf der Straße, und zwar auf eine Weise, daß er nicht mehr im Stande war, ihr auszuweichen.
Hochachtungsvoll grüßte er auch, und zog den Hut viel tiefer vor ihr ab, als es sonst seine Gewohnheit war – aber es half ihm nichts.
/74/ „Scheusal!“ murmelte die Dame wohl halblaut nur, aber doch verständlich genug vor sich hin, warf den Kopf, ohne den Gruß zu erwidern, hoch und weit zurück, und rauschte dann stolz, wie ein mächtiges Kriegsschiff an einem kleinen erbärmlichen Kauffahrtei-Schuner, vorüber. – Doctor Julius Forbach war aus der Liste der Existirenden gestrichen.
Die Schwestern.