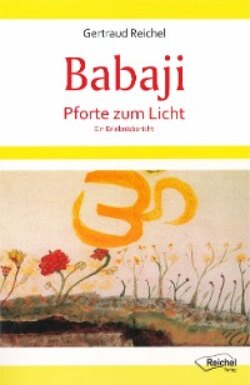Читать книгу Babaji - Pforte zum Licht - Gertraud Reichel - Страница 6
Kapitel 1
Kalkutta
Оглавление"Bist du glücklich?", fragte Babaji.
Ich saß im Flugzeug, an dem Fensterplatz, den Babaji mir zugewiesen hatte, eine Reihe hinter ihm. Sprachlos von dem, was sich in den letzten Stunden ereignet hatte, konnte ich nur nicken.
"Bist du glücklich?", wiederholte er. Seine schwarzen Augen schauten mich lächelnd an, während die Welt um mich versank. Wie im Traum nahm ich wahr, dass Babaji meine linke Hand ergriff, sie zwischen dem Sitz am Fenster und der Flugzeugwand durchzog und auf seine Schulter legte. Sanft streichelte ich seinen Oberarm. Die Zeit verstrich. Es war still in mir und um mich herum.
Dann, einem Impulse folgend, formten sich auf meinen Lippen die Worte: "Baba, bitte lass mich innerlich deine Stimme vernehmen!"
Kaum war diese Bitte ausgesprochen, als sich Babaji mir mit einem klaren und deutlichen: "Ja" zuwandte. Er nahm seinen Turban vom Kopf und reichte ihn mir. Ich sollte ihn während des Fluges auf dem Schoß halten. Draußen flogen die Wolken vorbei.
Babaji befand sich in Begleitung von fünf Indern, zwei hatten ihre Ehefrauen dabei, einem Amerikaner und mir auf dem Weg nach Kalkutta. Ein Geschäftsmann hatte Babaji zu einem zwölftägigen Yagna, einer Feuerzeremonie, und einer Pilgerfahrt nach Puri eingeladen. Alle, die ihn begleiteten, waren willkommen.
Hinter Babaji sitzend, dachte ich noch einmal an den vergangenen Tag.
Gestern war ich in Delhi eingetroffen. Die Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt oder eine Woche später nach Indien zu fliegen, war mir nicht leicht gefallen. Konnte ich es verantworten, einem jungen Mann, der vorübergehend bei uns wohnte, den Haushalt anzuvertrauen, meine zwei schulpflichtigen Kinder im Alter von fünf und acht Jahren und letztlich meinen berufstätigen Mann? Anderseits gab ich die Verantwortung gern ab, die Aussicht, einige Tage länger bei Babaji zu bleiben, war verlockend. Zudem würde meine Familie einschließlich des jungen Mannes vierzehn Tage später folgen.
Kurz nach meiner Ankunft in der Millionenstadt hatten mich Freunde im Hotel angerufen und mir mitgeteilt, dass Babaji in Dehli sei und morgen nach Kalkutta fliegen wolle. Sie erwähnten gleichzeitig die Aussichtslosigkeit auf einen Platz im Flugzeug, die Asiatischen Festspiele, ähnlich den Olympischen Spielen, gingen morgen zu Ende und Tausende von Menschen würden auf allen verfügbaren Verkehrsmitteln zurück in ihre Heimatstädte strömen.
Wenig später holten mich meine Bekannten auf ihrer Fahrt zu Babaji ab. Es war acht Uhr in der Früh. Delhi wimmelte vor Geschäftigkeit und der Weg nach Janakpuri, dem Stadtviertel, in dem Babaji vorübergehend wohnte, schien kein Ende zu nehmen. Endlich erreichten wir das Festzelt, das für ihn und alle Besucher errichtet worden war. Als ich vor dem mit bunten Blumengirlanden geschmückten Einlass meine Schuhe abstreifte, schlug mir ein betäubender Blütenduft entgegen. Ich reihte mich in die Schlange der Wartenden ein, um Babaji zu begrüßen.
Er saß etwas erhöht und überblickte die anwesende Menge. Sein Gewand war weiß, die schwarzen lockigen Haare umrahmten sein rundes Gesicht, das unendliche Güte und Liebe ausstrahlte. Mit pochendem Herzen und weichen Knien näherte ich mich ihm. Als ich schließlich meinen Kopf in seinen Schoß legte, fiel alles äußere von mir ab, ein mächtiger Sog erfasste mich. Einem gewaltigen Strome gleich floss er von den Füßen, die Wirbelsäule hinauf, und strömte durch meinen Scheitel in Babajis Hände hinein, die er mir segnend auf den Kopf gelegt hatte. Befreit von Gedanken, Gefühlen, gegenstandslos, stand ich Angesicht zu Angesicht mit der Unendlichkeit, ... entrückt. Wie lange ich so verharrte, weiß ich nicht, jegliches Zeitgefühl war mir verloren gegangen. Ein pochender Finger auf meinem Rücken hatte mich in die Wirklichkeit zurückgebracht. Der nächste in der Schlange hinter mir wollte Babaji seine Ehrerbietung erweisen.
"Wo ist dein Sohn?"
"In Deutschland".
"Warum ist er nicht mitgekommen?"
"Er muss zur Schule und kommt Mitte Dezember."
Babaji erkundigte sich, welche Klasse er jetzt besuche und wie es meinem Mann gehe. Dabei überreichte er mir eine Handvoll Früchte.
Welche Harmonie im Festzelt! Die Frauen hatten auf der linken Seite Platz genommen, die Männer auf der rechten. Alle Gedanken, alle Augen waren auf Babaji gerichtet. Die Klänge der indischen Instrumente, des Harmoniums, der Trommeln, Zimbeln, Chimtas vermischten sich mit dem Gesang der Menschenmenge. Babajis Sitz glich einem gelben Blumenmeer. Nach indischer Sitte überreichten ihm viele, die seinen Segen erbaten, Girlanden, geflochten aus Tagetes- oder Rosenblüten. Einige Besucher legten sie ihm um den Hals, andere auf die Hände. Manchen bekränzte Babaji mit den Blumen, anderen reichte er Süßigkeiten oder Früchte. Ab und zu spielte er mit einem Kind, holte es zu sich herauf und herzte es oder warf Früchte in die Menge.
Babaji war aufgestanden. Eine Feuerzeremonie, Havan oder Yagna genannt, sollte zu Ehren Gottes im Garten des Gastgebers stattfinden. Diese uralte Sitte des Austausches, des Gebens und Nehmens, ist auf vorvedische Zeiten zurückzuführen, in eine Zeit, in der alle Menschen zu dem Göttlichen noch engen Kontakt hatten. Gottes Gnade lässt das Korn auf den Feldern wachsen. Wir sollten ihm dafür danken und ihm einen Teil unserer Ernte durch das Opferfeuer zurückgeben. Der geschlossene Kreislauf des Gebens und Nehmens gewährt ständiges Wachstum und Gedeihen.
Die Flammen loderten hell auf, als Babaji an der Feuergrube Platz nahm. Mir bedeutete er mit einer Handbewegung, hinter ihn zu treten. Eine andächtige Stille herrschte, die Lautsprecher im Festzelt waren verstummt. Nur das Prasseln des trockenen Holzes in der Feuersglut war zu hören, unterbrochen von dem Ruf "swaha" aller Teilnehmenden. Bei jedem "swaha" warfen sie ein Gemisch von Reis, Weihrauch, schwarzem Sesam, Blumen und Nüssen in die Glut, während Babaji das Feuer mit Gaben von flüssigem Butterfett speiste. Gedankenverloren schaute ich in die Glut und horchte in mich hinein. In mir war tiefer Frieden. Ich war glücklich, da zu sein.
Nach dem Havan sagte Babaji: "Komm", ergriff kurz die Hand einer älteren Inderin und meine und führte uns zu einem Auto, das uns zu einigen verschiedenen Familien brachte, denen Babaji einen Besuch zugesagt hatte. Die Gastgeber empfingen ihn ehrerbietig. Abseits vom Menschengedränge konnten sie ihm unter vier Augen ihre Anliegen mitteilen. Eine Hochzeit sollte arrangiert werden, ein Kranker genesen. So oft sie konnten, holten viele seinen Rat für geistige und weltliche Angelegenheiten ein. Babaji hörte aufmerksam zu, nie schien er zu ermüden, unendlich war seine Geduld, seine Güte.
Wir durchquerten Delhi.
"Hast du einen Flugschein und eine Platzreservierung für Kalkutta?", fragte er, indem er sich im Auto auf der Fahrt zu mir umdrehte.
"Nein". Ich hatte nicht gewusst, dass Babaji nach Kalkutta fliegen wollte.
"Ja, dann ist nichts zu machen, du musst hierbleiben", übersetzte die Inderin.
"Oh, nein, nimm mich bitte mit!"
"Warum denn?", fragte er lächelnd.
Er wusste also, dass ich ihn gerne begleiten würde. Sollte es sein Wunsch sein, so würde er in Erfüllung gehen, gleich wie die äußeren Umstände aussahen. Im Vertrauen auf Babajis Allmacht verschwendete ich keine Zeit mit einer Platzreservierung oder einem Billetkauf.
Im Hause des Gastgebers angekommen, nahm Babaji nach dem Empfang auf einem prächtig hergerichteten Sessel Platz. Da aber der Farbfernseher in einer Ecke des Zimmers lief, ließen sich bald alle Anwesenden von den Sportfestspielen fesseln. Babaji existierte für sie nur noch im Hintergrund. Wie symbolisch war das für die meisten Menschen unserer Zeit! Das Göttliche wird am Rande wahrgenommen, wenn überhaupt. Ich saß auf dem Boden neben ihm, meine Hand ruhte auf seinem Fuß. Babaji schien mir alles Gegenwärtige einzuhüllen; trotz des Lärms aus dem Fernseher spürte ich einen inneren Frieden, eine Harmonie sondergleichen. Ab und zu trafen sich unsere Blicke; und ich wunderte mich, dass die Anwesenden sich so leicht von der Illusion des Lebens - hier die im Vergleich zum Weltenlauf unbedeutenden Sportfestspiele - ablenken ließen.
Am nächsten Morgen, früh um sieben Uhr stand ich mit meiner eilig zusammengepackten Reisetasche am Flughafen. Als ich mein Ticket kaufte und einen Platz auf dem Flugzeug haben wollte, sagte mir der Flughafenangestellte, es sei aussichtslos, 280 Passiere stünden auf der Warteliste. Ähnlich sei es auf den nächsten Flügen. Ich könnte frühestens in zwei bis drei Tagen fliegen. Diese Auskunft erschütterte mich nicht. Gleichmütig nahm ich sie hin, ich hatte etwas Ähnliches erwartet. Babaji würde mich schon mitnehmen. Das erschien mir ganz selbstverständlich.
Unterdessen war Babaji am Flughafen angekommen. Eine große Menschenmenge begleitete ihn, als er, wie ein einfacher Tourist, in der Wartehalle Platz nahm. Mehr und mehr Menschen strömten herbei. Irgendwie gelang es mir, durch das Gedränge in seine Nähe zu kommen. Mein Flugbillet hielt ich in der Hand. Kaum hatte Babaji mich erblickt, als er schon einen der anwesenden prominenten Inder anwies, mir einen Platz in dem Flugzeug zu besorgen. Nach einer Weile kam dieser unverrichteter Dinge wieder. Dieses Hin und Her wiederholte sich zweimal, erschütterte mein Vertrauen aber nicht.
Schließlich wurde der Flug aufgerufen. Babaji erhob sich, um in die Abflughalle zu gehen. Er nahm mein Ticket jetzt selbst in die Hand, lächelte dabei und übergab es einem vierten Inder. Mir bedeutete er, diesem zu folgen. Mit meinem Fluggepäck gingen wir auf den Schalter der Indian Airlines zu. Er war bereits geschlossen. Hinter dem Schalter herrschte großes Durcheinander, ein Gestikulieren und Geschrei. Mein Begleiter mischte sich kurzerhand darunter und ergatterte, ich weiß nicht wie, nicht nur eine Boardingkarte, sondern gleich fünf!
Babaji wartete mit Sri Muniraji, seinem engsten Schüler, und Shastriji, dem alten ehrwürdigen Sanskritgelehrten und Priester in der Abflughalle. Wie ein Fürst aus Tausendundeiner Nacht sah er aus mit seinem gelben Seidengewand, über dem er eine ärmellose, in allen Farben schillernde, Brokatweste trug. Ein roter Turban schmückte sein Haupt. Frei von jeglicher Beschränkung, unbekümmert wie ein Kind, zog er alles an, was ihm aus tiefstem Herzen geschenkt wurde. Und wirklich, ein Herrscher stand vor mir! Eine gewaltige Kraft ging von ihm aus. Groß, majestätisch, allgewaltig war er der Mittelpunkt der Welt. Einige Reisende in der Abflughalle, die seine Ausstrahlung wahrnahmen, fragten, wer er sei.
"Ein Mahavatar", war die Antwort.
Viele kamen und beugten die Knie vor ihm oder berührten seine Füße nach indischer Sitte. Segnend hob Babaji jedes Mal die Hand.
Mir gab er die Anweisung, am Zeitungsstand "Toffees", Karamellbonbons, zum Verteilen zu kaufen, um etwas von dem, was ich erhalten hatte, - die Ermöglichung des Fluges - zurückzugeben. Das göttliche Gesetz des Ausgleichs wurde auf diese Weise befolgt. Wie es kein Einatmen ohne Ausatmen gibt, so auch kein Nehmen ohne Geben.
Nun saß ich hinter Babaji im Flugzeug. Eigenartig, dass die Plätze, die wir in letzter Sekunde erhalten hatten, alle um Babaji's Sitz herum gruppiert waren. Nur der mitfliegende Amerikaner musste seinen Platz mit einem Mitreisenden tauschen.
Bald war Kalkutta erreicht. Der Flug näherte sich seinem Ende. Nach der Landung würde Babaji keine Zeit für meine Fragen haben. Deshalb musste ich jetzt die Gelegenheit beim Schopf greifen. Eine Freundin hatte mir aufgetragen, ihm einen Brief zu überreichen und zu fragen, ob sie auf dem richtigen spirituellen Weg sei. Aus Erfahrung wusste ich, dass ich solche kleinen Freundschaftsdienste und auch meine wenigen persönlichen Fragen immer nur sofort nach Ankunft bei Babaji ausrichten und stellen konnte, später würden sie mir nebensächlich und unwichtig erscheinen; ich würde erst gar nicht mit diesen Ansinnen an ihn herantreten. Welchen Zweck hatte es, die Aufmerksamkeit dem Veränderlichen anstatt dem Beständigen zuzuwenden?
Meine Bekannte war "Gouverneurin" bei Maharishis Transzendentaler Meditation gewesen, kam zu Babaji und fühlte sich zwischen ihm und dem Christentum hin- und hergerissen. Sie folgte nun dem Weg ihres Herzens, wie Babaji ihr riet, und hatte aus diesen drei Lehren das ihr wesentlich Erscheinende herauszogen.
Und so fragte ich Babaji, während ich ihm den Brief aushändigte: "Ist der Weg, den sie geht, der richtige für sie?"
Babaji nahm das Kuvert in die Hand, schaute hinein und blickte sekundenlang still und unbeweglich vor sich hin. Dann drehte er sich um und wiederholte mehrere Male: "Ist richtig, ... ist richtig!"
In dem kurzen Schweigen war mir, als besuche Babaji meine Freundin im Geiste und lese in ihr, wie in einem offenen Buch.
Dieses Gebaren hatte ich schon einmal deutlich an ihm in Haidakhan, dem Ort seines Ashrams in den Himalaya-Bergen, wahrgenommen. Meine Mutter hatte ihm ein kleines Geschenk mitgegeben. Dankend hatte er es entgegengenommen, aber kein Wort dazu gesagt. Viel sprach er nie, nur das Nötigste. Bittend hatte ich gefragt: "Hast du meiner Mutter etwas zu sagen?" Und so erlebte ich zum ersten Mal, wie Babaji, umringt von vielen Menschen, sein Bewusstsein von der Außenwelt zurückzog, kurz reglos dasaß und sich konzentrierte. Als er wieder zum Leben erwachte, schauten mich seine Augen strahlend an, und er sagte: "Schicke ihr meinen Segen!"
Da wusste ich, dass Babaji in die Seele meiner Mutter geschaut und sie für wert befunden hatte.
***
Kalkutta. Mein Gepäck fand ich im Hause des Gastgebers wieder. Die riesige Wohnung, für europäische Verhältnisse überdimensional groß, lag im zehnten Stock eines Hochhauses. Sie bestand aus zwei Etagen, einer offenen Dachterrasse, einer unübersehbaren Zimmerflucht und einem Empfangssaal mit Empore, in dem gut fünfhundert Leute Platz hatten. Die Koffer und Taschen derer, die Babaji auf dem Flug begleitet hatten, lagen in einem Zimmer, das mit einer raumausfüllenden Matratze ausgelegt war. Hier waren wir also untergebracht. Noch während ich meinen Schlafsack ausrollte, mich häuslich niederließ, trafen nach und nach meine Zimmergenossen ein. Es waren sieben Männer, darunter Sri Muniraji, von dem Babaji sagte, er sei nicht mehr dem Geburtenkreislauf unterworfen, und Shastriji. Die beiden Ehefrauen hatten sich in Luft aufgelöst. Bei dem Gedanken an mögliches Geschnarche fielen mir meine Oropax ein, die ich vorsorglich eingepackt hatte, und so wurde die Sorge über eine mögliche schlaflose Nacht schnell verdrängt. Ich war ohnehin übermüdet. Der schlaflosen Nacht im Flugzeug von Deutschland nach Delhi war ein Tag ohne Rast mit Babaji gefolgt, und darauf vier Stunden Nachtruhe bei meinen Bekannten. Zudem machte sich die Zeitverschiebung bemerkbar!
Die Fahrt hierher zu unserer Unterkunft war merkwürdig verlaufen. Sie bestand aus einer Hetzjagd. Niemand hatte mir gesagt, wo Babaji sich aufhalten würde, wo ich unterkommen könnte. Flüchtig hatte mir jemand am Flughafen zugeraunt, ich solle mich nicht um mein Gepäck sorgen und war im Getümmel der Menschenmenge verschwunden, bevor ich meinen Mund öffnen konnte. Babaji selbst war ehrfurchtsvoll mit Blumengirlanden empfangen worden und im Nu mit seinen Gastgebern im Auto aus dem Gedränge und Geschubse der Menschen entschwunden. Ebenso seine Begleiter. Ich selbst sprang in das Auto eines europäischen Schülers - es war ihm und den westlichen Anhängern zur Verfügung gestellt worden - und bat ihn, Babaji zu folgen. Wo er war, würde mein Gepäck auftauchen und ich eine Bleibe finden.
Babaji fuhr nicht sogleich zu seiner Unterkunft, sondern besuchte auf dem Wege dorthin verschiedene indische Familien. Irgendwie gelang es uns, trotz des unübersichtlichen Verkehrs, an seinen Fersen zu bleiben. Endlich gelangten wir zu einem Hochhaus, in dem ich unsere Unterkunft vermutete. Hier war nichts von der üblichen Geschäftigkeit zu bemerken. Eine bleierne Stille lag über dem Haus, in der Babaji mit seinen Begleitern verschwunden war. Ich zögerte einzutreten und wartete in der Eingangshalle der Wohnung. Mir fielen die Bilder eines mir unbekannten Yogis auf und die einer Frau, die in diesem Hause verehrt wurden. Später erfuhr ich, dass hier der bekannte Yogi Sita Ram Dass, der Millionen von Anhängern in Kalkutta und der ganzen Welt hat, im Sterben lag. Als er die Zeit seines Ablebens kommen fühlte, hatte er Babaji wochenlang zuvor gebeten, ihm ein letztes Darshan zu gewähren. Da Babaji wusste, dass der letzte Moment noch nicht gekommen war, hatte er ihn vertröstet. Nun saß er an seinem Bett und hatte dem Sterbenden Wasser vom Gautama Ganga, dem heiligen Fluss Haidakhans, mitgebracht und drei Tulsiblätter.
Kurz nach Babajis Besuch verschied Sita Ram Dass. Wenige Tage später beim öffentlichen Darshan ließ Babaji verkünden, dass der Geist dieses großen Yogis in seinen engsten Schüler, Sri Muniraji, eingegangen sei. Jeder musste sich vor Sri Muniraji verneigen und alle wurden aufgefordert, "Sita Ram Dass Omkar" auszurufen.
***
Die erste Nacht in Kalkutta überstieg meine Befürchtungen. An Schlaf war nicht zu denken. Bis um Mitternacht wurde im Zimmer gesprochen, das Licht brannte, und um ein Uhr, als vorübergehend eine erholsame Stille eingetreten war, hub ein Schnarchkonzert an, das mich - trotz der Oropax - fluchtartig das Zimmer verlassen ließ. Auf der Freiluftterrasse hoffte ich, den langersehnten Schlaf zu finden, doch vergebens. Myriaden hungriger Moskitos überfielen mich... da zog ich doch das Schnarchkonzert vor!
Während der nächsten zwölf Tage, so schien mir, war ganz Kalkutta auf den Beinen, um Babaji zu sehen. Die Gastgeber hatten eine Ankündigung über seinen Besuch samt einem Foto in die Zeitung gesetzt. Zu Tausenden drängten sich die Menschen vom frühen Nachmittag bis spät abends in den Saal hinein, überreichten ihm Blumen, Süßigkeiten, empfingen Babajis Segen und strömten wieder hinaus. Eng aneinander gepresst standen sie auf der Straße, kilometerlang, die Menschenschlange schien kein Ende zu nehmen.
Mit anderen hatte ich im Saal einen Platz gefunden. Meine Aufmerksamkeit war ganz auf Babaji gerichtet, niemand und nichts konnte mich ablenken. Durch meine Augen nahm ich ihn in mir auf, zog seinen Anblick in meine Seele. Dieses Bild des gütigen Vaters, liebevoll und aufmerksam, wollte ich ewig in mir tragen. Leise stimmte ich in den Gesang mit ein und fragte mich im Stillen, was denn die Leute veranlasste, zu Babaji zu kommen. Sicherlich hatten nicht alle spirituelle Ambitionen, sondern waren aus Neugier erschienen.
Diesem Gedanken hing ich eine Zeitlang nach. Dann kam die Erklärung in der typischen Art, wie Babaji oftmals Fragen beantwortete. Ich wusste intuitiv, dass, sobald ein Samenkorn benetzt wird, es sich zu regen beginnt. Der Wachstumsdrang in ihm veranlasst es, sich nach mehr Wasser zu sehnen. Erhält und nimmt es weitere Nahrung auf, gedeiht es und trägt Früchte. Fehlt sie, verkümmert und verdorrt es. Ähnlich ist es mit den Menschen.
Da ich nur Augen für Babaji hatte, bemerkte ich nicht, wie außergewöhnlich es den sittenstrengen Indern erscheinen musste, dass ich, als einzige Frau, mit so vielen Männern in einem Zimmer schlief. Sie störten mich nicht, ich nahm sie kaum zur Kenntnis. Ich brauchte mit niemandem zu reden, sondern konnte mit mir und meinen Gedanken an Babaji alleine sein. Shastriji, der ehrwürdige sechsundsiebzigjährige Sanskrit-Priester, erschien immer nur tagsüber im Zimmer, las in seinen heiligen Büchern und war ganz in sich gekehrt. Die Nächte verbrachte er in Babajis Zimmer. Sri Muniraji hatte es sich an der mir gegenüberliegenden Zimmerwand bequem gemacht. Auch er vertiefte sich, wenn er nicht bei Babaji weilte, in die heiligen Schriften, vornehmlich der Haidiyakhandi Sapta Sati, einem Gebetshymnus zu Ehren der göttlichen Mutter. Ab und zu warf er mir ein aufmunterndes Lächeln zu und erkundigte sich liebevoll nach meinem Befinden. Die ersten schlaflosen Nächte waren nach wie vor unangenehm. Dieser Zustand änderte sich jedoch schlagartig, als Babaji einmal in das Zimmer kam und sich schweigend für einige kurze Sekunden auf mein Lager stellte. Prompt schlief ich in den folgenden Nächten tief, fest und traumlos.
***
Wie in Haidakhan, dem kleinen Ashram Babajis, in der Kumaon Region des nördlichen Himalaya, begann der Morgen auch hier mit einer Zeremonie, die mich stets tief berührte. Zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh trug Babaji jedem, der um Erlaubnis gebeten hatte, Chandan auf die Stirn. Chandan besteht aus einem Gemisch aus Sandelholzpulver und Kampfer. Die Paste wird entweder in drei waagerechten oder drei senkrechten Strichen aufgetragen. Ein roter Punkt aus dem Puder der Kum-Kum Blume kennzeichnet das Stirn-Chakra, das geistige, dritte Auge. Das gelbe Chandan hat eine kühlende und reinigende Eigenschaft. Gelb symbolisiert die Weisheit, rot die Liebe.
Die kurzen Augenblicke des Gegenübers mit Babaji, während er Chandan auftrug, bedeuteten mir viel, oftmals waren sie die einzigen am Tage, an denen man ihm so nah war. Nie glichen sie einander. Mal lächelte er oder war geistig abwesend, ein andermal malte er schelmisch zusätzliche Punkte an die Ohren, an die Augenwinkel oder zwickte einem scherzhaft in den Arm oder ins Ohr, wobei jede Geste eine Bedeutung hatte.
Nach dem Chandan gab es Gelegenheit, in den frühen Morgenstunden zu meditieren, oder einen heißen Tee, gewürzt mit scharfem Pfeffer oder Ingwer, Milch und Zucker, auf der Dachterrasse einzunehmen. Von dort bot sich ein selten schöner Anblick im Morgengrauen. Kalkutta erwachte. In den Hinterhöfen begannen sich die Menschen zu regen, Kühe erhoben sich schlaftrunken auf dem Straßenpflaster, Palmen wiegten sich im Wind, und eine frische Brise wehte herüber vom Meer.
Beeindruckend war die Lichtzeremonie, Arti genannt, die morgens im Anschluss an die Teepause und abends vor Babaji ausgeführt wurde. Während religiöse Hymnen gesungen wurden, versammelte sich der Hausherr mit seiner Familie vor Babaji. Unter feinem Glockengeläute wurden ihm die Füße gewaschen und gesalbt. Der Duft von Rosenwasser oder Hinnaöl erfüllte den Raum. Es wurden ihm eine Holzperlenkette, eine Blumengirlande um den Hals oder die Hände gelegt und ihm eigens zubereitete süße Köstlichkeiten, barfi genannt, Früchte oder Nüsse offeriert. Babaji nahm etwas von dem Angebotenen und ließ den Rest in der Menge verteilen. Die Ketten, die er durch seine Berührung gesegnet hatte, verschenkte er. Immer waren sie und andere Dinge durch den anhaftenden Segen begehrt und werden stets in Ehren gehalten. Manche überhäufte Babaji mit Geschenken, anderen wiederum gab er nichts, was bei den Schülern die unterschiedlichsten Reaktion auslöste.
Die Kriterien, nach denen er seine Gaben verteilte, variierten. Es kam auf die Geisteshaltung der einzelnen an. Erwartete jemand nichts, erhielt er im Überfluss, forderte er im Glauben, benachteiligt zu sein, ging er leer aus. Andererseits überhäufte Babaji manchen so lange mit Geschenken oder Aufmerksamkeiten, bis dieser glaubte, bevorzugt zu sein. Steigerte sich dieses Gefühl zur Überheblichkeit, ließ Babaji ihn von einem Tag zum anderen fallen. Er kümmerte sich scheinbar nicht mehr um ihn, bis er seine Einstellung korrigiert hatte. Durch diese Handlungsweise holte Babaji minderwertige Gefühle an die Oberfläche, um sie umzuwandeln. Oftmals war die latente Existenz dieser Gefühle einem selbst nicht bekannt.
Vor Jahren, bei meinem zweiten Aufenthalt - insgesamt war ich zehn Mal bei Babaji - musste auch ich eine für mich sehr schmerzhafte Erfahrung machen. Schmerzhaft insofern, weil ich mit einem unterschwelligen Gefühl der Eifersucht konfrontiert wurde. Nie zuvor hatte ich damit zu kämpfen gehabt, es war mir fremd gewesen. Doch eines Tages trat es mit einer solchen Vehemenz auf, dass ich meinte, zerspringen zu müssen. Wie die Eruption eines Vulkans, so ergoss und erschöpfte es sich schließlich, um nie wieder aufzutauchen.
Mein Mann, mein kleiner Sohn und ich waren nach Chilianaula gefahren, um an den jährlichen Navratri-Festlichkeiten in einem Ashram hoch im Himalaya-Gebirge teilzunehmen. Der Tempel sollte eingeweiht werden. Viele Menschen aus nah und fern waren erschienen, sie wollten gemeinsam mit dem verehrten Meister die zehntägigen Festlichkeiten zu Ehren der göttlichen Mutter begehen. Ein Festzelt schützte die Menge vor der brennenden Mittagssonne. Die schneebedeckten Gipfel des Himalaya leuchteten in der klaren Luft, und das strahlende Blau des Himmels bildete einen wunderschönen Kontrast. Babaji segnete jeden, der zu ihm kam, widmete allen seine Aufmerksamkeit, verwöhnte meinen fünfjährigen Sohn und ganz besonders meinen Mann. Dieser musste dicht bei Babaji stehen und als Ordnungshüter seinen Dienst versehen.
Jedes Mal nach dem Darshan zeigte er mir, was er von Babaji erhalten hatte: ein silbernes Döschen, ein langes Seidentuch, einen runden, glattpolierten Onyx-Stein, ein beigefarbenes Seidenhemd mit passendem Lungi, eine Rudraksh-mala und ich weiß nicht, was noch alles. Zuerst freute ich mich mit ihm und seiner Gelassenheit, die Gaben anzunehmen. Dann allerdings begann es in mir zu rumoren. Außer dem üblichen Prasad, gesegnete Speisen, wie Nüsse, Bonbons etc. hatte ich nichts erhalten. Es war offensichtlich, dass Babaji meinen Mann mir vorzog. Erschreckt erkannte ich, dass ich eifersüchtig wurde.
Wie war das möglich? Ich war meinem Mann zugetan, und wie kann man auf einen Menschen, dem man verbunden ist, eifersüchtig sein? Ich verstand mich nicht mehr, waren mir doch bisher derartige Gefühle fremd gewesen. Als dann auch noch mein Mann wie ein indischer Fürst im langen Seidengewand daherkam und einen Turban auf dem Kopf trug, war bei mir das Maß voll. Ich war kaum fähig, mein Weinen zu unterdrücken, als er mir erzählte, wie er zum Turban auf dem Kopfe gekommen war.
Babaji war von seinem Sitz aufgesprungen, hatte meinem Mann "komm" zugeraunt und war um das Zelt herum, den langen Gartenweg hinunter, in das Haus gegangen, in dem er ein Zimmer bewohnte. Unter all den erhaltenen Geschenken, die dort abgelegt worden waren, befand sich ein Stapel Tücher. Babaji hatte seine Hand seitlich darüber gleiten lassen und schließlich ein fünf Meter langes, kleingemustertes Stück Stoff herausgezogen.
"Turban, aus Rajasthan", hatte er dazu gesagt.
Anschließend war Babaji auf seinen Sitz im Festzelt zurückgekehrt, nicht ohne meinen Mann angewiesen zu haben, sich von Shastriji den Turban um den Kopf wickeln zu lassen.
Die indische Tracht kleidete ihn gut, sie unterstrich die Schlankheit seiner Gestalt, und unter dem Turban schaute ein blondes, bärtiges, feingliedriges Gesicht hervor. Innerlich bekämpfte ich meine Gefühle. Sie hatten keine Berechtigung meine Ausgeglichenheit durcheinanderzubringen und taten es dennoch mit einer nie erwarteten Stärke. Ich schämte mich. Wie konnte ich mit diesen Gefühlen in der Brust Babaji gegenübertreten? Folglich ging ich nicht mehr zum Darshan, sondern folgte dem Pfad zu der, mit Fichten bewachsenen, Lichtung hinunter zum klaren Bach. Dort ließ ich mich erschöpft nieder. Ich wusste, dass nur Babaji mir in dieser Situation helfen könne, und flehte ihn innerlich um Hilfe an. Ich bat ihn, mir dieses Gefühl, das mich so unvermittelt angesprungen hatte, für immer zu nehmen, ich wollte es nicht, es erschreckte mich. Ein Abgrund tat sich vor mir auf. Vergessen war, dass mir Babaji bei meinem ersten Aufenthalt in Haidakhan, das mir wohl kostbarste Geschenk, einen Armreifen, um das Handgelenk gelegt hatte. Kostbar nicht im materiellen Sinne, sondern im spirituellen. Ein Reif ähnlich den Gliedern einer Kette stellt die Verbundenheit, das Aneinander-gekettet-sein, dar. Zwei oder dreimal muss ich wohl an dem Bächlein mit blutendem Herzen gesessen haben, bevor eine Milderung eintrat.
Endlich kam der Abend, an dem ich Babaji wieder unter die Augen treten konnte. Als er mir segnend die Hand aufs Haupt legte und mir nickend in die Augen schaute, wusste ich: der Kampf ist beendet! Und von dieser Sekunde an konnte ich die Freude mit meinem Mann teilen. Und nicht nur mit ihm. Wann immer ich bewusst wahrnahm, dass jemand beschenkt wurde, im großen oder kleinen, verspürte ich dessen Freude in Form von Energieströmen in der Wirbelsäule. Überhaupt verlor dieses Thema zusehends an Interesse; was zählte, war das innere Wachstum und der verinnerlichte Kontakt zu Babaji.
Einmal noch, nach drei Jahren Lehrzeit, überkam mich das Gefühl des "Haben-Wollens", obwohl ich meinte, davon nach dem letzten Erlebnis endgültig geheilt zu sein. Es war auf einer Reise durch Südindien.
Wir befanden uns in Baroda, im Staate Gujarat. Babaji hatte in den kühlen Nachmittagsstunden im Garten eines Schülers auf einer Hollywood-Schaukel Platz genommen. Sanft schwang sie hin und her. Viele Menschen saßen auf dem kurzgeschnittenen, saftig grünen Rasen. Einer nach dem anderen ging vor zu ihm, verneigte sich und überreichte kleine Gaben. Ich saß in der Menge und schaute dem bunten Treiben zu. Beim Arti wurde Babaji ein goldfarbener Sari um den Kopf und die Schultern gelegt. Beim Anblick des Saris, dessen Farbe mir so gut gefiel, obwohl sie für europäische Begriffe recht grell war, rasten mir plötzlich wie wild Gedanken durch den Kopf: Gelb ... die Farbe der Weisheit... wer bekommt wohl den Sari? Ob er ihn mir schenkt? ... Trotz größter Anstrengung konnte ich den Gedankenfluss nicht unterbrechen .... Ich will ja keinen Sari, dennoch, er ist so schön... Ob er ihn mir schenkt?
Plötzlich hörte ich meinen Namen. Babaji rief mich. Mir wurde ganz heiß vor Scham, als ich aufstand, um zu ihm zu gehen. Ich ahnte, weshalb er mich gerufen hatte. Als ich verlegen vor ihm stand, riss er den Sari mit einem Handgriff von den Schultern und warf ihn mir mit einer heftigen Gebärde in den Arm. Ich hätte im Boden versinken mögen, verstand ich doch diese Geste, mit der er mir sagte:
"Gebe ich dir nicht genug? Bekommst du nicht alles von mir, was du willst? Warum musst du dich an materielle Dinge hängen? Wann wirst du deine Lektion gelernt haben?!"
Wie ich auf meinen Platz zurückkam, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich wochenlang zögerte, den Sari anzuziehen.
Natürlich hat mich Babaji im Anschluss immer wieder geprüft und mich in Versuchung geführt. Er zeigte mir Schmuckstücke und fragte, ob sie echt sein. Jedesmal ging ich dann in mich, um meine Regungen zu überprüfen, doch es regte sich keine Begierde. An Äußerlichkeiten hatte ich jegliches Interesse verloren. Das hinderte Babaji nicht daran, mir eines Tages die Schmuckstücke, die ich begutachtet hatte, zu schenken, sozusagen als Preis für die bestandene Prüfung.
***
Dem Arti folgte ein Yagna. Auf der geräumigen Dachterrasse, auf der leicht zweihundert Menschen Platz hatten, war eine viereckige, rot, mit Lehm ausgekleidete Yagna-Grube gemauert worden. Leichtfüßig wie eine Gazelle sprang Babaji nach dem Arti behend die Stufen zur Terrasse empor und ließ diejenigen, die ihn umringt hatten, überrascht zurück. Im Nu saß er an seinem Platz an der Feuergrube, - flüchtig hatte er mir im Vorbeieilen ein "Komm" zugeflüstert - und gab kurz hier und da eine Anweisung. Die Gastgeberin hatte zu seiner linken Seite Platz genommen, andere Frauen in ihren bunten Saris umringten ihn stehend. Sie legten Babaji die Fingerspitzen auf den Rücken, auf die Schulter, um - da sie nicht selbst die Gaben ins Feuer warfen - auf diese Weise am Yagna teilzuhaben. Rund um die Grube saßen die Männer des Hauses und andere. Sri Muniraji war wie üblich an Babajis rechter Seite und Shastriji rezitierte stehend Mantren aus den Heiligen Schriften. Hell loderten die Flammen auf und züngelten Babaji entgegen, während er flüssiges Butterfett ins Feuer gab. Still war es, man hörte nur das Knistern des Feuers und die Stimmen der Opfernden. Alle konzentrierten sich nach innen, unhörbare Gebete stiegen in den Himmel und erflehten den Segen der Himmelsmächte. Hinter Babaji stehend, versuchte ich das Yagna innerlich nachzuvollziehen und bat darum, von den Flammen gereinigt zu werden, mehr und mehr wollte ich aufnahmefähig sein für das Göttliche. Die Einheit zu erfahren, ganz in ihr aufzugehen, war mein Ziel. Babaji repräsentierte für mich diese allumfassende, unbegrenzte Einheit. Eine grenzenlose Sehnsucht erfasste mein ganzes Sein.
Tief versunken in diese Gedanken bemerkte ich nur am Rande, dass Babaji nach der Beendigung des Yagnas aufgestanden war und über die Brüstung der Terrasse schaute. Jäh wurde ich aufgeschreckt. Jemand hatte mich angetippt. Ich glaubte, ich solle den Weg freimachen für Babaji. Da jedoch genügend Platz vorhanden war, zuckte ich nur mit den Achseln. Wieder wurde ich angestoßen, diesmal unmissverständlich. Was wollte man von mir? Ich blickte auf und begegnete den schelmischen Augen Babajis, der zu mir herüber nickte. Als ich vor ihm stand, drückte er mir den Sari, den er kurz vor dem Yagna erhalten und um den Hals gelegt hatte, in den Arm. Ungläubiges Erstaunen erfüllte mich.
"Für mich?"
Als ich dann seine Füße leicht mit den Händen berührte, wurde ich von einem Schluchzen geschüttelt. Babaji hatte seinen Fuß auf meine Hand gestellt. Er ließ mich nicht los und die Sehnsucht, die ich innerlich so stark gespürt hatte, floss wie ein Strom in ihn hinein. Als ich mich endlich aufrichteten konnte, zeigte Babaji auf das Ende des fünf Meter langen Saris, das auf dem Boden lag.
"Deins", sagte er. Ich hob den Stoff auf.
"Deins", wiederholte er und deutete lächelnd auf das andere Ende des Saris. Unter Lachen, während mir die Tränen über das Gesicht kullerten, hob ich auch das zweite Ende auf... Schweigend standen wir noch ein Weilchen beieinander; die anderen, die zuschauten, bemerkte ich nicht.
Welch kostbares Geschenk hatte Babaji mir soeben gemacht. Es war nicht der Shri, er war nur Mittel zum Zweck, um mir sein Versprechen zu verdeutlichen, das besagte: "Vieles werde ich dir schenken, so viel inneren Reichtum, dass du nicht alles auf einmal mit beiden Händen fassen kannst. Richte deinen Blick nur immer auf das Beständige, auf das Göttliche!"
Das Yagna lief noch einmal vor meinem geistigen Auge ab. Jeden Tag, insgesamt zwölf Mal, würde er hier oben ein Havan zelebrieren. Ist es Zufall oder keiner - denn Zufälle gibt es im Geistigen nicht -, dass sich in diesem zehnstöckigen Hause, in dem er täglich ein Yagna zelebrierte, ein Versuchslabor der indischen Regierung für Atomenergie befand? Während der letzten Jahre hatte Babaji immer wieder von der kommenden, allumfassenden Zerstörung gesprochen, die auch von Atombomben hervorgerufen werden würde. An einem der Tage war Babaji in das Labor geführt worden, hatte ein Stück Uran, das von den Wissenschaftlern nur unter ganz bestimmten Schutzvorkehrungen bewegt wurde, in die bloße Hand genommen und hatte damit mehrmals den Raum durchquert. Wollte er durch diesen ungewöhnlichen Akt die Auswirkungen der Radioaktivität günstig beeinflussen?
Babaji trat von der Brüstung zurück und setzte sich ein Weilchen auf die Hollywood-Schaukel, die sich auf der Terrasse befand. Später würde er einzelne Schüler besuchen oder einen Ausflug an spirituelle Orte machen. Jeder, der einen Platz in den bereitstehenden Autos bekam, konnte mitfahren. Heute war ein Ausflug nach Dakineshwar geplant und nach Daknath. Dakineshwar ist ein ganzer Tempelkomplex, direkt am Ganges gelegen. Hier lebte Ramakrishna vor einhundert Jahren. Dieser, für seine religiöse Toleranz auf der ganzen Welt bekannte, Heilige starb 1886. Wie auch Babaji, lehrte er die Einheit aller Religionen, aller Menschen, gleich welcher Farbe, welchen Glaubens und welcher Nationalität.
Dorthin ging die Fahrt durch übervölkerte Straßen, vorbei an Wasserverkäufern, wiederkäuenden Kühen, eleganten Geschäften an breiten Avenuen, Fahrrädern, geschäftigen Handwerkervierteln, Fahrrad-Rikshas, hupenden, überfüllten Bussen, entlang des Ganges mit seinen lehmigen Fluten und menschenleeren Stränden. Eine wohltuende Stille herrschte im Tempel von Dakineshwar. Babaji sprang leichtfüßig treppauf, treppab die Stufen zu den unzähligen Tempeln hinauf und hinab, verharrte in dem einen länger, in dem anderen kürzer. In Ramakrishnas Zimmer zog Babaji sich in eine Zimmerecke zurück, verharrte im meditativen Schweigen.
Dem Tempelbesuch folgte ein Rundgang im Außenbezirk. Jeder hatte Mühe, Babaji zu folgen. Wie er, liefen wir barfuß. Es hatte keinen Zweck, Schuhe mitzunehmen. In einen Tempeleingang ging es hinein, zum anderen hinaus. Zeit, die am Eingang abgestellten Schuhe zu holen, gab es nicht. Babaji war fort, ehe man sich versah.
Weiter ging die Fahrt über das Land, vorbei an kleinen Dörfern und Seen, aus denen bisweilen die schwarzen Köpfe der sich abkühlenden Wasserbüffel ragten, nach Daknath, zu einem Kloster. Die dort amtierenden Priester hatten Babaji eingeladen. Nach einem gebührenden Empfang führten sie ihn und seine Begleiter in einer Prozession durch die engen Gassen der Altstadt in den Shiva Tempel, den Männer nur mit bloßem Oberkörper betreten durften. Vergebens hatten die Priester sich bemüht, Babaji dazu zu bringen, sein Hemd abzulegen, und mit entblößtem Oberkörper durch die Gassen zu pilgern. Der Oberpriester, der Babaji zum ersten Mal begegnete und nicht so recht von ihm überzeugt war, hatte darauf bestanden. Es folgte eine lange Diskussion, in deren Verlauf er nicht anders konnte, als Babaji als Mahavatar anzuerkennen. Einige Tage später war er in Kalkutta erschienen und hatte sich Babaji vollends übergeben.
Alle, die Babaji auf der Fahrt begleitet hatten, folgten der Prozession. Babaji stach nicht allein durch sein blaues Seidenhemd aus der Schar hervor. Seine Bewegungen, im Gegensatz zu den der anderen, waren fließend, waren eins mit der ihn umgebenden Welt. Am Tempel, er bildete das Zentrum des Ortes, verschwanden alle Priester und Begleiter nacheinander im Eingang. Babaji verlangsamte seinen Schritt vor Betreten des Tempels, während ich versuchte, ihm zu folgen. Ausländern war der Zutritt verwehrt, was ich nicht wusste. Einer der Priester versperrte mir den Weg. Er hatte mich als Ausländerin erkannt, obgleich ich mir den Sari ins Gesicht gezogen hatte.
Wenn äußere Formen, Richtlinien und Dogmen, von Menschenhand gemacht, den göttlichen Gesetzen widersprechen, fühle ich mich eingeengt; und hier konnte ich mich nicht damit abfinden, als Andersgläubige den Zutritt zu einem Heiligtum - das für jedermann zugänglich sein sollte - verwehrt zu sehen. Die Essenz einer jeden Religion betrachtend, - egal wer, wo und wie man sucht, Hauptsache ist ein Glaube, gleichgültig, wie er genannt wird, - sagte ich zu dem Priester:
"Ich bin ein Hindu, lass mich hinein!"
Keine Reaktion.
Ich spürte nur Abwehr. "Lass mich hinein, ich bin ein Hindu", wiederholte ich mit Nachdruck.
Vergebens. Da schaltete sich Babaji ein. Forschend hatte er mich bei diesen Worten angeblickt, was mich wiederum veranlasst hatte, nochmals in mich hineinzuschauen. Ich war ein Hindu, ich war ein Christ, ich war ein Jude, ein Buddhist! Es gab keinen Zweifel. Und prompt wiederholte Babaji laut, was ich schon ausgesprochen hatte: "Sie ist ein Hindu", und winkte mir, durchzukommen.
Ich versuchte, an dem Priester, der sich mir in den Wege gestellt hatte, vorbeizukommen. Aber wie es nun einmal auf der Welt ist, der festgesetzte Glaube, die auferlegten und anerzogenen Schranken hielten auch den Priester gefangen, er ließ mich nicht an sich vorbeischlüpfen. Dabei versperrte er mir mit seinem prallen, hervorstehenden Bauch den Weg. Einem inneren Impulse folgend, zwickte ich kräftig in die oberste Fettschicht hinein.
"Autsch!", überrascht schrie der Priester auf. So etwas war ihm noch nicht vorgekommen. Ich hatte seine Autorität untergraben!
Babaji hatte sich unterdessen umgedreht und war langsam im Tempel verschwunden. Diese Begebenheit bildete den Auftakt zu mehreren hitzigen Diskussionen über Religionen nicht nur zwischen seinen indischen Schülern, sondern auch zwischen Hindu-Priestern.
Babaji betonte immer wieder die Einheit aller Religionen, - die, Flüssen gleich, alle in den großen Ozean münden - und die Gleichheit aller Menschen. Religionsbedingte oder sozialpolitische Einschränkungen wie Rassen- und Kastenunterschiede ließ er nicht gelten, sondern fegte sie hinweg. In seinem Ashram saßen Unberührbare neben Brahmanen, arbeiteten nebeneinander im Flusstal von Haidakhan, um Bollwerke gegen den reißenden Fluss zu errichten. Brahmanen, die gemäß ihren Sitten, nur gesondert zubereitetes Essen zu sich nehmen, mussten sich daran gewöhnen, mit allen Anwesenden gemeinsam zu speisen und die Andacht nebeneinander zu verrichten.
Babaji war frei, kein von den Menschen erlassenes Gesetz konnte ihn binden. Er herrschte über alle Naturgesetze, befehligte den Naturgewalten und den Elementen.
Die Regenwolken lichteten sich bei einem Fest, das im Freien stattfand, und es fuhr fort zu regnen, sobald es beendet war. Ein ungewöhnliches Ereignis, denn Sturzfluten fielen wochenlang während des Monsuns vom Himmel. Sicher überquerte er barfuß den reißenden, von Geröll übersäten Strom in Haidakhan zur Hochwasserzeit, und niemand kam zu Schaden, der mit ihm ging. Zubereitetes Essen vermehrte sich auf unsichtbare Art, wenn unerwarteter Weise viele Besucher im Ashram eintrafen. Es waren immer die Menschen, die ihm ihre Gesetze auferlegen wollten. In manchen Dingen gab Babaji ihnen nach, wenn sie von ihren Sitten, Gebräuchen und ihrem Denken gefangen waren, und ihr gegenwärtiger Bewusstseinszustand kein erweitertes Verständnis zuließ.
Als Europäerin fiel mir besonders die Rollenverteilung der Geschlechter auf. Von Gleichheit war hier bei den Einheimischen nichts zu spüren. Der eine nahm Vorrechte für sich in Anspruch, der andere wurde in seiner Entfaltung beschnitten. Und so gab es nach indischer Sitte in Haidakhan den Brauch, dass Frauen, die ihre Periode hatten, drei Tage nicht den Tempel betreten, gesondert ihr Essen einnehmen mussten, geschweige denn in Babajis Nähe weilen durften. Man fürchtete, unrein zu werden, und davor wollte man den Tempel und Babaji schützen, der über allen Dingen stand. Welch ein Widerspruch!
***
Nie glich ein Tag dem anderen in Kalkutta. Eines frühen Morgens, die Sonne war gerade aufgegangen, besuchten wir mit Babaji den Kali-Tempel. Dieser Tempel, in der Altstadt gelegen, ist wohl der älteste und heiligste dieser Millionenstadt.
In der westlichen Welt ranken sich die schaurigsten Geschichten um Kali, der schwarzen, langzungigen, alles verschlingenden Göttin.
Der Name Kal (a,i, mask., fem.) hat zwei Bedeutungen: er steht für die Zeit oder Ewigkeit, und für die Farbe schwarz. Aus der Dunkelheit ging das Licht, die gesamte Schöpfung hervor (siehe Bibel: und es ward Licht) und kehrt durch den Tod, die Auflösung, wieder zu ihr zurück. Alles was existiert, befürchtet das Ende seiner Existenz, deshalb wird Kali, die Schwärze, so schreckenerregend dargestellt. Aber jenseits des Todes und der Zerstörung herrscht die Ewigkeit, und nur, was beständig ist, ist Glück und Freude spendend. So ist die Verehrung dieser Göttin zu verstehen, wie überhaupt jede Gottheit in Indien als ein Aspekt des Einen verstanden wird.
Der Kali-Tempel war überfüllt, eine dichtgedrängte Menschenmenge machte es unmöglich, ihn zu betreten. Einblick jedoch gewährte uns ein hoch gelegenes, kleines Türchen, das der Statue gegenüber lag. Unser Blick fiel auf Babaji. Einem Felsen gleich stand er in der wogenden, sich schiebenden Brandung der Menschenleiber, der Statue gegenüber. Er winkte hinauf, wir sollten durch das Törchen zu ihm hinuntersteigen. Eine Zeitlang richteten wir schweigend den Blick auf Kali. Seit Ewigkeiten schien sie dazustehen, unberührt vom weltlichen Treiben um sie herum. Eine Welle der Kraft ging von Babaji und der Statue aus, die mich fast wanken ließ. Kurz darauf reichte uns Babaji seine Hand, um hinaufzusteigen. Wenig später fuhr er zurück zum Haus, wo ihn Hunderte von Menschen erwarteten. Wir folgten ihm zum Darshan.
In der Halle war noch ein Plätzchen frei. Ich setzte mich und schaute Babaji zu, wie er seinen Segen erteilte. Unter den Anwesenden befand sich ein vor wenigen Stunden angekommener Deutscher. Er stand seitlich neben Babaji zwischen einigen Indern und hielt einen geschlossenen Pappordner in der Hand. Mit einigen Worten überreichte er ihn Babaji. Dieser blickte kurz hinein, klappte ihn nickend zu und rief mich.
"Hier ist ein Manuskript, lies es und erzähle mir, was es enthält!"
Wieder auf meinem Platz in der Menge öffnete ich den Ordner und durchflog flüchtig einige kurze Passagen. Plötzlich liefen mir die Tränen übers Gesicht. Hier war eine Seele, die sich langsam dem Göttlichen öffnete und sich, zuerst noch etwas zaghaft, Gott übergab. Der ganze Schmerz ihrer Einsamkeit, ihrer langen Suche und schließlich ihre Glückseligkeit, am Ziel angelangt zu sein, durchflutete mich. Die Bedeutsamkeit, das Kostbare dieser Begegnung, erschütterte mich zutiefst. Bewegt blickte ich zu Babaji hin. Er hatte mich beobachtet und jede meiner Regungen wahrgenommen. Lächelnd nickte er zu mir hin. Was letztlich in dem Manuskript stand, war unbedeutend. Wichtig war die innere Entfaltung des Autors. Als ich endlich Zeit und Muße fand, es gründlichst zu studieren, fand ich meinen ersten Eindruck bestätigt, und vom Autor nach meiner Meinung gefragt, erwiderte ich im Hinblick auf das Essentielle:
"Es ist das Schönste, was du Babaji hast schenken können."
Babaji hörte gar nicht zu, als ich ihm den Inhalt bei der nächsten Gelegenheit stichwortartig vortrug. Das überraschte mich nicht; sobald er etwas Geschriebenes in der Hand hielt, kannte er dessen Inhalt. Das Manuskript hatte seinen Zweck erfüllt.
Zurück in meinem Zimmer überdachte ich weitere Erlebnisse, in denen durch Babajis Führung mein Herzchakra geweitet worden war. Wie und wodurch Babaji im Einzelnen an mir arbeitete, weiß ich nicht. Ich spürte nur die Auswirkungen. Waren sie die Folgen seiner in die Tat umgesetzten Lehren?
Beim Karma Yoga im Ashram hatte ich, wie so oft, mit den Steinen gearbeitet. Das Flusstal von Haidakhan ist von vielen großen und kleinen Felsbrocken übersät, von denen Babaji sagte, es seien Seelen. Damals wusste ich noch nicht, dass dichteste Materie, also Fels und Steine, ein ihnen eigenes Bewusstsein haben. Ich hob sie auf und trug sie an einen anderen Ort, wo sie gebraucht wurden. Nicht weit entfernt, rauschte der klare Fluss vorbei, am blauen Himmel strahlte die Sonne, die Steine waren rund und sonnenwarm. Von ihnen gingen wundersame Vibrationen aus, Vibrationen einer ungeheuren Liebe. Sie übertrugen sich von dem Stein, den ich in der Hand hielt, und von all den anderen, die rund herum verstreut lagen, auf mich; es war eine Liebe, so groß und mächtig wie sie unter Menschen nicht zu finden ist. Überrascht hielt ich inne und vertiefte mich in dieses wunderbare Gefühl, das mich durchströmte. Die ganze Schöpfung, einschließlich meines Wesens, der ganze Kosmos schwang, bebte, erzitterte in den Strahlen der Liebe, die allem Sein innewohnt, bei uns Menschen aber verschüttet sind.
Wie gewaltig musste die Liebe sein, die Babaji den Menschen gegenüber empfand! Eine Ahnung dieser alles umfassenden Liebe hatte ich soeben erfahren.. Während ich versuchte, in diesem Gefühl zu bleiben, fiel mein Blick auf eine junge Frau neben mir. Sie war gerade aus Deutschland angekommen. Was mag wohl Babaji verspüren, wenn er seine Schüler nach vielen Monaten wiedersieht? Sinnend schaute ich sie an, als ich erneut und unerwartet von einer gewaltigen Liebe ergriffen wurde. Sie durchflutete, vom Herzchakra ausgehend, meinen Körper und hüllte mich und alle, die um mich herum waren, in ein loderndes Feuer ein. Welch eindrucksvolle Antwort auf meine Frage, keine andere hätte ich besser verstanden.
Staunend hatte ich die wachsende Sensibilität in mir wahrgenommen. Ich selbst hatte keinen Einfluss auf die Entwicklung und konnte sie nicht steuern, auch die Freiheit nicht, die mit dem Gefühl der Liebe und Freude einherging. Babajis Stimme hatte die Eigenschaft, viele Reaktionen auszulösen. Sie bewirkte Freude, Glück, Traurigkeit, harmonisierte und regte die Yin oder Yang Energie an, je nachdem, welche von beiden einer Stärkung bedurfte.
Einmal kurz vor dem Mittagessen saß ich allein mit Babaji in Haidakhan auf den Stufen der Tempel, oberhalb der Höhle, in der er bei seinem Erscheinen entdeckt wurde. Er hatte mir seinen Schirm gereicht, ich sollte ihn durch das Flusstal zur Ashramseite begleiten.
Etwas seitlich von mir sitzend, fragte er: "Bist du glücklich?"
"Ja, ... so sehr", antwortete ich und deutete ihm einen Zentimeter mit Daumen und Zeigefinger an. Innerlich dachte ich: "Richtig glücklich werde ich erst sein, wenn ich deine Stimme in mir höre und vollends eins mit dir geworden bin."
"Was", fragte er, "du bist nicht glücklich?"
"Doch", wiederholte ich und zeigte ihm abermals mit den Worten: "So sehr", das Maß eines Zentimeters. Leicht war mir die Antwort nicht gefallen.
"Geh!", schrie er und schickte mich mit einer wilden Gebärde zum Ashram zurück. Im ersten Augenblick wollte mich ein Anflug von Traurigkeit überfallen, doch verging dieses Gefühlt sofort und machte, noch während ich die Treppen hinunterlief, einer unbändigen Freude Platz, so dass ich laut aufjauchzend durchs Flusstal sprang. "Ich bin frei, ich bin frei!", jubelte es in mir. Ich war glücklich, richtig überglücklich.
Wie Perlen an einer Kette reihten sich die Erfahrungen, in denen das Herz stärker angesprochen wurde. Sie wurden immer größer und schöner, bis sie schließlich unerwartet in einem sat-chit-ananda Zustand, einem Samadhi, gipfeln sollten. Die Erfahrungen unbeschränkter Liebe füllten eine große Leere in mir aus und schenkten meinem Leben neuen Inhalt, sie lehrten mich, Gott und seine Schöpfung zu lieben. Eine Schöpfung, in der nicht nur das Augenfällige, Prächtige, sondern auch das Unscheinbare, kaum Wahrnehmbare von klarer, reinster Liebe durchdrungen ist.
***
Wenige Tage nach dem ergreifenden Erlebnis mit dem Manuskript hatte ich mich in mein Zimmer zurückgezogen. Niemand war anwesend, und ich genoss die kurze Ruhepause. Plötzlich steckte ein alter Herr seinen Kopf durch die Zimmertür. Da er mir durch sein Alter und seine bescheidene Art bereits vorher aufgefallen war, bat ich ihn hereinzukommen. Er setzte sich mir gegenüber auf den Boden. Wir wechselten einige belanglose Worte auf Englisch, schwiegen aber bald wieder. In der eingetretenen Stille fragte ich mich, was mich bewogen hatte, diesen unscheinbaren alten Mann in mein Zimmer einzuladen. Ich hatte geglaubt, er sei einsam und fühle sich unter all den Menschen hier im Hause verloren. Bei diesen Gedanken öffnete sich ihm mein Herz. Eine große Liebe strömte ihm und der ganzen Menschheit entgegen. War es Mitgefühl, war es Liebe, Verstehen, dass wir alle dem gleichen Schicksal entgegengehen, ... dass jeder von uns immer und stets allein ist, gleich in welcher Lebenssituation? Der Greis verabschiedete sich still, während die wunderbaren Gefühle langsam verebbten.
Wenige Stunden später ließ Babaji jedermann wissen, dass sich auf dem kahlen Haupte dieses zweiundachtzigjährigen Mannes ein Om Zeichen gebildet hatte. Alle sollten es anschauen und sich vor dem Greise verneigen. Dieser saß auf der Erde seitlich von Babaji. Diejenigen, die Babajis Segen empfingen, mussten an ihm vorbeigehen und konnten das etwa zehn Zentimeter große, bläuliche Om Zeichen nicht übersehen. Wie eine Tätowierung leuchtete es auf seinem Kopf. Klar und deutlich stach es aus der leicht gebräunten Kopfhaut hervor, und Tage danach, als wir Kalkutta endgültig verließen, war es noch sichtbar. Später erzählten die Inder in meinem Zimmer, sie seien bei diesem Wunder anwesend gewesen. Zuerst wäre eine rauchartige Substanz aus dem Scheitel des alten Herren gestiegen, worauf sich das Om Zeichen gebildet hätte.
OM NAMAH SHIVAY