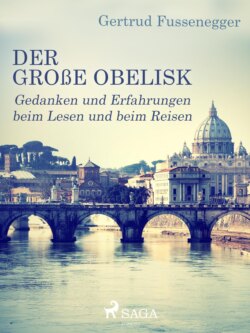Читать книгу Der große Obelisk - Gedanken und Erfahrungen beim Lesen und beim Reisen - Gertrud Fussenegger - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der große Obelisk
ОглавлениеJeder Beruf hat seine besonderen Tücken und Probleme. Darum fragt der Jurist nach dem Sinn des Gesetzes, der Ingenieur nach den Grenzen der Technik, der Lehrer nach der Belehrbarkeit der menschlichen Natur – und so fragt der Schriftsteller – oder sagen wir heute etwas hochtrabend: der Dichter nach dem Wesen der Poesie. Was ist das Poetische? Was unterscheidet einen Text von der Masse des Geschriebenen, daß er Dichtung sei, was hebt ihn ab von Reportage, von banalem Bericht, was macht ihn poetisch?
Ich glaube, das Poetische ist nichts Abstraktes, Reserviertes, Definitives, es ist nichts, was sich ein für allemal genau beschreiben und von einem klassischen Modell ablesen ließe. Es ist keine Eigenschaft, die an einem Werk haftet und festklebt wie ein Firmenschild an einer Ware. Das Poetische ist ein Vorgang, der sich immer wieder ereignen muß in der Begegnung zwischen Werk und Mensch, ein Erlebnis also, ein immer neues individuelles Ereignis. Aber weil es individuell und damit so unendlich vieldeutig, vielfältig und vielgestaltig ist, scheint es mir unerläßlich, daß wir hier einen ganz realen Fall ins Auge fassen. An ihm möchte ich zeigen, was ich meine, durch ihn möchte ich mich verständlich machen. Der Fall betrifft eine römische Anekdote, in ihr steckt Poesie oder mindestens das, was ich unter einem poetischen Motiv verstehe. Trotzdem ist sie nicht zu reiner Poesie gediehen, inwiefern und wieso …, damit möchte ich mich hier beschäftigen.
Auf den schönsten Plätzen von Rom stehen ägyptische Obelisken. Sie wurden in der diktatorischen und imperialen Zeit des alten Rom aus dem Nilstromland herübergebracht und zur höheren Ehre ihres jeweiligen Räubers aufgerichtet. Als Rom verfiel und zugrunde ging, wurden diese Obelisken umgestürzt, der eine oder andere mag auch durch ein Erdbeben gefallen sein. Nur ein einziger dieser merkwürdigen gigantischen Steine blieb aufrecht stehen, er stand im Zirkus des Nero und soll, späterer Legende gemäß, auf Leiden und Tod zahlloser christlicher Märtyrer herabgeblickt haben. Der Zirkus verschwand, Rom war längst christlich geworden, doch immer noch schaute man mit Neugier und Ehrfurcht nach der riesigen steinernen Nadel, an deren Spitze eine goldene Kugel steckte. In ihr, so munkelte man, sei Caesars Asche verborgen. Nichtsdestoweniger erfrechten sich die Landsknechte, beim Sacco di Roma nach der goldenen Kugel zu schießen, sie wurde auch getroffen, aber nicht zu Fall gebracht, unbesieglich stand der Obelisk, ein zwar deutliches, doch auch wieder schwer deutbares Zeichen für königliche oder priesterliche oder königspriesterliche Macht, ein Symbol für den Sonnenstrahl, der die Erde trifft, ein Finger der Erde, der sich zum Himmel erhebt. Und so konnte es nicht ausbleiben, daß einer der großen Päpste, die eben zu jener Zeit Rom ausund umzugestalten beschäftigt waren und die sich ja gleichfalls als königliche Priester oder priesterliche Könige in nahezu pharaonischem Sinne begriffen, daß also einer von ihnen sein Augenmerk dem Obelisk zuwandte, diesem einen, der alle Jahrhunderte der Zerstörung überstanden hatte und irgendwie als Sinnbild der Unzerstörbarkeit selbst galt. Schon war die Peterskirche erbaut, wenn auch nicht ganz vollendet, und vor der Peterskirche sollte jetzt das steinerne Wunder aus Ägypten aufgepflanzt werden. Der Mann, der diesen Entschluß faßte, war Sixtus V., Sohn eines Bauern aus Grottammare, mit 65 auf den Stuhl Petri gelangt. Er war beileibe nicht der erste, der den Obelisk aus dem untergegangenen Zirkus des Nero verrücken und vor die Basilika San Pietro transportieren lassen wollte, aber er war der erste, der es wagte, wirklich an den monolithischen Koloß zu rühren. Mit der Durchführung betraute er einen gewissen Domenico Fontana, einen sehr geschickten Architekten und Techniker, der sich schon an vielen schwierigen Aufgaben bewährt hatte und dem Papst Sixtus jede erforderliche Hilfe, jede nur denkbare Erleichterung und alle Mittel von vornherein versprach.
Fontana stellte seine Berechnungen an. Danach stellte er seine Forderungen. Dann überwachte er die Herstellung der notwendigen Apparaturen. Der Obelisk wurde mit einem Gerüst aus starken Eisenstangen und Holzbalken umgeben. Zugleich wurde rings um ihn ein breiter Gürtel freien Raumes geschaffen, man brach Häuser ab, man demolierte sogar eine Kirche, um ihn niederlegen und fortschaffen zu können. Dann wurden riesige Winden aufgestellt, auf denen armdicke Seile aufgerollt waren. Am Morgen eines Apriltages 1585 begann man mit der Arbeit.
Alle zu dem Platz führenden Straßen waren mittels Schranken abgesperrt. Papst Sixtus, nicht umsonst von Freunden und Feinden wegen seiner Strenge gefürchtet und von vielen „il terribile“, der Schreckliche, genannt, hatte die Todesstrafe verhängt für jeden, der die Schranken etwa durchbrechen würde. Schwere Strafen waren auch denjenigen angedroht, die durch Sprechen oder Lärmen die notwendige Stille stören würden. Innerhalb des abgesperrten Raumes stand der Bargello, der Polizeihauptmann, mit seinen Häschern und war bereit, jeden, der die Befehle übertrat, sofort zu fassen.
Zunächst hob man die Kugel von der Spitze ab. Sie war von den Geschossen der Landsknechte durchlöchert, ihr Inneres war leer. Die Asche des Caesar hatte sich also nicht in ihr befunden. Am 30. April, zwei Stunden vor Tagesanbruch, wurden zur Anrufung des Heiligen Geistes noch zwei Messen gelesen, wobei alle, die an der Arbeit beteiligt waren, die Kommunion empfingen. Noch vor Sonnenaufgang hatten die Arbeiter ihre Plätze eingenommen. Ein Trompeter gab das Zeichen zum Beginn. Die Schreiner, die den Auftrag hatten, unter den sich neigenden Obelisken Holzbalken zu spreizen, trugen eiserne Helme, um durch herabfallende Holzstücke nicht verletzt zu werden.
Hatte man für die Kardinäle und Botschafter eine eigene Tribüne errichtet, so waren alle Fenster und Dächer in weitem Umkreis von unzähligen Zuschauern besetzt. In den angrenzenden Straßen war ein Gewoge von Menschen, so daß die Schweizergarde und leichte Reiterei gerufen werden mußten, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Endlich, nach einem neuerlichen Trompetenstoß, setzten sich die 40 aufgestellten Riesenwinden in Bewegung. 75 Pferde und 907 Menschen bedienten die Maschinen, die den 25 m hohen und 50.000 Zentner schweren Monolith mittels eines erklügelten Systems von Flaschenzügen langsam, ganz langsam aus der Senkrechten kippen und in die Waagrechte legen sollten.
Fürs erste wurden der Obelisk von seinem jahrhundertealten Standort zwei Spannen hoch in die Höhe gehoben und die vier Kugeln, auf denen er stand, durch Holzbalken ersetzt. Die Kugeln wurden – als erste Zeichen des Erfolges – dem Papst überbracht. Kanonenschüsse von der Engelsburg verkündigten der Stadt den geglückten Beginn. Die gesamte päpstliche Artillerie stimmte ein.
Acht Tage später war der Obelisk glücklich niedergelegt. Die Überführung nach dem Petersplatz nahm den ganzen Sommer in Anspruch.
Der Petersplatz hatte damals noch nicht die Ausdehnung, die ihm später durch Bernini und durch den Bau der Kolonnaden gegeben wurde. Auch hier mußten Häuser und Kirchen abgebrochen und Platz geschaffen werden für das steinerne Ungeheuer und für die Winden und Maschinen. Bis jetzt hatte sich alles nach Wunsch und Berechnung abgespielt. Aber noch stand das Schwerste bevor: den Obelisk unbeschädigt, ohne Sprung, ohne Bruch auf die Fundamente zu hieven und aufzurichten.
Wieder ein feierlicher Beginn der Arbeit; wieder waren das Kollegium der Kardinäle, das Corps der Botschafter und tausend und abertausend Menschen versammelt; wieder waren die Befehle des Papstes verkündigt und eingeschärft worden: niemand dürfte die Schranken durchbrechen, niemand mit einem Wort die Stille stören. Wieder Messen, Gebete und dann ein Trompetensignal. An den vierzig Winden setzten sich abermals 900 Menschen und diesmal 140 Pferde in Bewegung. Stunde um Stunde verging. In stummer Spannung hielten die Tausende aus und sahen zu, wie sich der Koloß langsam, ganz langsam, fast so unmerklich wie der Zeiger einer Uhr aus der Waagrechten hob. Schon war er weit aufgestiegen, schon trennten ihn nur noch wenige Winkelgrade von der Senkrechten, da – plötzlich – stockte die Arbeit. Einige Winden liefen leer, andere blockierten, das System der Flaschenzüge und Verspannungen versagte. Die Vorarbeiter blickten sich hilfesuchend nach dem Architekten um. Der Architekt stand ratlos. Auch der Papst war aufmerksam geworden, Kardinäle und Botschafter reckten die Hälse. Was war denn geschehen? So sorgfältig Fontana alles berechnet, wieder berechnet, geprüftund überlegt hatte, eins war ihm doch entgangen: das Riesengewicht des Obelisken hatte die Seile derart ausgedehnt, daß die mühsam erstellte Maschinerie nicht mehr funktionierte. Der Koloß stand auf der Kippe und war nicht mehr weiterzubewegen. Sollte das ungeheure Unternehmen in der letzten Minute mißglückt sein?
Da plötzlich ist an den Schranken unten ein kurzes Schieben, Stoßen, Vorwärtsprellen: ein Mann hat sich an die Barrieren durchgekämpft, hat sich herübergeschwungen und läuft vor, läuft in den freien, abgeriegelten verbotenen Raum, und dabei schreit er, schreit etwas vorerst kaum Verständliches, doch schreit er’s noch einmal, da wird es deutlich und lautet: „Tut Wasser an die Seile! Tut Wasser an die Seile!“
Zwei, drei oder fünf Sekunden lang ist die ganze Szenerie bewegungslos. Fontana steht und starrt den Fremden an, die Arbeiter stehen und starren gleichfalls, der Chor der Botschafter und Kardinäle atemlos, vorgebeugt und lauschend, und selbst der Papst, der sich aus seiner Sedia erhoben hat, verharrt so, und sein altes, häßliches, runzeliges Bauerngesicht, das eben erst bis in die Lippen erblaßt war, ist ganz aufgerissen vor Staunen, Überraschung und Nichtbegreifen, Nichtbegreifen, in dem sich doch von Sekundenbruchteil zu Sekundenbruchteil Begreifen anbahnt, vorformt, durchformt und dann hervorbricht in den beinahe röchelnd hervorgestoßenen Worten: „Ja, Wasser, tut Wasser an die Seile!“
Da hat sich das Bild rund um den auf der Kippe schwebenden Obelisk auch schon durchaus verändert, aus zuckender Ratlosigkeit zuvor, Unbeweglichkeit danach bricht plötzliche Emsigkeit aus, ein Hasten und Rennen zu den Brunnen, ein Schöpfen und Schleppen, mit einem Male sind, weiß Gott woher, Eimer vorhanden, Krüge und Schläuche, und auf die armdicken Seile ergießt sich Schwall um Schwall.
Was danach geschah, können wir uns leicht vorstellen: die Seile zogen sich wieder zusammen, sie verkürzten sich auf die Länge, mit der der Architekt zuvor gerechnet und auf die er seine Winden und Züge eingestellt hatte. Das System funktionierte wieder, und bald stand der Obelisk aufrecht und fest auf seinem Postament.
Hier halte ich inne, um von der Erzählung zurückzukommen auf meine Frage: Was ist das Poetische? Was können wir poetisch nennen?
Ich meine, wir haben soeben ein Beispiel gehört, ein Beispiel wenigstens dafür, wie sich das Poetische aus einer Fabel ergeben, sich als Effekt einer Handlung einstellen kann.
Die Geschichte beginnt wie so viele historische Anekdoten im Raum historischer Kategorien: der Obelisk als Beute der Macht, als Zeichen der Macht, die Jahrhunderte überdauernd. Dann tritt eine neue Macht auf den Plan, die des Papstes, die den Obelisk neuen Zwecken zuführen will. Der päpstliche Befehl, die technische Vorbereitung, der Vorgang der Übertragung … das alles sind Berichte, die vielleicht ganz interessant klingen, die vielleicht unseren historischen Sinn ansprechen, die unter Umständen sogar malerisch-romantische Szenerien vor unser inneres Auge zaubern. Poetisch sind sie nicht. Zwar: wenn wir von dem befohlenen Schweigen hören, von dem verbotenen Raum, da siedeln sich in uns möglicherweise schon unterschwellige Ahnungen an, daß der Vorgang nicht so ohne weiteres ablaufen wird. Doch es sind eben nur Ahnungen; schließlich tritt die Stockung ein. Sie setzt ein deutliches Moment der Spannung. Trotzdem! Poetisch ist sie noch nicht. Erst in dem Augenblick, wo aus der anonymen Menge, aus der gesichtslosen Masse plötzlich einer, ein einziger hervorspringt und unter Einsatz seines Lebens das rettende Wort ruft, hier erst erfolgt der Umschwung, der Sprung hinüber in eine andere Zone, in die Erweisung des Poetischen. Denn, nicht wahr?, in diesem Augenblick ist dieser Mensch, dieser eine – eben noch gar nicht sichtbar Gewesene, er ist größer, wichtiger als der Architekt, der das Unternehmen leitet, als alle seine Helfer, größer als die Zuschauer auf der Kardinalstribüne, größer als der Papst und, ich möchte beinahe sagen, größer sogar als der Obelisk, dieses stumme, mit geheimen Mächten geladene Symbolum. Vor dem nüchtern-sachlichen Wissen dessen, der Bescheid weiß, vor seinem Mut, seiner Mannhaftigkeit verblaßt auch der Obelisk für einen Augenblick und gibt den Blick frei auf den Menschen in dessen voller sachbezogener Vernünftigkeit.
Hier haben wir die zarte Überraschung, die sinnvolle Sinnesverkehrung, den erheiternden Effekt der antithetischen Position. Der Namenlose wird zum Retter, der Niemand zur Schlüsselfigur. Er bringt in das Schauspiel mechanischer Kräfte einen neuen Gesichtspunkt ein, er ändert die Physik des Vorgangs, und die Überraschung, die seine Figur auslöst, gehört zu den Überraschungen, die das Poetische mit sich führt.
Hier wird Poesie geleistet.
Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, leider. Denn der poetische Ansatz bleibt als solcher stehen und kommt im weiteren Verlauf nicht zum Tragen.
Noch während man auf die Weisung des Unbekannten mit größtem Eifer und in höchster Hast am Werk ist, Wasser herbeizuschaffen und die Seile zu begießen, kommt natürlich und ganz unvermeidlich der martialische Bargello herbei, um seines Amtes zu walten. Er nimmt den Mann in Haft, er führt ihn ab. Doch ehe er ihn noch in den Kerker bringen kann, schmettern schon die Trompeten, schießen die Kanonen, läuten die Glocken von Rom Sieg und Gelingen. Der Obelisk ist aufgestellt, und da kommt auch schon ein Bote gelaufen und keucht seinen Auftrag: Seine Heiligkeit der Papst habe befohlen, den Mann, der gerufen habe, vor seinen Thron zu bringen. Das geschieht, und nun stellt sich heraus, daß der Mann Bresca heißt und ein Schiffer ist aus San Remo bei Genua und deshalb Erfahrung hat mit Tauen und Seilen, die sich bei Regenwetter zusammenziehen, bei Trockenheit ausdehnen, und der auf diese Weise erkannte, woran es lag, daß sich Fontanas geistreiche Apparaturen im letzten Augenblick als unbrauchbar erwiesen.
Der Papst dachte nun freilich nicht mehr daran, den Mann zu bestrafen, im Gegenteil, er fragte sogar, welche Gunst er sich erbitte, welchen Lohn, und da sagte der Mann, er erbitte sich das Recht, am Palmsonntag den Römern die Palmblätter zu verkaufen, die sie dann zur Weihe trugen – ein bombensicheres Geschäft. Und wirklich: Bresca erhielt das Recht, und es wurde dann auch auf seine Nachkommen übertragen, und so wurde Bresca Palmblätterverkäufer und ein reicher Mann, und auch seine Familie wurde reich und blieb es jahrhundertelang.
Hier ist die Zone des eigentlich Poetischen schon wieder verlassen. Hier schlägt die Anekdote aus der symbolischen Dimension zurück ins Banausisch-Erbauliche, hier pendelt sie aus dem Bereich zarter Überraschung in den der Banalität, wo sich vielleicht noch sprichwörtliche Wahrheiten zu bewähren haben wie „Guter Rat ist Goldes wert“ oder „Eine Hand wäscht die andere“.
Mit einer Art minderer Ersatzbefriedigung liest man dann noch am Ende, der Schiffer Bresca habe die Erlaubnis erhalten, die päpstliche Flagge zu führen … Nun gut, das war sicher das Äußerste, was von seiten des Sixtus zu erwarten war, eine Geste der Hochherzigkeit, die bei seiner sonstigen Strenge sympathisch berührt.
Damit ist die Anekdote zu Ende. Was können wir über sie sagen? Sie hat einen Ansatz zum Poetischen geleistet und hat ihn dann nicht durchgeführt. Hier erst müßte die Arbeit eines Dichters beginnen, der das poetische Fragment ausführt, der den poetischen Keim entfaltet. Hier müßte der Einfall erst erfolgen! – so wie er vielleicht einem Kleist, einem Brecht gelungen wäre, eine zugespitzte Szene zwischen dem Papst und dem Genuesen, ein Wortwechsel voll atemberaubender Wendungen … bei Kleist sicher ganz anders als bei Brecht, dort als geistreiche Vorform der Selbstvernichtung, hier als marxistisches Lehrstück: Aufreizung zur Aufsässigkeit, dort Michael Kohlhaas, hier Herr Keuner. Und wollten wir uns vorstellen, daß etwa auch der jüngere Günter Grass das Thema behandelt hätte, so müßten wir uns darauf gefaßt machen, daß er eine pantagruelische Unanständigkeit eingeflochten haben würde, und sollte sich schließlich ein Dichter konkreter Poesie je zu dem Thema verirrt haben, dann würde sich die Figur des Obelisken sicher als ein großes Rufzeichen oder als ein großes I vortragen, ein I, das das Ei der Seile dehnt, bis es sich im U des Ungehorsams wie in einer Zwinge stabilisiert und schließlich die Mitte und den Nabel des gewaltigen O bezeichnet, das die K-O-lonnaden des Bernini bilden.
Scherz beiseite. Ich habe lange genug von einem Beispiel gehandelt, das sich nur zur Hälfte als tauglich erwiesen hat, den Begriff des Poetischenzu beschreiben. Nur in einer Andeutung konnte ich ihn sichtbar machen.
Was mich allerdings selbst an dem Beispiel anzog, ist, daß ich in ihm etwas wie eine Beschreibung unserer Zeit fand, ein vereinfachtes Bild dessen, was wir erleben.
Auch wir haben uns sozusagen darauf eingelassen, das scheinbar Unverrückbare zu verrücken.
Wir haben uns darauf eingelassen, mit Mächten, Kräften und Massen der Natur zu manipulieren, die wir bis vor kurzem zwar gekannt, nicht aber zu unserer Verfügung gehalten haben.
Auch wir haben die Techniker damit betraut, diese Kräfte und Massen in unsere Welt hereinzuholen und sie an den für uns genehmen Platz zu unserer Benutzung heranzubringen.
Auch unsere Zeit hat dabei der Technik jede Hilfe gewährt und ihr jede Forderung von vorneherein bewilligt.
Es war zwar kein Verbot ausgesprochen, sich zu dem Vorgang zu äußern, aber das viel mächtigere Übereinkommen gleicher Gesinnung und gleicher Überzeugung verurteilte jede warnende Stimme zum Verstummen.
Auch das von uns geleistete Werk ist erstaunlich. Trotzdem trat, wie mir vorkommt, auch bei uns jener Augenblick ein, in dem sich die Apparaturen nicht mehr im richtigen Sinn bewegen, da die Arbeit stockt und die Erkenntnis um sich greift, daß alle Berechnungen, so großartig sie das Mechanische bewältigten, irgendeine wichtige Unbekannte nicht in Betracht gezogen haben. Man sagt, sie sei der Mensch … ich weiß es nicht, man müßte doch wohl erst darüber klargeworden sein, was in diesem besonderen Fall am und mit dem Menschen gemeint ist.
Wie dem auch sei: der Obelisk steht oben auf der Kippe – die Zuschauer auf der Ehrentribüne sind beunruhigt und stecken, verstört beratschlagend, die Köpfe zusammen. Sogar draußen hinter den Schranken hat sich das Gerücht schon verbreitet: Gefahr ist in Anzug. Wir warten. Wir warten auf Bresca.
Vermutlich muß jeder einzelne sein eigener Bresca werden.