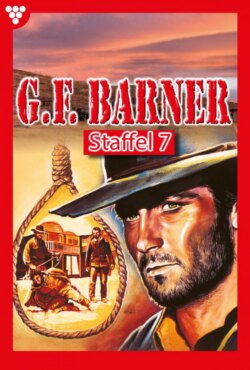Читать книгу G.F. Barner Staffel 7 – Western - G.F. Barner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMondlicht liegt auf dem Unterholz am Bodcau Bayou. Dunst über dem Wasser des sumpfähnlichen Geländes, durch das sich der schmale Pfad schlängelt. Baumwollbäume recken ihre breiten Kronen in die Nacht, die plötzlich in der Umgebung eines der Bäume völlig still geworden ist.
»Sssst!« zischelt der kleine Mann auf einem der Baumäste und hebt warnend die Hand. »Da kommt was, Jeff.«
Rittlings auf dem Ast, den Rücken an den gewaltigen Baumstamm gelehnt, hockt der zweite Mann. Jetzt hebt er jäh den Kopf und beugt sich vor. Seine Hand zieht einen Zweig zur Seite, aber kaum hat er es getan, als das Zischeln wiederkommt,
»Nicht«, flüstert der kleine Jackson neben ihm. »Nicht rascheln, sitz still.«
»Was kommt?« fragt Jeff Taylor so leise, wie er nur kann. »Was siehst du?«
»Nichts, aber ich höre etwas. Die Frösche quaken nicht mehr, Jeff.«
Das ist typisch für Jackson. Ein anderer Mann würde sich keine Gedanken darüber machen, ob Frösche einmal ihr Nachtkonzert abbrechen. Nicht Jackson, der denkt sich sofort etwas dabei. Jetzt neigt sich sein Oberkörper vorwärts. Und dann kriecht Jackson so lautlos, als winde sich eine Schlange auf dem dicken Ast. Sein Blick wandert wie der seines Secondlieutnants nach unten auf den schmalen Pfad im Sumpfgelände und ihn entlang.
Und dann…
Großer Gott, denkt der Oberleutnant Jeff Taylor hinter dem dicken Baumstamm und hält die Luft an, da ist einer. Jackson, Mensch, fliegt der da unten?
Es ist nicht zu hören, daß nur wenige Schritte unter ihnen jemand auf dem Pfad entlangschleicht. Der Mann dort unten bildet mit den hohen Buschzweigen einen einheitlichen Schatten. Er verschmilzt mit dem Blattgewirr dieser Mauer, aber Taylor glaubt eine Armbewegung auszumachen. Danach taucht, Taylors Augen weiten sich vor Schreck, der zweite Mann auf. Mondschein trifft seine Uniform, als er sorglos auf den Weg tritt.
Großer Manitu, ein Sergeant der Nordarmee!
Doch Taylors Schreck steigert sich in den nächsten Sekunden noch. Obwohl er nicht begreift, wie diese beiden Männer die Spuren gefunden haben, muß sie irgend etwas auf die Fährte von sechzehn Reitern aufmerksam gemacht haben. Taylor bleibt kaum Zeit, sich über das Erscheinen der beiden Männer dort unten den Kopf zu zerbrechen und einen Fehler bei sich zu suchen, als es passiert.
Ein Mann verläßt die Buschmauer, tritt ins Mondlicht und wird voll sichtbar.
Es ist ein Indianer.
Er betrachtet die Spur im Gras. Dann richtet er sich in halbgebückter Stellung auf und geht langsam los.
Jeff Taylor aber, Oberleutnant der Texasbrigade, steigen die Haare vor Entsetzen hoch. Sein erster Schreck ist vergangen. Er hält krampfhaft den Ast fest und wagt es nicht, ihn loszulassen. So gering das Geräusch der auseinanderschlagenden Blätter auch sein würde, der Indianer könnte es hören. Statt dessen wendet Taylor langsam und vorsichtig den Kopf. Es ist sicher, daß der Indianer, sollte er zur Baumkrone hochblicken, nichts von ihm sehen kann.
Taylor blickt zu Jackson und friert leicht.
Matt Jackson liegt zwar immer noch, hat aber die rechte Hand unter die Jacke geschoben. Und was dort steckt, das kennt Taylor ganz genau, es sind Jacksons drei Wurfmesser.
Der kleine Mann wirft seine Messer auf fünzehn Schritt in das Herz-As einer Spielkarte.
Während Taylor das Blut in den Ohren rauscht und er beinahe sicher ist, daß sein wildes Herzklopfen unten gehört werden müßte, erreicht der Indianer den Baum. Unter diesem ist es stockfinster, aber dennoch könnte der Indianer jene Stelle entdecken, an der zwei Mann gestanden haben.
Jackson hat recht gehabt, denkt Taylor beklommen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Alle Teufel, warum mußte ich auch gerade diesen Ritt anführen, warum der Captain Fieber bekommen? Ich bin verdammt nicht feige, aber von Indianern hat keiner etwas gesagt.
In diesem Augenblick setzt sich jener blauuniformierte Sergeant wieder in Bewegung. Der Mann huscht heran; er macht es zu hastig, und der Indianer sagt kehlig und vorwurfsvoll: »Machen Lärm wie Hirsche in Unterholz, wenn Hunde hetzen, Mann der drei Winkel!«
»Ich war doch leise, Poncah, was willst du?«
»Du zu laut, viel laut nicht gut, verstehen?«
»Schon in Ordnung, ich kann nicht leiser sein.«
»Sein laut, dann du tot, ehe es wissen«, erwidert der Indianer finster. »Bleiben zurück, bis Poncah da hinten an Ecke verschwunden und wieder winken, verstanden?«
»Hör mal, vier Augen sehen mehr als zwei, Poncah.«
»Nicht gut sehen, Mann mit drei Winkel, nicht gut hören. Poncah gehen zu Wasser, sehen nach.«
»Wie weit noch bis zum Bayou?«
»Dreimal zehn Schritte auf Pfad, dann Wasser. Viel Wasser, breit. Poncah wissen, hier Furt, nicht tief. Vielleicht drüben Wache von grauen Männern.«
Alle Teufel, denkt Taylor entsetzt, woher wissen sie das? Wie können sie erfahren haben, daß sich ein paar Rebellen durch ihre Linien geschlichen haben? Behält Jackson etwa noch mal recht?
Jener Vorfall am gestrigen Abend fällt ihm ein. Zu der Zeit waren sie bereits hinter den Linien der Nordtruppen, trafen aber in der Dunkelheit um ein Haar mit einer kleinen Gruppe Nordkavallerie zusammen. Sie wurden angerufen, antworteten mit der für diesen Tag gültigen Parole und ritten schleunigst davon. Eine halbe Stunde später brummte der schweigsame Jackson finster, über diesem Unternehmen stünde ein Unglücksstern, sie hätten die Yankees nicht treffen dürfen. Habe einer von denen scharfe Augen besessen, so sei es möglich, daß ihm die Umhänge ihrer Gruppe aufgefallen seien.
»Poncah, warum sollen es Südstaatler sein, eh?« fragt der Sergeant unten gepreßt. »Und wenn es nun unsere Leute sind?«
»Nein, keine blauen Männer«, antwortet der Indianer finster. »Reiten nicht einer hinter anderem, machen breite Fährte. Sind einmal zehn und sechs Männer.«
»Mann, Poncah, in der Meldung heißt es nur, daß wahrscheinlich ein Dutzend Rebellen hinter unseren Linien stecken, und ausgerechnet wir wollen sie gefunden haben?«
»Machen kleine Fährte, sehr schmal, sind nicht blaue Männer«, wiederholt der Indianer, und Taylor lernt nun kennen, wie einfach es sich die Indianer mit der Bezeichnung der gegnerischen Parteien in diesem Bürgerkrieg machen. Für sie tragen die einen Reiter blaue und die anderen graue Uniformen.
»Mann mit drei Winkel bleiben hier, bis Poncah winken.«
Taylor liegt still und bewundert nur heimlich die Nerven dieses kleinen, ungeheuer schnellen und zähen Jackson. Er stammt aus Nordtexas, hat alle möglichen Berufe im Zivilleben hinter sich gebracht und jahrelang mit Indianern zu tun gehabt. Der kleine, eisenharte Mann scheint sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen.
Dafür aber macht sich Taylor welche, und nicht wenige.
Von seinem Platz aus kann Taylor nicht erkennen, wohin der Indianer verschwunden ist. Ohne Zweifel aber wird sich der Späher, der wie viele andere im Sold der Nordarmee steht und sich hier sicherlich auskennt, die beiden Posten jenseits des Bayou sehen.
Der Teufel soll es holen, grübelt Taylor, da sind wir gut hierhergekommen, um jetzt aufgespürt zu werden. Als wenn Matt Jackson es vorausgesehen hätte. Er wollte unbedingt einen vorgeschobenen Beobachtungsstand auf diesem Baum haben. Und weil ich nicht schlafen konnte, ging ich mit ihm. Der kleine Bursche hat den sechsten Sinn, das hat schon der Captain immer behauptet. Was wird nur aus dem Indianer, holt er den Sergeant da unten ab oder…
In diesem Moment ertönt ein leiser Laut. Unter Taylor regt sich der Ser-
geant, steht auf, blickt nach der Pfadbiegung und hastet dann davon.
Fünf Sekunden später ist der Ser-
geant aus Taylors Blickfeld verschwunden.
Gleichzeitig regt sich Jackson auf dem Ast und winkt.
»Jeff, komm, wir müssen ihnen nach!« zischt Matt Jackson leise. »Der verdammte Chickasaw-Indianer hat unsere beiden Posten erkannt und wird versuchen, weiter oben durch den Bayou zu schwimmen, um sie zu packen.«
»Jackson, bist du sicher?«
»So sicher, wie ich hungrig bin«, erwidert der kleine, zähe Mann grimmig. »Laß es dir gesagt sein, Second, er hat sie gesehen und wird sie umbringen, wenn er kann.«
*
Jacksons Hand legt sich wie eine Stahlklammer um Taylors Arm.
»Runter!«
Nur ein Wort, das der kleine Mann zischt, aber Taylor reagierte sofort. Augenblicklich läßt er sich fallen und rührt sich nicht mehr. Respektlos wie immer brummelt Jackson heiser:
»Dachte ich mir doch, daß der verdammte Chickasaw sich umsehen würde. Bleib liegen, Second, runter mit dem Colt!«
Yor ihnen ist das sumpfige, von Büschen bestandene Ufer des Bodcau Bayou. Und irgendwo, keine dreißig Schritt entfernt, der Indianer mit jenem Sergeant.
Taylor starrt Jackson nach. Der kleine Mann windet sich nun durch das Gras und erreicht den ersten Busch. Dann winkt er hastig, und sofort kriecht Taylor ihm nach.
»Du meinst, er gräbt einen Busch aus?« zischelt er Jackson zu.
»Sicher«, antwortet Jackson kühl. »Kenne das rote Volk doch. Er ist bis hier um die Flußbiegung geschlichen, damit ihn unsere Wachen nicht sehen können. Weiß aber genau, der rote Sohn eines Wilden, daß der Fluß einzusehen ist, wenn er auf dem letzten Drittel zum anderen Ufer geschwommen ist. Er nimmt darum einen Busch mit, versteckt sich mit dem Sergeanten hinter ihm.«
Taylor ist keinen Moment darüber im Zweifel, daß Jackson ihre Chancen, gleichzeitig mit den beiden Gegnern an den Flußrand zu kommen, schlecht beurteilt.
»Jackson, Mann, wollen wir nicht los?«
»Wir warten noch«, sagt Jackson leise.
Es vergeht keine Minute, dann nickt er und zischelt:
»Langsam nachkriechen, jetzt, Second. Chickasaw hat ein Messer, er zieht einen Busch heraus. Denke, es könnte glücken. Nimm den Sergeant, aber nicht schießen. Am besten, er schreit nicht.«
Am besten, er schreit nicht, denkt Taylor und umklammert seinen Armeecolt, was der Kleine sich bloß denkt, was? Lautlos jemanden niedermachen, widerliches Gefühl!
Der kleine Mann ist schon weggekrochen und erreicht den nächsten Busch. Dann geht es etwa zehn Schritt weiter scharf nach Osten und an den Ufersaum des Bayou heran. Hier stehen die Büsche so dicht, daß man nur an einzelnen Stellen das Wasser blinken sieht. Unbeirrbar kriecht Jackson vor seinem Oberleutnant her. Der hat Mühe, das Tempo des kleinen Burschen zu halten.
Alle Teufel, ist der schnell! Tatsächlich, da wackelt ein Busch, die Zweige bewegen sich.
Nun sieht er es deutlich. Er liegt ja am Boden und blickt schräg gegen den Mondhimmel. So erkennt er genau, daß sich vor ihnen zwischen den vielen Buschschatten ein anderer bewegt. Ein leises Klirren, als träfe Stahl auf Stein, ist nun zu hören. Taylor hat weiter nichts zu tun, als jener Spur im Sumpfgras zu folgen, die Jackson bereits gezogen hat. Diese Spur führt so geschickt um die Büsche, daß sie ständig außerhalb des Mondlichtes bleibt. Einige Sekunden später liegt Jackson still, und Taylor erreicht seine Stiefel. Die Stelle, an der es gerade noch geklirrt hat, liegt nun etwa fünf Schritte vor ihnen. Jack-son zieht an Taylors Arm und bedeutet ihm, neben ihn zu kriechen. Erst als Taylors Gesicht neben seinem ist, flüstert er:
»Er ist am Ufer, sichert jetzt. Wir warten, bis der Busch rauscht, er muß ihn ans Ufer schleppen. Dann ist die Gelegenheit günstig.«
Mein Gott, denkt Taylor und starrt in die Finsternis zwischen den Büschen, das ist unheimlich. Er errät alles, was der Indsman anfängt. Teufel, wahrhaftig, da…
»He, Poncah, alles in Ordnung?«
»Sind drüben ruhig, keine Wächter, die an Ufer gehen, Drei-Winkel-Mann. Jetzt kommen, tragen Busch. Lassen nicht in Wasser, tun Poncah. Keine Wellen!«
Taylor glaubt verrückt zu werden. Genau das hat Jackson vorhergesagt. Augenblicke später hebt ein Rascheln an. Es ist für den Indianer und den Sergeant unmöglich, den Busch durch die eng beieinanderstehenden anderen zu tragen, ohne sie zu streifen. Das Rascheln der Blätter ist zu hören und Jackson kriecht sofort weiter. Seine Schnelligkeit ist nun so groß, daß Taylor ihm hastig folgen muß und dabei nicht mehr auf Lautlosigkeit achten kann.
Jetzt ertönt bereits leises Geplätscher und Poncahs kehlige Stimme:
»Keine Wellen machen, zu wenig Wind. Wächter sehen Wellen, wenn aufpassen. Langsam…«
Im nächsten Augenblick ist Jackson vor Taylor in der Gasse des niedergetretenen Ufergrases zwischen den Büschen. Er schiebt sich sofort etwas nach rechts, kommt neben der Spur her auf das Wasser zu und bleibt hinter dem letzten Busch liegen. Drei Sekunden darauf ist auch Taylor neben ihm. Behutsam, als habe er noch lange Zeit, hebt Jackson seine Hand und drückt einen Buschzweig nach unten.
In diesem Moment sieht Taylor unmittelbar vor sich, keine drei Schritt entfernt, die beiden Gestalten. Der Indianer, kenntlich an seinem bloßen Kopf, steht gebückt im Wasser. Der Sergeant ist gerade dabei, rechts des Chickasaws ins Wasser zu gleiten. Er hält sein Gewehr hoch und schiebt es zwischen die Buschzweige.
»Ziehen Jacke aus, legen drüber, sonst Mondlicht auf Gewehr fallen.«
Poncahs Stimme klingt jetzt leise und warnend.
Zur selben Zeit stößt Jackson Taylor in die Seite und deutet kurz nach rechts. Dann erhebt er sich lautlos, kauert sprungbereit und zieht sein Messer.
Jacksons Hand mit dem Messer wandert hoch. Dann zuckt sie nach vorn. Jetzt gibt Jackson das Kommando zum Sprung.
Von einer Sekunde zur anderen fallen alle Bedenken bei Taylor ab. Er weiß genau, daß sie keine andere Wahl haben. Gelingt es dem Sergeanten oder dem Indianer, zu schießen, werden in Kürze Patrouillen der überall hier verstreut liegenden Nordstaatler die Gegend durchstreifen. Und sicher haben sie nicht nur den einen Chickasaw als Scout angeworben. Jacksons Rechnung, daß sich mit der Morgensonne das Gras aufrichten und ihre Fährte unkenntlich machen müßte, wird nicht aufgehen.
Aus den Augenwinkeln sieht Tylor noch, wie Jackson links am Busch vorbeispringt. Der kleine Mann hat die Hand mit seinem Wurfmesser nach hinten genommen und holt aus.
Jackson fliegt beinahe lautlos um den Busch. Dafür aber hört Jackson, ehe er noch werfen kann, wie Taylor die Zweige streift.
Donner, Blitz und Hagelwetter, denkt der kleine Mann im Bruchteil einer Sekunde, das hört der verdammte Indianer doch.
Und genauso kommt es.
Jackson ist hinter dem Busch heraus, will werfen und sieht beim Rauschen der Zweige, wie sich der Indianer mit einem Zucken umwendet.
Der Chickasaw hat das winzige Geräusch vernommen und handelt sofort. Sich herumwerfen ist das Werk eines Augenblicks.
In diesem Moment wirft Jackson, aber er weiß es, als das Messer losfliegt:
Er trifft nicht voll!
*
Das Messer zischt auf den Chickasaw zu und bohrt sich in die linke Seite des Indianers. Schon fährt die Hand des Roten nach unten, aber sie erreicht so wenig wie Jacksons Hand eine Waffe. Auch Jackson will nach seinem zweiten Messer greifen, kommt aber nicht mehr dazu.
Dafür rammt Jackson, den linken Arm wie eine Klammer vorstreckend, den Indianer. Jacksons wilder Anprall reißt den Scout hintenüber. Gleichzeitig aber erfolgt ein so wilder, blitzschneller Armstoß nach Jacksons Kehle, daß Jackson zurückgedrückt wird.
Wasser schließt sich über Jackson. Er hat Atem genug und reißt die Beine an. Doch auch der Chickasaw, den Jacksons Messer nur leicht getroffen haben kann, stößt aus. Ihre Rammversuche fallen zusammen, und die Hand des Indianers ist immer noch so gefährlich, daß Jackson von plötzlicher Furcht gepackt wird, als sich der Griff um seinen Hals spannt. Der Chickasaw versucht Jackson die Luft abzudrücken und ihn unter Wasser zu halten.
Doch die Zeitspanne hat genügt. Jacksons rechte Hand ist unter die Jacke gefahren. Das zweite Messer zuckt heraus und sofort schräg nach oben.
Der Griff um Jacksons Hals scheint sich nicht lockern zu wollen. Jackson tritt aus. Dann endlich hat er den Indianerscout abgeschüttelt. Er richtet sich auf, holt tief Luft, zerrt den Chickasaw an die Oberfläche und sieht sich dann erst nach Taylor um.
Taylor taucht einen Moment später prustend aus dem Wasser. Er ist bereits acht Schritt vom Ufer entfernt, sieht Jackson mit verzerrtem, im Mondlicht geisterhaft bleichem Gesicht an und keucht: »Jackson, ich stecke fest. Großer Gott, hier ist Sumpfboden.«
»Alle Teufel!«
»Jackson, schnell, mein Gott, es zieht mich hinunter!«
»Nicht bewegen, Second!« schnauft Jackson. Blut, mit Wasser vermischt, rinnt ihm über das Gesicht. Er taucht den Kopf einige Male ein, um klar sehen zu können. Dann ist er dicht vor Taylor, packt den Busch und stemmt ihn nach unten. »Second, drück ihn an deine Beine und hole tief Luft. Dann knie dich auf die Zweige, hörst du?«
»Was – warum soll ich…«
»Knie dich auf die Zweige, dann kannst du den Fuß aus dem Sumpfmorast bekommen!« kreischt Jackson scharf. »Mach es schnell! Ehe jemand kommen kann, könnte es sonst zu spät für dich sein!«
Taylor schnappt nach Luft. Dann handelt er, wie Jackson es ihm gesagt hat. Er kniet sich unter Wasser auf den Busch. Und wirklich gelingt es ihm, sich nach vorn zu legen. Gleichzeitig fühlt er, wie Jackson im Stehen auf den Busch tritt und ihn unter den Achseln packt. Die dichten Zweige des Busches wirken anscheinend wie ein Teppich, den jemand auf den Sumpfboden gebreitet hat. Dazu kommt, daß die Füße durch Taylors nach vorne führende Bewegung eine fast senkrechte Stellung erhalten. Taylor spürt, wie der rechte Fuß zuerst aus dem Schlamm gerät. Danach kann er auf den Strauch treten und nun auch den linken Fuß herausziehen.
»Na?« fragt Jackson, als sei nichts gewesen. »In Ordnung, Second?«
»Ich – ich bin verdammt – verdammt nahe…«
»Unsinn, ich war ja noch da«, unterbricht ihn Jackson kühl. »Wo ist der Sergeant geblieben, Second?«
»Der – der ist weg!« stammelt Taylor verstört. Er sieht, wie Jackson sofort herumfährt und ahnt, was Jackson denkt. »No, no, er muß hier irgendwo unter Wasser sein.«
»Bestimmt?«
»Ja«, schnauft Taylor. »Verdammte Sache. Der arme Kerl.«
Jackson sieht ihn groß und starr an. Dann fragt er heiser: »Würde er das auch von dir sagen, Second? Na, was meinst du? Also, wo ist er geblieben?«
»Er stieß mich weg und versuchte durchzuschwimmen. Ich konnte mich auf ihn werfen und schlug nach ihm. Er tauchte unter, schwamm aber weiter auf die Mitte des Bayou zu unter Wasser. Ein paarmal stieß er nach mir, doch ich kam schließlich über ihn. Ehe ich wußte, was passiert, erlahmte sein Widerstand, ich jedoch geriet in den Morast. Er muß hier irgendwo wie ich im Morast…«
Jackson dreht sich um, schwimmt los und taucht zwei-, dreimal, bis er nur ein Wort sagt und zum Ufer hinschwimmt: »Ja.«
Taylor steckt das Frösteln in allen Gliedern, ehe er selbst das Ufer erreicht und Jackson schon wieder nach drüben blicken sieht. Dort regt sich irgend etwas.
»Rod?« fragt Jackson heiser. »Rod, Steve?«
»Yeah, was war los?« kommt es von drüben.
»Nichts weiter, zwei Yankees, einer davon ein Chickasaw-Indianer. Geht wieder zurück auf Posten.«
Ohne ein weiteres Wort geht Jackson davon. Er kehrt zum Pfad zurück, sieht sich nach Taylor um und deutet auf den Baum.
»Second, du sagst besser den beiden da drüben Bescheid. Jemand soll kommen und dir Gesellschaft leisten.
Ich will mal sehen, wo die beiden Freunde ihre Pferde gelassen haben und ob womöglich noch andere Yankees in der Gegend sind. Schätze, ich bin bald zurück. Komme ich nicht, Second, laß dir keine grauen Haare wachsen. Ich kann schon für mich sorgen.«
»Willst du nicht besser jemanden mitnehmen?«
Jackson schüttelt den Kopf und trabt los.
Sekunden später ist Jackson verschwunden. Taylor hastet zur Furt zurück, ruft seine Posten an und schickt einen zum Lager an der alten Hütte. Dann wartet er, bis Sergeant Briggs drüben auftaucht, durch den Bayou watet und bei ihm ist.
Kaum hat er Briggs die ganze Geschichte erzählt, als sie Hufgetrommel hören.
Wenig später erscheint Jackson hinter der Wegbiegung. Er sitzt auf einem Pferd und macht ein gleichgültiges Gesicht. Hinter dem Braunen, auf dem Jackson sitzt, läuft ein zweiter Gaul. Das Tier bleibt prustend stehen, und Jackson sagt knapp:
»Dachte schon, sie müßten am Sumpfrand zu finden sein. Habe nachgesehen. Sie sind an der Lichtung den Hauptweg entlanggekommen, haben gehalten und die Spur neben dem Weg entdeckt. Der Chickasaw muß sie bemerkt haben, ein Weißer hätte sie nie gesehen. Ich habe sie völlig gelöscht, Second. Was machen wir mit den Pferden?«
Taylor überlegt kurz.
»Mitnehmen?«
»Wird das beste sein«, antwortete Jackson. »Second, es ist besser, wir reiten ein Stück weiter, ich kenne noch ein Versteck, ist nur noch feuchter und voller Mücken.«
»Wir haben noch den morgigen Tag«, murmelt Taylor nachdenklich. »Jackson, kommen wir weit genug weg? Am Tag müssen wir uns versteckt halten und dann noch zehn Meilen bei Einbruch der Dunkelheit reiten. Schaffen wir das?«
Jackson kratzt sich am Kopf.
»Ja«, sagt er danach. »Es ist zu schaffen. Wann soll die Kolonne der Yankees denn kommen?«
»Nach Mitternacht hat sie im Hauptquartier der Nordstaatler zu sein«, antwortet Taylor. »Meine Informationen stimmen in jedem Fall. Die Kolonne besteht aus sechs Nachschubwagen mit Gewehren und Patronen. Es sollen neue Gewehre sein, mehrschüssige Henrykarabiner. Wahrscheinlich ist ein siebenter Wagen dabei, für den gebe ich noch besondere Verhaltensmaßregeln. Sie brechen heute vom Mississippi auf und fahren mit drei Zwischenstationen zum Hauptquartier. Die Sicherung soll aus knapp zwanzig Mann bestehen.«
»Hört sich leicht an«, sagt Matt Jackson. »Sechs Nachschubwagen der Nordarmee und zwanzig Mann. Du weißt nicht, wer die Leute führt?«
»Doch, gewöhnlich werden Waffentransporte von weißen Scouts geleitet«, erwidert Taylor. »Man sagte mir, ich hätte mit jemandem zu rechnen, der da drüben fast so einen guten Ruf hat wie du, Kleiner. Der Mann soll – warte mal – wie war das doch – Caldan… No, Cal ist sein Vorname. Der Nachname ist, glaube ich, Brindo oder…«
»Brendan?« fragt Jackson erschrocken und erstarrt. »Heißt der Kerl etwa Cal Brendan?«
»Ja«, sagt Taylor verwundert. »He, was hast du, Kleiner?«
»Oh, verflucht«, knirscht der kleine Jackson halblaut. »No, da mache ich nicht mit, nicht, wenn der Mann Brendan heißt!«
Sergeant Briggs und der Second sehen ihn verstört an. Der kleine Mann aber flucht in allen Tonarten und stampft mit dem Fuß auf.
»Hölle und Pest, warum hast du mir das nicht eher gesagt, Second?« faucht Jackson wild. »Das mache ich nicht, zum Teufel, no, das tu ich nicht. Starrt mich nicht so an, ihr könnt das nicht wissen, aber Brendan und ich waren einmal Partner. Wir haben in dieser Ecke und ein paar Meilen drumherum mal Biber gejagt. Das ist der feinste Kerl, den ich jemals getroffen habe. Der hat mich mal aus dem Dreck des Sumpfes gezogen. Ohne den würde ich nicht mehr leben. Hölle und Verdammnis, nicht, wenn Brendan dabei ist, der ist zweimal schlauer als ich!«
»Du kennst ihn?« fragt Briggs bestürzt. »Ja, aber Mann, früher und heute, das ist doch wohl was anderes.«
»Nichts ist anders!« knurrt Jackson. »Nicht, wenn es sich um Brendan und mich handelt. Second, brich das Unternehmen sofort ab, sage ich dir. Wenn Brendan den Haufen da drüben führt, dann reiten wir in die Hölle. Oh, verdammt, mein blödes Gefühl die ganze Zeit, jetzt weiß ich endlich, warum mir so verdammt komisch war. Mann, du kennst Cal Brendan nicht.«
»Jackson, nun hör mal zu«, sagt Taylor düster. »Selbst, wenn ich wollte, ich kann den Befehl nicht zurücknehmen. Ich habe ihn bekommen und…«
»Scheißkrieg!« knirscht Jackson unbeherrscht. »Dieser Dreckskrieg, dieser blutige, verdammte. Nicht genug, daß sich Verwandte gegenseitig umbringen wegen der Neger, nicht genug, daß man merkt, wie es immer bitterer für uns wird, jetzt soll ich einen Mann töten, der mir das Leben gerettet hat? No, sage ich, no, ich tu’s nicht. Und wenn ihr mich an die Wand stellt, ich mach’s nicht!«
Nach diesem Ausbruch schweigen sie alle drei einige Sekunden. Taylor und Briggs sehen sich betroffen an.
»Jackson, Matt, nun hör doch…«
»Halt’s Maul, Briggs!« faucht Jackson. »Da mache ich nicht mit. Was helfen uns denn ein paar Gewehre noch? Sei doch mal ehrlich, Mann. Irgendwann muß jeder, der Augen im Kopf hat, sehen, was mit uns passiert. Wir verlieren den Krieg, da ist nichts mehr zu gewinnen. Ich glaube nicht mehr an Wunder, ich hab’ mich nur geweigert, zuzugeben, daß wir Verlierer sein könnten. Und mir hat’s auch Spaß gemacht, den Yankees einen Streich nach dem anderen zu spielen. Das hier, das wird kein Streich. Brendan war mein bester Freund vor Jahren. No, das könnt ihr nicht verlangen.«
Sie blicken sich beklommen an. Wenn der kleine Jackson schon sagt, daß ihre Chance, davonzukommen, nicht mehr da sei, ist es dann nicht besser, die Sache ganz aufzustecken?
»Jackson, kann ein Verwundeter reiten?«
»No, Second«, brummt Jackson, sich langsam bruhigend. »Dann soll ich also auf ihn schießen?«
»Du oder einer, der sicher ist, jeden Punkt zu treffen, den er will, Jackson.«
»Mist!« sagt Jackson finster. »Überlege mal, Taylor, Brendan kennt sich nicht nur hier aus. Der ist quer durch das Indianerland bis nach Santa Fé gezogen. Der Mann kennt jeden Job, und in jedem ist er perfekt. Du kannst dir so was wie Brendan nicht vorstellen. Gegen den bin ich ein Säugling, ehrlich. Auf ihn schieße ich nicht.«
*
Räder knarren, Pferde schnauben. Sieben Wagen mahlen mit ihren Reifen den Sand des Weges und halten dann plötzlich. Von hinten nähert sich Hufschlag, ein Schrei ertönt, der den vordersten Fahrer an den Leinen ziehen läßt.
»Was ist los?« fragt vom dritten Wagen her jemand mürrisch. »Warum halten wir?«
Der Wagen unterscheidet sich durch seinen völligen Holzaufbau von den anderen, deren Dächer aus Plane bestehen.
»Brendans Befehl!« sagt jemand heiser. »Wir halten darum, Sir.«
»Zum Teufel, mitten im Wald?« knurrt der Mann und erscheint auf dem Wagenbock, um nach hinten zu sehen. »He, Brendan, warum der Stop?«
Aus der Dunkelheit jagt ein Pferd heran, dem zwei andere folgen. Brendans große, sehnige Gestalt taucht nun neben dem Sonderfahrzeug auf. Der Scout ist heran, treibt sein Pferd zur Seite und läßt die anderen beiden Reiter vorbei. Es sind ein Corporal und ein Private.
»Melden Sie«, sagt Brendan mit seiner tiefen Stimme knapp. »Nun, melden Sie dem Captain, Corporal.«
Brendan trägt Lieutenantsuniform. Man hat ihn wegen seiner Verdienste zum Offizier gemacht, obwohl er nie darauf wartete und es auch nicht wollte. Aber die Armee hat ihre eigenen Regeln.
Der Corporal salutiert vor dem Mann auf dem Bock und sagt laut und scharf: »Corporal Miller, Sir, Hauptquartier. Meldung an die Kolonne vom Nachmittag, Sir: Vermutlich Rebellen hinter unseren Linien. Seit heute früh sind ein Sergeant und ein Chickasaw-Späher am Bayou Bodcau verschwunden. Suche ergebnislos bis jetzt. Das Hauptquartier hat Patrouillen ausgeschickt. Jede Kolonne hat mit Flankensicherung zu reiten. Verstärkte Aufmerksamkeit an Waldstücken und Buschgelände, Sir. Befehl vom Hauptquartier!«
Der Captain steht auf, blickt zu Brendan und zuckt die Achseln.
»Brendan, ist das so wichtig?«
»Könnte sein, Captain«, erwidert Brendan knapp. »Weiter im Süden hat es mehr Überfälle als irgendwo anders gegeben. Warum nicht auch hier?«
»Wieviel Rebellen sollen denn in der Gegend sein, Corporal?«
»Man schätzt sie auf nicht ganz zwei Dutzend, Sir.«
»Was, und da regt man sich auf? Wir haben über zwanzig Mann, Brendan. Mit ein paar Rebellen wird man doch wohl fertig werden?«
»Sicher, Sir, wenn man sie rechtzeitig entdeckt«, antwortet Brendan kurz. »Flankensicherung ab sofort, je sechs Mann an den Flanken. Gewehre schußbereit halten. Captain, es sind kaum fünfzehn Meilen bis zum Bayou.«
»Nun und?« erkundigt sich Captain Dweller mürrisch. »Brendan, wir haben hier nur Gewehre geladen. Darauf machen die Rebellen in den letzten Monaten Jagd, hörte ich. Dennoch, was gehen uns ein paar Rebellen an?«
Brendan sieht seine Leute auseinander und tiefer in den Wald reiten.
»Ich nehme an, wir sind der einzige Transport heute«, murmelt Brendan nachdenklich. »Manchmal treiben sich Rebellen wochenlang hier herum. Sie schnappen irgendwann zu, wenn niemand mehr an sie denkt. Diese Burschen verstehen es, unentdeckt zu bleiben und immer dann aufzutauchen, wenn kein Mensch es erwartet. Vielleicht warten sie diesmal nicht wochenlang. Captain, ich muß meine Leute einteilen.«
»Tun Sie das, aber sehen Sie zu, daß wir vorankommen!« knurrt Dweller unwirsch. »Ich muß ins Hauptquartier – man wartet auf mich, Brendan!«
Brendan gibt keine Antwort, zieht das Pferd herum, reitet voraus, redet mit seinen Männern und läßt vorn zwei Doppelposten gestaffelt sichern. Nicht anders macht er es auch hinter der Kolonne.
Wenig später entfernen sich die beiden Kurierreiter. Brendan läßt die Kolonne anfahren, reitet zu First Sergeant Bowley nach vorn und sagt knapp: »Dick, ich sehe mich mal etwas um. Eine Meile vor uns beginnt Buschgelände.«
»Cal, meinst du etwa, sie könnten dort auf uns warten?«
Brendan zuckt die Achseln.
»Wenn es uns gilt, hätten sie drei Punkte, an denen sie es versuchen könnten«, antwortet er. »Der erste wäre das Buschgelände nicht gewesen, der war hier im Wald. Sie müssen die ganze Nacht zum Verschwinden haben. Ich denke, im offenen Gelände hinter dem Wald versuchen sie nichts. Ich fange euch vor dem Buschstreifen ab. Also, bis nachher.«
Brendan hat über die für einen Überfall günstigsten Plätze nachgedacht. Nun zieht er sein Pferd herum und reitet an. Er verschwindet vor den Doppelposten der Kolonnenspitze um die Biegung des Waldweges und prescht in das offene Gelände.
»Grey«, sagt der First Sergeant Dick Bowley mürrisch. »Er hat eine Nase für Ärger. Hoffentlich kommen wir heil durch. Zwar sind noch mehr Kolonnen unterwegs, aber die sind Meilen entfernt. Und keine andere hat Waffen geladen, soviel ich weiß.«
»Mit Brendan passiert nichts«, antwortet Corporal Grey. »Der riecht eine Falle, wetten? Schließlich war er hier zu Hause.«
»Was sagst du?« fragt Bowley überrascht. »Hier, aber ich dachte, er stammt aus Nord Virginia.«
»Seine Mutter, aber nicht sein Vater«, gibt Grey zurück. »Die Brendans haben in Louisiana eine Plantage besessen, wohnten jedoch in Nord Virginia.«
»Dann – dann ist Brendan ja ein halber Rebell!« sagt Bowley erstaunt, denn Brendans Heimat liegt in einem der Südstaaten. »Darum kennt er sich so gut aus. Na, warten wir ab, was er findet. Vorsichtig ist er nun mal.«
Irgendwo vor ihnen prescht Cal Brendan auf das Buschgelände zu. Der staubige, unbefestigte Weg zieht sich nun in Windungen an kleinen Buschansammlungen bis zu jenem ausgedehnten Gelände hin, das undurchdringlich auf den ersten Blick erscheint.
»Der Teufel soll die Rebellen holen«, brummt Brendan vor sich hin. »Sie haben sonst weiter im Süden Transporte überfallen, fängt es jetzt auch in dieser Gegend an? Stecken sie da vorn, dann sehen sie mich bald, wenn ich auf dem Weg reite.«
Er lenkt sein Pferd vom Weg und treibt es im Bogen nach rechts. Unruhe ist plötzlich in Brendan. Vor ihm ist die dunkle Wand des Buschgeländes. Dort können sich zwei Regimenter verstecken. Eine kleine Südstaateneinheit aber müßte geradezu unsichtbar bleiben.
Die Wildnis voraus würde sie verschlucken.
Wo sind die Rebellen geblieben?
*
Cal Brendans Lider zucken einmal. Im nächsten Augenblick fliegt er aus dem Sattel, reißt den Revolver heraus und duckt sich tief.
Brendan steht bis an die Knie im sumpfigen Wasser eines kleines Baches. Rings um ihn beginnen jetzt die Buschgruppen zum verfilzten Unterhalt zusammenzuwachsen. Hier und nirgendwo sonst, hat sich Brendan gesagt, könnte jemand in das Buschgelände eingedrungen sein. Diesen Weg hätte auch Brendan genommen. Er wäre im Bach geritten, um keine Spur zu hinterlassen. Der Bach versickert irgendwo zwischen den Büschen. Er führt nicht quer durch das Gelände bis zum Weg, sondern endet eine Viertelmeile voraus mitten im undurchdringlichen Gewirr der Büsche.
Bestürzt blickt Brendan auf die zwei, drei geknickten Zweige eines Strauches. Im Mondlicht sieht er deutlich den frisch geplatzten Bast der Rinde und das schimmernde Weiß des Holzes.
»Alle Teufel!« stößt Brendan erschrocken heraus, er sieht sich um und lauscht, hört aber nichts. Dumpfe, brütende Stille liegt über dem Tiefland. »Ein Pferd, nur ein Pferd, was? Die Zweige sind unter einen Steigbügel gekommen, da sind abgescheuerte Baststellen. Weiter, bloß weiter.«
Er reitet gleich darauf im Schritt vorwärts, kommt nach fünf Minuten an eine schmatzende, von Gras bestandene Fläche zwischen den Büschen und steigt wieder ab. Sein Blick erfaßt nach kurzem Suchen den nächsten Busch, dessen Zweige über das Wasser ragen. Tief unten entdeckt Brendan einige Schürfstellen an den dicken Zweigen. Und dann sieht er die einzelne Fährte quer über die Grasfläche laufen.
»Ein Mann ist gegangen und zurückgekommen«, stellt Brendan finster fest. »Wohin, he?«
Er läßt sein Pferd stehen, rennt los und erreicht wenig später den Rand einer Lichtung. Vor ihm liegt das helle Band des Weges. Und die Einzelfährte endet hier am linken Rand der Büsche.
Augenblicklich kehrt Brendan um. Die Fährte ist keine halbe Stunde alt. Wer immer hier einen Blick auf den Weg geworfen hat, er hat sich entschieden, umzukehren. Aber warum?
Erst im Zurückrennen begreift Brendan, warum der Mann umgekehrt ist. Der Boden ist zu sumpfig.
»Das genau ist es!« sagt sich Brendan. »Hier kann sich zu schlecht ein Angriff entwickeln, jedenfalls keiner zu Pferd.«
Sein Argwohn ist jetzt geweckt. Er betrachtet darum jene Scheuerstelle unter dem Busch am Ende des Wasserlaufes noch einmal. Dabei entdeckt er, daß es zwei Stellen gibt, an denen Bast abgerieben worden ist. Und er sieht nun auch trotz des schlechten Lichts, daß eine andere Fährte nach halblinks verschwindet und mitten im brackigen, seichten Wasser einige Flecken schillern. Hier haben Stiefel den Untergrund aufgewühlt.
»Noch ein Kerl, aber der war vorsichtiger als der andere«, stößt Brendan erschrocken heraus. »Verdammt, die hätte man in zwei Stunden nicht mehr gesehen. Der Bursche muß höllisch schlau sein.«
Im Laufschritt hastet Brendan zu seinem Pferd, schwingt sich in den Sattel und treibt es den Bach entlang. Es dauert nicht lange, dann findet er die Stelle, an der die beiden Reiter den Bach verlassen haben. Ohne zu zaudern folgt Brendan der schmalen Fährte. Sie führt zu einem Karrenpfad, auf dem sie verschwindet. Im Hintergrund des Geländes gibt es ein Gehölz. Und wenn die Fährte auch auf dem Pfad restlos gelöscht worden ist, Brendan ist sicher, daß sie am Gehölz enden wird. Das Gewehr in der Faust, reitet er auf die Bäume zu. Tief nach vorn gebeugt streicht Brendan langsam am Rand des Gehölzes entlang. Augenblicke später hält er, er hat die Fährte wieder.
»Der ist sehr geschickt!« knurrt Brendan gereizt. »Zum erstenmal reitet der nicht durch diese Gegend. Hier sind sie hinein und… Hölle!«
Nach diesem Ausruf bleibt Brendan einige Sekunden wie erstarrt stehen. Er ist keine zehn Schritte tief in das Unterholz zwischen den Bäumen eingedrungen und sieht es nun. Hier kreuzen sich ein volles Dutzend Spuren. Dann führt eine schlangenliniengleiche Fährte zu einem kleinen, kaum zehn Schritte im Quadrat messenden Platz unter den dichtesten Bäumen. Und hier sind Pferdespuren in Massen zu finden.
Brendan sucht keine zwei Minuten, dann richtet er sich auf und preßt die Lippen zusammen.
Es gibt keinen Zweifel mehr, hier sind Männer geritten, die vorsichtig genug waren, ihre Fährte so zu löschen, daß sie zwei Stunden nach Tagesanbruch unsichtbar werden muß.
Zurück, denkt Brendan. Sie sind nach Norden auf den Wald zu geritten. Und genau dort müssen wir durch. Runter mit der Kolonne vom Weg, sonst packen sie uns.
Er rennt zu seinem Pferd, schwingt sich in den Sattel und jagt los.
Im gleichen Augenblick bewegt sich in seinem Rücken der dicke Ast eines Baumes, und der kleine Mann sagt zwischen zusammengebissenen Zähnen heiser:
»Siehst du, Second, das war er. Ich habe es gerochen, und er riecht es jetzt auch. Einmal kann man ihn bluffen, noch einmal schafft das niemand, auch ich nicht. Jetzt denkt er, wir stecken drüben im Wald. Hol die Leute her, schnell, wir müssen sie von hinten packen. Er wird nach links auf festeres Gelände ausweichen und nicht auf dem Weg bleiben mit seiner Kolonne. Dies ist die einzige Chance, sie zu erwischen, eine andere gibt es nicht mehr.«
Jeff Taylor blickt den kleinen Matt Jackson an.
Er ahnt, was Brendan jetzt tun wird, und Jackson hat auch das vorausgesehen.
Brendan wird vor der Kolonne herjagen und den nächsten Wald untersuchen. Spätestens in einer Stunde wird er dann wissen, daß jene anderthalb Dutzend Rebellen gar nicht bis in den Wald geritten sind.
Der Überfall muß vorher erfolgen, oder er glückt nie mehr.
*
Hinter ihnen liegt der Sumpfstreifen mit seinen undurchdringlichen Büschen. Vor ihnen sind nun die ersten leichten Hügelformationen links des vielleicht eine Meile langen Waldstückes.
»Brendan – Brendan!« kommt von hinten der scharfe Ruf, als Brendan anreiten will, um sich vor die Kolonne zu setzen. »Brendan, zum Captain!«
Cal Brendan stößt einen leisen Fluch aus. Dann zieht er doch das Pferd herum und sagt kurz zu First Sergeant
Bowley: »Noch mehr südwestlich halten, Bowley. Ich will so weit wie möglich am Wald vorbei, verstanden?«
»In Ordnung, Cal!«
Bowley blickt Brendan mit gefurchter Stirn nach und wirft Corporal Grey einen düsteren Blick zu.
»Ich möchte nicht auf einem der Wagen sitzen«, sagt er zwischen den Zähnen. »Die Dinger schaukeln bei dem schlechten Gelände von einem Loch ins andere, seitdem Cal Befehl gegeben hat, vom Weg herunterzufahren. Wird Captain Dweller mächtig übel aufstoßen, in seinem Kasten hin und her geworfen zu werden wie ein Bund Flicken, was?«
»Immer noch besser, als jenem Rudel Südstaatler zu begegnen und in eine Falle zu geraten«, erwidert Grey mürrisch. »Was ist das bloß für ein Gelände hier, Loch an Loch im Boden.«
Hinter ihnen verschwindet Brendan an den ersten Wagen. Er hält neben dem dritten, auf dessen Bock nun neben dem Fahrer Captain Dweller sitzt.
»Brendan, zum Teufel«, knurrt Dweller, ein mittelgroßer, breitschultriger Mann, finster. »Vielleicht können Ihre Wagen hier fahren, aber meinem brechen noch die Achsen. Wo, zum Henker, bringen Sie uns hin, Mensch?«
»Im Bogen um den Wald, Captain«, antwortet Cal knapp. »Es wäre Leichtsinn, auf dem Weg zu bleiben.«
»So, Leichtsinn?« sagt Dweller wütend. »Kein Rebell würde so verrückt sein, uns auf einem Weg zu überfallen, den alle Stunden eine Patrouille reitet. Brendan, dies ist ein leichter Transportwagen, der kein Gelände wie das hier verträgt. Bricht er zusammen, mache ich Sie dafür verantwortlich, verstanden? Sie fahren auf den Weg zurück, Mann!«
Sein Ton ist so scharf, daß sich die Fahrer der anderen Wagen und das Sicherungskommando rechts und links bestürzt ansehen. Dweller ist Captain, Brendan nur Lieutenant.
In diesem Moment fährt der leichte Transportwagen durch ein Karnickelloch. Captain Dweller wird nach links geworfen, schlägt hart an den vorderen Kastenaufbau und tobt los:
»Brendan, ich habe jetzt genug, zum Henker! Sie fahren augenblicklich zur Nachschubstraße zurück, sonst soll Sie der Teufel holen, Mann! Jede Sekunde können an meinem Wagen die Achsen brechen. Ich bin für die Ladung verantwortlich. Meinen Sie, ich sitze gern auf vier Kisten Sprengstoff für Fort Lynn, die dauernd hin und her geworfen werden? Ich habe keine Lust, in die Luft zu fliegen, nur weil Sie aus Furcht vor einem Überfall die Richtung ändern.«
»Tut mir leid, Sir«, erwidert Brendan kühl und förmlich. »Das Kommando über diesen Transport habe ich. Auf Befehl des Oberkommandos bin ich auch für Sie und den Wagen verantwortlich. Sie bleiben in der Kolonne, Sir!«
Dweller scheint zu erstarren.
»Was ist das, Lieutenant?« fragt er messerscharf. »Jetzt werde ich Ihnen was sagen, Mister Brendan: Gerade dadurch, daß Sie von der Nachschubstraße, auf der im stündlichen Abstand Patrouillen unterwegs sind, heruntergefahren sind, bringen Sie den Transport in Gefahr. Hier kann die Kolonne viel leichter überfallen werden als auf der Straße, verstanden? Wir sind bereits über eine Meile vom Weg entfernt. Greift man uns an, kann uns so schnell keine Patrouille zur Hilfe kommen. Brendan, ich frage Sie noch einmal: Wollen Sie jetzt endlich zur Straße zurückfahren lassen?«
»Ich denke nicht daran!« kommt Brendans kalte, harte Stimme zurück. »Captain, Sie unterstehen hier meinem Kommando. Ich habe einen Befehl gegeben und warne Sie, ihn während meiner Abwesenheit umzustoßen. Die Kolonne umfährt im sicheren Abstand das Waldstück. Tut mir leid, Sir!«
»Das wird es Ihnen auch noch!« brüllt Dweller, rot vor Wut, Brendan an. »Passiert der Kolonne durch Ihr verrücktes Verhalten etwas, Mann, bringe ich Sie vor das Kriegsgericht, das verspreche ich Ihnen!«
»Tun Sie das, Sir!«
»Ich werde mich über Sie beschweren, über Ihren Ton, Sie – Sie ehemaliger Rebell!«
Brendan zuckt zusammen, Männer halten erschrocken die Luft an und blicken entsetzt von Dweller zu Brendan.
»Sir«, antwortet Brendan eisig. »Ich will das überhört haben.«
»Dann sage ich es noch mal, damit Sie es sich merken können!« schreit ihn Dweller zwischen zwei wilden Wagenstößen an. »Wer weiß, warum Sie uns vom sicheren Weg herunterbringen, ich jedenfalls habe meine eigenen Gedanken darüber. Sie haben Order bekommen, die Nachschubstraße zu benutzen, und was tun Sie? Mister, wenn hier etwas passiert, dann gnade Ihnen der Himmel! Ich werde Sie beschuldigen, absichtlich den Transport in die Hände von Rebellen geführt zu haben.«
First Sergeant Bowley hat gehalten, die Wagen herankommen lassen und sieht nun, wie Brendan kreidebleich vor Zorn wird.
»Das ist deutlich, Sir«, gibt Brendan eisig zurück. »Wir werden uns darüber später unterhalten. Fahrer, Ihr Name?«
»Mansfield, Sir!« antwortet der Fahrer nach einem Blick zu seinem Captain gepreßt.
»Mansfield, Sie folgen dem vorderen Wagen, ganz gleich, was Ihr Captain befiehlt, verstanden?«
Der Fahrer Mansfield würgt, und Dweller brüllt:
»Brendan, das nenne ich Aufwiegelung zum Ungehorsam! Ich bringe Sie vor die Militärjury, ich bringe Sie ins Armeejail, verlassen Sie sich darauf!«
»Sie haben meinen Befehl gehört, Mansfield!« sagt Cal Brendan, ohne weiter auf Dwellers Drohungen einzugehen. »Halten Sie sich hinter dem vorderen Wagen. Das ist alles!«
Im nächsten Augenblick sind die Wagen auf dem Kamm des ersten Hügels. Vor ihnen liegt jetzt eine Senke mit einem hellen, großen Fleck linker Hand. Ein Weg zieht sich zwischen Büschen und kleinen Bäumen vor ihnen her nach Westen.
Brendan sieht First Sergeant Bowley scharf an, reitet an den Wagen vorbei.
»Du sollst vorn bleiben, Dick, oder?« fragt er kühl. »Den Weg dort weiter. Das Loch links ist eine alte Kiesgrube. Der Weg von der Stadt führt hier hinaus. Bleibe auf ihm, reite zweihundert Schritte voraus und sichere am Hohlweg, dort gibt es einen Ravine. Aufmerksamkeit zum Wald richten, verstanden?«
»Ja, Cal. Hol’s der Teufel, was ist Dweller, diesem Schreibtischhocker, in den Schädel gefahren?«
Brendan antwortet nicht, er deutet nur nach vorn
»He, willst du an dem Wagen bleiben, Cal?« erkundigt sich Bowley.
»Sicher, sonst fährt dieser Narr mir noch auf die Straße und mit seiner Ladung den Rebellen in die Hände!« brummt Brendan. »Also los, nimm zwei Mann mit. Sicherung am Ravine!«
Bowley nickt und prescht los.
Den Streit zwischen Brendan und Dweller wird er so wenig vergessen wie einer der anderen Männer.
*
Der Ravine, jener etwa hundert Yards lange Hohlweg durch den Kieshügel, liegt einsam und still vor First Sergeant Bowley. Die drei Kavalleristen des Sicherungskommandos haben sich etwa zweihundert Schritte von den ersten Wagen der Kolonne entfernt.
»Grey.«
»Yeah, Dick?« fragt Grey und hält nun genau wie Bowley und Macolm, der dritte Reiter.
»Links hinauf und sichern. Macolm, reite durch, halte dein Gewehr schußbereit. Ich sehe es mir rechts an!«
Die beiden Männer reiten wieder an, während Bowley auf den rechten Hang des Ravine prescht und sich umblickt. Erst in diesem Moment sieht Bowley, daß es hier eine Unzahl Kieslöcher auf dem Hügel gibt. Wahrscheinlich haben die Leute aus der Stadt einfach Löcher gegraben, wenn sie an Kies kommen wollten. Bowley ist gut sechzig Schritte von Grey entfernt, der auf der anderen Seite des Hohlwegs auf und ab reitet.
»Grey, siehst du etwas?«
»Nichts, Dick, alles ruhig.«
Vorsichtig lenkt Bowley sein Pferd an einem jener von Buschwerk überwachsenen Löcher vorbei. Das Loch mag zwei Schritte tief und etwa sechs lang sein. Die Schatten der Büsche erlauben keinen Blick bis in seine Tiefe.
Dann sieht Bowley zum Waldrand rüber. Er erkennt die dunkle Masse der Bäume und das sanft gewellte, zum Wald hin abflachende Gelände klar. Die Sicht ist im Mondlicht ausgezeichnet. Keine Bewegung lenkt Bowleys Aufmerksamkeit ab. Die Gegend ist menschenleer.
Genauso geht es drüben Corporal Grey. Auch er blickt angespannt nach Norden, sieht aber nichts. Dunkel, düster liegt der Wald dort hinten. Greys Blick schweift nach links und sieht das nächste gewaltige Kiesloch. Drüben leuchtet die helle Steilwand im Mondlicht. Auf ihr steht eine alte, schiefe Hütte. Ein Weg führt in einem Bogen in Richtung Stadt.
Sekunden später erscheint auch der Corporal Macolm am Ausgang des Ravine und blickt zu Grey hoch.
»He, Grey, keine Seele da!«
Er dreht, kommt zu Grey und hält neben ihm.
Von hier aus, im Bereich einiger kleiner Kieslöcher, sehen sie die Kolonne herankommen.
»Der Weg führt auch zur Stadt, was?« fragt Macolm heiser. »Na, eine gute Stunde Umweg schadet nichts. Kommen wir eben etwas später hin.«
*
Der Second-Lieutenant hält den Atem zurück, als das Pferd kommt. In der nächsten Sekunde fällt der Schatten des Reiters auf die Büsche, unter denen er und Jackson liegen. Der Mann reitet so nahe an der Kante des Kiesloches vorbei, daß oben Kies abbröckelt und klickernd zwischen die Buschzweige fällt. Dann verstummt der Hufschlag, der Schatten über ihnen steht.
Es ist Taylor, als schnüre ihm eine unbekannte Gewalt den Hals zusammen.
Keine sechs Schritte entfernt hält der drohende Schatten eines Reiters in blauer Uniform. Der Mann über ihnen verhält sich einige Sekunden völlig still. Dann schnalzt er mit der Zunge und das Pferd geht an.
Taylor steht Schweiß auf der Stirn, als sich der Hufschlag entfernt. Sein bleiches Gesicht wendet sich Jackson zu.
Hat er geglaubt, daß auch Jackson fast vor Angst gestorben sein müßte, so hat er sich geirrt. Matt Jacksons Gesicht ist ausdruckslos und kühl wie immer.
»Mensch«, schnauft Taylor erleichtert. »Ich dachte schon, der reitet in das Loch und über uns hinweg. Alle Teufel, wo ist er hin?«
»Weiter nach vorn«, antwortete Jackson leise und richtet sich auf. Dabei schwankt der abgehackte Busch, den er wie alle anderen mitgenommen und als Deckung über sich gebreitet hat, etwas. »Er wird jetzt die anderen beiden anrufen. Ich verstehe es nicht, Brendan müßte selbst gekommen sein. Warum bleibt er an den Wagen, warum denn nur?«
Mit affenartiger Geschwindigkeit turnt Jackson zum Rand des Loches hoch. Oben ist langes Gras. Er schiebt es auseinander und hört den Mann, noch ehe er ihn sieht, nach einem Grey rufen.
Taylor schiebt sich neben Jackson. Beide blicken nun auf den First Ser-
geant, der etwas ruft. Seine Stimme ist deutlich zu hören.
»Grey, Macolm, ist etwas?«
»Nichts, Dick, keine Seele hier.«
»Gut, Macolm, zurück an die Wagen, Meldung machen!«
»Ay, First!«
Hufschlag tackt, wird dann aber, als das Pferd im Hohlweg ist, leiser und entfernt sich ganz.
Jacksons Gesicht spiegelt die Spannung wider, als der kleine Mann zurückrutscht.
»Jetzt passiert es«, zischt Jackson unruhig. »Entweder läßt er die Sicherung oben, oder er zieht sie ab und läßt weiter voraus aufklären. Wir werden es bald wissen. Die ersten Wagen sind unmittelbar vor dem Hohlweg.«
»Die letzte Chance für uns. Möchte wissen, was Brendan denkt, well. Gäbe hundert Dollar dafür, verdammt!«
Jenseits des Hohlwegs liegt Sergeant Briggs mit der anderen Hälfte Rebellen. Sie haben dreißig bis fünfzig Schritte zu laufen, ehe sie am Hohlweg sein können. Genauso weit ist es für Jackson, Taylor und jene hier in den Kieslöchern unter Büschen versteckt liegenden Männer.
Jackson zieht sich hoch, riskiert einen Blick auf den Sergeanten. Und dann zuckt Jacksons Kopf herum. Er sieht zwei Reiter erscheinen und saust wie der Blitz in die Tiefe.
»Brendan!« sagt er entsetzt. »Brendan kommt hoch, jetzt haben wir es.« Die Wagen müssen nun in den Hohlweg einfahren. Und Cal Brendan scheint sich selbst davon überzeugen zu wollen, daß der Kolonne vom Wald her keine Gefahr droht.
»Allmächtiger!« stößt der kleine rot-haarige Jackson durch die Zähne. »Er kommt her, er merkt es, der riecht den Braten. Jetzt ist es aus, die Wagen sind noch nicht alle im Hohlweg.«
*
Sekunden später trommelt Hufschlag auf sie zu. Sie liegen im vordersten Kiesloch vor dem Hohlweg. Der Hufschlag wird immer lauter, endet dann kaum fünfzehn Schritte vor ihnen, und jemand sagt laut und deutlich in das Räderrollen hinein:
»Sieht alles verdammt friedlich aus, Dick. Na gut, rückt vor, sichert hauptsächlich nach rechts. Auf dem Kiesweg zur Stadt wird Staub aufwirbeln und den Rebbs verraten, daß wir hier herumgefahren sind. Ich glaube zwar nicht, daß sie einen Angriff auf offenem Gelände riskieren werden, aber besser ist besser. Los, Mann, hau schon ab!«
Das Pferd geht an, aber es ist nur eins, das davonprescht. Das andere steht, schnaubt jetzt, prustet und bewegt sich.
Großer Gott, denkt Jackson entsetzt, als der leise, dumpfe Klang der Hufe sich seinem und Taylors Loch nähert, er kommt, erreicht mich.
Er ist so überzeugt davon, daß Cal Brendan ihn riechen müßte, daß er nicht mehr Atem zu holen wagt.
Zu Jacksons unbegreiflichem Staunen hält der Hufschlag nur wenige Schritte vor dem Loch an.
Brendan reitet zurück.
»Mein Gott!« flüstert Jackson. »Mein Gott, was wird…«
»Porter, durchfahren, kein Rebell in der Nähe!«
Der kleine Mann sitzt still. Für ihn ist es unbegreiflich, daß sie unentdeckt geblieben sind. Erst Taylors Anruf bringt Jackson in die Wirklichkeit zurück.
»Mensch, was ist los, ich rede mit dir.«
»Was – was? Ich versteh es nicht, ich versteh – was ist?«
»Mann, wir müssen los, sie sind schon mitten im Hohlweg.«
Taylor zieht ihn hoch. Und während sie die Kieswand annehmen, knurrt der Secondlieutenant:
»Nicht auf den gedeckten Wagen schießen, verstanden? Was der auch macht, nicht auf ihn schießen.«
»Yeah«, sagt Jackson halblaut und erinnert sich an Taylors Befehl, nachdem er gemeldet hatte, daß ein gedeckter Wagen zwischen den anderen Planwagen der Kolonne steckte. »In Ordnung, hoffentlich denkt jeder daran, Second. Los dann!«
Mit einem Schwung fliegt er über den Rand des Kiesloches ins Gras. Er weiß, daß nach Brendans Fortreiten aus den anderen Löchern jeweils ein Mann geblickt und nur auf ihr Auftauchen gewartet hat.
Aus den Augenwinkeln sieht der kleine Jackson, wie Männer aus den Löchern springen und geduckt losrasen. Sie stürmen auf die Kante des Hohlweges zu. Im Mondlicht blinken ihre Gewehre.
Noch hat sie niemand entdeckt.
Kleine, wieselflinke Schatten huschen von hinten auf den einen Mann am Hohlweg zu.
Dieser Mann ist Cal Brendan, und er wendet ihnen den Rücken zu.
Es ist Frobisher, einer der Südstaatler, der in ausgreifenden Sätzen auf den Hohlweg zustürmt und plötzlich rechts drei Reiter halten sieht
Frobisher, ein eiskalter, schneller und genau schießender Mann, sieht, wie der eine Reiter sein Pferd herumreißt.
Noch hat Frobisher etwa zwanzig Schritte bis zum Hohlweg zu laufen, als der Mann sein Gewehr hochreißt und gleichzeitig losschreit.
»Rebellen!« gellt sein Warnschrei über die Kraterlandschaft hinweg. »Achtung – Rebellen!«
Danach kracht der Schuß. Der peitschende Knall weht über den Hang und bricht sich dann weit hinten am Waldsaum.
Schrei und Knall aber lassen einen Mann herumfahren, der sicher gewesen ist, sich auf die Meldung des First Sergeanten Bowley verlassen zu können.
Der Schreck trifft Cal Brendan wie ein Hieb in den Rücken.
Cal Brendan nimmt die Hand zum Colt. Und dann, mitten in der Drehung, sieht er die durch das Gras auf ihn zurennenden Gestalten der Rebellen. Es kommt ihm unbegreiflich vor, daß keiner der Männer auf ihn feuert. Während er sich immer weiter dreht und sein Revolver herausfliegt, sieht er plötzlich den kleinen, keine zehn Schritte entfernten Mann.
Es ist kein Schreck mehr in Calipsel John Brendan, es ist nur das Staunen, jemand wiederzusehen, an den er keine Sekunde gedacht hat.
Cal Brendan reißt die Augen weit auf. Dort bleibt der kleine, krummbeinige und zähe Jackson stehen.
Brendan sieht ihn so deutlich, weil das Mondlicht Brendans Gegner und einstigen Freund mitten ins Gesicht scheint. Der kleine Matt hat den Mund offen. Und durch die Warnschüsse, die nun vom First Sergeant Bowley abgefeuert werden und über das Land rollen, hört Brendan den kleinen Mann heiser rufen: »Tut mir leid, Großer!«
In der nächsten Sekunde brüllt das Gewehr in den Händen des kleinen Jackson auf. Die Kugel trifft Brendans linke Hüfte mit einem Schlag, daß Brendan wieder zurückgestoßen wird. Vor seinen Augen beschreiben Wald und laufende Rebellen einen Halbkreis. Die Gegend zieht, zu Strichen verzerrt, an Cal Brendan vorbei. Danach gerät irgendwie der Himmel in Brendans Blickfeld.
Er glaubt noch zu spüren, daß sein Pferd springt, und sieht einen winzigen Moment lang den vollen, runden Mond. Danach verschiebt sich die Scheibe am Himmel, Sterne rasen vorbei.
In Brendans Ohren ist das wilde, berstende Krachen von Schüssen, der Schrei eines Mannes. Schmerz steckt in der linken Hüfte, als er stürzt und mitten in einen Orkan aus Feuerlanzen und belferndem Gekrache zu fallen glaubt. Dies ist das letzte, was er merkt. Um Brendan senkt sich völlige Finsternis.
Er liegt still und hört nichts mehr.
*
Bowley zaudert keine Sekunde mehr. Ohne Besinnen zieht er seinen schweren Kavalleristensäbel. Mit der anderen Hand reißt er den Revolver heraus, packt die Zügel wieder und jagt an.
»Grey, Macolm, vorwärts, Flankenangriff!«
Keine achtzig Schritte entfernt sieht Bowley die Rebellen überall am Hohlweg feuern. Das Dröhnen und Hämmern ihrer Schüsse mischt sich in das entsetzliche Schreien von Männern und Pferden im Hohlweg. Dann schnellen sich die ersten Rebellen ab. Sie springen in den Hohlweg hinein.
»Vorwärts, Macolm, Grey!«
Irgendwo dort vorn ein Kiesloch, und in dem Loch zwei Mann. Rebellen kauern dort und warten kaltblütig.
»Ich wußte doch«, sagt Frobisher heiser, »er würde ein Narr sein. Achtung, Smiles, sie kommen!«
Sie liegen still am Rand des Loches. Ihre Gewehre blinken leicht. Am Hohlweg ist die Hölle los. Schüsse krachen, als bekämpften sich zwei Regimenter.
Frobisher sieht die Reiter kommen. Der Mann aus dem Red River Streifen hat den ersten Reiter vor dem Lauf und drückt ab.
Im Knall sieht er, wie der Reiter die Arme hochwirft und zur Seite vom Pferd kippt.
Gleichzeitig feuert auch Smiles. Der zweite Mann schwankt im Sattel, der Gaul stürmt weiter, und der Mann neigt sich immer mehr. Sein Pferd springt in Frobishers nächsten Schuß, dreht sich und schlägt quer vor dem dritten Gaul zu Boden. Es gelingt dem Reiter nicht mehr, über das jäh vor ihm liegende Hindernis hinwegzukommen. Der Gaul prallt auf das andere Pferd, überschlägt sich und schleudert seinen Mann irgendwohin.
»Narren!« sagt Frobisher eiskalt, lädt nach und zuckt sofort herum, als sich der dritte Mann drüben hochschnellt und abspringt.
Es ist Frobishers dritter Schuß, und auch er trifft. Der First Sergeant Bow-ley ist kaum hoch und will hinter seinen gestürzten Gaul, als die Kugel
Bowleys Bein zerreißt. Dick Bowley schlägt der Länge nach hin. Schmerz wütet in seinem Oberschenkel. Er rollt sich verzweifelt in Deckung, verliert aber dabei seinen Revolver. Auch an das Gewehr, das sein Pferd eingeklemmt hat, kommt er nicht heran.
»Dick – Dick!« hört er durch das Hämmern der Schüsse Grey stöhnen. »Dick – meine Brust – ich verblute. Dick – hilf mir!«
Dick Bowley riskiert einen Blick über das Pferd. Vor ihm schnellen sich zwei Rebellen über die Kante des
Hohlwegs. Es sind Frobisher und
Smiles, die kaltblütig ihren Auftrag erfüllt haben, jeden Flankenangriff abzuwehren.
Jetzt wagt Bowley es trotz seiner wilden Schmerzen. Er schiebt sich an den ersten Gaul, der gestürzt ist. Dabei kommt er dicht an Macolm vorbei. Macolm liegt auf dem Rücken. Seine Augen sind weit offen und blicklos gegen den Himmel gerichtet.
»Dick – Dick! Hilf mir…«
Bowley erreicht Grey. Der Corporal hat die Beine hinter seinem Pferd angezogen und beide Hände auf die Brust gepreßt. Im Mondlicht sieht Bowley das Blut an Greys Händen.
Es zeigt sich, daß Greys Verwundung nicht schlimm ist. Grey ist die Kugel quer über die Brust gefahren. Er muß sich, als der Schuß fiel, gedreht haben.
Am Hohlweg ist die Hölle los. Während Bowley sein Taschentuch herauszerrt, um es Grey auf die Wunde zu pressen, ertönt das grelle Gewieher von Pferden. Verstört nimmt Bowley den Kopf hoch. Und dann beißt er die Zähne zusammen.
Sein ohnmächtiger Zorn gilt einem halben Dutzend jener kaum ausgebildeten Rekruten. Diese jungen Burschen verlieren den Mut. Ihre Angst vor dem Feuer der Rebellen läßt sie in kopfloser Flucht davonrasen. Gegen die eisenharten, kampferfahrenen und verwegenen Rebellen müssen diese jungen Burschen unterliegen. Sie sind dem Angriff nicht gewachsen und jagen keine vierzig Schritte an dem First Sergeant vorbei auf den Weg zur Stadt.
»Haltet doch«, ruft Bowley mit zitternden Lippen. »Wollt ihr wohl umdrehen, leistet ihr Widerstand, ihr Feiglinge?«
Sie jagen, als säße ihnen der Teufel im Nacken, über den Weg und verschwinden, während aus dem Hohlweg zwei Wagen auftauchen und dieselbe Richtung nehmen wollen.
Auf dem ersten Wagen kauert Corporal Porter hinter dem Kastenbrett.
Der Corporal ist mitten im Feuer auf das eine von den Rebellen erschossene Wagenpferd hinabgehechtet.
Porter hat die Sielen trotz der peitschenden Schüsse durchschneiden können. Ohne das Feuer zu erwidern, ist er wieder auf denWagen gestiegen. Jetzt hat er einen Moment erwischt, an dem hinter ihm die Hölle getobt hat. Vor ihm sind einige der Rekruten weggeritten, mehr als fünf sieht Porter reglos neben toten Pferden liegen. Die panikartige Flucht der Rekruten hat die Aufmerksamkeit der Rebellen abgelenkt.
In diesem Moment treibt Porter die restlichen Gäule an. Der Wagen ruckt los. Porter schlägt auf die Pferde ein und glaubt nicht daran, davonzukommen. Durch die Plane singen drei, vier Kugeln. Dann hat der Wagen sich seitlich des vor Porter schiefstehenden ersten Transporters vorgeschoben. Porter duckt sich noch tiefer. Es kommt ihm wie ein Wunder vor, daß keine Kugel die Pferde trifft. Dann ist Porter durch und sieht den Ausgang des Hohlweges vor sich. Jetzt erst riskiert er einen Blick zurück.
Hinter ihm scheint der gedeckte Transportwagen mit Mansfield auf dem Bock nichts abbekommen zu haben. Auch dieser Wagen jagt nun, er ist leichter und schneller als die schweren Munitionswagen, dem Ausgang des Hohlwegs entgegen.
Rumpelnd donnert der Wagen Porters auf dem Kiesweg in die Mulde hinein, gefolgt von Mansfields gedecktem Transporter.
Zwei Wagen sind davongekommen, und Porter begreift nicht, wie er es geschafft haben soll, der Hölle dort unten zu entrinnen.
Genausowenig wie Porter versteht es Mansfield, daß er ins Freie fahren kann.
Hinter Mansfield kauert Captain Dweller und schießt ab und zu. Mansfield stiert entsetzt auf die lodernden Flammen. In seinen Ohren ist das unaufhörliche Krachen der Schüsse. Als er einen Blick nach hinten wirft, packt ihn das kalte Grausen. Querschläger heulen um sie, aber schlimmer als die Gefahr von einer Kugel erwischt zu werden, ist der Anblick der Flammen für Mansfield.
Irgendeine Kugel muß die Lampe im Kasten getroffen haben. Dweller hat dort, über Papiere gebeugt, im Laternenschein gekauert, ehe der Überfall begann. Jetzt rinnt brennendes Petroleum über die im Wagen gestapelten Kisten. Corporal Fisk, Dwellers Schreiber, ist auf Dwellers Befehl hin vom Wagen gesprungen, um aus der Deckung unter ihm zu feuern.
»Captain, Feuer!«
Mansfield brüllt es. Voller Entsetzen sieht er die Flammenzungen an die Kisten kriechen. Sprengpatronenkisten liegen dort.
Jetzt bemerkt auch Dweller das Feuer und stößt einen heiseren Schreckensschrei aus.
»Fisk, Fisk!«
Fisk wagt es, unter dem Wagen heraus in den Kasten zu blicken. Er muß sich dabei aufrichten, sieht die Flammen und denkt nur an den Sprengstoff.
»Fisk, weg hier, lauf weg, Mann!« faucht Dweller scharf. »Fahren, Mansfield, los, fahren!«
Mansfield sieht in diesem Augenblick die Lücke neben Porters Wagen. Im selben Moment aber setzt sich Porters Transportwagen in Bewegung. Wie durch ein Wunder und zur rechten Zeit schiebt sich Porters Wagen am ersten der Kolonne vorbei und jagt los. Ohne Zaudern gebraucht Mansfield jetzt die Peitsche. Er jagt hinter Porters Fahrzeug her, gewinnt den Ausgang des Hohlweges und sieht Dweller mit einer Decke auf die Flammen einschlagen.
»Schneller, vorwärts!« brüllt Dweller heiser. »Wir fliegen in die Luft, Mann, wenn ich nicht löschen kann!«
Kaum wendet Mansfield den Kopf, als es kracht. Mansfield hat den Bruchteil einer Sekunde lang das Gefühl, daß sich hinter ihm der Wagen unter einer brüllenden Explosion in einen Feuervulkan verwandelt. Dann spürt Mansfield nichts mehr. Er sinkt nach vorn, rutscht auf dem Bock zusammen und liegt still.
»Verdammte Pest!« flucht hinter ihm Dweller heiser. »Da haben wir es.«
Die Flammen erfassen nun die Decke. Eine schwarze Rauchwolke weht aus dem rasend schnell über den Weg jagenden, gedeckten Transporter. Die hintere Einstiegstür steht offen und schlägt bei der Geschwindigkeit des Fahrzeuges hin und her.
Vor Dweller liegt nun die Senke. Wenige Schritte entfernt rasselt Porters Wagen den Weg zur Stadt weiter, während Dweller die Zügel packen und den gedeckten Sonderwagen nach links reißen kann. Es geht auf das Loch der anderen Kiesgrube zu.
Zur selben Zeit sieht sich Porter um. Er sieht die Rauchwolke, in der Dweller sich wie ein Geist auf dem Bock bewegt und irgend etwas schreit.
Auch First Sergeant Dick Bowley bemerkt den Wagen und sperrt vor Schreck die Augen auf. Bowley weiß, was der Kurierwagen geladen hat. Es handelt sich um Sprengmittel für Pioniere, die irgendwo am felsigen Red River Steine für eine Brücke heraussprengen sollen. Dwellers Auftrag hat zwar die Mitnahme der hochexplosiven Stoffe nicht vorgesehen. Irgendwer aber aus dem Hauptcamp der Versorgungseinheit hat Dweller gebeten, die Kisten mitzunehmen.
»Grey, Grey, Mann!« sagt Bowley verstört. »Der Kurierwagen brennt. Heiliger Rauch, die Sprengmittel!«
Der Wagen rast auf die Mulde des Kiesloches zu und verschwindet in ihr. Er kommt auch nicht wieder heraus, obgleich drüben an der anderen Grubenwand ein zweiter Weg in die Höhe führt. Schatten liegt über dem Weg.
Bowley, der wie gebannt auf die Kiesgrube sieht, kann nichts mehr von dem Kurierwagen sehen.
Dafür endet die Schießerei im Hohlweg so plötzlich, wie sie begann. Augenblicke später tauchen mit erhobenen Händen einige Männer des Sicherungskommandos und zwei Fahrer auf. Sie hasten aus dem Hohlweg den Pfad hinunter, bedroht von zwei Rebellen mit den Gewehren im Anschlag.
Dick Bowley sieht den Rest seiner Einheit. Und dann schleudert es ihn beinahe zu Boden.
Aus dem finsteren Loch der Kiesgrube schlägt ein Blitz in die Höhe. Entsetzt starrt Bowley, die Hände in das Gras krallend, auf diesen urgewaltigen Blitz, der die Umgebung in grelles Licht taucht. Deutlich sieht Bowley, wie die Gewalt der Explosion die hoch über dem Rand der Kiesgrube stehende Hütte zerfetzt. Das Dach fliegt auseinander wie Spreu unter einem Windstoß. Bretter und Balken wirbeln durch die Luft. Der Luftdruck ist so gewaltig, daß die davonlaufenden Männer des Sicherungskommandos hingeschleudert werden. Sie fallen übereinander, schreien los, aber auch die beiden Rebellen liegen am Boden und raffen sich unter heiseren Rufen hastig auf.
»Dweller«, sagt Bowley stockheiser vor Schreck, »großer Gott, Dweller.«
In Bowleys Ohren singt es grell nach dieser fürchterlichen Explosion. Er liegt still neben Grey und blickt nur noch einmal dem weit hinten verschwindenden Wagen Porters nach. Seine Leute werden wie Schafe davongetrieben, bis sie weit genug entfernt sind. Die beiden Rebellen kommen zurück.
Sinnlos zu schießen, denkt Bowley bitter. Was soll ich schon tun mit Greys Revolver? Ich schieße einmal, dann knallen sie mich ab. Warum soll ich mein Leben riskieren, wenn doch alles verloren ist? Sie haben die Ladung von fünf Wagen erwischt.
Er kümmert sich um sein Bein und Grey. Der Schmerz kommt wieder und läßt Bowley die Zähne zusammenbeißen.
Irgendwann nach Minuten hört er das Wiehern von Pferden in südwestlicher Richtung verklingen. Die Rebellen sind fort, er weiß es und sieht den Rest seiner Leute zurückkommen. Jetzt ruft er sie an. Man hebt ihn noch, schient sein Bein und stützt ihn auf dem Weg zurück zu den ausgeplünderten Wagen. Zwischen Toten und krepierten Pferden finden sie Corporal Fisk. Er hat sich totgestellt wie einige andere, die nicht sinnlos sterben wollten und meist verwundet sind.
»Sergeant, was ist mit dem Kurierwagen – der Knall?« fragt Fisk heiser. »Der Wagen brannte, und der Captain schrie, ich solle wegrennen. Was…«
»Sieh nach, Mann«, brummt Bowley finster.
»Wenn du ein heiles Stück von ihm findest, dann hast du Glück gehabt. He, wo steckt Brendan?«
»Hier«, sagt jemand verbissen. »Er liegt unter seinem Gaul, verwundet an der Hüfte. Irgend etwas scheint mit seinem Rücken nicht in Ordnung zu sein. Er liegt so seltsam gekrümmt.«
Mühsam humpelt Bowley hin. Einige Männer schleifen das Tier mit Hilfe von Stangen fort. Sie ziehen Brendan heraus. Er stöhnt, hat die Augen offen und tastet nach seinem Rücken. Als sie ihn anheben wollen, schreit er auf.
»Laßt mich liegen, mein Kreuz. Irgend etwas ist gebrochen. Laßt mich liegen, Leute.«
Sein Gesicht ist wachsbleich, aber dennoch hat er Kraft genug, um zu sagen:
»Sind verwundete Rebellen da?«
»Nein, alle tot«, berichtet einer der Männer. »Brendan, was sollen wir tun?«
»Wartet, ist ein kleiner Bursche unter ihnen?«
»No, Brendan, ein Sergeant nur. Warum?«
»Das war Jackson!« kommt es gepreßt über Brendans Lippen. »Zur Stadt, sofort zur Stadt. Matt Jackson hat die Rebellen geführt. Er kennt sich wie kein anderer im Bayou Bodcau aus. Sie werden versuchen, durch die Sümpfe zu entweichen. Sagt Bescheid, es war Jackson. Er kennt diese Gegend wie seine Westentasche. Sie sollen alle Wege zum Bayou überwachen, sonst entwischt er ihnen.«
Sein Gesicht zuckt unter Schmerzen. Er redet immer leiser und abgehackter. Vielleicht hört er noch, daß Fisk ankommt und kreidebleich mit zitternden Gliedern, vor Bowley stehenbleibt.
»Da ist ein Loch – und – und Fetzen«, stammelt Fisk. »So – Fetzen – klein wie – wie der hier.«
Männer starren auf Fisks zitternde Hände, zwischen denen ein Stück Uniform baumelt. Es ist ein Teil von Captain Dwellers Rock, kenntlich an den Knöpfen.
Von den Gespannpferden, die die Schießerei überlebt haben, läßt Bowley eins aussuchen. Dann schickt er die Männer los zur Stadt.
»Reite!« sagt Bowley finster. »Die anderen Burschen, diese davongejagten Feiglinge, werden es schon gemeldet haben. Du hast gehört, was Brendan gesagt hat, Matt Jackson hat die Rebellen geführt. Wahrscheinliche Fluchtrichtung Bayou Bodcau und dann westwärts, Richtung Red River. Ab mit dir!«
Bowley weiß nicht, warum ihm plötzlich der Gedanke an Captain Dweller kommt, der den Wagen noch aus dem Hohlweg brachte, um ihn nicht hier in der zusammengedrängten Masse Mensch und Tier hochgehen zu sehen.
Der Gedanke ist plötzlich in Dick Bowleys Kopf und will nicht mehr heraus.
Langsam wendet Bowley den Kopf und blickt zu Cal Brendan hin.
Es ist verrückt, denkt der First Ser-
geant Dick Bowley verstört, aber seltsam ist es doch.
Wären wir auf der Straße geblieben, hätten uns die Rebellen vielleicht nicht in die Falle gelockt. Wir sind mitten hineingeritten. Verflucht seltsam, was Dweller da gesagt hat, als wir kurz vor dem Hohlweg waren, schon verdammt seltsam, was?
Da waren wir auf der Straße, über die alle Stunden Patrouillen reiten, aber Brendan läßt uns genau hierher fahren. Die Rebellen müssen Zeit gehabt haben, hier Versteck zu spielen. Verdammt, ich kenne Brendan, aber Dweller hat da was gesagt, und so unrecht klingt das gar nicht. Brendan ist wirklich ein ehemaliger Rebell. Sieht man die Sache so, dann stinkt es hier verdammt nach Verrat.
Bowley blickt auf das leichenblasse, gelblich schimmernde Gesicht des Lieutenants Cal Brendan und schluckt.
Großer Gott, denkt Bowley, ich werde nicht der einzige Mann bleiben, der auf die Idee kommt.
Verrat ist eine verflucht schmutzige Sache.
Die Rebellen haben gewußt, daß wir herkamen.
Kein Zweifel, so ist es gewesen.
Mann, Brendan, solltest du etwa…
Bowley denkt es jetzt.
Und andere später.
*
Der kleine Mann sichert und sieht sich um.
Ich weiß nicht, denkt Jackson, das verfluchte Gefühl in mir, ich hätte nicht durch das Bayou gehen sollen, aber es ist sicherer als alle anderen Pfade.
Er hebt die Hand, rührt sich nicht im Sattel. Hinter ihm stehen die Pferde still. Nur der Second fragt leise und gepreßt, was los sei da vorn.
Den hat’s erwischt, denkt Little Jackson bitter, sechs Mann verwundet, davon sind zwei gestern gestorben. Mit den anderen vier Toten nun ein halbes Dutzend. Wofür, für hundertachtzig Gewehre und einige Schuß Munition? Dafür sechs Tote auf unserer Seite, ein Dutzend auf der anderen?
Stille, absolutes Schweigen im Schilf, durch das der Pfad läuft. Irgendwo quaken Frösche, das ist der einzige Laut in der Nacht über dem Sumpf.
»Weiter«, sagt Jackson nach einer Minute leise. »Daß mir keiner die Lappen von den Nüstern der Pferde nimmt. Kein Wiehern hier und später. In einer Viertelstunde sind wir heraus.«
Er läßt die nächsten Männer und die Packpferde vorbei. Dann hält er sich neben dem bleichen Second-Lieute-
nant.
»Geht es, Jeff?«
»Schon besser«, murmelt Taylor und klappert plötzlich mit den Zähnen. »Ich – kann es – verdammmt lange – aushalten.«
»Ja«, sagt der kleine Mann und blickt weg. »Wir sind bald raus, diese Nacht noch schaffen wir es, über die Linien zu schleichen. Morgen hast du einen Doc, Second, morgen.«
Jackson reitet an, schiebt sich langsam wieder nach vorn. Morgen? Den Jungen hat das Sumpffieber erwischt. Nur bei dem wird ihm mal heiß und dann wieder kalt. Ich hab’ Cal er-
wischt, aber der Gaul fiel auf ihn. Muß wohl eine Kugel der eigenen Leute gewesen sein. Ob die ihn mit einem von uns verwechselt haben? Von uns hat keiner auf sein Pferd geschossen, weiß ich genau.
Hinter Jackson ist Wescomber, ein hagerer Mann, kalt bis ins Mark. Danach drei Packpferde, der nächste Mann, ein Verwundeter.
Schatten sind vor Jackson – Nebelschwaden hängen um geisterhaft leuchtende Faulbäume. Sie wirken wie Laternen in dieser feuchten, schweren Luft.
»Jackson?«
»Was ist, Wescomber?«
»Du, ob die uns noch suchen?«
»Weiß nicht, könnte sein.«
»Und wenn sie uns schnappen?«
»Haben wir Pech gehabt, Mann. Sei jetzt still, ich muß mal horchen.«
Nur Fröschequaken ist zu hören, sonst alles ruhig.
Wasser ist vor ihnen, durch das die Pferde vorsichtig waten. Und dann fe-
stes Ufer, endlich kein Schilf mehr.
»Mann, wir sind draußen, was?«
»Halt’s Maul, Wescomber! Keiner redet, absolut leise weiter. Haltet die Waffen bereit.«
Wescomber schweigt erschrocken. Die anderen atmen auf, als sie weiter auf festem Boden langsam vorankommen und den Sumpf hinter sich lassen. Bäume in einer Reihe vor ihnen, eine Straße im Dunst.
Jackson hält, die anderen rücken auf, halten und warten.
»Ich gehe zu Fuß hin, klar? Seid ruhig, bis ich zurück bin.«
Jackson duckt sich, nimmt nur den Revolver mit. So huscht er auf die Baumreihe zu. Das letzte Stück kriecht er. Er ist so vorsichtig wie nie, als er an den Graben neben der Straße kommt und den Fahrdamm erreicht. Alles ruhig, nur weiter westlich rumpeln Wagen durch die Nacht, schimmert irgendwo ein Licht.
Beldon House, denkt Jackson, da drüben, das Licht, das muß es sein. Wir sind richtig geritten. Wenn Cal nun geredet hat? Ich bin nördlich durch den Sumpf gekommen, da kennt ihn kaum einer, höchstens ein paar Chicka-saw-Indianer-Scouts der Yankees, die kennen sich hier aus. Aber hier ist der Sumpf so dreckig, daß nicht mal ’n In-dianer in ihm herumpaddelt auf seinen Schilfrohrflößen.
Er denkt an Cal Brendan, an ihre Zeit im Sumpf. Hier oben waren sie nie zusammen, er war nur allein zweimal am Nordrand. Davon kann Cal nichts wissen. Bestimmt hat er geredet und ihnen gesagt, daß Jackson durch den Bayou-Sumpf verschwinden würde. Aber so weit nördlich?
Jackson liegt drei, vier Minuten im Graben und lauscht. Dann dreht er um, huscht zurück.
»Frei!« sagt er kurz. »Folgt mir, aber geht neben den Pferden her!«
Zwei Minuten darauf sind sie an der Straße und über sie hinweg. Sie entfernen sich, während Jackson zurückbleibt und die Fährte verwischt. Danach holt er die anderen ein.
»Aufsteigen, weiter!«
Er flüstert nur und führt wieder. Hufgetrappel ist in der Nacht, Räderrasseln nähert sich auf der Straße.
»Halten!«
Kaum hat er es gesagt, als es hinter ihm passiert. Plötzlich ist das Gepolter, danach folgt ein lautes, durchdringendes Geklapper. Die Gewehre, denkt Jackson noch, eine Gewehrladung ist heruntergestürzt und auseinandergebrochen, großer Gott!
»Rinacon, du Idiot!«
Also Rinacon ist das passiert.
»Ssst!«
Jackson zischt, so scharf er kann. Rufe im Dunst, ersterbender Hufschlag auf der Straße, das Ausrollen von Rädern.
»Ruhe, da war doch was? He, Corporal, da rechts hat etwas gekracht, reiten Sie mal hin!«
Allmächtiger, denkt Jackson, das jetzt, wo wir beinahe draußen sind und nur noch fünf Meilen bis zu unseren Linien haben.
»Runter, stehen, nicht bewegen!«
Plötzlich ist die Angst da, er kann gar nichts gegen sie tun. Die Angst schnürt ihm die Kehle zusammen. Sie stehen an ihren Pferden, der letzte Mann kaum sechzig Schritte von der Straße entfernt.
Hufschlag setzt ein, tackt los.
Rufe laut und deutlich: »Blunter, mal nach rechts, Shamrock, sieh linker Hand zu. Los, Leute!«
Vier Pferde kommen, halten aber Abstand voneinander. Sie bilden da vorn eine Kette, die Yankees. So stoßen sie in den Dunst hinein. Und im Dunst stehen oder liegen zehn Rebellen neben oder auf ihren Pferden.
Aus, denkt der kleine Mann, plötzlich weiß er es, es ist aus, ganz einfach vorbei. Man wird sie entdecken. Auf der Straße stecken mindestens achtzig, wenn nicht hundert Mann. Und die werden nicht lange zaudern, wenn es erst einmal kracht.
Ein Reiter taucht aus dem Dunst auf, kommt näher. Der Mann sitzt steif aufgerichtet im Sattel.
Wescomber hebt den Arm. Jackson sieht es, diese Bewegung mit dem Colt, die unabänderlich ist und den Tod bringt.
Warum sieht er sie denn nicht, der Yankee, warum reitet er weiter, als wolle er an ihrer ganzen, langen Linie vorbeiparadieren?
Augenpaare verfolgen ihn, lassen ihn nicht los, diesen Reiter. Stumm, unbeweglich stehen sie im Dunst. Und dann ist es nicht jener Dragoner aus irgendeinem der Nordstaaten, der sie entdeckt. Es ist hinten bei Rinacon, der seine Ladung nicht genug kontrolliert hat und vor Entsetzen bleich geworden ist.
Rinacon sieht den Reiter kommen, einen der anderen, die man ausgeschickt hat. Der Yankee trabt heran.
Rinacon kann sich noch nicht bewegen. Nur der eine Gedanke schießt immer wieder durch seinen Kopf: »Ich bin schuld, ich bin schuld!«
Dafür ist es Locum, Rinacons Vordermann, der den Arm hebt.
Und dann…
Der Yankee hält jäh an, zieht an den Zügeln des Pferdes.
»Eh, Parole? Wer seid ihr da? Parole!«
»Bluestream!« sagt Locum und hat den Arm schon hoch, die Waffe auf den Yankee angeschlagen. »Was willst du denn, he?«
»Was hast du da gesagt, was ist Parole?«
»Du Idiot, laß mich in Frieden mit deiner Parole!« erwidert Locum wütend und zielt mitten auf die Brust des Yankees. »Verdammt dreckiges Wetter, was? Wo kommt ihr denn her?«
Der bewegt sich, der Yankee, der angelt nach seiner Waffe, Locum merkt es.
Dann entdeckt er aus den Augenwinkeln den zweiten Mann etwas weiter rechts, dort hält der nächste Yankee.
»Nenn die Parole, Mister!«
»Mensch, du bist närrisch?« knurrt Locum. »Ich bin naß wie eine Katze, habt ihr auch Regen gehabt?«
»Zum letztenmal, die Parole!«
Es geht schief, denkt Jackson, das klappt nicht, der Yankee ist stur, den wickelt Locum nicht ein.
»Was ist da hinten los?« sagt Jackson scharf in den Dunst hinein. »He, hier ist Lieutenant Weston. Vierte Kavallerie! Was soll das dort, Corporal?«
Einen Moment ist es still. Schon glauben sie, daß Jacksons Trick Erfolg haben könnte, aber…
»Sir, die Parole!«
Du verdammter, sturer Hund, denkt Locum bitter, so stur kann nur ein Ire sein. Ich wette, der Halunke ist Ire, sonst würde er nicht so stur fragen.
»Wer sind Sie, welche Einheit?« fragt Jackson.
»Achte Dragoner, Sir. Sir, die Parole!«
Der ist selbst schuld, wenn er vom Gaul fällt, denkt Locum.
Dann sieht Locum nach rechts, der Schatten dort nähert sich. Der nächste Yankee kommt argwöhnisch heran, Schritt für Schritt.
Und dann… Von weit hinten Hufschlag. Man muß Rede und Gegenrede an der Straße gehört haben.
»Haskell, was ist dort?«
»Reiter von der Vierten, ein Lieute-
nant Weston, Major. Er nennt die Parole nicht.«
»So?«
Der Hufschlag kommt rasch näher. Hinter jenem Mann vor Locum hält der Gaul an.
»Parole?«
Aus, denkt Jackson, jetzt ist es vorbei.
Im gleichen Augenblick hat sich der Yankee rechts von Locum weit genug herangeschoben. Und wie der Teufel es will, tritt auch noch der Mond aus den Wolken. Er fällt auf den Dunst und bringt jäh Helligkeit mit.
»Rebellen!« gellt der Schrei über die Wiese. »Major, das sind Rebel…«
In diesem Moment drückt Locum ab. Er hat auf den Major gezielt, den Lauf etwas herumgenommen und feuert.
Vor ihm ein schriller Schrei, das Wanken des Mannes im Sattel. Locum taucht weg, reißt sofort sein Pferd herum und sieht Rinacon schwanken, ehe er schießen kann. Im Krachen des Schusses neigt sich Rinacon nach links und stürzt vom Gaul.
An drei, vier Stellen ist plötzlich das Krachen. Feuerlanzen brechen durch den silbern schimmernden Dunst. Pferde wiehern grell los, gehen durch.
»Zurück!« bellt Jacksons scharfe, heisere Stimme dazwischen. »Alles mir nach!«
Wescomber feuert rasend schnell, sieht Pferd und Reiter zusammenkrachen und jagt dann hinter Jackson her.
Fort, nur fort und wieder in den Sumpf!
Links von ihnen hört man Hufgetrappel auf der Straße und heisere Schreie:
»Rebellen! Absichern, sperrt die Straße! Vorrücken, Zug sieben!«
Mein Gott, denkt Locum und jagt zurück, das geht nicht gut. Die kommen zu schnell.
Er erkennt noch, daß Jackson nach Süden biegt und einen Bogen schlagen will. Aber sie, die hinteren Leute, kommen nicht schnell genug nach. Auf sie preschen plötzlich Reiter zu.
Locum schießt im Wegjagen, hört das Singen der Kugeln, bis etwas ihn anstößt. Die Kraft verläßt plötzlich seine Arme, er rutscht und spürt den Aufschlag noch. Dann wird es dunkel um ihn.
Pferde bleiben schnaubend stehen, Reiter kommen rasend schnell näher.
»Dorthin sind sie, dorthin! Ihnen nach, schnell doch, sie reiten auf den Sumpf zu!«
Jackson hört die Rufe, Kommandos, das Krachen von Schüssen.
Das Wasser ist vor ihm, die Straße liegt schon weit zurück. Er muß jetzt führen, sonst reiten sie mitten in den Sumpf und werden versinken.
»Aufschließen, schnell, schließt eng auf!«
Hinein, über schmatzenden, gurgelnden Boden, wieder hinein in den verfluchten Sumpf.
Jetzt holen sie Chickasaws, denkt Jackson, und er ist irgendwie müde und krank bei diesem Gedanken, nun holen sie Chickasaw-Indianer-Späher. Die finden uns, wir kommen nicht mehr heraus, nie mehr, wenn nicht in dieser Nacht.
Hinter ihm ist das Schnauben der Pferde, fluchende Männerstimmen und dann laute Schreie:
»Halt, zurück, nicht weiter, da beginnt der Sumpf! Nicht weiter durch das Wasser und ins Schilf, ihr versinkt!«
Noch vier Stunden bis Sonnenaufgang, nicht mehr. Dann ist die ganze Gegend rebellisch. Sie werden überall ihre Patrouillen haben, zwanzig, dreißig vielleicht, wenn nicht mehr. Kommt Tageslicht, werden sie auch Spuren sehen, die Jackson nun nicht mehr verwischen kann.
»Durchzählen!« sagt Jackson heiser nach hinten, als sie gut achthundert Schritte im Sumpf sind und nur noch weit entfernte Kommandos gehört werden. »Durchzählen, wieviel Mann noch?«
Wescomber nennt seinen Namen, Laine danach. Dann Sturgis, Alderson, der für den Second gleich mitruft. Maders meldet sich heiser. Und danach…
»Maders, was ist?«
»Keiner mehr, Matt.«
»Was?«
Sieben Mann, sieben, großer Gott! Sieben von sechzehn!
»Haltet, wartet, vielleicht kommt noch jemand.«
Sie warten, aber es rührt sich nichts mehr. Die Stimme des Second kommt dünn und zitternd durch die Nacht:
»Matt, in vier Stunden ist es hell.«
»Ja«, sagt Jackson heiser. »Dreieinhalb Stunden etwa.«
»Kommen wir raus, Jackson?«
Er sagt nichts, er preßt die Lippen zusammen. Dann hört er Taylors Geflüster:
»Chickasaws. Sie werden Indianer holen. Und vielleicht auch Bluthunde. Matt, antworte: Wie sieht es aus?«
»Was willst du hören, Second?«
»Wie groß ist unsere Chance, Matt, sage es uns!«
»Nun, Jeff, vielleicht dauert es bis gegen Vormittag, dann sind Indianer da. Wir kämen jetzt vielleicht noch hinaus, vielleicht.«
»Hör mal, Matt, du weißt doch, wie langsam wir durch den Sumpf vorankommen. Wo man auf festem Land zwei Stunden braucht, muß man hier mit zehn bis zwanzig rechnen, stimmt doch, oder?«
»Ja«, sagt der kleine Mann leise. »Die Chance steht auch eins zu neunundneunzig, jetzt noch rauszuschleichen. Man könnte es versuchen. Ist gleich, ob wir alle sterben, gelohnt hat es sich dann doch nicht.«
Sie schweigen und sehen weg. Sechs Mann, drei verwundet. Und Jackson ist Nummer sieben.
»Matt, würdest du allein durchkommen?«
»Ich pfeife drauf, ich gehe nicht allein weg«, sagt er bissig. »Fang nicht damit an, ich würde nie gehen.«
»Matt, einer muß durchkommen.«
»Gib dir keine Mühe, Second. Ich will nicht weg, ich bleibe. Vielleicht erwischen uns die Indianer doch nicht, es gibt immer Wunder.«
»Matt, was ist mit mir? Ich habe Sumpffieber, stimmt das?«
»Ich weiß nicht.«
»Du lügst! Matt, ich habe also Sumpffieber, und bei uns gibt es keine Medizin, was? Wenn ich auch durchkäme, ich müßte wahrscheinlich sterben, ist das richtig? Ist es richtig, daß ich die anderen anstecken würde, dich auch?«
»Mich nicht«, sagt Jackson heiser. »Ich hab’s schon mal gehabt, mich packt das nicht wieder.«
»Großer Gott!« stößt Laine durch die Zähne. »Matt, jetzt heraus mit der Wahrheit: Wenn wir zusammenbleiben, dann steckt uns der Second an, und wir sterben vielleicht alle. Ist es so, Matt?«
»Es könnte so kommen, sicher ist es nicht, Laine.«
»Verdammt, Second, was sagen Sie, wollen wir hier zusammen von Chickasaws oder vom Fieber erwischt werden?«
Der Second schweigt, seine Zähne schlagen wieder mal aufeinander. Es dauert Minuten, bis der Schüttelfrostanfall vorüber ist.
»Matt?«
»Ja, Taylor?«
»Sie wissen längst, daß wir ihren Transport überfallen haben, sie haben ja die anderen Packpferde gefunden mit den Waffen.«
»Sicher«, murmelt Jackson kühl. »Noch was, Second?«
»Yes, Alter, sie werden, wenn wir uns schnell stellen und unseren Leuten, die es vielleicht da hinten überlebt haben, Bescheid sagen können, etwas glauben. Willst du wissen, was?«
»Ich weiß es. Sie werden glauben, das sind alle gewesen, wenn ihr euch stellt. Sie werden ihre Patrouillen zurückziehen und jede Suche aufgeben. Das wäre eine Chance für mich, durchzukommen, meinst du das?«
»Genau das, Matt. Du schaffst es, oder?«
»Ich will es nicht schaffen. Wie soll ich Captain Bennet unter die Augen treten? Ich, der Scout, ich gebe auf, no!«
»Du mußt! Das ist ein Befehl, Matt.«
»Ich mache, was ich will. Also gut, stellen wir uns alle. Schmeißen wir die Waffen in den Sumpf, damit sie wenigstens die nicht bekommen. He, fangt an, sie loszubinden, ich führe euch zu einer Stelle, die tief genug ist und voller Morast unter der Wasserfläche.«
»Matt, du mußt zurück. Sie müssen erfahren, was passiert ist, verstehst du denn nicht?«
»Nein«, sagt der kleine Jackson finster. »Ich will nicht verstehen, Second, denn sonst müßte ich anfangen nachzudenken. Ich würde mich fragen, warum ich gegen mein besseres Wissen noch mitgemacht habe. Du bist nicht schuld, Second, ich bin’s, der neun Männer auf dem Gewissen hat. Und noch ein paar Yankees dazu. Sie reden wie wir, sie essen wie wir, wir haben alle Dinge gemeinsam. Und wir haben uns umgebracht wie Tiere. Wofür, Second, frage ich dich, wofür denn? Für die Drecksgewehre, die jetzt ohnehin in den Sumpf fliegen? Yeah, wenn sie Briten wären, oder Franzosen, oder Spanier, was weiß ich, eben Fremde, die in unser Land gekommen und es besetzt hätten, dann würde ich nicht lange nachdenken, aber…«
Er macht eine Pause, der kleine Mann, holt tief Luft.
»Es ist sinnlos geworden«, murmelt er dumpf. »Wir wissen doch, daß sie immer neue Menschen heranschaffen, neue Waffen, Tausende von Kanonen. Daß sie zu essen haben, bis es ihnen aus den Ohren quillt. Und wir? Bei uns ist das letzte Zucken schon da, Second. Du weißt das, alle wissen es, aber wir sind Texaner und stur, hart, wir beugen uns nie. Nicht in hundert Jahren. Nur wird es, wenn wir weiterkämpfen, keine Texaner mehr geben. Und das lohnt sich nicht. Ist gut, ich gehe, ich komm auch durch. Ich werde diesen Wahnsinn weiter mitmachen, bis den Leuten ganz oben einfällt, daß es nur noch Tod und sonst nichts geben kann. Ich gehe also, und ihr kommt durch, wenn auch hinter Stacheldraht. Ich werde an euch denken und meine Narrheit verdammen, die euch in Gefangenschaft gebracht hat. Ich gehe, gut, ich gehe. Ich würde lieber tot sein.«
Er sieht keinen an. Er wird gehen. Und durchkommen. Auch die anderen sechs Mann. Eines Tages wird er an Brendan denken und sich fragen, was aus ihm geworden ist. Eines Tages – lange danach.
*
Sie sollen aufhören, denkt der Mann und starrt durch das Fenster in den Himmel. Wolken jagen nach Norden, und zwischen Sonnenschein folgen einzelne Regenschauer wie jetzt, sie sollen mich in Ruhe lassen.
»Antworten Sie, Lieutenant! Warum sind Sie von der Nachschubstraße abgebogen? Lieutenant Brendan, warum gaben Sie den Befehl?«
Er liegt still, er kann nur ganz langsam den Kopf bewegen und wendet ihn mühsam den vier Offizieren zu. Sie stellen immer wieder dieselben Fragen, seit Monaten.
»Ich habe es zwanzigmal gesagt«, erwidert Lieutenant Cal Brendan leise. Er spürt den Schmerz im Rücken, dieses ständige, leise Nagen irgendwo an den unteren Wirbeln des Rückgrats. Sobald er sich bewegt, ist es da. »Ich entdeckte die Spuren der Rebellen. Sie führten auf den Wald zu. Das war der günstigste Platz für einen Überall, Sir. Ich mußte die Kolonne um den Wald führen.«
»Gegen Captain Dwellers Willen, Mr. Brendan?«
»Ja, ich hatte schließlich das Kommando und die Verantwortung, Colonel!«
»Aber Dweller wollte, daß Sie auf der ständig kontrollierten Nachschubstraße bleiben, war es so, Lieutenant?«
»Er wollte es, ja! Aber ich war überzeugt, daß die Rebellen im Wald steckten.«
Einen Moment schweigen sie. Ihre bohrenden, pausenlosen Fragen verstummen.
Sie sind wahnsinnig, denkt der gelähmte Mann in seinem Hospitalbett und blickt starr auf die Decke. Dweller ist ein Kriegsheld geworden. Einen Orden für außergewöhnliche Tapferkeit hat man ihm nach seinem Tod verliehen und ihn außer der Reihe zum Major befördert. Na ja, was hilft ein Orden und eine Beförderung einem Toten? Gut, er hat sich geopfert, als er den Wagen herausfuhr. Sonst wären alle Wagen, Männer und sämtliche Waffen in die Luft geflogen. Statt vierzehn Toten eben dreißig. Hätte ich Dweller gar nicht zugetraut, so viel Mut.
»Noch mal, Lieutenant: Sie blieben an der Kolonne, statt weiter vor ihr zu sichern. Möglicherweise hätten Sie dann die Rebellen entdeckt. Wenn Sie vorausgeritten wären, hätten Sie die Rebellen aufstöbern können, ist das richtig?«
»Vielleicht…«
»Antworten Sie nicht mit Ausflüchten, Lieutenant. Haben Sie sich von den Wagen entfernt oder nicht?«
»Nein, Sir. Ich mußte bleiben, weil ich fürchtete, daß Captain Dweller allein mit seinem Wagen losfuhr und zum Nachschubweg hinüberlenkte. Ich war sicher, daß ihn dann die Rebellen fangen würden.«
»So, Sie waren sicher?«
»Ja, ich war sicher, Sir!«
»Wären Sie das heute auch noch, Mr. Brendan?«
»Ja, unter denselben Umständen!«
»Und Sie würden dieselbe Entscheidung treffen?«
»Ja, Sir!«
»Lieutenant, was sagt Ihnen der Name Mitchell?«
»Mitchell, welcher Mitchell?« fragt er. »Ich kannte einen Mitchell im Nachschubdepot.«
»Den meine ich nicht, Lieutenant, ich meine Major James Mitchell. Kennen Sie den Mann?«
»Major James Mitchell? Nein, Sir!«
»So? Und wenn Sie ihn nun doch gekannt haben? Er war nicht immer Major. Vor dem Krieg besaß er eine Plantage in Louisiana, nicht weit von der Plantage Ihrer Eltern, Mister Brendan. Nun, kennen Sie ihn immer noch nicht?«
Mitchell, denkt Brendan, James Mitchell, richtig. Ein kleiner, drahtiger Mann, ein Pflanzer und Südstaatenanhänger, Südstaatenanhänger?
Vielleicht hat er mit den Lidern gezuckt, denn jemand sagt laut und heiser:
»Aha, jetzt erinnert er sich!«
»Ja, ich kannte ihn flüchtig, vor dem Krieg!«
»Nur vor dem Krieg, oder auch während des Krieges, Brendan? Antworten Sie! Sie hatten Verbindung zu Mitchell?«
»Wie sollte ich, ich habe ihn jahrelang nicht gesehen, Sir.«
»Auch nicht geschrieben, keine Briefe von ihm bekommen, Lieutenant?«
»Nein, Sir, nie! Was wollen Sie von mir, Colonel? Ich habe Mitchell gekannt, ganz flüchtig nur. Ich wußte bis jetzt nicht mal, daß er Major gewesen ist. Wo, auf Südstaatenseite doch?«
»Natürlich auf Südstaatenseite, Mr. Brendan«, sagte einer der anderen sarkastisch. »Er hat die Gegenspionage auf der anderen Seite geleitet. Und Sie wollen ihn nicht gekannt haben? Seltsam, wie?«
»Sir«, sagt Brendan dünn, »wenn ich gesund wäre, dann würde ich Sie fordern. Sie denken, daß ich der Mann gewesen bin, der den Rebellen den Transport und ein Dutzend andere verraten hat, weil ich jede Woche einige Tage im Hauptnachschubcamp zu tun hatte und alle Transportzeiten kannte. Das denken Sie doch alle, wie? Man hat mir gesagt, daß die Rebellen einen Befehl hatten, nicht auf den Kurierwagen zu schießen, weil sie wußten, daß im Kurierwagen Sprengmittel lagerten. Hätten die Rebellen die Kisten getroffen, wären sie in die Luft geflogen. Und mit ihnen die ganzen Waffen. Ich wußte nichts von jenen Kisten, ehe ich losfuhr, ich wußte nicht mal etwas von Captain Dwellers Erscheinen an der Kolonne.«
»Sie wußten nichts, aber sonst wußten Sie doch alles?« fragt der Colonel kühl. »So, Ihrer Meinung nach hatten die Rebellen nur wegen der Sprengmittel Befehl, nicht auf den Wagen zu feuern. Was würden Sie sagen, Mr. Brendan, wenn es noch etwas auf dem Wagen gab, was die Rebellen haben wollten, das nicht durch eine Explosion zerstört werden durfte?«
»Noch etwas?« murmelt Brendan verstört. »Was denn?«
»Zum Beispiel sechsundsiebzigtausend Dollar, die Löhnung für die Armee von General Banks!«
»Sechsundsiebzigtausend Dollar?« stottert Brendan. »Das ist ja – das ist…«
»… die Wahrheit, die Ihnen bisher niemand gesagt hat, Brendan«, unterbricht ihn der Colonel eisig. »Oder haben Sie es gewußt, wußten Sie von der Löhnung, vom Truppensold? Sie haben es nicht gewußt. Die Rebellen wußten es auch nicht. Diese Sendung stand unter höchster Geheimstufe. Ganz gewöhnliche Kisten waren es, in denen das Geld verpackt war. Sprengmittelkisten, Mr. Brendan, die unter wirklichen Sprengmitteln steckten. Sie wußten nur von den Waffen, wie? Die Rebellen auch!«
Mein Gott, denkt Brendan, das ist ja Wahnsinn, ich habe davon keine Ahnung gehabt, ich wußte nichts.
»Ich verstehe«, sagt er tonlos. »Ich habe nichts gewußt, die Rebellen auch nichts. Aber, Sir, da ist doch Major Mitchell. Warum fragen Sie Major Mitchell denn nicht, ob ich Verbindung mit ihm hatte?«
»Das haben wir getan. Und er hat uns eine prächtige, interessante Geschichte erzählt über Sie, Brendan. Nun, wollen Sie endlich gestehen?«
»Sir, ich habe nichts zu gestehen. Wenn Mitchell irgend etwas behauptet dann lügt er, um einen anderen zu decken! Gott im Himmel, ich habe nichts als meine Pflicht getan, jahrelang. Und Sie erklären mir, wenn auch nicht direkt, ich sei ein Verräter gewesen. Sir, Sie haben mich die ganzen Jahre gekannt, Sie kennen mich doch alle!«
»Wer kann in die Seele eines Mannes sehen?« kommt die kühle, finstere Antwort. »Brendan, Sie stehen unter Arrest bis zur Verhandlung. Ob diese in Ihrer Gegenwart geführt werden kann, haben die Truppenärzte zu bestimmen. Sie werden verdächtigt, dem Gegner laufend Informationen geliefert zu haben. Alles, was Sie von nun an sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Haben Sie richtig verstanden, Mr. Brendan?«
Die Decke, denkt Brendan, die Decke stürzt ein und schlägt mich tot. Das kann nicht wahr sein, das können die doch nicht mit mir machen! Ich habe doch nur meine Pflicht getan.
»Sir, haben Sie Matt Jackson gefangen, haben Sie ihn verhört? Sie haben doch diesen Second-Lieutenant Taylor, der muß doch wissen, daß ich kein Verräter bin. Sir…«
»Diese Männer bekamen eine versiegelte Order von Major James Mitchell!« unterbricht ihn der Colonel kalt. »Die Order war zu verbrennen. In ihr stand nichts über den Mann, der den Rebellen die Informationen lieferte. Nur ein Mann wußte, wer der Verräter war, Major James Mitchell.«
»Wußte – wußte?« fragt Brendan. »Aber es muß doch Aufzeichnungen geben. Sir, was ist mit Mitchell?«
»Seine Aufzeichnungen hat er selbst alle verbrannt, die gesamte Liste seiner Agenten und Spione in unseren Reihen!« erwidert der Colonel eisig. »Danach ist er mit einer Gruppe fanatischer Rebellen losgeritten und hat versucht, General Banks im Hauptquartier zu erschießen. Er ist dabei gefallen. Das ist alles für heute, Mr. Brendan. Sie stehen unter Arrest!«
Er liegt still in seinem Stützkorsett aus Gips, er ist ein lebender Leichnam und wird vielleicht nie wieder gehen, geschweige denn reiten können.
Und sie sagen, sie stellen ihn vor ein Armeegericht, weil er ein Verräter ist.
Cal Brendan – der Verräter!
*
»Junge«, sagt sie ganz leise und zitternd. »Junge, mein Junge…«
Es ist schon Herbst. Die Blätter fallen, die Bäume werden kahl. Der Wind weht böig und peitschend um die Mauern des Hospitals. Der Sommer ist vergangen mit seinen kurzen Nächten und langen Tagen, mit Verhören und endlich jener Verhandlung in Abwesenheit. Nur zur Urteilssprechung sind sie noch einmal hereingekommen. Danach hat es noch Wochen gedauert, bis sie seine Eltern endlich zu ihm gelassen haben. Nun sind sie hier, und seine kleine, weißhaarige Mutter sitzt neben seinem Bett auf dem Stuhl, während sein Vater am Fenster lehnt und hinausblickt.
Sie weint in sein Kissen und streicht ihrem Sohn über das Haar. Der alte Mann am Fenster hört das Schluchzen, blickt starr hinaus und preßt die Lippen fest zusammen.
»Junge, was haben sie mit dir gemacht? Cal, mein Junge, du bist so blaß. Hast du Schmerzen?«
»Nein, Mutter«, sagt er leise. »Es geht mir besser. Sie haben einen guten Arzt hier. Cox Lewis ist ein feiner Bursche. Er hat mir das Gestell gebastelt und hingehängt. So kann ich mich schon hochziehen.«
Sie weint wieder, sie denkt daran, daß er immer aufrecht und gerade ging. Jetzt muß er sich an einem Querstock, der wie eine Schaukel von der Decke herabhängt, hochziehen. Und dabei hat er immer noch Schmerzen im Rücken. Stehen darf er nicht, er könnte es wahrscheinlich auch gar nicht.
»Mutter, mir geht es gut, wirklich, du kannst es mir glauben.«
»Wirklich, Junge, wirklich?«
»Ja, ich kann sogar schon wieder aus dem Fenster sehen.«
Am Fenster ist ein Hüsteln zu hören. Der alte William Brendan wendet sich um.
»So – geht es dir gut? Lewis meinte, in zwei Monaten könnten wir dich hier abholen. Dann würde es kein Risiko mehr für dich sein, eine Wagenfahrt im Liegen auszuhalten.«
»Dad, du wirst fragen«, sagt Cal ruhig. »Ich habe nichts anderes zu sagen als das, was ich geschrieben habe. Ich mußte sie offen abgeben. Dad, nichts an allem, was sie geschrieben oder geredet haben, ist wahr. Ich habe nie jemandem Informationen geliefert.«
Der Alte nickt, brummelt unwirsch:
»Was soll das? Hätte ich eine Sekunde an dir gezweifelt, wäre ich nicht hier. Ich habe diesen Narren meine Meinung gesagt.«
»Du hättest das nicht tun sollen. Für sie bin ich ein Verräter, dem sie nur nichts beweisen konnten, Dad!«
Der alte Mann sieht ihn scharf an, zerrt und zupft an seinem Bart.
»Verräter, wenn ich das Wort nur höre. Diese Narren, sie sind ja nicht normal.«
Brendan liegt still. Er blickt seine Mutter nicht an, nur seinen Vater. Und plötzlich weiß er, daß der alte Mann krank ist, krank vor Zorn, daß man seines Sohnes Ehre in den Dreck gezogen hat und damit auch seine.
»So ist das? Die Nachbarn reden?« fragt er gepreßt. »Ihr habt wohl meinetwegen etwas Ärger?«
»Junge, was du denkst…«, flüstert seine Mutter schnell. »Du kennst doch unsere Nachbarn. Es waren Südstaatler, die meisten jedenfalls. Für sie könntest du nur…«
»Was?« fragt er, ehe der alte Mann etwas sagen kann. »Für den Süden ein guter Mann – oder was sonst? Und die anderen Nachbarn? Sie reden doch, sie schneiden euch, oder?«
»Das – das kann man nicht schneiden nennen, Sohn«, murmelt der alte Mann finster. »Ihre verdammte, falsche Freundlichkeit nach außen. Ich kann sie nicht mehr ansehen, ohne daß mir schlecht wird. Diese verlogenen Gesichter und Augen, hol’s der Teufel!«
»William, der Junge ist krank. Wir wollten doch nicht darüber reden, William.«
»Mutter«, sagt Brendan ganz gelassen. »Ich habe viel Zeit gehabt, nachzudenken, das kannst du mir glauben. Sicher habe ich über euch und unsere Nachbarn nachgegrübelt. Ich weiß schon einige Zeit, wie Menschen sein können. Heute lieben sie dich, morgen bist du ihnen verhaßt.«
Er hört ihre heftigen Atemzüge und blickt seinen Vater an.
»Dad, hast du direkten Ärger?«
»Nein, den nicht, aber man merkt es, daß nichts mehr wie früher ist und sein wird. Wir hatten eine Menge Freunde, sogar oben in Washington. Ich bin schließlich nicht irgendwer. Aber sie haben es vergessen. Mich stört es nicht, ich habe schlimmere Dinge erlebt. Es regt mich nur auf, daß sie dich ohne Angabe von Gründen entlassen haben. Das ist genauso schlimm, als hätten sie es dir auf die Stirn gebrannt, daß du für sie ein Verräter bist. Entweder wird man ehrenhaft aus der Armee entlassen, oder man stößt jemanden unehrenhaft aus. Das Mittelding ist die Entlassung ohne Angabe von Gründen. Du hast deine Pflicht getan die ganzen Jahre. Und dann versagst du einmal. War es ein Versagen?«
»No, Dad«, antwortet Brendan leise. »Ich habe mir hundertmal überlegt, was ich anders hätte tun sollen. Es gab jedoch keine andere Möglichkeit für mich. Wenn es irgendeinen Fehler an der Sache gegeben hat, dann den, daß ich nicht auf freiem Gelände hielt und die nächste Patrouille abwartete. Das hätte jedoch meinem Befehl widersprochen, ohne Aufenthalt den Transport ans Ziel zu bringen. Bei der ganzen Sache gibt es einige Ungereimtheiten, seltsame Dinge, die unbegreiflich sind für mich.«
»Und was sind das für Dinge?«
»Alles, was mit Captain Dweller zusammenhängt, Vater!«
»Mit Dweller, diesem untadeligen Mann, der sein Leben verlor, um das anderer zu retten, Junge!« fragt der Alte verstört. »Man hat mir nicht erlaubt, die Protokolle zu lesen, aber ich hab’ dennoch alles erfahren. Einige Verbindungen sind mir ja geblieben. Was ist mit Dweller?«
»Nichts, was für mich in Ordnung wäre«, gibt Brendan zurück. »Ich begreife nicht, warum kein anderer daran gedacht hat, aber ich liege hier und beschäftige mich seit Monaten nur noch mit dem Captain, Dad. Da gibt es zuerst zwei Fragen, und auf jede einige Antworten.«
»Ich verstehe nicht, Junge, was soll das? Der Mann ist tot.«
»Ist er das?«
»Was?«
»Ist er wirklich tot?« wiederholt Brendan grimmig. »Oder lebt er noch? Halte mich nicht für verrückt. Ich weiß, es klingt alles verrückt, was ich sagen werde. Es kommt mir ja selbst völlig närrisch vor, aber es könnte genau passen. Es gibt auf alles eine Antwort, und jedesmal stimmt sie. Da war zuerst mein Zusammenstoß mit Dweller. Er verlangte von mir, daß ich zum Nachschubweg zurückkehren sollte. Er wußte, daß ich im Wald Rebellen vermutete. Er wollte mit aller Gewalt zurück zur Straße. Die Antwort darauf bekommst du gleich. Vorher aber die nächste Frage, Dad: Warum schickte Dweller Fisk vom Wagen? Fisk war auf dem Wagen so sicher wie unter ihm. Und dann, warum fuhr Dweller den Kurierwagen plötzlich selbst? Wo blieb sein Fahrer Mansfield?«
Er macht eine Pause und schließt die Lider.
»Und nun die Antworten«, sagt er danach. »Mansfield war tot. Er muß tot auf dem Wagen gelegen haben, Dad, denn er ist mit ihm in die Luft geflogen. Man hat ihn so wenig gefunden wie Dweller. Uniformfetzen, das war alles. Dweller schreit Fisk an, der Wagen brenne, er solle wegrennen. Und was ist mit Mansfield? Zu der Zeit, als Fisk in den Wagen blickt, lebt Mansfield noch. Dann fährt der Wagen hinter dem Porters her. Porter sagt aus, man habe nicht mehr auf ihn geschossen. Warum nicht? Weil sich der Kurierwagen unmittelbar hinter Porter befand und die Rebellen, wollten sie Porter treffen, erst durch den Kurierwagen schießen mußten. Auf den aber sollten sie auf keinen Fall feuern, besagte ihr Befehl! Jetzt frage ich dich: Wie kann Mansfield sterben, wenn er nicht beschossen und also auch nicht getroffen wird? Dennoch fliegt Mansfield mit dem Wagen in die Luft. Er muß es, denn man hat nichts mehr von ihm gefunden.«
Der alte William Brendan reißt die Augen auf und sieht seinen Sohn bestürzt an.
»Das sind doch nur Ideen, Junge.«
»Nur langsam mit deinem Urteil, Dad«, murmelt Brendan grimmig. »Ich habe auch erst gedacht, ich sei närrisch, aber nach und nach wurde mir alles klarer. Hör zu: Mansfiel muß auf dem Wagen erschossen oder niedergeschlagen worden sein. Wenn Dweller Fisk wegschickte, warum ließ er dann Mansfield nicht abspringen? Wollte er Mansfields Leben retten, mußte er ihn vom Wagen schicken, das ist doch klar, wie? First Sergeant Bowley sah Dweller fahren, nicht Mansfield. Also lag Mansfield zu der Zeit schon im Kasten. Die ganze Sache ist faul, Dad. Dweller war der einzige Mann, der wußte, was auf seinem Wagen war. Er hatte als Nachschub- und Kurieroffizier alle Möglichkeiten, an Transportpläne für die ganze Armee zu kommen. Er war der einzige Mann, der wußte, daß er Geld in den Kisten hatte. Jemand bat ihn, den Sprengstoff mitzunehmen. Das war so vorgeplant, um unter den Sprengstoffkisten andere mit Geld zu verstecken. Dweller wollte mit Gewalt zur Straße zurück. Ich kann dir sagen, warum. Er wollte überfallen werden. Er glaubte mir jedes Wort.«
»Großer Gott, viele Fragen und auf jede eine Antwort«, keucht William Brendan verstört. »Junge, noch verstehe ich nicht alles, aber rede weiter, schnell.«
»Ja«, sagt Brendan kühl. »Dweller schenkte meinen Worten Glauben, tat aber so, als hielte er mich für einen Narren. Er wollte mich veranlassen, die Wagen oder doch ihn mit seinem Kurierwagen zur Straße zu schicken. Dort hätte man ihn überfallen. Er muß den Ort gewußt haben, die Stelle im Wald, an der man wartete. Dieser Rebellen-Second hat ausgesagt, sie hätten Befehl gehabt, im Wald den Überfall zu machen, aber Jackson habe sich geweigert und den anderen Platz am Hohlweg vorgeschlagen. Jackson weigerte sich, weil er erfuhr, daß ich die Kolonne führte. Er wußte, daß ich, erfuhr ich von durchgerittenen und irgendwo verschwundenen Rebellen, den Weg vor den Wagen absuchen würde. Begreifst du, Dad, Jackson änderte den Überfallplan. Das konnte Dweller nicht wissen. Er war sicher, daß man im Wald auf ihn warten würde. Deshalb wollte er unbedingt hin. Er muß seinen Plan fertig gehabt haben. Dweller wollte den Wagen in die Luft fliegen lassen, nachdem er davongejagt war. Er brauchte nur Mansfield und Fisk zu erschießen, dann konnte er mit dem Wagen davonjagen. Er wußte, niemand würde auf ihn feuern. Sie haben nicht auf den Wagen gefeuert, weil etwa Sprengstoff in ihm war, sondern sie schossen nicht, weil sie den Mann nicht treffen durften, der ein Verräter war. Der Mann war zehnmal wichtiger als einige Kisten Sprengstoff.«
»Allmächtiger, das ist eine verdammte Logik!« schnauft der alte Mann heftig. »Junge, wenn Dweller also allein hingefahren wäre, hätten sie ihn überfallen?«
»Nein, wozu?« brummt Brendan. »Sie hätten ihn durchgelassen. Ich bin sicher, wenige hundert Schritte weiter hätte er Fisk und Mansfield umgebracht, Feuer an den Wagen gelegt wie dann auch wirklich im Hohlweg, und schließlich wäre der Wagen in die Luft geflogen. Vorher jedoch hätte Dweller das Geld weggeschafft. Von diesem Geld wußten nicht mal die Rebellen etwas. Dweller fuhr in der Kolonne, um bei dem von ihm geplanten Überfall in den Besitz des Truppensoldes zu kommen. Er brauchte Geld. Seit anderthalb Jahren wurden immer wieder Nachschubkolonnen der Armee von Banks überfallen. Dennoch verloren die Rebellen den Krieg. Das konnte sich Dweller an zwei Fingern ausrechnen. Er mußte verschwinden, ehe unsere Leute den Krieg gewinnen und Major Mitchell gefangennehmen konnten. Man hätte ihn, wenn Mitchell geredet hätte, gehängt. Das wußte Dweller, er brauchte Geld, und dies war seine Chance, genug zu bekommen, um sich absetzen zu können. Er fuhr den Wagen in die Kiesgrube. Damit war er aus der Sicht von Sergeant Bowley und aller anderen. Er nahm ein Pferd, legte das Feuer, das er niemals vorher direkt an den Kisten mit Sprengstoff entfacht hatte, nun an die richtigen Kisten und jagte mit den beiden Geldkisten zu Pferd davon. So muß es gewesen sein. Dweller kam als Kurieroffizier an Dutzende von Ausweisen heran. Er konnte jeden Ausweis auf irgendeinen Namen ausstellen und mit ihm irgendwohin verschwinden. Man suchte ihn ja nicht, er war tot. Heldenhaft bei der Rettung seiner Untergebenen gefallen, in die Luft gesprengt worden. Man schenkte ihm sogar das Majorspatent und einen Orden. Man feierte ihn als Helden, während er in einem Zug nach Norden saß und sein geraubtes Geld bei sich hatte. Für ihn starben vierzehn unserer Leute und neun Rebellen. Für ihn und den Haufen Geld, Dad. Überlege, ich war der Verräter nicht, also hat es einen anderen gegeben. Und der andere kann nur Dweller gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, Vater. Er ist es gewesen, niemand sonst!«
»Das – das ist ungeheuerlich!« stammelt der alte William Brendan entsetzt. »Hast du es ihnen gesagt, hast du es gemeldet? Junge, du kannst vielleicht deine Unschuld beweisen. Wir müssen das melden!«
»Nein!« erwidert Brendan knapp und hart. »Du meinst doch nicht, daß sie dir glauben würden? Die Armee irrt sich nie, und wenn, dann gibt sie es erst zu, wenn zwei Menschenalter vorbei sind und keiner der Beteiligten mehr lebt. Die Beweise muß ich selbst suchen und beibringen, ich, niemand sonst.«
»Du – du bist doch krank, Junge. Dein Rückgrat…«
»Ich habe nicht mehr leben wollen damals«, sagt Brendan ernst. »Jetzt will ich es. Seit Monaten will ich leben und wieder gehen können, laufen, reiten. Doc Lewis ist ein prächtiger Mensch. Er hat gesagt, daß er mir glaubt. Von meinem Verdacht gegen Dweller weiß er nichts, niemand außer euch hat eine Ahnung, daß ich Dweller für den Verräter halte.«
»Du – du hast Hoffnung, gesund zu werden?« stammelt seine Mutter. »Junge, nichts ist schlimmer, als eine Hoffnung zu haben und am Ende erkennen zu müssen, daß sie getrogen hat. Was meint der Doc Lewis?«
»Seiner Meinung nach müßte ich steif sein, völlig gelähmt«, erwidert Brendan. »Das ist auch die Meinung der anderen Ärzte hier. Einer hat sogar vor meiner Tür zu den anderen nach einer Visite gesagt, es habe wohl so kommen müssen. Dies sei meine Strafe für den erbärmlichen Verrat, gelähmt bis an das Lebensende. Seit zwei Monaten merke ich, daß ich meine Beine wieder leicht bewegen kann. Ungefähr seit jener Zeit kann ich auch meine Hände wieder gebrauchen. Doc Lewis sagt, er begriffe es nicht, meine Rückenwirbel müßten nur angebrochen gewesen sein Ich will gesund werden, aber das werde ich hier nie. Holt mich hier raus, so schnell ihr könnt und Doc Lewis seine Zustimmung gibt. Bringt mich nach Hause an unseren See. Dort werde ich gesunden!«
Ich will gesund werden, ich muß es, denkt Cal Brendan. Und wenn ich tausend Schmerzen ertragen muß, ich werde wieder gehen und reiten. Und bin ich ganz gesund, dann suche ich diesen Second-Lieutenant Taylor auf. Ich will auch mit Little Jackson reden. Er hätte mich töten können, der Freund den Freund. Aber er schoß mich nur an. Für den Sturz des Pferdes konnte er nichts. Einer der Rekruten unter mir schoß vor Schreck und traf meinen Gaul. Ich will gesund werden. Und wenn es Monate dauert. Ich will.
Cal Brendan liegt ganz still und grübelt schon wieder. Er weiß, daß er es schaffen und wieder ganz gesund werden kann, wenn er nur den Willen hat. Dann wird er sich bei den wenigen Freunden erkundigen, die ihm noch geblieben sind, ob ein Militärpaß im Of-
fice der Armeeverwaltung verschwunden ist. Dweller muß Papiere gehabt haben, gefälschte. Heute schon weiß Brendan, daß Dweller dreimal bei Beförderungen übergangen wurde, daß ihm nach dem Urteil seiner Vorgesetzten die Befähigung fehlte, eine Truppe, eine Kampfeinheit zu führen.
James Mitchell fällt ihm ein. Mitchell ist tot, aber er hatte einen Sohn und eine Tochter. Sie müssen wissen, was ihr Vater während des Krieges getan hat. Brendan erinnert sich dunkel an Mitchells Sohn und die Tochter, ein blondes, schlankes Mädchen. Virginia Mitchell.
Ich werde sie alle fragen, denkt Brendan. Ich muß nur erst gesund werden. Dann werde ich herumhorchen. Ich finde etwas, und wenn ich jahrelang suchen muß. Vielleicht weiß auch Captain Cordon Bennet mehr, als er zugeben will. Er war schließlich die rechte Hand Mitchells. Gesund werden – und reiten, Fragen stellen. Aber wann ist er gesund – wann?
*
Er hält an und faßt nach seinem Rücken. Ein leichtes Ziehen ist dort zu spüren, aber mehr nicht.
»Ja«, sagt Brendan und blickt sich um. »Ich habe es geschafft. Ich bin seit einem halben Jahr wieder zu Hause und weiß nun viel mehr. Es ist wahr, was ich mir während der verdammten Zeit im Bett zurechtgelegt hatte: Im Verwaltungsoffice ist tatsächlich um jene Zeit ein Armeepaß als verlorengegangen gemeldet worden. Ein paar Wochen vor Dwellers angeblichem Tod verschwunden, wie? Meine Geschichte stimmt, nur wird man sie nicht glauben, weil ich keine Beweise habe. Ich muß also Dweller suchen.«
Er reitet an und weiß, daß er seit einer Viertelstunde auf dem Gebiet der Mitchell-Plantage ist. Dort hinten liegt unter Bäumen das verwüstete und erst zum Teil aufgebaute große Haus der Mitchells. Und dann kommt der Bach, der weiter im Süden in jenen See fließt, an dem die von den Nachbarn gemiedenen Brendans wohnen. Zu Hause sein und doch von allen gemieden zu werden, das ist Brendans Schicksal geworden.
Ein Steg ist am Bach, und auf dem Steg ein Mädchen mit hellem blondem Haar.
»Hallo«, sagt das Mädchen, als Brendan hält. Es sieht zu ihm hoch und fragt lächelnd. »Cal Brendan?«
»Ja«, antwortet er heiser, überrascht, daß sie lächelt und ihm nicht wie andere den Rücken zuwendet. »Miß Mitchell?«
Sie nickt nur, deutet auf den Steg und fordert ihn auf, abzusteigen. Als er neben ihr steht, blickt sie ins Wasser.
»Ich hörte, daß Sie reiten können«, sagt sie leise. »Und ich wußte, daß Sie kommen würden, Cal Brendan. Sie wollen mich etwas fragen, ja? Sicher wissen Sie, daß mein Bruder gefallen ist. Meine Angehörigen sind alle tot, und ich versuche nun, unseren Besitz wieder aufzubauen. Ich bin erst vor vier Wochen zurückgekommen, so lange war ich bei meinen Verwandten im Norden. Vielleicht hätte ich zu Ihnen kommen sollen, Cal Brendan, denn ich weiß etwas, was andere in diesem Land nicht glauben.«
»Was wissen Sie?« fragt er heiser. »Miß Mitchell, ich wäre eher gekommen, aber ich konnte noch nicht weit reiten. Was ist es, Miß Mitchell?«
»Mein Vater«, murmelt sie, »sprach nie über seine Tätigkeit mit mir. Ich war bei ihm, bis alles zu Ende ging. Er kannte Sie flüchtig, aber als er hörte, was man Ihnen vorwarf, sagte er etwas zu mir. Wenige Tage später nahm er Abschied und ritt davon. Er kam nicht wieder.«
»Was sagte Ihr Vater, Miß Mitchell?«
»Nicht viel«, erwidert sie gepreßt. »Er war kein Mann, der über seine Arbeit ein Wort verlor. Aber an jenem Tag, als er hörte, daß man Sie der Zusammenarbeit mit Rebellen beschuldigte, meinte er, die Yankees wären alle verrückt geworden. Er sagte, ich müßte mich doch an Sie erinnern, und er brummte finster, die Yankees hätten die verteufelte Gewohnheit, immer die Falschen zu hängen.«
»Wie?« fragt Brendan verstört. »Die Falschen? Miß Mitchell, er hat den wahren Verräter gekannt, er wußte, daß ich es nicht war, sagte er das?«
»Nein, nicht direkt«, gibt sie zurück. »Er sagte nur, es sei verrückt, ausgerechnet Sie in einen Zusammenhang mit den Überfällen auf Transporte zu bringen. Ein Brendan und ein Rebellenfreund, meinte er. Er lachte dabei und redete eine Weile über Sie und Ihre Familie, über die alten Zeiten. Damals dachte ich mir nichts dabei, aber später begriff ich, daß er noch einmal mit mir über alles reden wollte. Er hatte schon beschlossen, zu sterben.«
»Und sonst sagte er nichts?« erkundigt sich Brendan heiser. »Miß Mitchell, ich weiß, daß es ein anderer getan hat, ein Halunke ohne Gewissen, der in leitender Position war. Man beschuldigt mich, aber ein anderer tat es. Und für alle ist der Halunke tot.«
»Wie?« fragt sie bestürzt und sieht ihn starr an. »Was sagten Sie da? Großer Gott, das sind – das sind ja fast dieselben Worte, die mein Vater gebrauchte. Jetzt erinnere ich mich, Mr. Brendan. Er sagte, man könne keinen Toten hängen.«
Brendan fährt herum, umklammert unwillkürlich Virginia Mitchells Arm und keucht:
»Er hat gesagt, man könne keinen Toten hängen? In welchem Zusammenhang sagte er das, erinnern Sie sich, versuchen Sie es.«
»Ich weiß nicht mehr genau«, stammelt sie verwirrt. »Ich glaube, er sprach über die Narrheiten Ihrer Leute, die verrückt genug wären, den falschen Mann zu hängen. Ich weiß nur noch, daß er dann sagte, einen Toten hätten sie auch schwerlich hängen können. Das ungefähr waren seine Worte, Mr. Brendan. Großer Gott, wenn der wahre Verräter tot ist, dann können Sie nie beweisen, daß Sie unschuldig sind.«
»Er ist nicht tot«, sagt Brendan zwischen den Zähnen. »Der Mann lebt noch, ich muß ihn nur finden. Und ich werde ihn finden, wie lange es auch immer dauert. Danke, Miß Mitchell, ich werde Ihnen das nie vergessen.«
Er sieht sie nicht an, er sitzt da und blickt ins Wasser.
Es ist unklar wie alles, was vor ihm liegt.
*
Sonne, Staub, Hitze und flimmernde Luft liegt über dem heißen Südwesten von Texas.
Der Mann sitzt locker im Sattel. Seine hellen Augen wandern kurz über die Ranch, die Zäune, ein paar Pferde im Corral und den Rauch aus dem Kamin.
Der Mann führt ein zweites Pferd mit, auf dem sein Packen geschnallt ist.
Als er in den Hof kommt, öffnet sich die Haustür. Unter dem Vorbau erscheint eine dunkelhaarige, schlanke Frau und sieht ihm entgegen. Ein vielleicht siebenjähriger Junge steht hinter ihr.
»Hallo«, sagt der Mann und nimmt den Hut ab. »Ich bin doch richtig hier auf der Bennet Ranch, Madam?«
»Dies ist die Bennet Ranch, Mister. Und?«
»Ich komme von Shreveport her-über, soll einen Gruß ausrichten an Captain Bennet von Mister Taylor, Jeff Taylor, Madam. Ich fragte in der Stadt nach der Bennet Ranch, hätte aber sicher auch gleich fragen sollen, ob Captain Bennet zu Hause sei, wie? Er ist fort, ja?«
»Jeff Taylor?« murmelt die Frau erstaunt. »Mein Gott, wie weit ist Shreveport? Das ist ja am Meer im Osten. Jeff Taylor und mein Mann waren zusammen im Krieg. Taylor hat Sie geschickt?«
»Sicher, Madam. Er sagte, wenn ich herkäme, würde ich wahrscheinlich auch Matt Jackson hier finden. Jetzt ist niemand da – weder Ihr Mann, noch
Little-Jackson. Mein Name ist Brendan, Madam, Cal Brendan.«
Er sieht, wie die Frau zusammenzuckt und erstaunt den Mund öffnet.
»Sie sind Cal Brendan? Mein Gott, was wollen Sie? Sie waren bei Talyor, Sie suchen Jackson? Brendan, der Krieg ist über einem Jahr vorbei, denke ich. Sie werden doch nicht…«
»Natürlich nicht«, sagt er und lächelt kurz, als er ihre Sorge erkennt. »Madam, ich weiß nicht, was Sie alles über mich gehört haben. Vielleicht denken Sie, daß ich mich für die Falle, in die
Little-Jackson mich lockte, rächen will. Er tat nur seine Pflicht, Madam, genau wie ich in diesem Krieg. Das ist lange vorbei, Missis Bennet. Ich muß Ihrem Mann einige Fragen stellen. Er arbeitete mit einem Major Mitchell zusammen. Wissen Sie etwas darüber?«
»Nein, nicht viel. Nur, daß Mitchell sein Vorgesetzter war, Mr. Brendan. Sie wollen wirklich nur ein paar Fragen stellen?«
»Madam, ich war Jacksons Freund, und ich denke, ich bin es geblieben. Wir haben einmal zu viele gemeinsame Dinge erlebt. Hier ist kein Rind zu finden, also sind sie nach Norden. Wohin, Missis Bennet?«
Die Frau sieht ihn forschend und abschätzend an. Dann sagt sie:
»Kommen Sie herein, das Essen ist gleich fertig, Mr. Brendan. Ja, sie sind nach Kansas zur Bahn mit den Rindern. Vor fünf Wochen sind sie aufgebrochen, einige andere kleine Rancher mit ihnen.«
»Danke«, sagt er kurz. »Ich denke, ich werde sie einholen können. Auf Wiedersehen, Missis Bennet.«
»Aber, Mr. Brendan, Sie können doch essen, Sie verlieren nicht viel Zeit.«
»Ich habe schon fünfzehn Monate verloren«, murmelt er leise. »Danke für das Essen, Madam, vielen Dank.«
*
Du großer Gott, denkt der kleine Mann und starrt entsetzt auf den hageren Niggels und das leere Camp neben dem Küchenwagen herab, dieses verdammte Volk!
Er macht nur noch zwei Schritte, dann packt er Niggels und reißt ihn hoch
Die Brandyfahne schlägt ihm beim ersten, lallenden Ton des hageren Niggels entgegen und wirft ihn beinahe zurück. Kein Mann mehr hier, nur Flaschen liegen leer herum. Sie sind leer, und Niggels ist voll.
»Die Pest soll dir in den Bauch fahren!« knurrt Jackson grimmig. Einen Augenblick später hat er den Wassereimer und hebt ihn hoch. »Wachst du jetzt auf, du Oberaufpasser?«
Das Wasser schießt mit einem Guß über Niggels’ Kopf. Gurgelnd kommt Niggels hoch, hockt sich hin und hält sich den Schädel.
»Ohooo, mein armer Kopf. Bin ich ertrunken?«
»Du verdammter Idiot!« knirscht Jackson. »Wo sind die anderen, he? Morgen früh, du gehörnter Ziegenbock, soll verladen werden, und hier liegen ein Dutzend Flaschen herum. Was hatte Mister Bennet dir gesagt, na? Solltest du nicht aufpassen, daß die Halunken nicht wieder in die Stadt reiten und sie auf den Kopf stellen? Wo sind sie denn, he?«
Niggels sieht sich um, sperrt die Augen vor Schreck auf und sagt:
»Weg, alle weg. Ja, wo sind sie denn?«
»Was kannst du eigentlich?« donnert Jackson. »Alles, was ihr könnt, ist Kühe treiben. Dauernd muß man auf euch aufpassen. Und sollst du es mal selbst tun, versagst du, du Bohnenstange. Haben sie dich hereingelegt, he? Heute früh wurde die Herde verkauft, am Nachmittag ist der halbe Verein betrunken. Und schon fangen sie Streit mit einigen Siedlern in der Stadt an, belagern die Saloons und benehmen sich wie Wilde.«
Jackson hört Hufschlag, dreht sich um und sieht dem heranjagenden Bennet entgegen.
»Was ist hier los?« fragte der große, breitschultrige Bennet verstört. »Matt, wo sind die Burschen?«
»Das fragst du besser den hier, oder laß es, er ist betrunken. Sie haben ihn hereingelegt. Ich rieche an den Flaschen nur Wasser, aber keinen Brandy. Irgendeiner unserer Männer hat den uralten Trick versucht und Niggels eingeredet, er könne mehr vertragen als Niggels. Zum Schein haben die anderen aus mit Wasser gefüllten Flaschen mitgetrunken, bis Niggels umgefallen ist. Und dann sind sie in die Stadt. Soll ich dir sagen, weshalb?«
Bennet sieht den kleinen Jackson loshetzen. Jackson fliegt mit einem Sprung in den Sattel, reißt sein Pferd herum und jagt auch schon an. Augenblicke später ist Bennet neben ihm. Bis zur Stadt sind es achthundert Yards. Das Herdencamp ist am Ende des Corrals, in die man ihre Rinder getrieben hat. Jetzt jagen sie an den Corrals vorbei, und Jackson sagt finster:
»Am Nachmittag haben wir es gerade noch verhindern können, daß sie diesen verdammten Saloon auseinandernahmen, in dem angeblich falschgespielt worden ist. Ich wette, Rocco ist auf die Idee gekommen, Niggels hereinzulegen, um seinen Streit mit jenem Salooninhaber auszutragen. Schneller, Bennet, sonst ist die Hölle los. Wir hätten niemals mit dem Viehaufkäufer hinaus zur Handelsranch fahren sollen.«
»Verdammt, woher sollte ich wissen, daß Niggels die Burschen nicht an der Leine halten konnte?« knurrt Bennet düster. »Hörst du schon was, Matt?«
Sie preschen nun vollen Galopp auf die ersten Häuser von Abilene zu, als ihnen Lärm entgegenschlägt.
»Einen zusammengewürfelten Haufen hungriger Wölfe neun volle Wochen über den Weg zu bringen, ist schon schlimm«, flucht Jackson. »Wer, zum Teufel, hat mich nur geritten, diesen wahnsinnigen Job bei dir anzunehmen, he? Jackson ist ein Idiot, er spielt immer noch den Scout, statt lieber Büffel schießen zu gehen. Hätte ich deine Herde und diesen Haufen Narren doch nie gesehen. Ich habe euch heil durch Indianer, Banditen und andere Gauner gebracht, und hier werden diese Affen wild. Sie riechen Brandy nach neun Wochen Trail und sind nicht mehr zu halten. Da, da hast du es!«
Was Jackson sagt, ist in jedem Punkt wahr. Er hat sich von Bennet, statt auf Büffeljagd zu gehen, für diesen Trail als Scout anwerben lassen. Die zurückliegenden neun Wochen hat er alle Hände voll zu tun gehabt, um die Herde durchzubringen. Er ist wieder mal wie zu seiner Armeezeit vor Männern geritten.
Daß sich diese Männer austoben wollen, hat Jackson geahnt, aber mit diesem Lärm nicht gerechnet. Ihre zweistündige Abwesenheit vom Camp hat genügt, um in der Stadt die Hölle losbrechen zu lassen.
Kaum biegen die beiden Reiter in die Mainstreet ein, als sie die Traube Zuschauer gegenüber dem Alamo Sa-
loon sehen. Im Saloon selbst ist die Hölle los, während sich unter dem Vorbau einige Männer in einer zum Schlammbad gewordenen Regenlache wälzen.
»Der Teufel soll sie holen!« faucht Bennet scharf. »Da ist Rocco, der verdammte Bursche. Reite ihn um, Matt!«
Matt Jackson ist rechts neben Bennet und dem Vorbau am nächsten. Männer springen zurück, als die beiden Reiter auf die Zuschauer zupreschen. Fluchend versucht Jackson Rocco, einen großen schwarzhaarigen Herdentreiber, vor dem Saloon abzufangen, doch er schafft es nicht mehr. Rocco stürmt mit zwei Partnern auf die Tür zu, deren einer Flügel bereits auf dem Vorbau liegt. Um nicht über die sich im Schlamm wälzenden Männer wegzureiten, muß Jackson sein Pferd hochreißen.
In diesem Moment gibt es im Saloon ein Getöse, als fiele die Decke ein. Wüstes Geheul dringt aus zwei zerplatzten Fenstern, deren Rahmen nach außen hängen und gesplittert sind.
Irgendwer kauert unter dem einen Fenster, sieht kurz über die Brüstung und duckt sich dann blitzschnell. Keine Sekunde später zischt eine leere Flasche über den Mann hinweg.
Jackson springt vom Pferd, sieht Bennet heranrennen und stürmt auf die Tür zu. Ein Mann saust auf ihn zu, ehe er in den Saloon kann. Der kleine Mann macht einen wilden Satz zur Seite. An ihm vorbei schießt Blake, einer der kleinen Rancher, über den Vorbau und landet vor Bennets Füßen. Als
Blake brüllend auf die Beine will, packt ihn Bennet und schlägt ihm die Faust ans Kinn. Blake kippt auf der Stelle um. Bennet stürmt weiter und sieht Jackson geduckt in den Saloon hechten.
»Aufhören!« schreit Jackson schrill in das Toben. »Macht Schluß, Rocco, alles raus hier! Rocco…«
»Schollenbrecher, verdammte!« brüllt es neben Jackson, und ein Rudel Cowboy stürmt auf die Siedler zu. »Werft sie auf die Straße!«
Erst in diesem Augenblick entdeckt Jackson Rocco. Er will zu ihm, aber irgendwer springt von der Galerie herunter und prallt auf Jacksons Rücken. Plötzlich liegt der kleine Mann. Über ihm gellt der Schrei: »Ich habe einen verdammten Kuhtreiber erwischt, Sam, her zu mir!«
»Bennet, Gordon!« brüllt Jackson heiser los. »Gordon, schnell!«
Jetzt bekommt Jackson den Haß zu spüren, den Siedler gegen Herdenleute in sich tragen. Siedler mögen keine
Cowboys, keine Rinder, die über ihre Felder trampeln und die Ernten zerstören. Der kleine Mann fliegt hoch und saust davon. Er sieht die Tür auf sich zurasen, irgendeinen Mann in seinem Weg auftauchen. Der Mann fliegt um und Jackson im Bogen auf den Vorbau. Der Haltebalken ist vor ihm, er prallt an das Holz und sieht feurige Sterne. Langsam stemmt sich Jackson hoch. Die Straße dreht sich um ihn, in seinem Kopf haust ein Hornissenschwarm. Er flucht, der kleine Mann, als er wieder auf die Brust in die verdammte Schlammpfütze fällt und das Gebrüll aus dem Saloon nun deutlicher wird. Dann greift er nach dem Haltebalken und merkt zu spät, daß er irgendein Bein umklammert und nicht den Haltebalken.
»Verdammte Narren«, sagt er keuchend. »Keine Stunde kann man diese Affen allein lassen, schon stellen sie etwas an. Ich werde euch…«
»Bleib besser draußen, Kleiner!« sagt der Mann über ihm und hält ihn fest. »Matt, du fliegst doch gleich wieder vor die Tür. Bleib hier, Matt.«
Jackson sperrt die Augen auf und glotzt verstört in das Gesicht des Mannes. »Was – wer?« stottert der kleine Bursche verstört. »Laß mich los, Mensch. Ich werde…«
In seinem Kopf dreht sich immer noch ein Mühlenrad. Er versucht, den Mann wegzustoßen und erinnert sich dunkel, ihn schon irgendwann einmal gesehen zu haben.
»Geh zum Teufel, ich werde diesen Irren so lange auf die Schädel schlagen, bis sie…«
»Matt, ich bin das«, sagt der Mann an seiner Seite und rüttelt ihn. »He, komm zu dir, Kleiner. Matt, du hast einen prächtigen Schnitt an der Stirn, du blutest, Alter. Zum Teufel, bleib liegen!«
Die Stimme kommt Jackson bekannt vor. Er hat sie schon mal gehört, irgendwann und vor langer Zeit.
»Verdammt«, sagt er heiser. »Wer hält mich da wie einen zappelnden Hasen am Genick gepackt, he? Dich kenne ich doch?«
Er ist immer noch nicht ganz beisammen, der kleine Mann. Doch dann bäumt er sich jäh auf und hört das Lachen. Danach wird er steif wie ein Brett.
»Cal?« sagt er ungläubig und mit einem Kratzen im Hals. »Cal, bist du das, oder ist es dein Geist?«
»Aha, jetzt bist du wach!« sagt der Mann hinter ihm lachend und stellt ihn mit einem Ruck auf die Beine. »Dreh dich nur um, du Querschädel, ich bin es schon.«
Der kleine Mann zieht den Kopf ein. Er erinnert sich jäh an die Nacht, den Mann auf dem Pferd, der herum wollte und seinen Revolver hochriß. Ganz langsam wendet er sich um, die Hände nun halb erhoben.
»Cal«, stößt er heraus. »Wo kommst du her?«
Ich habe auf ihn geschossen, denkt der kleine Jackson, ich mußte es tun. Das war meine Bedingung, sonst hätte ich den Second nicht geführt. Er wird nie vergessen, daß ich geschossen habe, aber ich mußte doch…
Der Mann steht da und sieht ihn mit einem dünnen Lächeln an.
»Oh, verdammt, du frißt mich nicht auf, Cal, ich mußte es tun, ich…«
»Sicher«, sagt Cal Brendan achselzuckend. »Ich weiß es. Du hättest mich töten können, wenn du gewollt hättest. Aber du wolltest nicht. He, ich brauche Bennet, wollen wir ihn uns holen?«
»Ho – holen; wir beide, wie früher?«
»Ich denke so, Kleiner.«
»Wie früher«, kichert der kleine Mann und schnallt blitzschnell seinen Gurt auf. Dann schiebt er ihn durch Brendans und legt ihn wieder um. Sie sind nun wie siamesische Zwillinge aneinandergebunden. »Das wird ein Spaß. Jetzt räumen wir auf, was?«
»Du sagst es, Matt.«
Sie gehen im gleichen Schritt los, bis sie denselben Takt gefunden haben und immer schneller werden. So stürmen sie schließlich über den Vorbau und ducken sich, als sie zur Saloontür hineinstürzen.
Er trägt es mir nicht nach, denkt der kleine Matt Jackson und hat plötzlich das Gefühl, daß ihm jahrelang etwas gefehlt hat, Cal Brendan. Zum Teufel mit den Schollenbrechern und Kartenhaien in diesem Nest. Jetzt denkt er nur an den Spaß früherer Zeiten, der kleine Jackson.
*
Sie sagen sekundenlang nichts. Gordon Bennet nagt auf seiner Unterlippe und starrt vor sich auf den Boden. Der kleine Matt Jackson aber stößt sich vom Wagen ab.
»Bist du stumm, Gordon?« fragt er heiser und bissig. »Hat dir Mitchell etwas gesagt, weißt du etwa nichts?«
Bennet sieht den großen Brendan an, der sie mit Jackson herausgehauen hat.
»Nein«, sagt er knapp. »Mitchell hätte sich eher die Zunge abgebissen, als einen seiner Kundschafter zu verraten. Er allein kannte die Namen. Sie standen in seinen Papieren, die er immer verschlossen hielt. Tut mir leid, Brendan. Das ist eine verdammte Geschichte, aber…« Er macht eine Pause und sieht wieder in die Nacht hinaus.
»Aber ich kann nicht helfen, ich weiß nichts über jenen Captain Dweller. Für mich ist diese Zeit vorbei.«
Jackson fährt herum, einen bestürzten Ausdruck im Gesicht.
»Was ist das?« keucht er. »Und die Toten – deine Leute, Gordon? Es waren doch deine Männer! Briggs, Locum, Rinacon, denkst du nicht mehr an sie?«
Gordon Bennet sieht ihn an, streicht sich über die Stirn.
»Natürlich denke ich daran«, sagt er leise. »Aber sie werden durch nichts mehr lebendig. Gut, Dweller hat den Überfall bestellt, wenn Brendan recht hat. Doch es ist nicht mehr zu ändern. Damals war Krieg, jetzt ist Frieden, Matt. Wie Briggs sind andere umgekommen, auf beiden Seiten. Ich verstehe, daß Brendan diesen Dweller haben will. An seiner Stelle würde ich den Kerl auch suchen, aber ich habe eine Familie, verstehst du, Matt? Sicher, ich mag keine Verräter, ganz gleich, zu welcher Seite sie gehören. Doch ändere ich etwas?«
»So ist das«, murmelt Jackson bitter. »Dir hat es gereicht, du bist damit fertig. Was verloren ist, das holt man nicht zurück. Verstehe schon, Gordon. Für mich ist es anders, begreifst du? Ich habe euch geführt, ich brachte sie in den Sumpf und teilte mit ihnen meinen Tabak und das letzte Stück Brot. Da war ein Hundesohn wie Dweller, für den sind sie gestorben.«
»Matt, doch nicht für den Kerl!« sagt Bennet. »Du siehst das falsch, Matt.«
»Oder du, oder du!« knirscht der kleine Jackson. »Wenn Dweller uns den Transport verraten hätte, ohne daß er dabei die Absicht hatte, sich zu verdrücken, na gut. Aber er brauchte den Überfall, um verschwinden zu können. Meine Partner sind für einen verdammten Hundesohn gestorben. Genauso Cals Leute. Das hatte nichts mit dem Krieg zu tun. Ein Mann hatte sich vorgenommen, unterzutauchen. Dazu brauchte er ein kleines Gefecht. Was sind schon zwei Dutzend Tote für so einen Lumpen? Es ist etwas anderes, wenn du für dein Land stirbst, aber meine Partner sind für einen Verräter gestorben.«
Er sieht Bennet an und schüttelt den Kopf. So ist das, denkt Jackson, und er hat plötzlich die reine Galle im Mund. Gordon will vergessen oder hat es schon. Ich wußte nie, daß er so wenig an seinen Männern hing. Für ihn war es wichtig, dem Gegner möglichst großen Schaden zuzufügen. Genauso wichtig ist ihm jetzt seine Arbeit, seine Ranch, die Familie. Sicher, es ist zu verstehen. Nur ich, ich hab’s nie vergessen. Dieses Dreckloch, in dem wir hockten.
Jackson dreht sich um und geht los. Er rollt seine Decke zusammen, zieht die Ölhaut herüber und holt sein Pferd und die Waffen. »He, Matt, was willst du tun?« fragt Bennet bestürzt. »Matt, du kannst doch nicht wegreiten?«
»Ich kann«, sagt Jackson heiser. »Ich vergesse nichts, Gordon, darin unterscheiden wir uns. Die alten Zeiten kommen nie wieder, das ist richtig. Aber du brauchst mich nun nicht mehr. Du kannst dich auf deine Dinge konzentrieren. Für mich gibt es noch andere, wenn du das auch nicht begreifst. Kommt gut zurück, Gordon.«
»Matt, hör doch, wenn ich keine Familie hätte…«
»Du hattest damals eine und gute Männer«, murmelt Jackson gepreßt. »Damals hast du auch nicht an deine Frau gedacht. Du hast deinen Spaß gehabt, wenn alles über deine Ritte redete und dich lobte. Du warst der Mittelpunkt, weil du der Captain warst, der das Kommando hatte. In Wirklichkeit, Gordon, vollbrachten deine Leute jene Taten, für die du deine Orden bekamst. Mir ist das nie aufgefallen, bis heute, Gordon. Es wird auch heißen, daß du deine Herde und die Rinder der anderen durchgebracht hast. Gordon Bennet, der große Gordon Bennet, was? Und der kleine Matt Jackson, ein einfacher Bursche nur, aber er hat deinen Haufen damals geführt, nicht du, und er ist mit jedem Mann gestorben, du nicht. Heute weiß ich es, Gordon. Tut mir leid, daß ich jemals mit dir geritten bin.«
Er schwingt sich in den Sattel und gibt dem Pferd die Hacken. Hinter ihm steigt Cal Brendan auf, jagt ihm nach und reitet eine Weile schweigend neben ihm her.
»Das war hart, Matt.«
»Die Wahrheit war es«, erwiderte Matt Jackson finster. »Er hat es verdient, einmal die Wahrheit zu hören. Damals war er anders, aber er ist so wie viele andere. Sie vergessen immer, was früher war. Wohin wollen wir überhaupt, Cal?«
»Nach Norden«, gibt Cal Brendan zurück. »Ich habe unterwegs überall in den Städten nachgefragt. Ich habe Dweller beschrieben und mich nach einem ehemaligen Nordstaatenmajor oder Captain erkundigt. Bis jetzt nichts, Matt. Du brauchst nicht mitzukommen und den Kerl zu suchen, wenn du nicht willst.«
»Will ich nicht!« zischt Jackson, und plötzlich ist etwas wie Haß in seiner Stimme. »Der Kerl verdient den Galgen!«
Und er spuckt im Bogen ins Gras.
*
Hinter ihnen steigt der Rauch immer höher, und der kleine Matt Jackson blickt sich um.
Ihre Pferde fallen jetzt in den Trab, bis sie schließlich stehenbleiben. »Die Hölle!« stößt Jackson durch die Zähne. »Warum, zum Teufel, muß ich auch Indianer riechen, he? Sieh dir das an!«
Brendan starrt einige Sekunden verstört auf Jacksons linkes Bein und den darin steckenden Indianderpfeil.
»Mensch!« sagt Brendan heiser. »Und davon sagst du nichts? Damit bist du zwanzig Meilen geritten? Matt, sitzt das Ding fest?«
Der kleine, stoppelbärtige Jackson grinst von einem Ohr zum anderen. Dann nimmt er sein Messer, blickt sich aber noch mal um und trennt seine Lederhose an der Naht auf.
»Möchte wetten, sie sind uns nicht mehr auf den Fersen, die Wilden!«
Danach betrachtet er mit offener Neugierde den Pfeil, betastet seinen Schenkel und fragt:
»Kannst du mir diesen Zahnstocher durchstoßen, Großer?«
»He, das Ding ist doch nicht etwa durch dein Bein gegangen?« erkundigt sich Cal hastig. »Laß sehen, Mann.«
Sie haben nichts als eine gewaltige Portion Glück gehabt. Die Büffeljägergruppe, der sie sich angeschlossen hatten, wollte zur Poststation nördlich von Fort Heys. Plötzlich erklärte der kleine Matt, er röche doch verdammt Indianer und würde um keinen Preis der Welt in der Station übernachten. Die Büffeljäger lachten Jackson aus. Während sie zur Station ritten, schlugen Brendan und Jackson ihr Nachtlager gut vier Meilen von der Station entfernt im Buschgelände auf. Sie löschten ihre Spuren, schliefen abwechselnd und hörten im Morgengrauen die Schüsse.
Sie ritten los, um nachzusehen. Jackson hatte recht behalten. Ihnen kam eine Horde Indianer vom Sioux-Stamm in die Quere, die Sioux hatten anscheinend die Büffeljäger verfolgt.
Jackson und Brendan konnten sich die Indianerhorde vom Hals halten. Daß Jackson dabei einen Pfeil erwischte, sagt er erst jetzt.
Brendan untersucht Jacksons Bein und brummt:
»Zieh die Hose aus!«
»Was? Da frier ich ja!« knurrt der kleine Jackson. »Ist hundekalt geworden. Muß ich ausziehen?«
»Wie soll ich dich sonst verbinden können, he?«
Jackson brummelt vor sich hin, streift seine Hose ab. Als er am Boden hockt, sieht Brendan ihn kurz an.
»Beiß die Zähne zusammen, Kleiner!«
Brendan zaudert einen winzigen Moment. Dann schneidet er das gefiederte Ende des Pfeiles ab und schlägt einmal zu. Die Pfeilpsitze ist draußen. Kein Wort kommt über Matt Jacksons Lippen. Blut schießt nun ins Gras, aber Brendan preßt ein Tuch auf die Wunde und sieht hoch.
»Ausgeblutet genug, meinst du nicht?«
»Kö – könnte sein!« zischt Jackson durch die Zähne. »Feines Gefühl, ehrlich. Verbinde mich, damit wir reiten können. Wette, die Büffeljäger leben nicht mehr. War gut zu hören, wie sie aus ihren schweren Flinten schossen. Wurde aber verdammt schnell still, meine ich. Wollen wir zurückreiten und nachsehen?«
»Mit dem Loch in deinem Bein?« fragt Brendan kopfschüttelnd. »Hör mal, sie haben dich für einen Narren gehalten, als du anfingst, Indianer zu riechen.«
»Schade um die Büffeljäger, waren ganz anständige Burschen. Wäre gern auch eine Weile Büffelabzieher, renne aber wie ein Narr seit drei Monaten mit dir durch Colorado, ganz Kansas und andere Gebiete. Habe bald die Nase voll, verstanden? Dweller finden wir doch nie mehr.«
Erstaunt sieht ihn Brendan während des Verbindens an.
»Wir haben vielleicht in der falschen Gegend gesucht«, sagt er dünn. »In Ordnung, Matt, wenn du nicht mehr willst, du kannst deine Büffel besuchen. Ich halte dich nicht.«
»Würdest du ohne mich weiterreiten?« fragt Jackson finster. »Bekommst du fertig, verdammt. Aber es kann Jahre dauern, verstanden?«
»Ich sage doch, wenn du aufgeben willst, dann halte ich dich nicht«, antwortet Brendan knapp. »Ich dachte zuerst, wir würden Dweller irgendwo finden, wo man nach Gold oder Silber sucht. Wenn er aber zur Bahn gegangen ist? Hör mal, Matt, ein Kerl wie Dweller kann rechnen, eiskalt rechnen, das ist doch klar, oder?«
Matt Jackson nickt nur, steigt wieder in seine Lederhosen und stampft ein paarmal prüfend auf.
»Ich kann reiten, laufen, springen, well! Dweller ist ein schlauer Hundesohn und geldgierig.«
»Und er kann rechnen«, stellt Brendan fest. »Wie weit reicht sein Geld, he? Ich sage dir, er ist irgendwo zu finden, wo er aus dem Geld noch mehr machen kann. Der Kerl weiß zu gut, daß diese Summe niemals bis an sein Lebensende reicht. Er war früher Händler, ehe er zur Armee ging. Er versteht etwas vom Transportwesen, das hat er bei der Armee gelernt wie kaum einer. Darin war er nicht zu schlagen. Matt, an der Bahn wird eine Unmenge Geld verdient, verstehst du?«
Jackson steigt auf sein Pferd, greift in die Satteltasche und zieht seine Blechflasche mit dem Brandy heraus. Dann nimmt er einen kräftigen Zug und steckt die Flasche nach Brendans ablehnendem Kopfschütteln ein.
»Jetzt also die Bahn«, sagt er dann mürrisch. »Sie bauen da oben im Norden und sollen über Julesburg hinaus sein. Wir reiten hin, und wer ist nicht da? Dweller! Dann suchen wir weiter den Winter lang. Gibt genug Gold- und Silbercamps, wie? Landen schließlich in Kalifornien. Feines Land, bloß keine Büffel für Matt Jackson. Ich will Büffel schießen, well!«
»Dann reite doch, ich binde dich nicht an«, sagt Brendan kühl. »Na, was willst du nun?«
»Sehe ich so aus, als wolle ich aufgeben?« fragt Jackson bissig. »Bin nur höllisch müde, mein Bein schmerzt. Hunger habe ich auch, verstanden? Mach dir einen Vorschlag.«
»Was hast du vor?«
»Wir reiten beide nach Norden«, sagt Jackson. »Büffeljäger haben von der Bahn erzählt. Große Station ist North Platte. Westlich davon Ogallala nächste Station. Danach im Westen Julesburg, aber die Bahn soll noch nicht dort sein, stimmt?«
»Ja.«
»Gut, ich reite nach North Platte, du nach Ogallala. Wir trennen uns, fragen herum. Du wartest auf mich in Ogallala, ich komme dann hin, well.«
»In Ordnung!« erwidert Brendan. »Halte dich aber in North Platte nicht lange auf, verstehst du? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, unser Mann könnte an der Bahn sein. Vergiß nicht, Dweller hat ein Dutzendgesicht. Der Mann kann untertauchen und für immer verschwinden.«
Matt Jackson blickt zum Horizont. Im Norden ist die Bahn; im Westen liegt Kalifornien. Der Mann, der kaltblütig andere verriet, kann längst irgendwo ein friedliches, geachtetes Leben führen.
Suchen, denkt der kleine Mann bitter, monatelang herumfragen. Bei Frachtlinien und Posthaltereien, in Saloons und bei Sheriffs, aber der Hundesohn ist wie vom Erdboden verschluckt. Dieses Land ist zu groß. Wenn hier einer verschwinden will, dann kann er es. Ich werde also nach North Platte reiten, und Cal nach Ogallala. Und danach suchen wir den Halunken Dweller woanders, in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Camp. Wir werden ihn nicht finden, nicht in North Platte, auch nicht in Ogallala. Der verdammte Schurke ist für alle Zeit untergetaucht.
*
Das Heulen der Zugsirene hallt klagend über die Häuser. Es dringt durch den Lärm des Railroader Saloon, übertönt das Gehämmer eines Walzenklaviers.
Der Mann steht am Tresen, den Ellbogen aufgestützt, das Glas in der Hand. Links ein paar Girls, zurückgeblieben hier in diesem Saloon, nachdem die Bautrupps der Bahn längst weitergezogen sind. Die Mädchen lachen, ein Mann hält sie frei und verjubelt seine hart erarbeiteten Dollar für ein Lächeln.
Hinter dem Tresen ist der Keeper, ein dicker Mann mit einem breiten Grinsen.
»No«, sagt der Keeper achselzuckend. »Nie gehört von einem Major oder Captain, von keinem jedenfalls, der so aussieht wie der Bursche, Fremder. Du weißt nicht mal seinen Namen?«
Brendan schüttelt den Kopf, deutet auf seine Stirn und die Narbe dort.
»Kann mich nicht mehr erinnern, seitdem mir ein Rebell seinen Säbel über den Schädel zog. Der Name meines Captains fällt mir nicht mehr ein. War lange krank, mein Freund.«
Der Keeper starrt auf Brendans Narbe.
»Ja, der Krieg«, sagt er bedauernd. »Mittelgroß, rundes Gesicht, die Augenfarbe, no, nicht gesehen, mein Freund. Was meinst du, was hier an der Bahn für Leute kommen und gehen? Man sieht ein paar tausend Gesichter und vergißt sie wieder. Hast du gehört? Der Zug ist da, der letzte nach Julesburg zum Camp. Der Townmarshal ist bestimmt mit dem Zug gekommen. Er mußte jemanden in North Platte abliefern. Wenn du losgehst, triffst du Mar-
shal Smith sicher in seinem Office. Immer die Straße hinauf.«
»Danke!«
Sieben Saloons, denkt Brendan, als er das Glas Whisky bezahlt hat und auf die Tür zugeht. Nirgendwo kennt man einen ehemaligen Captain oder Major. Und ich hatte die Hoffnung, daß ich hier vielleicht eine Spur von Dweller finden würde.
Eine Hoffnung weniger für Cal Brendan.
Er kommt aus dem Saloon und geht die Straße hinauf. Keine hundert Schritte weiter ist das Marshal’s Office.
Irgendwo hinter Brendan ist ein Mann, der jetzt aus dem Railroader Saloon tritt und sich an die Wand drückt.
Der Mann blickt Brendan nach, kneift leicht die Lider zusammen und hüstelt kurz. Dann geht er los, aber er hält Abstand. Trotzdem verliert er Cal Brendan keine Sekunde aus den Augen.
Links vor Brendan ist das Alhambra Hotel mit einem Saloon. Brendans Blick geht die Straße hoch zum Mar-
shal’s Office, doch dort ist noch kein Licht. Im nächsten Moment betritt Brendan den Alhambra Saloon.
Im gleichen Augenblick bleibt der Mann stehen und pfeift leise durch die Zähne.
»Er fragt«, sagt der Mann nach seinem leisen Pfiff. »Warum fragt er über-all dasselbe, weshalb sucht er diesen ehemaligen Captain oder Major? Da stimmt doch was nicht.«
Er geht schneller, drängt sich dann nach wenigen Sekunden durch die Tür in den Alhambra Saloon und sieht Brendan am Tresen lehnen.
Der ist doch müde wie ein Hund, denkt der Mann, als er sich unauffällig dem Tresen nähert. Dieser Bursche schläft bald in seinen Stiefeln ein, aber er fragt. Die Geschichte mit dem Säbelhieb und seinem Captain, der ihm angeblich das Leben gerettet haben soll, die stimmt nie, wette ich. Der sucht diesen ehemaligen Captain oder Major, aber aus einem anderen Grund, als sich bedanken zu wollen. Die Augen, die der Bursche hat, wie ein hungriger Wolf.
»Es war bei Gettysbury, mein Freund«, hört er Brendan sagen. »Ich bekam eins mit dem Säbel von einem Rebellen verpaßt. Ehe der Bursche noch mal zuschlagen konnte, schoß ihn ein Captain vom Gaul. Das war alles, was ich noch sah. Später wachte ich im Lazarett auf, und sie sagten mir den Namen des Captains. Ich war über ein Jahr lang krank und konnte keine Namen behalten. Ich vergaß sogar meinen eigenen, Mister. Der Captain soll befördert worden sein, Major wahrscheinlich. Er ist mittelgroß, hat mittelblondes Haar, ein rundes Gesicht und…«
Der Fremde bleibt eine halbe Minute stehen und hört sich an, was der Keeper und Brendan reden.
»No, mein Freund, tut mir leid, ich kann mir nicht jedes Gesicht merken. Mittelgroß, rundes Gesicht? Mein Gott, da laufen so viele Leute herum, auf die die Beschreibung passen könnte. No, Mister, kenne keinen Major oder Captain, der so aussieht.«
Der Fremde drückt sich hinter ein paar Männern durch und schiebt sich hinaus. Draußen lehnt er sich an die Saloonwand und wartet.
Er wird zum Marshal gehen, denkt er beunruhigt. Wenn der sich erinnert? Smith erinnert sich bestimmt, ich ahne es doch. Und dann? Dieser große Bursche mit den hungrigen Augen bekommt es fertig und nimmt seine beiden Gäule, die er im Crazy Horse Sa-
loon abgestellt hat, und dann reitet er los. Wenn sich Smith erinnert, was dann?
*
Ein müder Marshal, ein paar Steckbriefe an der Wand, ein Regal mit Gewehren, und dahinter der düstere Gang mit dem Gitter vor den beiden Zellen.
»Major?« fragt Marshal Smith kopfschüttelnd. »Nein, Brendan, wir hatten einen Major an der Bahn, aber der ist groß, dürr, hat rote Haare und keine Ähnlichkeit mit diesem Mister, den Sie suchen. Tut mir leid, Brendan, kein Major oder Captain ist jemals hier in Ogallala oder North Platte gewesen, auf den Ihre Beschreibung zuträfe. Es soll Leute geben, die vom Krieg genug hatten und nicht mehr an ihn erinnert werden wollen. Was war dieser Mann denn im Zivilleben?«
»Er hatte mit Frachtlinien und Transporten zu tun, Händler, glaube ich«, erwidert Brendan. »Marshal, er ist nicht arm, er muß sogar ziemlich viel Geld haben. Vielleicht ist er ins Transportgeschäft eingestiegen.«
»Ja, vielleicht, Brendan, aber… Moment mal, Transporte? Brendan, wie wär doch die Beschreibung?«
»Mittelgroß, mittelblondes Haar, braune Augen und ein rundes Gesicht. Man müßte seinen Oststaatendialekt heraushören.«
»Wie das vornehme Volk aus Boston und…«
»Ja, so ungefähr, Marshal.«
Er weiß etwas, denkt Brendan und fühlt nach den monatelangen, vergeblichen Hoffnungen, die ihn abgestumpft haben, nun doch etwas wie Erregung. Weiß Smith etwas?
»No«, sagt Smith, »no, der war bestimmt nicht bei der Armee. Die Beschreibung kommt hin, aber der und Armee? Undenkbar, daß der jemals Captain gewesen sein sollte, obgleich die Beschreibung…«
»Wie alt ist der Mann, und wie heißt er?« fragt Brendan ganz ruhig. »Was macht er?«
»Carter«, murmelt Smith und nimmt wieder einen kleinen Schluck. »Jim Carter, Brendan. Von Scotts Transportcompany. Carter sieht so aus, aber wie der sehen hundert andere auch aus. Er war Scotts Partner hier.«
»Und wo ist er jetzt?«
»Lodgepole Creek«, antwortet der Marshal seufzend. »Mann, Sie fragen einem noch die Seele aus dem Leib. Carter war bestimmt nie bei der Armee. Er hat nichts von der Armee an sich. Außerdem ist er ein ziemlich ängstlicher Mann, der jedem Streit aus dem Weg geht. Versteht was vom Frachtgeschäft und kann gut organisieren. No, Carter ist ein friedlicher Mensch, der als Soldat bestimmt vor Angst gestorben wäre, wenn er Kugeln pfeifen gehört hätte.«
»Er ist der Partner von Scott, seit wann?« erkundigt sich Brendan kühl. »Wie lange kennen Sie Scott und Carter, Marshal?«
»Ich sagte schon, er war Scotts Partner!« erwidert Smith achselzuckend. »Scott hatte Schwellen und Telegrafenmasten für die Bahn zu liefern. Er ist vor einem Vierteljahr verunglückt, unter Stämme gekommen. Seitdem führt Carter für Scotts Witwe die Sache allein, soviel ich weiß. Habe Carter nicht viel gesehen, Brendan, er war fast immer bei den Holzfällern oder unterwegs, um die Transporte rechtzeitig an die Schienenlegerkolonnen zu bringen. Hören Sie, Brendan, Carter ist nicht der Typ eines Kämpfers, soweit kenne ich ihn doch, meine ich.«
»Wie lange war er bei Scott, schon immer, Marshal? Sie sagten vorhin, Sie hätten seit anderthalb Jahren ständig mit dem Bahnbau zu tun gehabt, wie lange kennen Sie Carter?«
Smith stellt den Kaffeebecher hin und denkt kurz nach.
»Ein Jahr vielleicht, ja, ich glaube, es ist nicht mal ein Jahr«, sagt er dann müde. »Es können neun Monate sein, kaum mehr. Er muß beim Streckenabschnitt neun damals zu Scott gekommen sein. Die Bahn baut immer in Abschnitten, mein Freund. Sie vergibt auch nur für die einzelnen Abschnitte Aufträge. Wenn ich mich nicht irre, hatte Scott damals wenig Geld. Ja, ich glaube schon, da war etwas mit der Bezahlung faul. Er hatte Termine nicht ganz eingehalten. Dann kam Carter und stieg bei Scott ein. Von der Zeit an liefen die Schwellen und Telegrafenstangentransporte immer pünktlich. Mann, Brendan, Carter war bestimmt nie im Krieg.«
»Er spricht Oststaatendialekt, und die Beschreibung paßt?« fragt Brendan kurz. »Marshal, wo finde ich Carter? Ich weiß nicht, ob mein Captain so hieß. Er kann Catter – Waller – oder auch Dweller geheißen haben. Mir ist immer so, als hätte er Dweller geheißen, aber – ich kann mich nicht genau besinnen. Und wo finde ich ihn nun?«
»Na, heute bestimmt nicht mehr, der letzte Zug nach Lodgepole Creek ist weg«, antwortet Smith achselzuckend. »Carter hat seine Station in Lodgepole Creek, dort sammelt er seine Schwellen und die Stangen. Seine Holzfällercamps jedoch sind in der Wildcat Range. Carter steckt die meiste Zeit dort oben. Wahrscheinlich können Sie ihn nur in den Bergen erreichen, Brendan, und das nicht vor dem morgigen Mittag. Der erste Zug kommt nach sieben Uhr früh hier an.«
»Und vorher kann man nicht mit einer Stagecoach fahren?«
»Läuft eine Stagecoach, wo die Bahn fährt?« sagt Smith mit leisem Spott. »No, Mister, schlafen Sie sich aus, Sie wirken völlig erschöpft. Morgen ist auch noch ein Tag, mein Freund. Versprechen Sie sich nichts von einem Besuch bei Carter, bei der Armee war der nie, da bin ich sicher. Seltsame Geschichte mit ihrem Gedächtnis, Brendan, ich hörte schon mal von einem ähnlichen Fall. Der Mann kannte auch seine eigene Frau nicht mehr, gut, was?«
»Ja«, sagt Brendan und nimmt seinen Hut. »Das gibt es, Smith. Nun gut, ich bleibe im Crazy Horse diese Nacht und fahre morgen früh mit dem ersten Zug nach Lodgepole Creek. Vielen Dank, Marshal.«
Als er auf die Tür zugeht, huscht der hagere, fremde Mann unter dem Fenster fort und verdrückt sich am Stall. Augenblicke später klappt die Tür, Brendans Schritte wandern über den Gehsteig.
Der Hagere ist mit wenigen Sätzen aus der Gasse heraus und blickt Brendan nach. Kurze Zeit später sieht der Hagere, wie Brendan seine Pferde in den Stall bringt.
»Sieh mal einer an«, sagt der Mann leise vor sich hin. »Mein Freund Jim Carter ist also nach Meinung des Mar-
shals nie bei der Armee gewesen. Und Scott ist verunglückt? Wie hat dieser Brendan doch gesagt, Dweller, dieser Name, ging ihm nicht mehr aus dem Kopf? Seltsam, was? Carter war angeblich nie bei der Armee?«
Der hagere Mann wartet noch, bis im oberen Stockwerk des Saloons hinter einem Fenster Licht angeht. Dann hastet er los zu seinem in der Mailstation abgestellten Pferd.
»He, Fenter…«
»Ja?« sagt er mürrisch, als der Posthalter aus dem Küchenfenster blickt. »Ist was?«
»Mann, Fenter, ich denke, du willst dir ein paar Holzfäller suchen?« fragt der Posthalter erstaunt. »Willst du wieder weg?«
»Ich habe nur drei Mann, die fahren morgen mit dem Zug nach Lodgepole Creek«, erwidert der hagere Fenter kurz. »Muß noch was besorgen, Dan.«
Sekunden später sitzt Fenter im Sattel und drückt dem Pferd die Hacken ein. Der Gaul geht aus dem Hof, und erst fünfzig Schritte weiter treibt Fenter ihn scharf an.
»Das wird ein verdammter Spaß«, sagt Fenter hämisch, als er die Stadt hinter sich läßt und nach Westen davonprescht. »Carters Gesicht will ich sehen, der Bursche soll sich noch wundern. War nie bei der Armee, was?«
Und er lacht höhnisch vor sich hin.
*
Blinzelnd, die Augen voll Schlaf, blickt Carter auf die beiden Männer.
Es ist still im Camp in den Wildcat Bergen. Die Männer schlafen, nur zwei Feuer brennen schwach, und kalter Luftzug strömt in das einfache Blockhaus, als Carter Fenter hereinläßt, hinter dem Johnson, Fenters rechte Hand, sich in den Raum schiebt.
»Was, zum Teufel, ist los?« fragt Carter wütend. »Mitten in der Nacht, Fenter? Wo kommst du überhaupt her, Mann? Ich denke, du besorgst mir zehn neue Leute für das Holzfällerkommando in Ogallala, und jetzt bist du hier? Ich brauche die Leute bis übermorgen, Mann.«
»So?« fragt Fenter zurück. »Brauchst du Leute, Carter, oder soll ich Major Greystone sagen, oder vielleicht Dweller, Captain Dweller?«
Carters untersetzte, stämmige Gestalt scheint zu schwanken. Hat Carter bis zu diesem Augenblick einen verschlafenen Eindruck gemacht, so zuckt er jetzt zusammen, als träfe ihn eine Kugel. Im nächsten Moment verliert Carter die gesunde Farbe aus dem Gesicht. Zwei Sekunden scheint er umstürzen und gegen den Tisch fallen zu wollen. Dann aber sinkt er, Fenter wie einen Geist anstierend, auf die Bettkante und bleibt dort mit offenem Mund hocken.
»Wa – was sagst du da, Fenter?« stottert er, gewinnt nun aber blitzschnell seine Beherrschung zurück. »Was soll der Unsinn, wie nennst du mich?«
»Major James Greystone«, sagt Fenter höhnisch, während Johnson, ein großer, schwerer Mann mit krausem, dunklem Haar an das Fenster tritt und hinaussieht, »oder Dweller, so habe ich dich genannt, mein Freund. Versuche erst gar nicht, mich zu tricksen, Carter, von mir aus kannst du heißen, wie du willst, mir ist das gleich. Nur Brendan wird das verdammt nicht gleichgültig sein. Freund von dir, dieser Brendan, he?«
»Bren – dan«, keucht Carter entsetzt. »Was – wo – wo ist er? Woher weißt du von Brendan, Mensch? Wo ist der Kerl?«
»Sieh mal an, er wird vernünftig!« antwortet Johnson vom Fenster her mit blitzendem Hohn. »Du hast doch gedacht, uns in der Hand zu haben, was, Carter? Wir sind rauhe Burschen, richtig. Man lernt es in unserem Beruf, Leute aus dem Weg zu räumen. Der dumme Kerl damals, der mit uns spielte und dem wir hinterher das Geld abnahmen, das er uns vorher aus den Taschen getrickst hatte.«
»Halt den Mund!« zischt Carter und kommt mit einem Ruck hoch. »Ihr habt ihn umgebracht, und ich habe es gesehen. Dafür habt ihr mir einen Gefallen getan und mir jemanden vom Hals geschafft, wie? Wir waren quitt.«
»Quitt?« erkundigt sich Fenter eisig. »Nur ruhig, Mr. Carter, ob wir quitt sind, das wird sich noch herausstellen. Du kennst also Brendan. Er ist in Ogallala und wird mit dem Frühzug nach Lodgepole Creek kommen. Vor dem Nachmittag kann er nicht hier sein. Der Bursche will etwas von dir. Es muß länger zurückliegen, im Krieg habt ihr etwas miteinander gehabt, wie? Er sucht einen Major, und das warst du doch.«
»Ich – Major? Ich war nie bei der Armee und…«
Seine Stimme verstummt mit einem heiseren Laut, als Fenter seinen Revolver zieht und die Waffe auf ihn richtet.
»Halt die Luft an, Mann«, zischt Fenter scharf. »In der Kiste da liegt eine Blechkassette. Und in der Kassette ist ein Militärpaß, ausgestellt auf den Namen eines Majors James Greystone. Die Signatur von Greystone und dein eigenes Aussehen decken sich vollständig. Was glotzt du mich so an, he? Ich werde neugierig, wenn jemand eine schwere, eisenbeschlagene Kiste mit zwei Schlössern sichert. Schlösser öffnen, Mister, macht mir Spaß. Na gut, ich habe den Militärpaß gefunden und durchgelesen. Kenne mich mit gefälschten Papieren aus, das Ding da ist echt, nehme ich an. Wie heißt du nun wirklich, Greystone? Dweller, was?«
Carter stiert ihn an, leckt sich über die Lippen und nickt dann.
»Also gut, ich heiße Dweller«, gibt er dann mürrisch zu. »Und dieser Brendan will etwas von mir, auch richtig. Er wird mich umbringen wollen!«
Johnson pfeift leise durch die Zähne, Fenter grinst nur und deutet auf das Bett.
»Setz dich hin«, sagt er kalt. »Jetzt wollen wir mal vernünftig reden, Carter: Dieser Brendan sieht nicht aus wie einer, dem man viel vormachen kann. Er wird dich sofort erkennen, obwohl du früher keinen Backenbart getragen hast, denke ich. Wenn der Kerl dich umbringen will, dann brauchst du uns, was?«
»Ja«, erwidert Carter schwer atmend. »Ihr müßt ihn mir vom Hals schaffen, der Kerl darf es nicht überleben. Großer Gott, wie hat er mich gefunden, wie nur?«
»Das kann ich dir sagen«, grinst Fenter. »Gefragt hat er überall. Ich stand an einem Tresen, als er den Keeper ausfragte und ihm deine Beschreibung gab. Wenn ich nicht gewußt hätte, daß du bei der Armee Major warst, wäre ich nicht aufmerksam geworden. Er ging dann zum Marshal und hat den ausgehorcht.«
»Wa – was? Was weiß Smith?«
»Nichts«, brummt Fenter. »Für Smith hat Brendan eine prächtige Geschichte gehabt, Gedächtnis verloren, hat er Smith erzählt. Smith meinte, du wärest ein friedlicher Mensch. Er meinte auch noch, Scott wäre verunglückt – hähä!«
»Das ist er auch, oder?« keucht Carter. »Was wird das nur? Brendan, dieser Spürhund…«
Johnson nimmt sich eine von Carters Zigarren, brennt sie an und bläst Carter den Rauch ins Gesicht.
»Beruhige dich, mein Freund«, sagt er hämisch. »Scott ist damals unter die Bäume geraten und war tot, ehe er uns dem Marshal melden konnte. Dieser Brendan wird auch nicht mehr lange genug leben, um etwas tun zu können. Wir müssen uns für den Burschen etwas einfallen lassen. Das besorgst du am besten, Carter. Bei Scott hat es auch geklappt, he?«
»Scott wollte euch…«
»Er wollte nur«, unterbricht ihn Fenter trocken. »Warum mußte er auch mit dir dazukommen, als wir den verdammten Kartenhai wegschaffen wollten? Scott brauchte drei Tage, um sich einfallen zu lassen, daß es doch Mord gewesen sein könnte. Und mit Mord wollte Scott nichts zu tun haben, sein Pech. Du hast uns damals gewarnt und uns gesagt, wie wir ihn beseitigen konnten. Dabei hast du aber am meisten gewonnen, was? Dir gehört jetzt alles, Carter, und deine Bezahlung für uns war schäbig. Zweihundert Dollar waren verdammt wenig für Scotts Leben. Was ist dir Brendan wert?«
Carter hält den Kopf gesenkt und denkt blitzschnell nach. Plötzlich weiß er, daß er den beiden rauhen Burschen für alle Zeit ausgeliefert sein wird. Als Fenter und Johnson damals den Spieler umbrachten und er mit Scott dazu kam, wie sie den Toten wegschleiften, wollte Scott nicht glauben, daß der Spieler zuerst den Revolver in der Faust gehalten hatte. Drei Tage schwankte Scott, was er tun sollte, dann entschied er sich, den Marshal doch zu holen. Carter ließ ihn umbringen und gewann so Scotts gesamte Unternehmen.
Diese Halunken, denkt Carter finster, sie haben mich jetzt in der Hand. Wie Blutsauger werden sie an mir hängen und mich zahlen lassen. Ich muß mir etwas einfallen lassen, um sie und Brendan aus dem Weg zu räumen. Morgen nachmittag ist er hier, bis dahin ist nicht mehr viel Zeit. Sie müssen alle drei weg. Brendan zuerst, dann Fenter und Johnson. Alle drei.
*
Wagen rumpeln auf ihn zu, auf denen Männer mit Gewehren sitzen und wachsam in das Buschgelände blicken. Indianer tauchen hier ab und zu auf und greifen einzelne Wagen an. Darum fahren sie in Kolonnen.
Es ist seltsam, daß Brendan wieder von der Erinnerung an seine Kolonnen während des Krieges gepackt wird. Vielleicht machen es die Waffen in den Händen der Männer, daß er an jene Fahrzeugschlangen denken muß, vor denen er ritt.
Diese Männer hier tragen keine Uniformen. Und sie befördern auch keine Munitionsmengen über den Weg. Sie sehen kurz zu Brendan hin. Von hinten taucht ein Reiter auf, zieht sein Pferd vor Brendan herum und fragt knapp:
»Wohin, Stranger?«
»Ich suche Jim Carter«, erwidert Brendan. »In Lodgepole Creek sagte man mir, ich würde ihn hier oben in irgendeinem der Holzfällercamps treffen.«
»Ah, du willst zum Boß?« murmelt der Mann in der derben Kleidung der Holzfäller. »Reite nur immer den Wagenspuren nach, bis du an den ersten Kahlschlag kommst. Hinter dem Kahlschlag siehst du dann linkerhand einen ausgefahrenen Weg, er führt nach Camp Whright. Der Boß ist heute früh mit Fenter hingefahren. Sie wollen aus dem von uns letzte Woche geräumten Camp die dort lagernden Werkzeuge und Schleppseile holen.«
»Wie weit ist das von hier, mein Freund?« erkundigt sich Brendan freundlich. »Habt mächtig Holz geschlagen, was?«
»Die Bahn frißt ganze Wälder«, gibt der Holzfäller mit einem Achselzucken zurück. »Nicht weit, keine fünf Meilen von unserem jetzigen Camp entfernt. Suchst du Arbeit?«
»Vielleicht?«
»Dann sag dem Boß, Jenkins hätte dich geschickt, das bin ich. Er nimmt dich schon, wenn ich für dich gutsage. Paß hinter dem Kahlschlag auf, liegen massenhaft Baumwipfel an der Weggabelung herum. Verfehle den Seitenweg nach Camp Whright nicht, klar?«
»In Ordnung, danke«, antwortet Brendan. Er tippt an seinen Hut und reitet weiter. Hinter ihm bleibt die Kolonne zurück.
Carter, denkt Brendan, Carter wird nicht Dweller sein. Warum soll ein Mann, der nie bei der Armee war, der Schurke Dweller sein? Es ist wieder vergeblich, ich weiß es jetzt schon. Noch vier Meilen bis zu diesem Carter. Und dann die nächste Enttäuschung.
*
Die Blockhütte liegt vor ihm, der Weg endet hier. Und auch die frischen Wagenfährten. Brandstellen überall, Reste von Feuern zwischen den halbhoch abgesägten Baumstümpfen.
Ein verlassenes Camp, das die Spuren jener Wunden trägt, die man einem Waldgebiet schlagen kann. Buschwerk nur noch hier, mittendrin die Hütte, deren Tür offensteht.
Vor der Tür steht ein Wagen, dessen Hinterbrett herausgezogen worden ist. Ein Haufen Äxte und Sägen liegt bereits auf dem Wagen, zu dem Brendan mit ein paar langen Schritten geht.
Dann steht er still und hört das Geklapper von Eisen.
Jemand zählt laut in der Hütte.
»Siebzehn – achtzehn – einundzwanzig Eisenkeile, Boß!«
»Jetzt die Blockspanner, Fenter!«
Ein Kloß steckt urplötzlich in Cal Brendans Hals, etwas beginnt ihn zu würgen. Die Stimme, denkt Brendan, großer Gott, die Stimme!
Er steht still, hat einige Sekunden keine Luft mehr. Der Mann in der Hütte – Carter – Carter redet mit Dwellers knarrender, nasaler Stimme.
»Boß, hier sind zwei mit geplatzten Rollen.«
»So? Dann lege sie beiseite, pack sie nicht zu den anderen, Fenter!«
Luft, denkt Brendan, mir fehlt die Luft. Er ist es, mein Gott, das ist er. Ich brauche ihn nicht zu sehen, nur seine Stimme zu hören. Carter ist Dweller!
Erst in dem Moment, als er den Colt schon aus dem Halfter hat und langsam den Daumen zurückzieht, fällt jene seltsame Betäubung von ihm ab, die ihn beim Erkennen der Stimme überfallen hat.
Er hat nun die Waffe in der Faust und bewegt sich vorsichtig zum Endbrett. Ein Blick genügt, dann sieht er den kurzen Gang der Hütte, dahinter eine offenstehende Tür. Die Hütte muß zwei oder drei Räume haben. Dicke Stangen bilden die Wände, und der Gang ist halbdunkel.
Brendan macht einen weiten Satz an die Wand neben der Außentür der Hütte und hört den Mann fragen:
»Boß, soll ich die Blöcke in einen Sack stecken?«
»Willst du sie etwa einzeln tragen, Mann? Zum Teufel, stell dich nicht an, als machtest du die Arbeit zum erstenmal, Fenter!«
Der Mann dort redet, der Mann ist ein Verräter und lebt. Und andere sind für den Hundesohn gestorben, umsonst!
Brendan steht schon im Gang, sieht auf die linke Tür. Also doch, die Hütte hat drei Räume. Vor der Hüttentür waren nur zwei Spuren. Draußen steht neben dem Wagen ein Pferd. Zwei Männer in der Hütte: einer ist geritten, der andere hat den Wagen gefahren. Dennoch, die Tür linkerhand macht Brendan unruhig. Er legt die Hand auf den Drücker des stabilen Kastenschlosses, probiert kurz, aber die Tür ist abgeschlossen. Noch zwei Schritte für Brendan. Er kommt auf die Endtür des Ganges und jenen großen Raum zu, aus dem das Poltern erklingt, in dem der Mann ist, sein Mann. Er hat ihn monatelang gesucht.
Dweller, denkt Brendan, Schurke! Und dann steht er hinter der Tür, macht den letzten Schritt. Er sieht den Mann in diesem Augenblick über einem Jutesack stehen und einen Block in ihn versenken. Der Mann blickt nicht hoch.
Der andere hockt an einem primitiven Tisch auf einer Stangenbank und schreibt irgendwelche Zahlen in eine Liste. Er sitzt da, den linken Arm auf dem Tisch, in der rechten Hand den Kopierstift. Sein Haar ist schütter, seine Gestalt noch etwas fülliger geworden.
In der Faust Brendans wird der Revolverkolben feucht.
Er richtet den Lauf der Waffe auf den Mann über dem Jutesack.
Ein fremdes Gesicht mit ein paar Pockennarben. Eng zusammenstehende grüngraue Augen. Und ein Mund, der sich nun langsam öffnet. Der Mann läßt den Jutesack los und bleibt gebückt, in den Augen nichts als Schreck, stehen. Einen Moment rührt er sich nicht. Und als er es macht, bewegt er nur die Lippen. Jetzt flüstert er nur, seine Stimme klingt leise und stockend durch den Raum, als er sagt:
»Boß – Boß – da ist – jemand! Boß…«
Er sagt nichts, der Mann Brendan, dem sie keine Chance gaben, jemals wieder gehen oder reiten zu können, er sieht seinen Mann an, der nun langsam den Kopf hebt. Die Augen Dwellers weiten sich, sein Mund beginnt zu zucken, und seine rechte Hand macht jäh einen langen Strich über die Liste. Dann entfälllt der Kopierstift Dwellers Fingern.
»Ver – Brendan?« keucht Dweller.
»Hallo«, murmelt Brendan, sein Colt zeigt nun mitten auf Dwellers dicken Kopf, genau zwischen die Augen. »Hallo, Dweller, mein Freund. Keine Bewegung, Hände ruhig halten, Dweller. Du, Fenter, richte dich auf, Hände über den Kopf, los, Mann!«
»Wa – was?« sagt Fenter verstört und sieht zu Dweller, von dem zu Brendan, als verlöre er den Verstand. »Was soll das, Boß, was heißt das? Mister, das ist…«
»Er heißt nicht Carter!« sagt Brendan eisig. »Sein Name ist Amos Dweller, Mann. Nimm die Arme hoch! Ich sage es nicht noch mal, dann passiert etwas. Dieser Mann, den du als Carter kennst, lebt hier unter falschem Namen!«
»Großer Gott – ist das – wahr?« stammelt Fenter und streckt die Arme jäh nach oben. »Boß, sage doch was, warum schweigst du denn, Boß?«
Dwellers Mundwinkel zucken, aus seiner Nase fährt fauchend der Atem. Aber er sagt nichts, er sitzt da, als hätte ihn der Schlag getroffen.
»Fenter, ich will nichts von dir«, murmelt Brendan kalt. »Halte dich heraus, Mann, sonst hängst du mit in der Sache. Ich werde ihn nach Ogallala zum Marshal bringen und ihn der Armee übergeben. Dein Boß hieß früher Dweller. Er hat im Krieg über ein Dutzend Leute umgebracht. Das ist genug jetzt, Fenter, mach mit der linken Hand deinen Gurt auf und wirf ihn in die Ecke, Mann!«
»Er hat im Krieg…«
Fenters Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse. Dann aber angelt er vorsichtig nach dem Gurt, löst die Schnalle und wirft ihn zur Seite.
»Mister«, keucht er heiser. »Damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin nur der Aufseher hier, ich weiß nichts weiter, als daß dieser Mann Carter heißt und mein Boß ist. Ich will nichts mit dem Gesetz zu tun haben.«
»In Ordnung«, antwortet Brendan knapp. »Geh jetzt hinter Dweller und nimm ihm seine Waffe ab. Dann weg mit ihr und zu den Stricken der Blöcke. Du schneidest zwei Stricke ab, bindest Dweller an Händen und Füßen und machst keinen Fehler dabei, sonst drücke ich ab, verstanden?«
In diesem Moment scheint Dweller endlich wieder zu sich zu kommen. Sein Blick saust zu Fenter, und seine Stimme kippt über, als er schrill sagt:
»Fenter, Fenter! Jede Summe, wenn du mir hilfst, hörst du? Fenter, er ist allein und…«
Fenter reißt entsetzt die Augen auf, als er Brendan mit einem Satz losfliegen sieht. Noch steht Fenter wie erstarrt zwei Schritte von Dweller entfernt, als Brendan kommt und Dweller einen schrillen, furchtsamen Schrei ausstößt. Im nächsten Augenblick saust Brendans Colt herunter.
»Nun?« fragt Brendan scharf, als Fenter mit erhobenen Armen und bleichem Gesicht an die Außenwand zurückweicht. »Die Stricke, Mister, binde ihn! Oder willst du ihm helfen?«
»Ich – ich bin doch nicht verrückt, Selbstmord zu begehen«, japst Fenter bestürzt. »Schon gut, Brendan, in Ordnung, ich binde ihn. Was – was hat er getan im Krieg?«
»Er war ein Verräter!« erwidert Brendan kurz. »Angeblich zerriß ihn die Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Wagens. Mann, ich sage die Wahrheit, du wirst sie in Ogallala bestätigt finden. Genügt dir das?«
»Dann bist du im Auftrag der Armee hinter ihm her?«
»Ungefähr das«, gibt Brendan kühl zurück. »Also, was ist nun, willst du den Kerl binden?«
»Sicher!« sagt Fenter seufzend. »Ich will keinen Ärger mit dem Gesetz oder der Armee. Du brauchst mich nicht dauernd über den Lauf des Revolvers anzusehen, Mann.«
Kaum hat er Dweller hinter dem Tisch herausgezerrt und gebunden, als Brendan mit dem Revolver wedelt und Fenter in die linke Raumecke schickt. Dort bleibt Fenter kopfschüttelnd stehen und sieht zu, wie Brendan die Fesselung kontrolliert.
»Fest genug!« stellt Brendan fest. »Fenter, pack dir den Kerl auf den Rücken und bringe ihn hinaus auf den Wagen. Du wirst fahren, und ich reite. Wir fahren zur Bahn, bringen Dweller in den nächsten Zug und schaffen ihn zur Stadt, verstanden?«
»Mein Gott, hier sind fünfzig Männer beschäftigt. Sie werden alle ihre Arbeit verlieren, wenn Carter – eh, ich meine, wenn Dweller ins Jail fliegt. Mister, es gibt nur noch Missis Scott, und sie kann keine Befehle geben. Großer Gott, wir werden alle die Arbeit verlieren.«
Er kommt heran, wuchtet Dweller hoch und legt ihn sich auf den Rücken. Brendan steckt die Listen Dwellers ein, deutet dann auf die Tür und sagt ruhig:
»Vielleicht übernimmt die Bahngesellschaft die Linie und euch alle, wir werden sehen. Jetzt bring den Hundesohn auf den Wagen, Mann. Ich habe ihn lange genug gesucht.«
»Die Bahn – vielleicht?« schnauft Fenter unter der Last Dwellers. »Herr im Himmel, es wird die anderen wie ein Schlag treffen. Ich wußte nicht mal, daß Carter – Dweller – bei der Armee war. Das ist eine verdammte Geschichte, Mr. Brendan. Nun gut, auf welcher Seite hat er gekämpft?«
»Er hat den Südstaatlern eine Menge Nachschubtransporte verraten«, sagt Brendan. »Wieviel Männer durch seinen Verrat gestorben sind, wird man nie genau feststellen können, aber sicher sind es zusammen beinahe hundert.«
»Was?« keucht Fenter und geht durch den Gang. »Hol ihn der Satan, hundert unserer braven Burschen hat der Kerl auf dem Gewissen? Mann, ich schlage ihm die Zähne ein. Er hat unsere Jungens den Rebellen ausgeliefert. Wenn ich jemals etwas gehaßt habe, dann Verrat.«
Er flucht laut und wild, während er Dweller ins Freie schafft. Seine Flüche schallen durch den Gang. Dann geht Fenter zum Wagenende, dreht sich um und schleudert Dweller unter einer wilden Verwünschung auf die Äxte und Sägen.
»Da, du dreckiger Verräter! Man sollte den Kerl zwischen zwei Bäume spannen und…«
Brendan hört das Klirren und Singen der Werkzeuge, auf die Dweller hart schlägt. Er ist in der Tür, als er hinter sich das Fauchen vernimmt und noch versucht, ruckhaft den Kopf herumzunehmen.
Die Tür, die Seitentür, schießt es Brendan jäh durch den Kopf, jemand ist hinter meinem Rücken aus der Tür gekommen!
Nichts als das Fauchen ist hinter ihm. Er sieht, wie Fenter urplötzlich einen Satz um den Wagen macht und dabei in seine Hosentasche greift. Brendans Colt zeigt zu Boden. Und es ist zu spät, irgend etwas mit der Waffe zu tun.
Der Hieb des dritten Mannes, der aus der vor vier Minuten noch verschlossenen Tür gesprungen ist, trifft Brendans Nacken. Die Wucht des Schlages schleudert Brendan nach vorn. Es gelingt ihm nicht mehr, abzudrücken.
Die Welt geht für Brendan in einem blendenden Blitz unter.
*
»Wach auf, du Satan, wachst du auf?« Er hört sich selbst stöhnen und spürt den Schmerz in den Rippen wieder. Tritte fahren ihm in die Seite.
»Wachst du auf, Hund?«
Etwas wuchtet ihn herum und reißt ihn empor. Er schwebt plötzlich, bis er irgendwo hinknallt und blinzelnd und verschwommen die Decke aus Stangen über sich erkennt.
»Er kommt zu sich!« hört er Fenter sagen. »Es ist soweit, Boß. Der Narr hat es verdammt schnell geschafft. Muß ganz schön zäh sein, der Bursche. Na, Mann, willst du noch etwas Wasser?«
Es klatscht ihm ins Gesicht und macht ihn ganz munter. Nur der bohrende, nagende Schmerz in seinem Hinterkopf und Nacken bleibt. Durch Wasserschleier sieht er das Gesicht über sich, Dwellers höhnische Fratze.
»Hund!« knirscht Dweller voller Haß. »Hast du geglaubt, mich zu haben? Ich habe dich, und du wirst bald in die Hölle sausen, das verspreche ich dir. Antworte, weiß die Armee davon, daß du hergeritten bist? Wer weiß es außer dir, wer? Du sollst antworten!«
»Sie – sie wissen es nicht!« stöhnt Brendan. »Nur der Marshal weiß, daß ich heraufgeritten bin – aber er weiß nichts von der Sache.«
»Wie hast du es erfahren, du Hund – wie? Rede, gib Antwort, sonst erwürge ich dich. Brendan, gib dir keine Mühe zu lügen, du trickst mich nicht. Ich habe dich getrickst, ich, hörst du? Der schlaue Brendan, der jede Fährte findet, mir ist er in die Falle gelaufen! Ich bekomme alles heraus, alles, hörst du? Wie bist du Satan auf die Idee gekommen?«
Hinhalten, denkt Brendan verzweifelt, reden und antworten, ihm alles sagen, nur etwas nicht. Der bringt mich um, aber er ist eitel, er wird mir alles erzählen wollen, um sich groß und klug vorzukommen. Das könnte helfen, Zeit zu gewinnen, nur Zeit.
»Im Hospital«, sagt er stockend. »Ich lag wochenlang mit der Verwundung und konnte viel nachdenken. Sie gaben mir die Schuld, sie verdächtigten mich, weil ich die Kolonne von der Nachschubroute gebracht hatte, ein Verräter zu sein. Aber ich war keiner, und irgendwer mußte die Rebellen auf unsere Spur gehetzt haben. Da war James Mitchell, der Mann der Rebellen, der starb und das Geheimnis seiner Leute mit ins Grab nahm. Sie verdächtigten mich, mit Mitchell gearbeitet zu haben.«
»Weiter, weiter, Brendan…«
Er redet, er erzählt alles von seinen Nachforschungen, von dem verschwundenen Militärpaß, von dem Beginn seiner Suche und von Captain Gordon Bennet, der nichts wußte.
»Allein!« knirscht Dweller endlich. »Hund, allein heraufgekommen? Gut, du sollst auch allein sterben! Verschollen irgendwo, weitergeritten bist du, wenn mich jemand fragt. Du Narr, du verdammter, man kann dich suchen, aber finden wird dich niemand.«
»Wer weiß«, sagt Brendan heiser und sieht den Verräter schmaläugig an. »Die Sonne bringt alles an den Tag, Dweller. Du wirst keine Ruhe mehr haben und immer denken, daß eines Tages doch jemand kommen könnte. Ich habe es auch geschafft, warum nicht andere?«
»Mensch, es kommt nie mehr einer! Mich machst du nicht verrückt, mich nicht. Ich habe schon ganz andere Dinge gemacht!«
»Ja«, erwidert Brendan und sieht zu den beiden Männern hin. »Scott ist doch auch nicht durch einen Unfall umgekommen, was? Damals ist Mansfield von dir erstochen oder erschossen worden, was?«
»Mansfield – mein Fahrer, richtig«, sagt Dweller. »Er merkte nichts, ich schoß ihm in den Rücken, es ging ganz schnell für ihn. Der Trick mit dem Sprengstoff war gut, was? Und Scott, ich habe ihn nicht umgebracht.«
»Die beiden da?« fragt Brendan. »Du hast nie teilen wollen, Dweller, denke ich. Dein Geld steckte in Scotts Unternehmen, aber den Gewinn mußtest du mit ihm teilen, wie? Wer von den beiden da hat ihn für dich umgebracht?«
Fenter verzieht das Gesicht und spuckt aus. Dann tritt er an die Bank, auf der Brendan liegt.
»Was soll das, wozu noch lange reden, Boß? Der Kerl ist mir zu schlau. Je eher er weg ist, desto besser für uns alle. Der kommt auf die verrücktesten Sachen, verdammt.«
»Kann er etwas tun?« fragt Dweller höhnisch und deutet auf Brendans Fesselung. »Er wird zu niemandem mehr reden können, wenn wir mit ihm fertig sind. Habe ich euch nicht gesagt, daß er gerissen wie ein Indianer ist? Well, Brendan, Scott wußte ein wenig zuviel, genügt dir das?«
»Ich dachte es mir«, murmelt Brendan. »Er wußte also, daß du mal bei der Armee warst?«
»Das nicht«, sagt Dweller hämisch. »Es war ein Fehler, den verdammten Militärpaß zu nehmen. Ich wollte Major werden, den ganzen Krieg über wartete ich darauf, daß sie mich beförderten. Aber sie taten es nicht. Ich blieb immer der kleine Versorgungscaptain. Zum Führen einer Einheit reicht es nicht, sagten sie. Ich hätte das Zeug nicht dazu. Das verdammte Narrenvolk! Darum machte ich mich selbst zum Major, aber es war falsch, es war beinahe tödlich. Wir hatten mal einen Major in der Armee, den kannte ich. Er fiel eines Tages, und sein Name paßte mir. Darum setzte ich ihn in den gestohlenen Militärpaß ein. In Saint Louis traf ich jenen, der den richtigen Major Greystone gekannt hatte. Der Kerl hörte, wie mich der Keeper in meinem Hotel mit Major Greystone anredete und kam zu mir.«
»Und du warst nicht jener Grey-
stone, den er kannte, was?« sagt Brendan leise. »So ist das. Du wolltest immer Major sein. Und weil du über den Captain nicht herauskamst, Dweller, wurdest du zum Verräter, du Lump!«
»Boß, hör auf, schaffen wir ihn weg, in zwei Stunden wird es dunkel!« zischt Johnson.
»Noch nicht!« keucht er und stiert Brendan voller Haß an. »Er soll die Hölle von innen sehen, ehe ich mit ihm fertig bin. Der denkt genauso wie die anderen Narren von der Armee. Ich hatte das Zeug zum Colonel, wenn nicht zu noch mehr, Brendan, verstanden? Sie waren alle gegen mich, weil ich vorher Händler war. Der paßte nicht zu ihnen, der durfte nicht befördert werden. Abgeschoben haben sie mich, sie ließen es mich fühlen, daß ich für sie eine Krämerseele blieb, die hochmütigen Burschen im Stab. Ich habe sie gehaßt, diese hochnäsigen Narren. Gut, ich habe sie verraten, na und? Das war meine Antwort für die De-mütigungen meiner Vorgesetzten. Ich war klüger als sie, ich wußte es, und ich bewies es mir, verstehst du?«
»Ich verstehe«, antwortet Brendan mühsam. »Sie hatten deine Qualitäten erkannt, und sie erkannten sie richtig. Du hättest in keinem Gefecht deinen Mann gestanden, Dweller, weil du im Grunde ein Feigling bist. Das sind die meisten Verräter. Du trafst jemanden, der den richtigen Greystone kannte und du warst wieder zu feige, dich weiterhin Major nennen zu lassen. Du hattest Angst, von irgendwem erkannt zu werden, darum hast du so getan, als wärst du nie bei der Armee gewesen. Niemand sollte vermuten, daß du jemals etwas mit der Armee zu schaffen hattest. Nach Greystone legtest du dir den Namen Carter zu, sicher hast du auch Papiere auf diesen Namen. Und der richtige Carter?«
»Gestorben am Schwarzwasserfieber!« sagt Dweller. »Ich nahm seine Papiere an mich. Er war Händler wie ich. So, ich bin feige?«
»Das bist du auch!« sagt Brendan kalt. »Feige und verschlagen. Ich wette, du hast aus den siebzigtausend geraubten Dollar etliche Tausend mehr gemacht.«
Er sieht den Blick, den sich Johnson und Fenter jäh zuwerfen. Fenters Gesicht erstarrt, dann wendet er sich langsam nach Dweller um.
»Was ist das?« fragt Fenter lauernd. »Moment mal, Boß, was sagt Brendan – siebzigtausend Dollar geraubt?«
»Sechsundsiebzigtausend«, murmelt Brendan. »Er stahl die Armeekasse. Hat er euch das nicht gesagt?«
»Zum Teufel, Boß, warum hast du nichts davon gesagt? Warum hast du uns erklärt, da wäre eine dunkle Armeegeschichte, und Verrat wäre im Spiel? Warum hast du nichts von dem Geld gesagt, he?«
»Der verdammte Hundesohn!« faucht Dweller. »Ich habe das Geld nicht, es flog in die Luft!«
»Nur ein paar zerfetzte Scheine, mehr nicht!« gibt Brendan zurück. »Du hast einige Scheine geopfert, Mister. Mit dem Hauptteil des Geldes bist du verschwunden, ich weiß es. So, hat er euch nichts davon gesagt?«
»Verflucht!« knurrt Fenter und wechselt einen Blick mit Johnson. »Und dann will er uns mit tausend Dollar abspeisen? Moment, mein Freund, fünftausend und keinen Cent weniger.«
»Was?« keucht Dweller. »Fünftausend? Seid ihr wahnsinnig? Mein Geld steckt im Geschäft, ich kann nicht…«
»Er kann«, meldet sich Brendan leise und sieht, wie Fenter zupackt und Dweller, der sich auf ihn stürzen will, zurückreißt. »Zehn Prozent der Summe würde die Armee dem Mann zahlen, der das Geld wiederbringt. Zehn Prozent, Fenter, siebentausendsechshundert Dollar für euch. Halte ihn fest, Mann, sonst bringt er mich gleich um! Überlegt es euch, gibt er euch nicht mehr als siebentausend, dann könntet ihr mich losbinden und den Kerl dafür in Eisen legen. Ich würde auf die Belohnung verzichten.«
Dweller beginnt wie ein Wilder zu toben.
»Ruhig!« brüllt ihn Fenter schließlich an. »Hör zu, Dweller, er hat recht, der verdammte Kerl. Nur vergißt er, daß du uns auch in der Hand hast. Zehntausend, fünf für jeden von uns, sonst…«
»Ihr – ihr Halunken, ich habe das Geld nicht auf einen Schlag, ich muß erst zur Bank und es beschaffen. Zehntausend, ich bin ruiniert!«
»Aber uns los«, sagt Johnson höhnisch. »Mit zehntausend Dollar siehst du uns nie wieder, Dweller. Na, wie ist das?«
Dweller erschlafft, torkelt zur Wand und lehnt sich lechzend gegen sie.
»Ist gut«, murmelt er, erschöpft von seinem Wutausbruch. »Ihr bekommt das Geld, aber jetzt schafft mir den Kerl weg. Laßt ihn dort verschwinden, wo auch der Spieler damals geblieben ist. Fort mit ihm, bringt ihn aus meinen Augen, sonst vergesse ich, daß er die Hölle sehen soll und mache es selbst!«
Er stiert Brendan an, den Johnson und Fenter hochreißen. In seinem Blick ist jener düstere Haß, den Brendan schon oft bei Männern gesehen hat, die bereit waren, jemanden kaltblütig zu töten.
»Fenter!« sagt er schnell. »Mann, ich warne euch, er…«
Er kann nicht mehr reden. Dweller springt auf ihn zu und reißt seinen Revolver heraus. Und dann schlägt er ihm die Waffe über den Kopf.
Er zahlt nie, denkt Brendan noch, eher bringt er die beiden Halunken auch noch um. Er zahlt nie.
*
Er liegt auf der Erde, und der Wagen steht dreißig Schritte entfernt, an dem Fenters Pferd gebunden ist. Dort gibt es einen Vorsprung über dem unheimlichen, dunkel gähnenden Steilabfall einer nackten Felsschlucht. Die Sonne steht schon tief.
»Siehst du, Brendan, da unten wirst du landen«, sagt Dweller hämisch. Er kommt langsam vom Wagen heran, sieht voller Hohn auf Brendan hinab und stößt ihn mit dem Stiefel an. »Hundertachtzig Schritte, Brendan – ganz gut, was? Los jetzt, schafft ihn an die Kante?«
Er tritt zurück, als Brendan einen dumpfen, erstickten Laut unter dem Knebel ausstößt und Fenter starr anblickt. Dwellers Gesicht ist eine höhnische Fratze, denn vergeblich bemüht sich Brendan, den Knebel auszustoßen. Umsonst blickt Brendan Fenter an. Der Mann beachtet ihn kaum, packt ihn an den Armen und zerrt ihn hoch.
»Boß, ich glaube, er will noch etwas sagen!« meldet sich Johnson, der Brendan an den Beinen ergriffen hat, heiser. »Er will sicher um sein bißchen Leben wimmern. Sollen wir ihm nicht doch den Knebel rausnehmen?«
»Nein!« fährt Dweller ihn scharf an. »Wenn jemand in der Nähe ist und hört ihn schreien, ist die Hölle los. Der Knebel bleibt, verstanden? Wartet, zeigt ihm erst mal, wie tief es hinuntergeht. Wartet noch, ich will es vom Vorsprung aus sehen, damit ich sicher bin, daß er unten auch gut ankommt! Moment mal.«
Er rast am Wagen vorbei bis zu dem von Büschen umstandenen Vorsprung, einer Felsnase, die weit über die Schlucht ragt. Von dort aus muß er freie Sicht bis in die Tiefe haben. Als er sich hinkauert, versucht Brendan verzweifelt, dumpfe Laute ausstoßend, Fenter auf sich aufmerksam zu machen. Während Johnson einen sturen Eindruck macht, wirkt Fenter auf Brendan bedeutend schlauer und gerissener. Anscheinend erkennt keiner der beiden rauhen Burschen, daß Dweller absichtlich zum Vorsprung gegangen ist. Er ist dort von den Büschen halb verdeckt und nur fünfzehn Schritte von Fenter und Johnson entfernt. Es ist die günstigste Weite für Dwellers Revolver.
Großer Gott, sie sind Narren, denkt Brendan verzweifelt. Merken sie denn nichts? Können sie sich nicht ausrechnen, daß Dweller ihnen niemals auch nur einen Cent geben wird? Er erzählt ihnen, er wolle sehen, ob ich gut unten lande, aber in Wahrheit hat er vor, sie zu erschießen, sobald ich unten bin.
Fenter schleift ihn bis zur Kante und richtet ihn dann auf. Sie haben Brendan an einen abgehauenen Ast gebunden, und Brendan kann weder austreten, noch die Arme gebrauchen. Steif wie eine Mumie steht Brendan, von den beiden Männern gehalten, einen Schritt vor dem Abgrund. Er kann nur die Tiefe erkennen und schließt einen winzigen Moment schaudernd die Lider. Unter ihm liegen im Zwielicht der einsetzenden Dämmerung die buckligen, schroffen Felsen. Klippen ragen wie messerscharfe Grate hoch. Dazwischen ist großes Geröll, große Felsbrocken.
»Fenter, in Ordnung«, hört er Dweller heiser sagen. »Noch näher mit ihm. Und dann hinunter, ich werde sehen, wo er aufkommt. Der verdammte Bluthund, hier ist seine Fährte schon zu Ende.«
In diesem Augenblick sieht Fenter Brendan an, dreht ihn dann mit einem Ruck und schrickt zusammen, als er in Brendans Augen blickt.
Brendans Blick liegt auf der Stelle, an der Dweller kauert. Der Verräter kniet, starrt in die Tiefe und sieht nicht, daß sich hinter ihm ein Busch teilt.
Aus dem Busch taucht lautlos eine kleine, magere Gestalt mit einem schmutzigen, fleckigen Hirschlederhemd auf.
*
Mein Gott, denkt Brendan verstört, als er den kleinen Mann vorwärtsschnellen und mit dem Revolver zuschlagen sieht, Matt Jackson!
Es ist die Sache eines Augenblicks.
Kaum wendet Brendan den Kopf, als Fenter seinem Blick folgt. Zwar sieht Fenter seitlich zu jenem Vorsprung, aber für ihn genügt ein blitzschnelles Kopfherumdrehen, um den kleinen Mann dort herumwirbeln zu sehen.
Jackson, der kleine Mann mit den kurzen Säbelbeinen und langen Armen, muß über den zusammengesunkenen Dweller hinweghechten. Die Bewegung wird von Fenter augenblicklich erkannt.
Noch ist der kleine Mann mitten im Sprung, als Fenter den Mund zu einem Schrei aufreißt und sich zurückwirft. Fenter erkennt den Revolver in der Hand Jacksons und handelt im Bruchteil eines Augenblicks. Noch kann der kleine Bursche nicht schießen, noch hat Fenter eine Chance, von der Kante und hinter den nächsten Busch zu kommen.
»Johnson, Vorsicht!«
Brendan begreift es jäh: Er hat sich geirrt. Weder Fenter noch Johnson haben Dweller blindlings vertraut. Beide sind bereit gewesen, sofort gegen Dweller Front zu machen, das erkennt Brendan im Bruchteil einer Sekunde. Die beiden Schurken müssen geahnt haben, was Dweller ihnen zugedacht hatte.
Kaum ist Fenters Schrei heraus, als sich auch Johnson zurückwirft. In seiner rechten Hand, mit der linken hat er Brendan gehalten, taucht jäh der Revolver auf. Der Mann zieht so schnell, daß Dweller kaum eine Chance gehabt hätte, sie zu überraschen.
Brendan aber steht plötzlich, herumgerissen von Johnsons Hand, aufrecht und frei dicht an der Schluchtkante. Es ist Brendan, als käme ihm die Kante rasend schnell entgegen.
Es geht hinunter, denkt er noch.
Und dann hört er den Knall.
*
Das fürchterliche Gefühl, zu fallen, dauert nur eine Sekunde. Er schlägt hart auf und spürt, wie die dicke Stange gegen seinen Rücken prallt. Dann liegt er, den brüllenden Knall von Fenters Revolver noch in den Ohren, dem jetzt ein zweiter Schuß folgt, auf dem Rücken. Im Unterbewußtsein fühlt er die todbringende Nähe der Schluchtkante, während links von ihm Zweige brechen und Fenter vornüber in den Busch fällt. Äste brechen unter der Gewalt von Fenters Fall.
Brendan hebt den Kopf, er sieht Johnson keine zwei Sehritte vor dem Busch, in den Fenter gestürzt ist. Mit einer seltsam unbeholfenen Bewegung versucht Johnson seine rechte Hand mit dem Colt hochzubringen. Aus der Mündung der Waffe bricht die nächste Feuerlanze, und die Kugel schlägt keinen Schritt von Brendan entfernt in den Boden ein. Danach torkelt Johnson mit verzerrtem, zuckendem Gesicht rückwärts. Der Mörder stolpert keine zwanzig Zoll an Brendans Stiefel vorbei. Dann neigt er sich nach vorn und sinkt in sich zusammen. Brendan hat den Eindruck, als würde Johnson zu Boden sinken. Danach aber hört er das dröhnende Gepolter und versucht den Kopf zu heben.
Brendan sieht nun, was geschehen ist. Bis jetzt hat Brendan nur nach rechts gesehen. Nun blickt er nach links und macht im nächsten Moment die Lider zu. Unmittelbar an Brendans Stiefeln beginnt die Kante der Schlucht. Die Stelle, an der Johnson vor drei Sekunden noch gewesen ist, ist leer. Johnson ist verschwunden, wie von einem Strudel verschlungen.
Nur das schwere, dröhnende Gepolter von Steinen dringt aus der Tiefe zu Brendan hoch.
Es ist der heisere, krächzende Laut einer Stimme irgendwo hinter Brendan, der ihn dazu bringt, die Lider wieder zu öffnen. So gut er kann, nimmt Brendan den Kopf herum. In diesem Augenblick sieht er den kleinen Mann am Boden knien.
Matt Jacksons Gesicht ist totenbleich. In seinem Hirschlederhemd ist ein Loch, aus dem Blut rinnt. Der kleine Mann starrt Brendan aus weit geöffneten Lidern an. Dann neigt sich sein Oberkörper nach vorn. Jackson kippt um. Dennoch bleibt sein Blick auf Brendan gerichtet. Es ist unheimlich, wie Jackson trotz seiner augenblicklichen Schwäche die Hände nach vorn nimmt. Er läßt nicht mal den Revolver los, sondern zieht sich mit steinernem Gesicht und fest zusammengebissenen Zähnen Zoll um Zoll an Brendan heran. Dabei läßt er Brendan keine Sekunde aus den Augen. Und nur die Augen verraten, welche Schmerzen Matt Jack-son in diesem Augenblick fühlen muß.
Trotz allem, der kleine Mann kriecht, er kommt und gibt nicht auf. Brendan beobachtet die Anstrengung Jacksons mit verstörtem Staunen. Mühsam zieht sich Jackson bis an Brendans Seite.
Danach richtet sich Jackson auf. Seine Hände sind nach wie vor in Brendans Schultern verkrallt.
So wirft sich der kleine Mann mit einem Ruck nach hinten. Der Schwung reicht aus, Brendan über die rechte Schulter zu wälzen und auf den Bauch zu rollen.
Sekundenlang glaubt Brendan, halb erstickt durch den Knebel, keine Bewegung mehr neben sich zu spüren. Er ist unfähig, sich zu regen oder zu rufen.
Plötzlich ist es Brendan, als kröche ihm etwas über den Rücken. Er hört das scharfe, fauchende Luftausstoßen und Atemeinsaugen des kleinen, ei-
senharten Jackson unmittelbar neben sich.
Augenblicke später fühlt er, wie sich der gräßliche Druck um seine Arme lockert. Und dann sagt Matt Jackson mit krächzender, kaum hörbarer Stimme:
»Es hat gereicht, well.«
Dies ist alles, was der kleine Mann herausbringt. Brendan hat die Hände frei, aber Jackson liegt auf ihm wie ein schwerer Klotz. Nur mühsam gelingt es Brendan, die Hände zum Knebel zu bringen. Er starrt auf die tiefen roten Striemen an seinen Handgelenken und stemmt sich von der Kante ab. Der kleine Mann rutscht nun von ihm herunter und bleibt neben ihm liegen. Sein breites Jagdmesser liegt im Gras. Brendan packt es, richtet sich nach einer Drehung zur sitzenden Stellung auf und durchtrennt auch die Stricke, die seine Beine an die Stange gepreßt haben.
»Matt!« stößt er nach ein paar keuchenden Atemzügen heraus. »Kleiner, he, Matt.«
Der kleine Mann liegt auf der Seite und macht ein seltsam friedliches Gesicht.
»Großer Gott, er wird doch nicht tot sein?«
Brendan beugt sich vor, kommt auf die Knie und legt die Hand an Jacksons Hals. Jacksons Puls schlägt, der kleine, zähe Bursche ist ohnmächtig geworden. Matt hat ihm das Leben gerettet.
*
Regen klatscht gegen die Scheiben. Grau der Himmel, Kälte draußen und auch hier in jenem Backsteinbau von Omaha. Der Tag ist da, ein trüber, düsterer Herbsttag voller Dunst und gespenstischer Stille.
Omaha, denkt Brendan und starrt aus dem Fenster auf den Hof hinunter, Omaha, Nebraska. Ich wußte doch, daß sie zwölf Wochen brauchen würden. Sie brauchen immer lange bei der Armee, sie sind zu gründlich und wollen alles wissen.
Irgendwo Kommandos unten im Hof von Fort Omaha. Dann der Marschritt einer Kolonne. Er blickt in den Hof und sieht sie auf das Gestell zumarschieren. Regen fällt auf ihre blauen Uniformen und Gewehre. Die Scheibe beschlägt von seinem Atem und wird undurchsichtig. Er kann nur noch Schatten unten erkennen, nichts als Umrisse, die immer mehr verschwimmen. Selbst das Holzgestell ist nun nicht mehr genau zu sehen.
Brendan steht still. Er könnte über die Scheibe wischen und alles sehen, wenn er wollte, aber er will plötzlich nicht mehr. Er hört die Trommeln und die knappen, scharfen Befehle. Dann liest irgend jemand das Urteil noch einmal vor. Die Stimme klingt laut und klar durch den verhangenen, finsteren Morgen.
Schritte danach, das Dröhnen von Bohlen auf jenem Gestell mit der Plattform und der Klappe. Die Trommeln werden lauter, als eine Stimme sich meldet, schrill durch Regen und Dunst dringt. Dumpfer, schneller der Trommelwirbel, bis er die Stimme übertönt und plötzlich ein Krach erfolgt, als fiele das Gestell unten im Hof zusammen.
Totenstille danach für Sekunden. Und dann wieder Kommandos, knappe, scharfe Befehle.
Brendan rührt sich nicht, als er die Tritte auf der Treppe hört und die Tür hinter ihm klappt. Jemand humpelt leicht und nähert sich ihm hüstelnd.
»Du hast ja nichts sehen können, Cal«, sagt der kleine Mann neben ihm heiser. »Nun, du hast auch nichts versäumt. Dweller war kein erhebender Anblick. Dennoch, du hättest nur die Scheibe freizuwischen brauchen.«
»Wozu?« fragt Brendan. »Ich wollte bleiben, bis es vorbei war, ich hatte es mir vorgenommen, Matt. Wir können gehen, Alter. Am Nachmittag fährt das Schiff ab.«
Er wendet sich um und sieht die vier Männer in der blauen Uniform stehen. Sie sind in der Tür zurückgeblieben und blicken ihn an.
»Mr. Brendan«, sagt der Colonel dünn. »Ich kann nur nochmals versichern, daß die Armee den Irrtum bedauert. Irrtümer gibt es immer einmal, obgleich…«
»Schon gut«, murmelt Brendan. »Sie können nichts dafür, Sir. Mir genügt, was geschehen ist, um den Vorwurf gegen mich zurückzunehmen. Guten Tag, Sir!«
Er geht hinaus und hört Little-
Jackson neben sich humpeln. Der kleine Bursche kommt kaum mit, also verlangsamt Brendan seinen Schritt. Irgendwann sind sie am Tor, vorbei an salutierenden Posten und draußen im böigen, naßkalten Wind, der den Regen vom Missouri herüberpeitscht. Sie gehen nebeneinander her, zwei Männer, die nicht sprechen und erst stehenbleiben, als sie den Fluß erreicht und ihr Hotel vor sich haben.
»Und jetzt?« fragt der kleine Mann heiser. »Du fährst nach Hause, deine Eltern warten.«
»Und du kommst mit«, sagt Brendan. »Bei uns ist es warm, immer warm. Es gibt Arbeit für jeden, auch für dich, Matt.«
Jackson schweigt, starrt auf den Fluß, die Wellen und kleinen Schaumkronen.
»Nein!« stößt er plötzlich heraus. »Du fährst allein, Cal. Nicht reden, unterbrich mich nicht. Du kommst nach Hause, sie werden dich erwarten. Sie wissen längst, daß du unschuldig gewesen bist. Die Leute sind nun mal so, heute jubeln sie, morgen spucken sie dich an. Ich könnte dort nicht leben, verstehst du? Eines Tages, wenn der kleine Matt keine Zähne mehr im Mund hat, um zu beißen, wird er einen Platz brauchen. Und der Platz wird bei dir sein. Ich wüßte niemanden, zu dem ich sonst gehen würde. Frei wie ein Vogel, Freund und Bruder. Was kann einem Mann Besseres im Leben geschehen, als frei zu sein? –
Meine Sachen sind schon nicht mehr im Hotel, ich habe sie wegschaffen lassen. Man soll nie lange Abschied feiern, er wird nur schwerer dadurch. Grüß deine Leute zu Hause, auch dieses Girl, von dem du mir erzählt hast, James Mitchells Tochter. Muß ein feines Girl sein, denke ich. Nimm sie zur Frau, wenn sie will. Du taugst dazu, Kinder in die Welt zu setzen, ich nicht. Also, Cal, man soll kurzen Abschied nehmen, wie? Dann nehmen wir ihn, meine ich. Adios, Bruder Cal, vergiß den kleinen Matt nicht ganz. Und wenn du einen Vogel hoch oben am Himmel siehst, dann denk an mich, ich werde so frei sein wie er. Adios.«
Er faßt nach Brendans Hand. Und dann dreht er sich mit einem Ruck um.
»Matt!« sagt Brendan stockheiser. »Matt, Alter…«
Da geht er, er humpelt leicht. Und der Dunst kommt vom Wasser her und nimmt ihn auf, verschluckt ihn.
»Matt!«
Brendan läuft los, hinein in den Dunst. Regen peitscht ihm ins Gesicht.
»Matt!«
Fort, verschwunden wie ein Spuk. Schließlich lehnt er irgendwo an einem Stapel Kisten und brennt sich eine Zigarre an. Er raucht fahrig, der Rauch schmeckt bitter.
Ja, denkt er, ja, er hat es kurz gemacht, und er hat recht. Wenn er geblieben wäre, hätte ich ihn umstimmen und mitnehmen können. Aber glücklich wäre Matt nie geworden. Die Weite lockt ihn.
Er geht los, der Regen fällt dichter. Dort drüben liegt Fort Omaha. Und in seinem Hof haben sie einen Verräter zum Galgen geführt.
Der Mann ist tot.
Die Jagd zu
– E N D E –