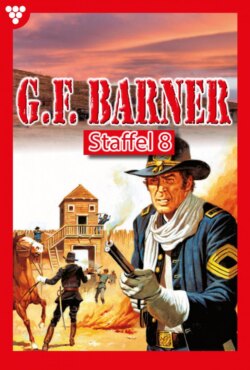Читать книгу G.F. Barner Staffel 8 – Western - G.F. Barner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer schwache Lichtblitz einer Laterne warnt Chuck Madison. Er macht einen Riesensatz, fliegt gegen die Bretterwand, rutscht ab und landet mitten in einer Wasserlache.
Im selben Augenblick feuert der Mann vor Chuck. Der belfernde, scharfe Knall des Revolvers übertönt das wütende Peitschen des Windes und den herabprasselnden Regen. Die Kugel faucht über den Marshal von Virginia City hinweg, knallt in den Bretterzaun, durchschlägt ihn und bleibt im Schuppen stecken.
Noch zwei Patronen, denkt Madison grimmig, als er sich aufstemmt und den Mann hinter den düsteren Hütten des Diggercamps und einem Haufen Unrat verschwinden sieht.
Vor Madison liegt das abfallende Ufer des Baches. Hier stehen über hundert Hütten im wirren Durcheinander. Es gibt winklige und verschlungene Gassen zwischen ihnen. Wer sich hierhin wagt, der kommt manchmal nicht mit dem Geld wieder, das er in den Taschen hatte, als er das Diggercamp betrat.
Hinter Madison ertönen Rufe. Irgendwo flucht ein Mann heiser. Eine Frau versucht die schreienden Kinder zu beruhigen, und ein paar Männer laufen zur Seite, als Madison angerannt kommt.
»Der Marshal!« warnt jemand heiser. »Aus dem Weg.«
Sie sind weg wie die Ratten, die im Unrat des Diggercamps nach Fressen wühlen. Das Licht in der einen Hütte links erlischt. Und weit hinter Chuck Madison gellt der Schrei durch den prasselnden Regen: »Oates hat ein Messer ins Kreuz bekommen. Der Kerl hat Madison hinter sich. Paßt da vorn auf, Leute!«
Es ist Brennan, der dort schreit. Und wenn es unter den Diggern am Alder Gulch irgend jemanden gibt, auf den das halbwilde Gesindel hört, dann ist es Brennan.
Der Kerl vor mir hat Oates niedergestochen, denkt Madison bitter. Pech für den Halunken, daß ich zufällig in der Nähe stand und Oates noch um Hilfe rufen konnte. Verdammt, wo ist der Kerl hin?
Im nächsten Moment sieht Madison den Schatten einer Frau vor sich. Ihre Stellung an der großen Hütte kurz vor dem eigentlichen Eingang verrät Chuck Madison einige Dinge. Der Bursche, dessen Messer Oates in den Rücken gefahren ist, muß hier links an der Hütte vorbeigerannt sein. Die Frau hat sich sofort aus der verschlammten Gasse in den Schutz der Hüttenwand gedrückt. Sie steht da, und erst auf drei Schritte Entfernung erkennt Madison sie.
Es ist Myra Gloster, eine schlanke Frau, die im Old Fellow Palace singt und vor den Männern die Beine schwingt. Myra hat rotes Haar, ist kühl wie gefrorener Boden, sagt man, und sieht angeblich keinen Mann an. Sie kümmert sich um niemanden, trinkt selten, spielt nicht wie die anderen Ladies und ist Chuck Madison bis heute mit keinem freundlichen Wort entgegengekommen.
»Madison, er ist nach links.«
Ihre Worte kommen in der Sekunde, als Madison an ihr vorbeirennt. Einen winzigen Moment zuckt Madison zusammen. Er hat nicht erwartet, daß sie ihn anreden würde. Wie sie in dieses verrufene Viertel kommt, ist Chuck ein Rätsel, aber sie wird ihren Grund gehabt haben.
Madison kann ihr nicht mehr danken. In dieser Sekunde errät er, wohin sein Mann ist. Er hat den Burschen beinahe eingeholt. Der Mann ist langsamer als der Marshal. Und wenn er nicht geschossen haben würde, hätte Madison ihn längst erwischt.
Madison läuft in die Dunkelheit hinein. Im vollen Lauf versucht er sich an die Geländebeschaffenheit zu erinnern. Kurz hinter der Biegung führt der Weg um einige gut acht Schritte hohe Stein- und Erdhaufen. Er windet sich zwischen ihnen durch an den Bach und das Höhlengelände.
Er ist schon zwischen den Hügeln, denkt Chuck Madison wütend. Wenn er jetzt einen Haken schlägt, dann ist er hinter mir. Und entkommt er, wird sich von dem hier hausenden Gesindel keine Seele melden, die ihn erkannt hat. Hol’s der Teufel, vielleicht gibt es doch noch eine Chance?
Chuck sieht seine einzige Möglichkeit. Er hetzt in langen Sprüngen auf einen der ersten Erdhügel zu. Einmal rutscht er auf dem glitschigen Boden aus, aber dann erreicht er die Spitze des riesigen Maulwurfhügels und wirft sich der Länge nach hin.
Der Regen peitscht Madison nun genau ins Gesicht. Das Geklapper der vom böigen Wind gerüttelten Hüttendächer ist kaum noch zu hören. Es übertönt jenes Schmatzen nicht mehr, das Madison halbrechts vor sich vernimmt.
Da ist er! Marshal Chuck Madison macht einen Augenblick später den davonhastenden Schatten des Flüchtigen aus. Der Mann stürmt in langen Sprüngen zwischen den Schotterhaufen durch. Er wendet sich scharf nach rechts. EinenAugenblick ist sein Schatten mitten in der Lücke zwischen diesem riesenhaften Maulwurfhügel aus gesiebter Erde und Steinbrocken zu sehen. Danach scheint der Bursche wie vom Boden verschlungen zu werden.
Der Mann hat das Höhlen- und Stollengelände erreicht.
*
Brewster hat die Leinen in der Hand, er geht vor seinem Karren und hält die Laterne hoch.
Chuck Madison ist nicht wenig erstaunt, als er hier am Ende des Stollengeländes auf den Karren stößt. Der kleine, magere Mann hält die Laterne hoch, leuchtet Madison an und bleibt sofort stehen.
»Hoi – prrr! Steh, du lahmendes Ungeheuer!«
»Die Laterne aus!« sagt Madison scharf. »Schnell, Mann, lösch das Licht! Hast du die Schüsse nicht gehört?«
»Was sind hier schon Schüsse?« fragt Brewster heiser. »He, verdammt, etwas passiert?«
»Ja – jemand hat Oates niedergestochen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Brewster, was hast du auf dem Karren?«
»Kerosin.«
Der durchdringende Geruch ist Madison in die Nase gestiegen. Innerhalb weniger Augenblicke begreift Madison, daß sich ihm die nächste Chance zufällig bietet. Er ist mit einem Satz an Brewster vorbei, hebt eines der kleinen Fässer vom Wagen und reißt sein Halstuch unter dem Regenumhang hervor.
»Was willst du denn mit dem Faß?« erkundigt sich Brewster. »He, Marshal…«
»Ich bezahle es dir später.«
Brewster starrt ihn entgeistert an. Er löscht endlich die Laterne, steht blinzelnd in der Dunkelheit und sieht, wie Madison, das Faß unter dem Regenumhang in den Armen, davongeht.
Der hat die verrücktesten Einfälle, denkt der kleine Mann, als Madison hinter der nächsten Erhebung verschwindet. Was zum Teufel, will er denn mit der Tonne?
Brewster fährt nicht weiter. Er bleibt stehen, starrt auf die Fortsetzung des schmalen Pfades, der sich um das Hüttengewirr zieht, und schüttelt den Kopf. Irgendwo in der Nacht sind nun Rufe zu hören. Sie entfernen sich nach links in Richtung auf den Bach zu.
Auch Chuck Madison lauscht einen Moment. Er glaubt Brennans tiefe, heisere Stimme zu erkennen und weiß, daß Brennan mit seinen Leuten in die falsche Richtug hastet. Brennan scheint zu denken, daß der Flüchtling den Weg zum Bach eingeschlagen hat, um im Wasser zu entkommen.
Während Madison die Wand über den Löchern hochsteigt, erinnert er sich, daß Brennan mit drei seiner harten Burschen aus dem Golden Saloon gerannt kam. Sie bogen in die Gasse ein und sahen Oates dort liegen. Weit hinten rannte der Kerl davon, aber Brennan blieb vor Schreck bei Oates stehen. Oates fährt seit anderthalb Jahren für Brennan, und sicher war es nicht verwunderlich, daß Brennan bei seinem Mann blieb.
Ob der Halunke Brennan auch hört? überlegt Madison. Hört er ihn, dann wird er sich sagen, daß man ihn zu weit links sucht, und vielleicht aus dem Loch kommen. Aber er kann genausogut damit rechnen, daß ich ihm immer noch auf den Fersen und nicht mit den anderen gerannt bin. Was wird der Hundesohn tun?
Seit Madisons erstem Auftreten am Rand des Stollenbezirks sind kaum zwei Minuten vergangen. Madison hat nun die Höhe über den Stollen erreicht. Er kann von hier aus in die vielleicht 20 Yards weite Senke blicken. Der Hang dort ist so steil, daß man ihn nicht ohne zu klettern hinabsteigen kann. Oates’ Mörder muß jedoch dazu keine Zeit besessen haben. Er wird hinuntergerutscht und dann geradewegs auf die Stollen rechter Hand zugehastet sein. Links gurgelt das Wasser. Es fließt rauschend und scharf die Rinne hinab. Der Mann hätte hineinfallen und mitgerissen werden können.
Viel zu sehen ist unter Chuck Madison nicht. Nur das Wasser bildet einen glänzenden, fünfzehn Schritt breiten kleinen See. Direkt unter Madison liegen mehr als zwei Dutzend Stollen. In einem dieser Löcher steckt der Mörder.
Mit einem Ruck stellt Madison sein Faß auf die Kante. Mit dem Messer wuchtet Madison den Spund heraus. Kerosin läuft aus dem Spundloch und gleich darauf über das Tuch. Madison stopft es in das Spundloch hinein.
»So, Mister«, sagt er grimmig. »Jetzt werden wir etwas sehen können, denke ich.«
Als er das Halstuch ansteckt, blakt die Flamme augenblicklich hoch. Es brennt hell lodernd, und Chuck stößt das Faß über die Kante.
Der Marshal hat sich nicht verrechnet. Drei Schritte tiefer prallt das Faß auf einen Vorsprung. Dann rollt es in die Tiefe, an zwei offenen Stollenmäulern vorbei. Es kollert den Hang hinab, überschlägt sich wirbelnd und läßt das Kerosin gegen das Tuch klatschen. Sekunden später fliegt der Lappen heraus. Er bleibt brennend liegen, während das Faß weiterrollt. Bei jeder Umdrehung schießt ein zwei Finger starker Strahl Kerosin auf den feuchten Boden.
Einen Moment fürchtet Madison schon, daß der Lappen im Regen erlöschen wird, als eine Feuerbahn unter ihm am Hang dem Faß nachrast. Die Kerosinspur brennt, Flammen züngeln empor. Sie laufen auf das an einigen Steinen liegende Faß zu. Dort wächst eine Feuersäule gen Himmel.
Trotz des Regens, der das Kerosin auseinanderspült, brennt es auch am Hang weiter. Sekunden später ist die rechte Hälfte des Einschnitts unter Chuck in helles, flackerndes Licht getaucht. Die Feuersäule wächst noch höher. Das Faß liegt mitten darin, bis sich in ihm genug Dämpfe entwickelt haben. Mit einem dumpfen Krach fliegt das Faß auseinander. Dauben wirbeln durch die Luft und bleiben brennend einige Schritte weiter liegen.
Nun sieht Chuck deutlich, daß sich tatsächlich eine Rutschspur den Hang hinabzieht. Obwohl sie mehr als 30 Yards von ihm entfernt ist und der Regen herabprasselt, ist sie noch so deutlich zu erkennen wie die Fußstapfen im weichen Grund zwischen dem jenseitigen Hang und diesem hier unter Chuck Madison.
Die Fußspur läuft auf diese Wand zu. Die Stolleneingänge und Höhlen sind grell angeleuchtet.
Dort, denkt Madison grimmig, da ist er hinein. Und hinaus ist er nicht. Well, Bursche, du steckst in einem Loch und kommst nicht mehr heraus.
Von weit rechts hört Madison nun die Schreie. Man hat den hellen Feuerschein gesehen. Brennan kommt zurück. Die Rufe nähern sich, während der Feuerschein unter Madison immer mehr zusammensinkt. Der Regen spült das Kerosin den Hang hinunter. Dabei zerteilt es sich und zerfließt mit dem Wasser.
Mit langen Sätzen hastet Madison nach links. Er tritt oben gegen einige Steine. Sie kollern den Hang hinunter, prallen vor dem Stolleneingang auf und lösen augenblicklich einen Schuß aus, der dumpf durch die Senke dröhnt.
Einige Schritte weiter ist die Rinne im Hang. Chuck Madison springt zu ihr hin, rutscht hinab und kommt unten am nächsten Loch wieder auf die Beine. Er ist nun keine acht Yards vom Stolleneingang entfernt. Ehe er sich an ihn heranschieben kann, hört er die heiseren Rufe Brennans. Das Feuer verbreitet noch genug Helligkeit. Brennan taucht mit zwei seiner Burschen jenseits der Senke auf. Er sieht Madison, brüllt seinen Männern etwas zu und beginnt den Abstieg.
»Zurück, Brennan, zurück!« schreit ihm Chuck entgegen. »Nicht hinunter, solange noch Licht ist. Er schießt und…«
Weiter kommt Madison nicht.
Aus dem Stollen brüllt der nächste Knall auf.
Brennan ist auf halber Hanghöhe, als der Mörder schießt. Die Kugel klatscht neben Brennan in den Hang. Brennan verliert vor Schreck den Halt und stürzt ab. Er überschlägt sich auf dem glitschigen Boden, dann saust er in eine Wasserlache und liegt zwei Sekunden wie tot am Boden. Kaum kommt er hoch, als der dritte Schuß knallt. Brennans heiserer Schrei sagt Madison genug. Der Frachtwagenboß ist getroffen worden. Er macht dennoch einen wilden Satz auf einen kleinen Steinhaufen zu. Dabei hängt sein linker Arm schlaff herab. Brennan prallt auf, verschwindet in der Deckung des Steinhaufens und schreit von dort aus wild: »Chuck – Chuck, da sitzt der Kerl! Ich hänge ihn auf!«
»Rühr dich nicht, ehe das Feuer nicht erloschen ist!« gibt Madison scharf zurück. »Und ihr da oben – versucht nicht herabzusteigen – er könnte diesmal besser treffen!«
Die beiden Männer Brennans oben haben sich hingeworfen. Madison sieht nur ihre Köpfe und das langsam schwächer werdende Blinken der Waffen. In der Senke erlischt zuerst die Feuerspur am Hang. Danach wird das Feuer an der Stelle des Fasses immer kleiner. Ein flackernder Rest bleibt für Sekunden, bis auch er erstirbt. Es ist wieder dunkel.
»Brennan?«
»Ja«, sagt Brennan – er muß bereits einige Schritte weiter gekrochen sein. »Chuck, der verdammte Kerl hat meinen Arm angekratzt. Wir holen ihn da raus!«
»Kommt nicht her, der erste erwischt eine Kugel, der den Kopf hereinsteckt!« schreit der Bursche dumpf aus dem Stollen. »Ich schieße jeden nieder!«
Brennans Gefluche verstummt, dafür ertönt das Platschen seiner Stiefel am Grund der Senke. Und dann taucht Brennan aus der dunklen Tiefe der Rinne auf. Er klettert zu Madison hoch, kauert sich neben ihm hin und sagt bissig: »Kommen wir hinein oder knallt er uns ab, Chuck?«
Madison hört nun, wie Brennans Leute drüben hinabsteigen. Sie sind die einzigen Männer, die sich hergewagt haben.
Als Madison zum Sprung ansetzt, hört er das Kollern aus der Tiefe des Stollens. Anscheinend zieht sich der Bandit noch weiter zurück. Und dann ist seine schrille Stimme zu hören: »Kommt nicht herein! Ich warne euch, ich schieße!«
Im selben Moment springt Chuck auch schon los. Er fegt mit einem langen Satz um die graue schartige Eingangsstelle des Stollens.
Madison ist gerade im Eingang, als nachhallender Donner durch den Berg grollt.
Großer Gott, denkt Madison entsetzt und läuft zurück, die Decke stürzt ein.
Er bekommt einen Schlag an das rechte Bein und landet dann im Freien. Hinter ihm aber ist die Hölle los.
Der ganze Berg scheint in Bewegung zu geraten. Dicht hinter Chuck Madison bricht einer der Deckenstempel wie ein Streichholz durch. Ein Felsblock donnert in der Mitte des Eingangs nieder. Steine prasseln herab.
Allmächtiger, denkt Madison verstört, diese Narren aus dem Diggercamp. Die sind zu faul, sich irgendwo einen Baum umzuschlagen, wenn sie Brennholz brauchen. Statt dessen steigen sie in die toten Schächte ein, reißen Balken, Stempel und Bohlen heraus und verfeuern sie.
Chuck Madison rafft sich langsam auf. Er kommt hustend aus der Staubwolke, torkelt auf Brennan zu und sieht den Mann auf Händen und Knien an der Wand kauern.
»Der Teufel!« sagt Brennan ächzend und stiert auf Madison, als sähe er einen Geist. »Mann, der Teufel – was ist da passiert?«
»Was schon?« fragt Chuck heiser. »Die Decke ist eingestürzt.«
»Was ist los – wer ist da drin?« erkundigt sich Brewster.
»Der Halunke, der Oates niedergestochen hat, ist im Stollen verschwunden«, gibt Madison zurück. »Gebt mir eine Laterne, ich sehe nach.«
»Mann, die Decke kann ganz einstürzen!« keucht Brennan. Sie haben nun Licht genug, um den Haufen Gestein im Eingang des Stollens erkennen zu können. Balken und Stützen ragen aus dem Gewirr. Der Staub sinkt nieder, das Klickern endet jetzt. Soviel Madison sehen kann, hält aber die Decke über dem Eingang noch dem Druck des Berges stand.
»Abwarten«, erwidert Madison kurz. »Ich will sehen, wie weit die Decke heruntergekommen ist, Brennan. Da hinten...«
Dann schweigt der Marshal plötzlich. Er kann nunmehr den Hintergrund des Stollens ausmachen. Teile der Decke sind an der linken Gangseite herabgebrochen. Gesplitterte Balken ragen aus den Steinen – und aus der düsteren Tiefe des Ganges dringt nun das schrille, klagende Gewimmer des Banditen.
»Hilfe, meine Beine – ich sterbe!«
Mit zwei Schritten ist Chuck Madison im Eingang. Er sieht sich um und blickt auf die entsetzten, verstörten Gesichter der anderen Männer.
Keiner rührt sich. Sie stehen still und sehen ihm nach. Und niemand von ihnen hat Mut genug, sich unter das drohend herabhängende Gestein zu wagen.
Noch nie zuvor hat Madison ein derart unheimliches Gefühl in sich gehabt. Über ihm lauert der Tod.
Mit dieser Gewißheit macht Chuck Madison die nächsten Schritte.
*
»Hier!«
Die Laterne schwebt höher. Madison steht unter zwei Streben, deren oberer Verbindungs- und Abstützbalken wie ein straff gespannter Geigenbogen durchhängt.
Wer immer die Stützen und Bohlen aus dem Stollen zu Feuerholz verarbeitet hat – weiter als bis zum Knick hat er sich nicht in dieTiefe des Ganges getraut.
Und genau das hat dem Banditen das Leben gerettet. Hier ist nur wenig Gestein herabgestürzt.
Aus dem graubepuderten Gesicht des Banditen, in das der Angstschweiß Furchen gezogen hat, leuchten Madison zwei vor Furcht flackernde Augen entgegen.
»Ich will raus!« kreischt der Eingeklemmte grellend, als er Madison erkennt. »Hilf mir doch, Marshal – ich werde begraben, ich werde erschlagen, wenn es nachrutscht. Meine Beine – mein Arm – alles gebrochen!«
Madison leuchtet die Umgebung ab. Der Lichtschein fällt über die Balken und das Geröll, aber von dem Revolver des Banditen ist nichts zu sehen. Sicherlich ist er vom Geröll begraben worden.
»Der Balken – nimm ihn weg. Er quetscht mir den Arm entzwei.«
Einen Augenblick zaudert Madison. Dann stellt er die Laterne rechts auf einen größeren Stein.
Er steigt vorsichtig über den Mann hinweg. Das Geröll ist von der Wand ausgebrochen. Es kollert sofort nach, als Madison die ersten Steine von den Beinen wegräumen will.
Er beginnt nun, die obersten Steine wegzuheben und sie vorsichtig abzulegen. Die Arbeit geht quälend langsam voran. Nur nach und nach schafft Madison es, die Lage des Gerölls zu verändern. Der auf dem Bauch eingeklemmt liegende Bandit hat den Kopf gewendet. Er beobachtet jede von Madisons Bewegungen und zuckt beim geringsten Steinkollern zusammen. Endlich ist Madison soweit, daß er auf eine der durchgebrochenen Deckenstützen stößt. Unter ihr müssen die Beine des Mannes begraben liegen. Mühsam packt Madison einige dickere Steine zur Seite, bis er einen Hohlraum unter dem Balken findet.
»Marshal, was – was ist?« fragt der Mann stöhnend. »Ich fühle kein Gewicht mehr auf den Beinen, aber die Schmerzen...«
»Das haben wir gleich«, murmelt Madison. »Ich werde versuchen, den Balken anzuheben. Kannst du dich ein Stück vorwärtsziehen?«
»Nein, nein, kann ich nicht. Mein Arm...«
Es prasselt weiter vorn im Gang. Das dumpfe Grollen von herabkollernden größeren Steinen ist zu hören. Von draußen kommen Brennans Worte: »Es bricht aus, Chuck! Schnell, raus mit dir, ehe der Gang ganz einstürzt!«
»Schrei nicht – seid leise!«
Einige Sekunden später hat Madison die Beine des Banditen freigelegt.
»He, du – wie heißt du?«
»Warum willst du das wissen?«
»Gib dir keine Mühe, den Mund halten zu wollen«, knurrt Chuck finster. »Ich wette, draußen sind zwei Dutzend Burschen, die dich kennen, Mister. Na, wie heißt du?«
»Richards – Dick!«
»Nun gut, Richards, ich werde jetzt wieder zurücksteigen!«
Der Mann stiert Madison angstvoll an.
Chuck klettert über den Balken zurück. Dann bückt er sich, faßt den Mann unter dem Balken durch am Hosenriemen und holt tief Luft.
»Stütz dich mit der linken Hand ab, so gut es geht, Richards!« befiehlt er heiser. »Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich dich aus den letzte Steinen ziehe und die gegen die abgebrochene Stütze fallen. Das Ding kann ich nicht hochheben. Es liegt weit hinten an der Wand unter einem Berg Geröll. Der ganze Haufen kann rutschen.«
Richards antwortet nicht. Er preßt die Lippen zusammen, sieht sich ängstlich nach der Stütze um und fühlt sich im nächsten Augenblick fortgerissen.
Augenblicklich gerät er aus dem Geröll. Doch dann passiert es schon: Das Geröll kollert nach. Ein größerer Brocken schlägt gegen den Balken. Der Stützbalken verändert seine Lage – die Steine hinten an der Wand lösen sich.
Schlagartig krachen die Brocken von der Wandeinbruchstelle in den Gang.
Während Madison den Mann halb auf sich zieht und mit ihm um die Ecke hastet, geht es dort grollend los.
Die Erschütterungen hinter dem Knick des Ganges genügen, um nun überall andere Steineinbrüche auszulösen.
Madison schafft es mit Richards. Er erreicht den Eingang und läßt den Mann vom Rücken gleiten.
Im Halbkreis vor dem Schacht sind etwa dreißig Männer versammelt. Sie blicken unter Gemurmel auf Madison. Und irgendwer sagt aus dem Hintergrund: »Da hat er wieder mal Glück gehabt. Und ich dachte schon, wir brauchten jetzt den vierten Marshal.«
Chuck erwidert nichts. Er sieht in die verschlossenen Gesichter der Digger, als er sich aufrichtet und sich eine Laterne geben läßt.
Stöhnend richtet sich Richards auf.
»Na, du schmutziger Hundesohn?« fragt Brennan fauchend. »Erst Oates ein Messer in den Rücken jagen und dann mir ein Loch in den Arm zu pusten, was? Hundesohn, ich hänge dich auf, das verspreche ich dir!«
Madison sagt eiskalt: »Das ist Sache einer Jury, Brennan. Rührt ihn nicht an – ich dulde keine Lyncherei! Wir bringen ihn zum Jail.«
*
Der Wind streicht um das Jail und läßt die schweren Blendladen klappern. Das Licht der Lampe fällt auf Bill Sanders’ Repetieruhr. Sie ist eins jener wenigen Dinge, die Sanders Chuck Madison hinterließ, dem einzigen Mann, zu dem der wortkarge Bill Sanders Vertrauen hatte.
Sanders ist seit drei Wochen tot.
Und sein Mörder läuft vielleicht in diesem Augenblick grinsend am Office vorbei.
Als Madison den Deckel aufspringen läßt, repetiert die Uhr. Die zehn Schläge dringen leise durch das Jail. Vor dem Gitter steht Madisons Deputy Shane, ein hagerer, sehniger Mann mit flintsteinhellen Augen. Shane war schon unter Sanders Deputy.
»Er ist stumm wie ein Fisch, was?« fragt Shane grimmig. »Für einen Hundesohn, dem du das Leben gerettet hast, Chuck, hat er verdammt wenig Dankbarkeit gezeigt.«
Er wirft einen Blick auf Richards. Der liegt auf der Pritsche. Der Doc hat Richards den Arm eingerenkt. Gebrochen hat sich Richards wie durch ein Wunder nichts. Lediglich einige aufgeschürfte Stellen an seinen Beinen und an der Hüfte erinnern noch an den Einsturz des Stollens. Richards kann sogar schon wieder den rechten Arm bewegen.
»Ich kann nichts anderes sagen«, murmelt Richards. Seine Stimme klingt leicht höhnisch und sehr sanft. »Wie oft soll ich das denn noch wiederholen müssen, Marshal? Ich hatte mal Streit mit Oates. Niemand hat mich geschickt.«
»Well, also niemand«, erwidert Madison träge. Er steckt die Uhr ein, blickt finster auf Richards und runzelt die Stirn. »Jetzt hör mal zu, Halunke: Oates lebt. Er hat gesagt, er hätte nie Streit mit dir gehabt und dich kaum gekannt. Und ich war in den vier Tagen seit deinem Mordversuch an Oates auch nicht gerade faul. Kein Mensch weiß, wovon du eigentlich gelebt hast. Du hast ein paarmal Besuch in deiner Hütte gehabt. Der eine Mann war Hunkey Jones, und der ist verschwunden. Seltsam, was? Die anderen sind immer zur Nachtzeit gekommen. Und sie sind dann mit dir auch nur bei Dunkelheit verschwunden.«
»So, ist Hunkey weg?« fragt Richards. »Was weiß ich, warum er weggegangen ist, he? Hunkey ist mal hier, mal dort.«
»Wie du es gewesen bist, und einige Male gerade an Plätzen, an denen später oder am selbenTag jemand überfallen und ausgeraubt wurde«, stellt Madison kühl fest. »Wer waren die anderen, die dich besucht haben, Richards?«
»Waren da andere?« fragt Richards zurück. »Keine Ahnung, hier nennt man sich ja immer bei den Vornamen, Marshal. Die Nachnamen interessieren einen doch nicht, das weißt du selbst. Kannte schon ein paar Leute – Karten haben wir gespielt. Und davon habe ich gelebt. Ist das vielleicht verboten?«
»Wo warst du, als Marshal Sanders erschossen wurde, Richards?«
»Sanders? Was weiß ich von Sanders«, mault Richards. »Ich habe den kaum gekannt, willst du mir das anhängen? Ich sage dir, ich weiß nichts von dem.«
»Es hat keinen Zweck«, murmelt Shane. »Chuck, der Vogel singt nicht. Mann, in einer Woche tritt die Jury zusammen. Es sind lauter Freunde von Brennan – hast du gehört, Richards?«
Der Gefangene wendet den Kopf und nickt kurz.
»Sicher«, sagt er dann achselzuckend. »Na, und? Ich weiß schon, was sie wollen. Aber ich schwöre euch: Oates hat mich mal beim Spiel betrogen. Später schlug er mich nieder. Ich wollte mich nur rächen.«
»Und das wird dir auch gerade einer glauben!« antwortet Shane scharf. »Sie werden dich dazu verurteilen, deinen Hals in eine Schlinge zu stecken, Richards.«
Er sieht den Gefangenen scharf an, aber Richards zeigt keine Reaktion. Es scheint dem Burschen gleichgültig zu sein, was mit ihm passiert.
»Ich mache meine Runde«, sagt Madison, als er die Tür zum Jail schließt. »Luke, wenn du willst, kannst du jetzt gehen.«
Luke Shane tritt an den Tisch, dreht die Lampe höher und steckt sich eine Pfeife an.
»Sicher, spät genug, um ins Bett zu steigen«, erwidert er gähnend. »Du machst jetzt die zweite Woche die Nachtschicht, Chuck, soll ich nicht morgen...«
»Vor der Verhandlung nicht«, erwidert Madison leise. »Der Kerl da drinnen ist mir zu ruhig. Ich bin verdammt sicher, daß er eine Menge Freunde hat, Luke. Richards weiß was über Bills Tod.«
»Du kannst dich auch irren, Chuck«, antwortete Luke Shane gepreßt.
»Bill war ein harter Mann und machte sich eine Menge Feinde hier. Es können viele getan haben. Zwei Schüsse sind schnell abgefeuert, was?«
»Und hinter wem war er her?« fragt Chuck Madison heiser. »Er hat einen Tag vor seinem Tod zu dir gesagt, er würde bald jemanden an den Galgen bringen. Und damit würde hier Ruhe sein. Luke, was tat er unten am Fluß? Wen hat er dort gesucht? Es stehen zwei Dutzend Häuser da hinten, wollte er in eins?«
»Ich weiß nicht«, entgegnet Shane. »Du kannst mir glauben, ich habe das immer wieder überlegt. An jenem Abend knallte es ein paarmal. Ich hatte Nachtrunde in der Stadt, und ich habe mehrere Schüsse gehört. Als sie Bill fanden, lag er am Fluß. Aber haben sie ihn dort erschossen oder woanders? Sie können ihn auch hingetragen haben, was?«
»Es sind nur eine Handvoll Schurken, die diese Stadt in Wahrheit beherrschen«, murmelt Chuck. »Die meisten Leute sind friedlich und wollen ohne Angst leben. Als ich herkam, haben sie mich zum Marshal gemacht. Sie hatten von mir gehört. Ich war in einem halben Dutzend rauher Städte, in einigen mit Bill Sanders. Sie wollten mich haben – und ich habe angenommen, Luke. Nicht, um in einer Stadt wie dieser einen Orden zu tragen oder sie zur Ruhe zu bringen. Ich habe an Bill gedacht. Und ich bin sicher, daß Richards etwas über sein Sterben weiß. Geh schon, Luke, wir reden doch immer dasselbe. Nimmst du noch einen Drink?«
»Ja, ich werde zu Thompson gehen.«
»Dann komm nachher noch mal vorbei. Vielleicht sollten wir dir eine Pritsche hier aufschlagen, es könnte besser sein.«
»Also hast du dir überlegt, was ich gestern schon vorgeschlagen habe?« fragt Luke Shane. »In Ordnung, ich gehe zu Thompson, dann hole ich mein Bettzeug herüber und schlafe hier. Ich denke, du wirst dann ruhiger sein, daß sie uns nicht unseren Vogel herausholen, was?«
Shane lächelt flüchtig. Dann geht er hinaus, dieTür klappt zu, und Madison ist allein.
In sieben Tagen wird Richards vor der Jury stehen. Aber vielleicht kommt es dazu gar nicht mehr. Man könnte ihn vorher befreien. Morgen – in drei Tagen. Oder auch heute.
*
Madison wirbelt so schnell herum, daß der Mann hinter ihm nur noch einen halberstickten Schrei herausbekommt. Der Revolver sitzt dem großen, bärtigen Mann mitten auf dem Leib. Der Mister steht still. Er nimmt nicht die Arme hoch, sieht Madison verstört an, hüstelt.
»Langsam«, sagt er dann, und der Schreck ist immer noch in seiner Stimme. »Marshal, nicht abdrücken.«
»Jetzt nicht mehr!« erwidert Madison scharf. »Mann, warum sind Sie mir nachgegangen?«
Der Mann hat Madison von der Ecke der Wallace Street bis zur Main Street verfolgt. Er ist nicht wie ein Digger gekleidet. Dennoch erkennt Madison die Ausbeulung seiner Jacke in Hüfthöhe.
»Mein Name ist Sanders, Wilbur Fisk Sanders, Marshal!«
Chuck Madison bewegt die Hand. Der Revolver wirbelt herum und steckt im nächsten Augenblick im Halfter.
»So«, sagt Madison bissig. »Willie, was? Irgendwann hat mir mal jemand von seinem Vetter Willie erzählt und von der verdammten Seitenlinie seiner Familie, die nichts von ihm wissen wollte. Ich meine, von Bill Sanders.«
»Immer ruhig«, erwidert Sanders hastig. »Marshal, Bill war ein einsamer Wolf, und Sie haben ihn gut gekannt, vielleicht besser als ich. Er hätte eine Familie haben können, nachdem seine Eltern tot waren, aber er wollte nicht. Bill war schon immer ein Mann, der lieber ritt und schoß, auch wenn es für das Gesetz war. Er schoß nun mal gern.«
»Und Sie tragen den Colt nur als Gewichtsausgleich, was?« fragt Madison. Er tritt zur Seite, lehnt sich an die Wand von Hickmanns Store und steht im Schatten der Außentreppe. Über ihnen ist niemand auf dem Treppenpodest zu sehen.
»Nicht gerade«, murmelt Willie Sanders leise. »Sicher bin ich eine Schnecke gegenüber Bills Schnelligkeit, aber ich kann auch schießen. Madison, Sie wissen, wer Bill in dieses verdammte Rattenloch holte?«
»Nein!«
»Ich war das!«
»Und jetzt ist Bill tot. Muß ein prächtiges Gefühl sein, ihm zu einem Grab verholfen zu haben«, stellt Madison bitter fest. »Ich weiß nicht viel über Bills Verwandtschaft, nur das, was er mir gelegentlich erzählte. Sie sind Rechtsanwalt, was?«
»Ja. Und – zum Teufel, ich mache mir eine Menge Vorwürfe wegen Bill. Darum bin ich nach Cheyenne gefahren, aber dort sagte man mir...«
Wilbur Fisk Sanders macht eine Pause, sieht sich sichernd um und flüstert: »... daß man schon jemanden hergeschickt hätte. Ich wollte um einen US-Marshal bitten, doch ich kam zu spät. Der Bursche war schon hierher unterwegs.«
»Das würde ich besser nicht zu laut sagen«, brummt Madison kurz. »Hier haben die Wände Ohren, Sanders. Also gut, Sie müssen bei Gouverneur Meagher einigen Einfluß haben, sonst hätte er Ihnen das nicht verraten. Es ist genauso gekommen, wie Meagher es vorausgesehen hat: Die anständigen Bürger der Stadt haben mich gewählt. Ich brauchte niemandem zu erzählen, daß ich längst Marshal war, als ich hier eintraf. Sanders, ich würde an Ihrer Stelle die Neuigkeit für mich behalten.«
»Was heißt hier anständige Bürger?« fragt Sanders gepreßt. »Marshal, Sie sind lange genug hier, denke ich, um einige Dinge erkannt zu haben. Diese Stadt will Ruhe und Ordnung, ihre Bürger wollen in Frieden leben. Es sind nur zwei Handvoll wilder Burschen in der Gegend. Und sie allein machen den Ärger, bringen Leute um und überfallen Wagen und Goldtransporte. Irgendwer regiert das Gesindel, aber ich weiß nicht, wo ich den Kerl suchen soll, sonst hätten wir ihn...«
»Was?« fragt Madison, als Wilbur Sanders schweigt. »Wer sind ›wir‹, Sanders? Ich habe gehört, daß es hier ein Vigilantensystem geben soll. Gehören Sie zu dem Verein?«
»Und wenn? Ein Marshal allein wird hier nicht fertig, Madison. Irgendwo knallt es, er fällt um und steht nicht wieder auf. Manchmal haben Bürger die Pflicht, für Sicherheit und Ruhe zu sorgen – oder?«
Madison nickt flüchtig, sagt dann aber warnend: »Ich werde keine Lynchjustiz dulden, verstanden?«
»Es wird auch keine geben«, erwidert Sanders leise. »Der Großteil der Bürger wird sich immer an das Gesetz halten, Marshal. Nun gut, ich wollte nicht darüber reden, sondern über Bill und den Burschen im Jail. Als ich vor einer Stunde ankam, hörte ich ein paar Gerüchte. Dieser Richards, hat er Verbindung zu anderen Halunken?«
»Er streitet alles ab«, gibt Madison zurück. »Ein aalglatter Bursche, Sanders. Wenn er Freunde hat, werde ich es bald merken.«
»Denken Sie, man holt ihn heraus?« erkundigt sich Sanders erregt. »Marshal, wenn Sie Hilfe brauchen...«
»Ich nehme keine Hilfe von Vigilanten an«, antwortet Madison kühl. »Mit Gesindel muß ich allein fertigwerden. Sanders, was wollten Sie noch wegen Bill wissen?«
Jenseits des Baches steht eine kleinere Herde Schlachtvieh für die sechstausend Digger und Einwohner von Virginia City. Das Echo von einigen Schüssen hallt durch den Dunst und den Regen bis zu ihnen.
»Cowboys«, murmelt Sanders vor sich hin. »Sie sind am Nachmittag mit dem Vieh gekommen. Marshal, es gibt Arbeit, wenn Sie die wilden Burschen friedlich haben wollen, fürchte ich. Nun, ich wollte nichts über Bill erfahren. Es war nur so, daß er mich gebeten hatte, über meine Einladung an ihn zu schweigen. Niemand wußte, daß ich ihn geholt hatte. Ich bin an der Mine beteiligt.«
»Jeder ist hier irgendwie am Gold beteiligt«, sagt Madison trocken. »So, Bill kam also her, um Ihnen einen Gefallen zu tun?«
»Das nicht, er erwartete nichts von mir. Unsere Verwandtschaft bestand nur auf dem Papier«, sagt Sanders düster. »Bill wollte sein eigenes Leben haben, und er hatte es auch. Er sagte, es sei ihm gleich, für wen er etwas täte, wenn nur das Geld stimmen würde. Es gibt hier zwei Dutzend Leute, die Sanders heißen. Von ihm und mir wußte niemand etwas. Dennoch, ich habe Bill immer gemocht, Marshal. Sein Leben verlief so, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Er war frei wie ein Vogel.«
»Den jeder erschlagen konnte, obwohl er einen Marshalstern trug«, bemerkt Madison finster. »Bill war mein Freund, Sanders, darum bin ich hergekommen. Ich wollte aufhören.«
»Was – Sie wollten den Orden abgeben?«
»Ja«, erwidert Madison knapp. »Es geht nicht immer gut aus. Eines Tages ist man nicht mehr schnell genug für einen Halunken. Man muß wissen, wann es Zeit wird, die Revolver in einen Kasten ganz nach unten zu packen. Wenn es nicht Bill gewesen wäre, hätte ich jetzt im Zug nach Denver gesessen und an meine Leute, unseren Store und ein friedliches Leben gedacht. Ich werde zu alt für den Beruf, mein Freund.«
»Bill sprach mal von Ihnen«, sagt Sanders. »Sie sind doch genauso alt wie er, aber er dachte nicht daran, seinen Kampf für das Gesetz aufzugeben.«
»Ich weiß«, antwortet Chuck gepreßt. »Vielleicht ist er darum gestorben. Er war nicht sehr schnell mit dem Revolver, er hatte nur mehr Mut als viele andere Männer. Mut hilft nicht gegen eine Kugel aus dem Hinterhalt, Sanders. Sie werden...«
Chuck Madison bricht mitten im Satz ab. Das Schießen hat sich vom Südufer des Baches und jener Schlachtviehherde genähert. Nun ist das wilde Trommeln von Hufen zu hören. Eine Frau zieht hastig ein etwa zwölfjähriges Mädchen mit sich über die Main Street auf den Variety Store zu. Einige Männer bleiben stehen. Sie blicken alle die Wallace Street hinunter. Einer hebt die Hand, sagt etwas und verstummt, als sich Madison vom Gehsteig abstößt.
»He«, schnauft Wilbur Sanders heiser. »He, Marshal, was ist los?«
Sanders blickt Madison verstört nach. Der Marshal hetzt mit vier, fünf langen Sätzen auf die Mitte der Straße. Dort bleibt er breitbeinig in den tiefen Furchen des aufgeweichten Bodens stehen. Laternenlicht vom Variety Store trifft seineWeste und den Orden.
Eine Moment später hallt das Hufgetrommel von den Hauswänden zurück. Zwei Schüsse peitschen gen Himmel, dann kracht ein dritter, und die Stimme Wagners, des Barbiers, heult in die Nacht hinein: »Ihr verdammten Rauhreiter – mein schönes, neues Schild! Ouuh, nicht...«
Was immer Wagner noch schreien will, es geht im Krachen von zwei weiteren Schüssen unter. Dann jagen in einem Keil etwa ein halbes Dutzend Viehtreiber um die Straßenecke. Dreck von den Hufen der Pferde spritzt bis zu Wilbur Sanders. Der große, bärtige Mann hat sich an die Wand gedrückt und glaubt einen Wahnsinnigen vor sich zu sehen, denn Chuck Madison steht immer noch mitten auf der Straße. Und die Pferde rasen auf ihn zu.
Einen Augenblick hat es den Anschein, als wolle der erste Reiter sein Pferd zurückreißen. Der Mann liegt auf dem Pferdehals, er richtet sich auf und stößt einen gellenden Rebellenschrei aus.
»Jiaaah, ein Ordensträger! He, paßt auf, daß ihr ihm nichts tut! Ein Marshal!«
Die anderen fünf Mann stoßen ein Geheul aus. Der letzte Bursche schießt noch zweimal gen Himmel. Dann öffnen sie die Keilformation zu einer Gasse. Anscheinend wollen sie rechts und links an Madison vorbeijagen.
Chuck Madison hört den Zuruf des ersten Reiters und weiß dann, was sie vorhaben. Als die beiden ersten Männer mit ihren Pferden direkt vor ihm sind, schwingen sie sich blitzschnell seitlich aus den Sätteln. Sie hängen nun so auf den Pferderücken, daß sie mit jeweils einer Hand nach Madison greifen können. Das Manöver führen sie kaum drei Schritte vor ihm aus, aber Madison hat es kommen sehen.
Sie sind auf einen Schritt heran, als sich Madison duckt und sofort wieder hochschnellt. Der eine Mann reagiert mit einem grellen Schrei, doch seine Warnung kommt zu spät.
»Ihr wilden Burschen!« sagt Madison fauchend, als er die Hände über sich hinwegschießen sieht. »Wolltet ihr mich zwischen euren Pferden ein Stück tragen, was?«
Er erwischt den linken Arm des rechten Reiters, wirbelt herum und stemmt die Beine ein. Dann saust der Mann auch schon aus dem Sattel. Sein Gaul steigt, der Mann fliegt im hohen Bogen auf die Straße und bleibt dicht vor Madison im Schlamm liegen. Die Brühe spritzt hoch, der Gaul dreht sich, und der nächste Reiter versucht noch sein Pferd wegzuziehen. Er gerät in die Drehung des ersten Pferdes hinein.
Mit einem dumpfen Laut prallen die beiden Pferde zusammen. Und auch der dritte Gaul rast noch in das Wirrwarr hinein. Aus seinem Sattel fliegt der schießwütige Cowboy im weiten Bogen über den breitschultrigen Mister hinweg. Er schießt vor Schreck seinen Revolver ab. Und dann saust er kopfüber in eine Fahrbahnmulde, die voller Schlamm ist.
Madison aber macht einen Sprung, dann steht er neben dem Breitschultrigen und hat – der Teufel weiß woher – seinen Colt in der Faust.
Links von Madison bringen die anderen drei Männer ihre Pferde zum Stehen. Sie fluchen wild, sehen dann aber den Revolver auf ihren Partner zeigen und werden still.
»Wie war das?« fragt Madison eisig. »Sollte ich ein wenig zwischen euch hängen und vielleicht Schlamm schlucken? Vorsicht, Mister, ich habe deinen Partner. Laß die Hand am Zügel!«
»Hölle und Pest!« flucht der Breitschultrige neben Madison heiser. »Wo bin ich gelandet? Ah, zum Henker, mein neues Hemd ist hin. Und meine prächtigen Stiefel...«
Er verstummt, nachdem Madison ihn mit dem Revolverknauf angestoßen hat.
»Boß«, sagt einer der Männer gepreßt. »Den Trick muß er schon gekannt haben. Er sieht nicht aus, als wolle er einen Spaß mit uns machen.«
»Stellt euch vor, einige Kinder hätten hinter der Ecke gespielt«, sagt Madison grimmig. »Seid ihr sicher, daß ihr nicht mitten über sie hinweggeritten sein würdet?«
Die Männer blicken sich beklommen an, dann sagt der Breitschultrige mürrisch: »Wir haben vier Wochen getrieben und wollten nur...«
»Ihr wolltet nur«, unterbricht ihn Madison kühl. »In dieser Stadt ist das Herumjagen mit Pferden oder Wagen auf den Straßen verboten – das Schießen auch. He, Wagner, was ist los?«
»Mein feines, neues Schild!« brüllt Wagner und rennt um die Ecke. »Marshal, drei Löcher hat es. Es hat mich neun Dollar gekostet.«
»In Ordnung«, erwidert Chuck knapp. »Mister, neun Dollar für das Schild und zehn für die Schießerei und das wilde Reiten. Wie sieht es aus, zahlst du oder wollt ihr ins Jail?«
»Oh, Hölle!« stöhnt der Breitschultrige. »Neunzehn Dollar! Und das für einen kleinen Spaß.«
»Yeah«, sagt Madison träge. »Paßt auf, daß der Spaß nicht in einem Saloon in einer Schlägerei endet. Wie ist es?«
Der Mann rafft sich auf, holt seinen Geldbeutel hervor und bezahlt zähneknirschend. Dann steigt er in den Sattel und reitet mit seinen Leuten im Schritt die Main Street hoch. Einige Zuschauer gehen nun auch weiter. Von drüben kommt Shane heran und grinst breit.
»Chuck, ich dachte schon, es würde rauh werden.«
»Nicht bei Viehtreibern«, antwortet Madison trocken. »Hast du deinen Drink genommen?«
»Sicher, ich hole jetzt meine Sachen«, sagt Luke Shane. »Du findest mich im Saloon drüben, wenn deine Runde zu Ende ist. Hallo, Mr. Sanders.«
»Hallo«, murmelt Sanders. »Wechselt ihr euch ab?«
»Ich denke, wir machen es so«, gibt Madison zurück. »Wir sehen uns sicher noch, Sanders.«
Er hebt seinen Hut auf, wischt ihn ab und geht dann los. Die Main Street liegt vor ihm. Es sind nur 50 Yards, dann beginnt der wilde Teil der Stadt. Hier liegen die Tanzhallen und Saloons dicht bei dicht. Acht Hotels, sechs Billard Halls, fünf elegante Spielsaloons, drei Tanzhallen, einige sogenannte Bawdy-Houses, in denen man für Gold alles haben kann, und Dutzende von Saloons. Das ist die eigentliche Main Street.
Die Nacht hier hat tausend Gesichter. Irgendwo kommt ein Miner fluchend aus einer Spielhalle, drüben hockt ein Bettler im Regen und jammert nach ein paar Cents. Betrunkene stolpern vom Gehsteig und landen im Straßendreck.
Chuck Madison weiß, daß sich das Gesindel niemals offen zeigen wird. Es streicht irgendwo zwischen den Häusern in dunklen Ecken herum. Sie verdrücken sich wie Ratten in der Schwärze der Nacht.
Jenseits der Straßenzeile liegt der Old Fellows Saloon. Dreimal an jedem Abend singt Myra Gloster. Jetzt dringt nur das Lachen der Männer und das Gefiedel einer Geige aus dem Saloon.
Der Marshal überquert die Fahrbahn hinter einigen Wagen. Dann geht er am Saloon vorbei. Er bleibt nicht stehen, aber er denkt wieder an die Nacht im Diggercamp und die Frau, die plötzlich vor ihm auftauchte. Was hat eine Frau wie Myra Gloster im Diggercamp zu tun gehabt?
Chuck Madison wendet den Kopf, als er auf der Höhe des Hoftores ist. Das Tor steht offen – und in seinem toten Winkel lehnt jemand an der Wand. Licht fällt nicht bis in die Ecke, doch ihr Haar gleißt im Zucken eines Wagenlichtes kurz auf. Ihr schmales, stets kühles Gesicht ist ein heller Fleck an der Hauswand.
»Hallo«, sagt Madison etwas heiser. »Keine gute Luft für jemanden, der singen muß.«
»Hallo, Marshal«, antwortet sie, als er stehenbleibt und kurz an den Hut greift. »Immer noch besser als im Saloon, glaube ich. Marshal…«
»Ja?« fragt er, denn sie redet nicht weiter. »Ist etwas, Madam?«
»Nichts, Marshal. Gute Nacht!«
Er nickt nur, sieht sie in der Seitentür des Saloons verschwinden. Es ist seltsam, er hat sich nie viel aus Frauen gemacht, aber diese Lady beschäftigt ihn, seitdem er sie vor zehn Tagen zum erstenmal gesehen hat.
Chuck Madison geht weiter.
Und der Mann drüben in der Nische wendet den Kopf.
»Los!« sagt er über die Schulter hinweg.
Das ist alles.
*
Der kleine Anbau neben Mrs. Willows’ Haus liegt still in der Dunkelheit vor Luke Shane. Langsam klinkt der Deputy das Staketentor des Zaunes auf. Bei Mrs. Willows im Vorderhaus brennt kein Licht mehr. Sie gehört zu den Frauen, die bereits seit Jahren hier sind. Ihr Mann ist vor einem Jahr beim Einsturz des Idaho Minentunnels umgekommen. Seitdem vermietet sie den kleinen Anbau. In ihm haben die Willows die erste Zeit gehaust, ehe sie das Blockhaus vorn bauten.
Als Shane sich dem Anbau nähert, hört er zwei Schüsse aus der Richtung des Diggercamps. Danach ist wieder alles ruhig.
Einen Moment später steht Shane vor der schmalen Tür. Er nimmt den Schlüssel, öffnet die Tür und will hinein, als er ein schwaches Klappen hört.
Das Fenster, denkt Shane verstört und dreht den Kopf herum, ich hatte es doch fest geschlossen.
Shane sieht das Fenster, jenen schmalen Flügel, den er immer schließt, wenn er zum Office geht. Der Luftzug stößt das Fenster auf und läßt es draußen mit einem leisen Klirren gegen die Anbauwand schlagen.
Das ist alles, was Luke Shane noch erkennt. Den Schatten neben der Tür ahnt er mehr, als er ihn sieht. Ein Hieb trifft ihn am Kopf. Luke Shane sieht Feuer, will schreien, bekommt aber keinen Ton mehr heraus. Er stürzt vornüber. Aber noch ist Shane nicht ganz ohne Besinnung, er hat den Hieb nicht voll auf den Kopf bekommen. Der Deputy prallt gegen einen Körper. Einen Augenblick gelingt es ihm, sich festzuhalten. Er spürt, wie ihn jemand am Rücken packt, herumreißt, und hört einen Mann heiser und tief sagen: »Schlag zu, schnell.«
Die Stimme klingt dumpf – und Shane ist sicher, sie noch nie gehört zu haben. Dann trifft ihn der zweite Hieb und löscht Shanes Bewußtsein aus.
In sein ersticktes Stöhnen hinein sagt jemand aus der rechten Raumecke heiser: »Tür zu – bleib draußen und paß auf!«
Die Tür klappt, Schritte huschen über die Dielen.
Im Vorderhaus hebt Mrs. Willows den Kopf und lauscht. Irgendwo ist ein Klappen gewesen, das sie aus ihrem leichten Schlaf geschreckt hat. Mrs. Willows hört jetzt nur noch das Winseln des Windes und das Tropfen des Regens aus der undichten Regenrinne am Hausdach.
»Shane«, sagt Mrs. Willows und schließt wieder die Augen. »Das ist Mr. Shane gewesen. Er hat nur am Tag Dienst. Das war Mr. Shane...«
*
Es brennt in Shanes Gesicht. Lichtschimmer ist da, wird immer heller und blendet ihn.
Die Hand ist da – ein Stück Ärmel ist zu erkennen. Und dann hebt Shane den Blick, bis er den Umhang erkennt. Es ist ein einfaches Sackleinentuch, in das zwei Augenlöcher geschnitten sind.
Shane stößt den Atem heftig durch die Nase, spürt nun, daß er einen Knebel zwischen den Zähnen hat und schließt einen Moment die Augen.
Der Umhang, denkt Shane bestürzt, den tragen nur die Halunken, die einzelne Transporte oder Digger überfallen – großer Gott, das Fenster. Sie sind eingestiegen, weil sie durch die Tür mit dem Doppelbartschloß nicht hereingekonnt haben.
»Mach die Augen auf und sieh es dir an.«
Plötzlich ist die nackte Furcht da. Shane kämpft vergeblich gegen sie an und spürt nun, daß sie ihm nicht nur einen Knebel zwischen die Zähne gezwängt haben. Man hat ihn an das Bett gebunden. Er kann sich nicht befreien. Und Madison macht sicher noch seine Runde, der geht immer noch einmal zum Diggercamp hinunter.
Langsam macht Shane die Augen auf. Vergeblich bemüht er sich, seine Furcht nicht zu zeigen. Vielleicht kann er sein Gesicht beherrschen, aber den Angstschweiß kann er nicht aufhalten. Die Schweißperlen auf seiner Haut glitzern im Lampenschein wie das scharfe Bowieknife.
Luke Shane stiert auf die funkelnde, breite Klinge. Eine behaarte Hand hält die unheimliche Waffe keine vier Zoll vor seinen Augen hoch und bewegt sie dann nach unten. Im nächsten Moment sitzt die Schneide dem Deputy am Hals.
»Shane, wenn du schreien willst, dann bist du tot«, sagt der Mann mit der dumpfen Stimme neben dem Bett. »Willst du antworten, dann mach zweimal die Augen zu. Nun, Hundesohn?«
Es gibt kein Überlegen oder idiotischen Mut für Luke Shane. Er blinzelt zweimal, spürt den Griff, das Rucken des Knebels und holt tief Luft, als ihm dann das Tuch aus dem Mund gerissen wird.
»Schreit er los, mach es!« kommt die dumpfe Stimme wieder. »Shane, antworte leise. Was ist mit Richards, hat er geredet?«
»Nein«, sagt Luke Shane gepreßt und spürt, wie ihm der Angstschweiß langsam von der Stirn zu rinnen beginnt.
»Ich sage die Wahrheit. Um Gottes willen, nehmt das Messer weg.«
»Das Messer bleibt, Mister. Also was hat Richards gesagt?«
»Nichts«, antwortet Luke Shane stockend. »Er sagt, er hätte mit Oates einmal wegen eines verlorenen Kartenspiels Streit bekommen und sich nur rächen wollen.«
»Und seine Freunde? Der Marshal hat sich doch nach den Männern erkundigt, die ihn nachts besucht haben? Hat er über seine Freunde geredet?«
»No, Mister. Er sagt, er hätte mit ihnen nur Karten gespielt. Er will nicht mal ihre Namen nennen.«
»Sein Glück!« sagt jemand aus dem Hintergrund knarrend. »Der verdammte Kerl, besonders hart ist er nicht. He, Deputy, wenn du lügst…«
»Ich lüge nicht«, versichert Shane tonlos. Er muß dauernd auf die Klinge blicken. Es ist ihm, als ginge von der Messerklinge eine hypnotische Kraft aus. Dabei hat Shane immer mutig und eisenhart sein wollen.
Jetzt weiß er, daß er es nie sein wird. Seit jenem Abend, als er im Hay Saloon mit ein paar Freunden trank und danach von irgend jemandem nach Hause gebracht wurde, steckt die heimliche Furcht in ihm. Der Deputy Shane hat kein volles Erinnerungsvermögen mehr daran, was er mit jenem Mann auf dem Heimweg redete. Aber im Unterbewußtsein ist es ihm, als hätte er damals über Bill Sanders gesprochen.
Ich habe ihn umgebracht, denkt Shane und schwitzt stärker. Niemand weiß es, und ich bin auch nicht ganz sicher. Aber ich habe damals über ihn geredet. Es war kühl draußen. Ich kam aus dem Saloon. Dann fiel ich um. Zuviel Whisky, was? Irgendwer hob mich auf und führte mich – irgendein Mann. Ich habe versucht, mich an ihn zu erinnern, aber ich kann es einfach nicht. Dann haben wir geredet, er fragte nach Bill Sanders. Und danach, ob Sanders hinter jemandem her sei. Ich muß es ihm gesagt haben – ich bin nicht ganz sicher, aber bestimmt habe ich ihm gesagt, daß Sanders gemeint hatte, er würde keine vierundzwanzig Stunden mehr brauchen, um jemanden an den Galgen zu liefern.
Shane beißt sich auf die Unterlippe. Die Erinnerung quält ihn seit jenem Tag. Manchmal kann er schlecht einschlafen, weil er nicht weiß, ob er es nicht war, der Sanders mit seiner Rederei im betrunkenen Zustand in den Tod geschickt hat.
»Shane, was weiß Madison über Richards’ Freunde?«
»Nichts. Er sucht nach den Burschen, die Sanders umgebracht haben. Aber er weiß nicht, wo er sie finden soll.«
»Hund, du lügst! Madison ist vielleicht schon so weit wie Sanders damals. Wenn wir dich nicht betrunken gemacht hätten...«
Drei Sätze nur, aber die Gewißheit ist nun für Luke Shane da.
Nein, denkt Shane, nein, ich habe nicht geredet, ich war das nicht. Ich habe Sanders nicht verraten.
Der Mann über ihm lacht leise. Shanes Gesicht ist verzerrt, die Augen vor Schreck aufgerissen.
»Narr, du warst zu betrunken, was?« fragt der Mann voller Hohn über ihm. »Erinnerst du dich nicht mehr? Ich war doch bei dir. Und du hast geredet – geredet...«
Ich bring sie um, denkt Shane – ich habe Sanders verraten, also doch. Meine Ahnung war richtig.
Er liegt still, hat die Augen geschlossen. Das Lachen ist in seinen Ohren – und die knarrende Stimme des Mannes aus dem Hintergrund: »Shane, du wirst uns noch helfen, Mister. Vielleicht hast du keine Lust dazu, was? Aber du wirst es tun, denn sonst kommen wir wieder. Und danach bist du tot. Gebt ihm den Knebel!«
Die Hand schnappt zu und preßt sich um seinen Hals. Das Messer ist fort, das Tuch in seinem Mund.
»Du wirst Deputy bleiben«, sagt der Mann im Hintergrund. »Auch beim nächsten Marshal oder Sheriff, Shane. Und du wirst uns alles erzählen, was du erfährst.«
Die Lampe erlischt. Dunkelheit breitet sich um Shane aus. Er hört, wie der Wind draußen geht. Die Tür ist auf – ein helles Rechteck, durch das sich ein paar Schatten entfernen. Und Luke Shane liegt allein. Gedanken schießen ihm durch den Kopf. Er kann sich nicht rühren und weiß, daß sie ihn in der Hand haben. Wenn er fortgehen will, dann werden sie ihm vielleicht irgendwo am Weg am Alder Gulch auflauern und ihn erschießen.
Und wenn er nicht geht?
Sie werden wiederkommen, denkt Luke Shane, sie werden etwas wissen wollen von mir. Ich bin ein Feigling, ich weiß es. Ich sehe hart aus, aber ich bin es nicht. Sanders ist durch mich gestorben.
Sie werden sich melden, denkt Luke Shane – sie kommen bestimmt. Es gibt keine Möglichkeit für den Feigling Luke Shane, was?
Einmal kann Shane ein Held sein – er weiß es plötzlich.
Aber er weiß noch etwas: Er kann dabei sterben.
*
Geschrei erschallt, Männer rennen weg, als jemand aus der Tür des Old Fellows fliegt. Dennoch sind einige nicht schnell genug zur Seite gesprungen. Der Mann reißt sie um. Sie stürzen zu Boden. Einer fällt vom Vorbau auf zwei Pferde am Balken. Die Pferde steigen hoch, der Mann stößt einen schrillen Schrei aus. Danach ist es still, die Hufe haben ihn getroffen. Wiehernd zerren die Pferde an den Zügelleinen.
Irgendwer aus der Menge der Gaffer stürzt auf den Balken zu. Es ist Baily, der Vormann Brennans. Das ist es, was Chuck Madison erkennt, als das Lampenlicht Baily voll trifft.
»Hölle – Freeman!«
Also einer von Brennans Leuten, denkt Madison, ehe er an den Pferden vorbei ist. »Was, zum Teufel, ist im Saloon los?«
»Zieh ihn weg, Baily, schnell!«
Brennan schreit es von drüben. Er stürmt vor einem halben Dutzend seiner Maultier- und Ochsentreiber über die Straße auf den Saloon zu. Neben ihm der kleine Wake.
»Boß, sie haben Freemann und Marty halbtot geschlagen. Es ging um irgendein Girl!« schreit der kleine Wake schrill. »Es waren Sherwoods verdammte Maultierschinder, die verdammten Schotten. Boß – hinein!«
»Aus dem Weg, Leute!«
Die Hölle, denkt Madison bitter, als er Brennan wie einen Stier durch die gaffende Menge brechen sieht – ausgerechnet Brennans Konkurrenzlinientreiber fangen eine Prügelei an. Wenn die Burschen in den Saloon kommen, dann fliegt er auseinander.
Madison schnellt am Balken vorbei, ist mit einem Satz auf dem Vorbau und packt dann auch schon Brennan.
»Halt, Brennan!«
»Zum Teufel – schon wieder du?« brüllt ihn Brennan wütend an. »Geh mir aus dem Weg, Chuck. Meine Männer sind verdroschen worden. Ich werde...«
Er flucht los, als Madison ihm den Revolver entgegenhält und drinnen der Lärm immer wilder wird. Eins der Vorderfenster zeigt plötzlich einen Schatten. Der Mann segelt auf das Fenster zu, durchbricht Sprosse und Glas und landet kreischend wie ein Teufel auf dem Vorbau.
»Brennan, bleibt draußen – ich erledige das!«
»Ich werde es nicht zulassen, daß jemand meine Leute verprügelt.«
Im selben Augenblick fliegt der Türflügel wieder nach außen. Madison macht einen Satz, aber Brennan kommt nicht mehr weg. Es ist Marty, ein Fahrer Brennans, der an einen von Sherwoods Burschen gekrallt gegen Brennan prallt.
»Du rotborstiger Hundesohn, du Höllenfürst, ich mach dich fertig!« brüllt Sherwoods Mann, nachdem Marty rücklings hingeschlagen ist und er auf ihm landet. »Da hast du was!«
»Und du das!« sagt Madison eiskalt, ehe er zuschlägt. »Brennan, halt dich zurück – von dir ist kein Mann mehr im Saloon, was?«
Er hat es kurz und rauh gemacht und den Burschen Sherwoods mit dem Revolver niedergeschlagen. Marty jedoch bemerkt davon nichts. Der rothaarige Marty rollt sich herum, schwingt seine Fäuste wie Mühlenflügel und drischt weiter auf den Gegner ein.
»Marty!«
Marty sieht erschreckt hoch, als Madison ihn am Kragen packt, sich dreht und ihn vom Gehsteig den anderen Fahrern vor die Stiefel wirft.
»Ouuh, der Marshal!«
Martys heiserer Schrei geht im Krachen aus dem Saloon unter. Dort bricht anscheinend ein Tisch zusammen. Es ist wie bei jeder Prügelei zwischen wildfremden Burschen. Zwei fangen an, einer fliegt gegen irgendeinen dritten Mann, und schon prügelt sich auch der. Sekunden später schlagen manchmal fünfzig Männer aufeinander ein, ohne daß einer dem anderen im Grunde etwas getan hat. Brandy und Bitters sorgen für heißes Blut.
Geduckt springt Madison auf dieTür zu. Eine Flasche knallt an den Türbalken. Splitter regnen auf Madison herab. Jemand fällt gegen die Tür, seine Beine sehen einen Moment heraus, und Madison greift zu. Er zieht den Mann ins Freie.
»Brennan, halt den Narren fest!« sagt Madison grimmig. Dann geht er in den Saloon hinein.
Vor ihm liegt ein Tisch auf der Seite. Zwei Männer wälzen sich am Boden. Ein anderer rennt jemandem den Kopf in den Bauch und greift ihn wie ein wilder Torro an. Dann rennt er mit ihm weiter, übersieht Madisons Stiefel, der sich langmacht, und stolpert. Sie stürzen beide hin.
»Großer Gott!« sagt Madison verstört, als er Old Fellows hinter dem Tresen herauskriechen sieht. Der Alte hat eine Beule an der Stirn und versucht die Hintertür zu erreichen. Im selben Moment tauchen hinter dem Tresen zwei andere Burschen auf. Einer hat eine offene Flasche gefunden, nimmt einen Schluck und schleudert die Flasche dann mitten in das Gewirr der prügelnden Männer hinein.
Im nächsten Augenblick sieht Madison die Mädchen. Sie drängen sich in der Ecke an der Bühne zusammen. Vor ihnen liegen zwei Tische umgestürzt am Boden. Einige Girls ducken sich hinter ihnen, aber Myra Gloster steht aufrecht an der Wand. Sie blickt nicht auf die Tür, sondern zum Tresen. Chuck Madison hat den Colt schon hoch, als er den Schreck über das Gesicht der Lady huschen sieht. Myra Gloster hebt die Hand, sie ruft irgend etwas und will dann loslaufen.
In diesem Moment sieht Chuck Madison, warum die Lady erschrocken ist. Der zweite Bursche hinter dem Tresen muß dem alten Fellows eins auf den Kopf gegeben haben. Fellows bleibt nach einigen lahmen Bewegungen liegen. Links hinter dem Tresen aber taucht der Bursche auf. Er hat einen Kasten unter dem Arm, schwingt sich hoch und springt über die Tresenplatte hinweg.
Einer der Waiter von Fellows stößt einen schrillen Schrei aus. Der Mann ist unter einem Tisch hervorgekrochen. Nun sieht er den über den Tresen hechtenden Mister und schreit los. Der Waiter ist noch vor Myra Gloster. Losrennen und schreien ist für ihn das Werk einer Sekunde.
»Er hat die Geldkasse, er hat das Geld, haltet ihn!«
Der Mann, ein kleiner, wieselflinker Kerl, zuckt bei dem Geschrei herum. Er hält die Kasse unter dem linken Arm. Und dann fährt seine Hand unter die Jacke.
Madison jagt jemandem den Ellbogen in die Seite. Der Mann stürzt brüllend zu Boden. Dann hat Chuck den Waiter erreicht und ist an Myra Gloster vorbei.
In derselben Sekunde reißt der Geldkassendieb seine rechte Hand hoch. In ihr blinkt ein Messer. Und dann schwirrt das Messer auch schon los.
Der Waiter hat die Gefahr erkannt. Er wirft sich zur Seite. Das Messer zischt über ihn hinweg.
Die Lady, denkt Madison entsetzt, wird getroffen.
Zum Schießen auf das dicht an Madison vorbeischwirrende Messer ist es zu spät. Madison kann nur noch zuschlagen. Er muß es mit dem linken Arm tun, weil das Messer an seiner linken Seite vorbeisausen will. Mit der Revolverhand schafft Chuck den Abwehrhieb nicht mehr. Während er den Arm hochreißt, hört er hinter sich den entsetzten Aufschrei der Lady. Im selben Augenblick zischt die Schneide des Messers über seinen Unterarm hinweg. Die Klinge trennt ihm den Jackenärmel und das Hemd durch. Danach spürt er Schmerz, weiß aber, daß er das Messer aus der Bahn gebracht hat.
Madison wirbelt zurück. Er hört den Schrei des Waiters, dann sieht er den wieselflinken Burschen auch schon an einem der Seitenfenster auftauchen. Der Mann will hinausspringen.
Nur aus den Augenwinkeln macht Madison die Bewegung aus. Er erkennt das matte Blinken in der Hand des Waiters. Und dann brüllt der erste Schuß durch den Saloon. Der Waiter hat aus seinem Bullcolt gefeuert.
Am Fenster zuckt der kleine Kerl mit der Geldkasse zusammen. Er torkelt gegen die Wand, seine Hand schnappt unter die Jacke und kommt mit einem Colt wieder zum Vorschein. Blut ist auf dem hellgrauen Rock des kleinen Diebes zu sehen.
»Du Narr«, sagt Madison bitter, als er abdrückt…
Er hat auf die Hand des Diebes gezielt. In derselben Sekunden trifft er auch. Die Revolverhand des kleinen Mannes fliegt zur Seite. Aus dem Revolver bricht eine Feuerlanze. Dann fällt die Waffe zu Boden. Der kleine Kerl steht einen Augenblick wie erstarrt an der Wand. Plötzlich beginnt er zu rutschen und schlägt der Länge nach hin. Klirrend prallt der Eisenkasten auf die Dielen. Er öffnet sich, Nuggets und Münzen kollern über den Boden.
Er ist tot, denkt Madison verstört, als sich der Mann nicht mehr rührt. Aber ich habe doch nur auf seine Hand geschossen. Ihm bleibt keine Zeit, länger nachzudenken. Mit einem Ruck nimmt Madison die Hand hoch und feuert dreimal gegen die Decke.
»Aufhören!« ruft er grimmig. »Schluß jetzt, sonst wandert ihr alle ins Jail! Aufhören!«
Er schießt noch einmal und sieht, wie sich die ersten Männer aufraffen, andere verstört zu ihm blicken und sich dann den Fenstern nähern wollen. Dort aber tauchen nun Brennans Leute auf.
»Laß keinen raus, Brennan«, sagt Chuck scharf. »Du wirst sonst den Schaden mit Sherwood allein zu tragen haben. Waiter, hol das Geld, schnell!«
Der Mann steht mit dem Bullcolt in der Faust noch immer an derselben Stelle. Aus der Mündung der Waffe kriecht der Rauch, und durch ihn blickt der Waiter starr auf den zusammengesunkenen Dieb.
»Das war es!« sagt Madison eisig. »Niemand verläßt den Palast! Ihr habt euren Spaß bekommen – jetzt dürft ihr ihn bezahlen, Freunde. He, Waiter, was ist mit dem Burschen?«
Der Waiter hat sich gebückt, den Mann umgedreht und richtet sich nun auf.
»Er ist tot!« erwidert er gepreßt. »Ich habe auf seine Schulter gefeuert, die Kugel sitzt dort. Aber eine andere hat ihn in der Brust erwischt. Marshal…«
»Ich feuerte auf seinen Revolver – tut mir leid«, brummt Madison finster. »Shields, herein jetzt. Laß einige Männer an den Fenstern!«
Brennan kommt fluchend durch die Tür. Hinter ihm ertönen zornige Worte. Brennan fährt herum und hat die Hand am Colt.
Es ist Sherwood. Er brüllt Brennan an: »Das haben deine Halunken gemacht! Sie haben angefangen!«
»Mensch, noch ein Wort, dann breche ich dich Bohnenstange mittendurch!« schreit Brennan wild zurück. »Fellows, wo ist Fellows? Er muß doch wissen, wer angefangen hat.«
Old Fellows sitzt dicht vor der Hintertür am Boden und hält sich den Kopf. Er ist noch nicht fähig zu sprechen. Dafür aber sagt jetzt eins der Girls laut: »Mr. Brennan, Freeman wollte mir einen Drink spendieren – und Thomas hatte das gleiche vor. Sie stritten sich, bis Thomas Freemann vor das Schienbein trat. Damit fing es an.«
Thomas hängt über einem Tisch, hebt matt den Kopf und stöhnt: »Er hat mich vorher einen Schweinetreiber genannt. Sollte ich mir das gefallen lassen?«
»Also habt ihr beide angefangen«, stellt Madison kühl fest. »Sherwood – Brennan, ihr teilt euch die Hälfte des Schadens, die andere werden die Burschen hier bezahlen. Ich denke, das wird ihnen der Spaß wert sein. Hallo, Fellows!«
Der Alte zieht sich nun langsam am Tresen hoch.
»Daß hier jeden zweiten Tag ein Saloon in Trümmer fliegen muß. Oh, mein Schädel. Wie sieht mein prächtiger Saloon aus? Ich sage dir, Marshal, sie werden es bezahlen. He, was hast du da an der Hand. Du blutest, Marshal.«
Chuck hebt den linken Arm. Er blutet heftig.
»Das war weiter nichts«, erwiderte Madison knapp. »Einigt euch schnell, sonst erlebt ihr es, daß ich euch einige Dollar Strafe aufbrumme. Fellows, dein Neffe kommt!«
Fellows’ bärenstarker Neffe stürmt zur Tür herein. Verstört bleibt er stehen, wirft einen Blick auf das Durcheinander und sagt heiser: »Drei Minuten muß man im Store sein, schon passiert hier was. Onkel Jeff, was hast du da am Kopf?«
»Eine Beule«, murrt der Alte. »Irgendein Kerl sprang über den Tresen. Ich hatte das Geld in der Kasse, wollte sie gerade abschließen und... Teufel, meine Kasse! Wo ist mein Geld?«
»Hier!«
Der Waiter bringt es, aber auf ihn achtet kaum jemand. Brennan und Sherwood geben jeweils den Leuten des anderen die Schuld an der Schlägerei.
»Ich nehme euch die Revolver ab, wenn ihr nicht friedlich miteinander reden könnt!« knurrt Chuck sie an. »Ihr seid beide Narren. Für jeden von euch ist genug an Frachten zu fahren. Einer allein könnte es doch nie schaffen. Zum Teufel, vertragt euch!«
Das hilft. Die beiden Männer werden leiser. Nun sind auch drei der anderen Waiter wieder munter. Sie sind gleich zu Beginn der Prügelei niedergeschlagen worden und fangen an, die Stühle und Tische wieder hinzustellen. Während sie den beiden Fellows’ laut die Anzahl der zerbrochenen Dinge melden, hört Madison hinter sich einen leichten Schritt.
»Marshal?«
»Ja« murmelt Chuck und sieht sich um. »Lady?«
»Ich hätte dem Messer nicht mehr ausweichen können«, sagt Myra Gloster leise und nicht so beherrscht wie gewöhnlich. »Ich danke Ihnen.«
»Ich habe es getan – und damit gut.«
»Nichts ist gut. Sie bluten ziemlich schlimm, Marshal. Hier können Sie doch nichts mehr tun – kommen Sie mit, ich werde Sie verbinden.«
Madison zaudert nur einen Moment, dann nickt er und folgt ihr. Myra Gloster geht vor ihm her zur Hintertür, von dort in den Flur und die Treppe hinauf. Das Licht der Flurlaterne fällt auf ihr Gesicht und läßt sie weicher erscheinen. Im oberen Flur stößt sie die Tür zu ihrem Zimmer auf.
Ich werde sie fragen, denkt Chuck Madison. Was hatte sie an jenem Abend im verrufenen Diggercamp zu tun?
Als sie sich über seinen Arm beugt und den Knoten des Leinenstreifens festzieht, ist ihr Haar dicht vor ihm. Einmal zieht Madison den Duft ein, dann aber sagt er kühl: »Was hatten Sie im Diggercamp zu tun, Madam?«
»Ich wußte, daß Sie das fragen würden«, antwortet sie leise. »Aber vielleicht will ich darüber nicht sprechen. Marshal – noch nicht.«
»Was dort lebt, das ist am Ende«, murmelt er.
»Niemand geht ins Camp hinunter – keine anständige Lady. Und Sie waren da. Ich habe Sie beobachtet, Madam. Sie sind in fast allen Saloons dieser Stadt gewesen – allein. Es paßt irgendwie nicht – no, es paßt gar nicht. Sie gehören nicht dazu – nicht zu jenen Ladies, die sich nichts daraus machen, allein in einen Saloon zu gehen.«
Jetzt bemerkt er, daß sie erschrocken ist. Ihre Augen senken sich blitzschnell, sie blickt zur Seite und antwortet nicht gleich.
»Ein Marshal, der eine Sängerin beobachtet«, murmelt sie. »Marshal, ich kann ganz gut für mich sorgen, glaube ich. Mich spricht niemand an, wenn ich das nicht will. Vielleicht war ich nur neugierig, wie es in anderen Saloons aussah?«
»Sie waren nicht neugierig«, gibt er zurück. »Nicht auf die Saloons. Ich habe Sie im Hay Saloon gesehen. Sie standen da und betrachteten die Bilder. Das hätte man glauben können, aber Sie taten es nicht.«
»Nein?« fragt sie kühl. »Marshal, Sie interessieren sich für Diebe und Mörder – seit wann für eine Lady?«
»Noch nicht lange«, sagt Madison. »Ich habe einige Sängerinnen gehört, eine ganze Menge, um ehrlich zu sein. Saloonsängerinnen benehmen sich anders und singen ganz anders, um Männer anzuziehen.
Fellows’ Neffe findet Sie zu kühl, ich hörte ihn einmal sagen, Sie hätten das nicht, was Männer in einen Saloon ziehen könnte. Der alte Fellows mag Sie, denke ich, weil Sie anders singen als die üblichen Ladies hier. Ich wette meinen Hut, daß Sie vor Virginia City noch nie in einem Saloon gesungen haben. Eher würde ich meinen, Sie müßten aus Kansas stammen und dort vielleicht in einem Theater gesungen haben. Missouri oder Kansas, nun?«
Diesmal blickt sie ihn erschrocken an, dann nickt sie kaum merklich und sieht wieder fort.
»Missouri, Marshal. Und ich habe auch vorher noch nie in einem Saloon gesungen – vorher nie. Marshal, denken Sie nicht mehr über mich nach, es lohnt sich nicht. Vielleicht werden Sie der Mann sein, der mich eines Tages ins Jail bringt.«
»Ich Sie?« fragt er bestürzt. »Madam, ich habe noch nie eine Frau eingesperrt, und Sie werde ich sicher nicht hinter Gitter bringen wollen.«
»Vielleicht aber müssen«, antwortet sie herb.
»Marshal, es ist besser, wenn Sie sich nicht weiter um mich kümmern. Sie haben verhindert, daß mich das Messer dieses kleinen Diebes traf. Ich schulde Ihnen sicher etwas. Aber fragen Sie nicht weiter.«
Madison streift den Jackenärmel herab, lehnt sich an die Kommode und blickt Myra Gloster scharf an.
»Ich habe nachgedacht«, sagt er dann leise. »Männer sind Ihnen gleichgültig. Und doch gehen Sie in Saloons. Es gibt nur eine Erklärung für mich: Sie suchen jemanden, vielleicht eine Frau, vielleicht aber auch einen Mann. Und Sie sagen, Sie würden eines Tages vielleicht von mir ins Jail gebracht werden. Etwas ist mir noch aufgefallen, die kleine Tasche dort. Sie haben sie immer bei sich, sogar, wenn Sie unten singen. Ich werde...«
Er hat sich bei seinen letzten Worten dem Tisch genähert, greift dann blitzschnell zu und sieht, wie ihr Gesicht kreidebleich wird.
»Lassen Sie meine Tasche...«
Chuck Madison hat sie schon, klappt sie mit einem Griff auf und dreht sie um. Es geschieht so schnell, daß Myra Gloster vergeblich weit über die Platte greift und ihm die Tasche fortzunehmen versucht.
»Nein!« sagt die keuchend und erregt, als seine Hand ein Tuch, einen Geldbeutel und mehrere Gegenstände zur Seite schiebt.
»Marshal, mit welchem Recht tun Sie das? Sie können nicht meine persönlichen Dinge fortnehmen.«
»Und das hier?«
Madison hat die anderen Sachen zur Seite geschoben. Seine Hand ist wieder schneller.
Obwohl sie um den Tisch zu laufen versucht, dabei auch noch an der kleinen Decke zerrt, hat Madison die Decke festgehalten.
Im nächsten Moment bleibt sie mit kreideweißem Gesicht stehen und blickt auf die Waffe in Madisons Hand.
»Das ist kein Spielzeug«, erklärt Chuck Madison gepreßt und hält die Hand hoch. »Und geladen ist er auch noch? Wen wollen Sie damit umbringen, Lady?«
Er drückt kurz und sieht sie über den Derringer hinweg groß an. Es ist eine jener kleinen, auf nahe Entfernung absolut tödlichen Waffen. Die vernickelten Läufe des Derringers schimmern im Lampenlicht.
Ohne Myra Gloster aus den Augen zu lassen, entfernt Madison die beiden Patronen. Und dann fragt er noch einmal: »Und wer ist der Mann, den Sie umbringen wollen?«
In diesem Augenblick weiß er, daß Myra Gloster mit dem festen Vorsatz nachVirginia City gekommen ist, einen Mann zu töten. Die abweisende Kühle dieser Lady kann nur einen Grund haben: Sie muß einen Mann hassen wie sonst nichts auf dieser Erde. Und weil sie einen Mann haßt, kann sie anderen kein wärmeres Gefühl entgegenbringen. Dies ist der einzige Grund: Sie will töten.
Einen Moment scheint sie es aufgeben zu wollen. Dann aber stürzt sie sich mit einem halberstickten Laut auf Madison. In ihren Augen ist plötzlich etwas wie Haß.
»Geben Sie meinen Derringer her! Sie haben kein Recht, sich in meine Dinge zu mischen, kein Mann wird das jemals tun!« stößt sie hervor. »Meinen Derringer! Ich will ihn haben. Und wenn ich…«
Ihre Hände greifen zu, berühren die Waffe, aber kaum hat sie den entladenen Derringer ergriffen, als Madison ihre beiden Handgelenke umklammert.
Keuchend versucht sie sich aus seinem eisernen Griff zu befreien. Da sie die Waffe zwischen beiden Hände hält, kann sie die Mündungen anheben. Die Läufe richten sich auf Madisons Gesicht. Und während ein beinahe irrer Glanz in ihre Augen tritt, keucht sie mit überkippender Stimme: »Ich bringe Sie um, ich bringe Sie um! Loslassen, sonst schieße ich!«
»Sie Närrin!« zischt Madison scharf. »Jetzt ist es genug. Sie werden niemanden umbringen – keinen Mann auf dieser Welt. Ich habe die Patro...«
Weiter kommt er nicht. Er hört das scharfe Doppelklicken der Hammer und ist sicher, daß Myra Gloster nicht mal bemerkte, daß er die Waffe entladen hat. Aber auch auf die Lady übt das Klicken eine seltsame Wirkung aus. Ihre Augen weiten sich vor Schreck. Ihr Gesicht hat sich innerhalb der letzten Sekunden gerötet – jetzt wird es so blaß wie nie zuvor. Sie stößt einen kleinen, matten Seufzer aus und wird urplötzlich schlaff.
Die vernickelte Waffe entfällt ihren Händen. Myra Gloster wird ohnmächtig.
Chuck fängt sie auf und hält sie fest. Dann wendet er sich um, trägt sie zum Sofa und legt sie sacht hin.
»So ist das«, sagt Chuck bestürzt und hastet zur Wasserkanne. »Irgend etwas hat sie beinahe um den Verstand gebracht. Großer Gott, sie hätte geschossen.«
Er zieht den Stuhl heran, nachdem er das Handtuch angefeuchtet hat, und dann wischt er ihr über die Stirn. Es dauert nur wenige Sekunden, bis Myra Gloster erwacht. Einige Sekunden blickt sie ihn wie einen Fremden an. Dann jedoch beginnt ihr Mund zu zucken. Entsetzt flüstert sie: »Ich habe – abgedrückt. Ich habe – o mein Gott!«
Ihre Stimme erstickt in einem Schluchzen. Sie preßt beide Hände vor das Gesicht, wendet sich der Rückenlehne des Sofas zu und fängt an zu weinen.
Madison verhält sich still. Er hockt neben ihr, wartet über eine Minute und streckt dann langsam die Hand aus. Als er ihre Schulter berührt, zuckt sie zusammen.
»Es ist nichts passiert«, sagt er sanft. »Lady, wenn Sie wollen, dann gehe ich jetzt und komme nicht mehr wieder. Aber vielleicht hilft es, wenn Sie zu jemandem über das reden, was Sie sich vorgenommen haben. Ich bin nicht nur der Marshal, und ich denke auch nicht, daß alle Männer so schlecht sein müssen wie jener Bursche, hinter dem Sie her sind. Sicher haben Sie einen Vater, und ganz bestimmt ist er kein Lump. Es gibt immer und überall Leute, die nichts taugen. Nun, Madam, soll ich gehen?«
»Nein – nein«, flüstert sie kaum verständlich. »Mr. Madison, der Derringer – er ist nicht losgegangen. Gott sei Dank, er ist nicht losgegangen.«
»Weil ich die Patronen herausgenommen hatte«, antwortet er mit einem kurzem Lächeln. »Sie haben mir vorhin Brandy aus der Flasche auf den Arm getan, wollen Sie jetzt vielleicht einen Drink nehmen?«
»Danke – nein, Marshal. Sie – Sie verstehen mich nicht, niemand kann mich verstehen.«
»Doch«, murmelt Chuck Madison. »Ich glaube schon, daß ich Sie begreifen kann. Da war also ein Mann – und er hat Sie betrogen. Seitdem mögen Sie nichts mehr von Männer wissen und suchen den Burschen, um ihn umzubringen. Ist es so?«
»Mich hat kein Mann betrogen, sondern meine jüngere Schwester. Er hat sie getötet und meinen Vater ruiniert. Marshal, wenn ich ihn finde, dann muß er sterben.«
»Der Mann Ihrer Schwester?«
»Ihr Verlobter. Ein Schurke ist er, ein Teufel. Marshal, er hat sie getötet, ehe sie richtig zu leben begann. Dieser Mann ist der Satan selbst. Ich habe mir geschworen, ihn umzubringen. Und ich werde es tun, hören Sie? Danach kann man mit mir machen, was man will. Es ist ohnehin alles verloren. Ich suche ihn seit einem Jahr, und ich werde ihn eines Tages finden. Er ist ein Mörder und muß sterben.«
*
Madison dreht das Glas zwischen seinen Fingern.
»Wir fanden sie nicht«, hört er Myra sagen. »Vater war krank, und sicher war es gut so, denn er spürte nichts von dem, was um ihn vorging. Er lag im Bett und hatte die Augen offen, aber er sprach nicht, er konnte kein Glied rühren. Nach drei Wochen zog man Gladys aus dem Missouri. Ich mußte hinfahren und sie holen. Ich erkannte sie nur an den Schuhen, alles andere hatte der Fluß…«
Großer Gott, denkt Madison bitter. Da kommt ein Mann nach Saint Joseph und verdreht einem Girl den Kopf. Er verlobt sich mit ihr, ein Mann mit prächtigen Manieren, der sein Girl bald heiraten will. Er hat Geschäfte, der Mister. Große Geschäfte mit der Bahn. Und er sagt zum Vater des Girls, der ein wenig Geld gespart hat, er solle sich beteiligen, er könne in zwei Jahren den doppelten Gewinn einstreichen.
Der Bursche sieht so ehrlich aus – und in zwei Monaten will er heiraten. Da gibt ihm der Alte den größten Teil seines gesparten Geldes und freut sich schon auf seinen Gewinn. Aber der Kerl ist weg – und mit ihm das Geld. Und das Girl merkt zudem noch, daß er ihr etwas dagelassen hat – ein dauerndes Andenken. Schließlich geht sie nachts in den Missouri. Das kommt überall vor – Lumpenkerle gibt es genauso viele wie schlechte Frauen. Nur, es kann, wie hier, eine ganze Familie umbringen.
»Ja«, sagt Madison und stellt das Glas weg. Der Brandy schmeckt ihm nicht mehr. »Und wie geht es Ihrem Vater jetzt?«
»Meine Antje sorgt für sein Grab und das von Gladys. Ich bin dann bald losgefahren. Manchmal glaubte ich, eine Spur von John Dayton zu haben. In Kansas City hatte er sich Wellman genannt und eine Witwe um ihre ganze Barschaft gebracht. In Abilene war es, daß ich wieder von ihm hörte. Ich hatte ja nur seine Beschreibung, aber seinen Namen nicht. Wer weiß, wie er wirklich heißt – vielleicht Miller? Beim Bahnbau hat man ihn gesehen. Und wieder sind Leute durch ihn betrogen worden – zumeist Frauen. In Fort Leavenworth soll er hoch gespielt und verloren haben. Danach verschwand er. Er soll jetzt hier im Minendistrikt sein, Marshal. Was er macht, das weiß ich nicht. Vielleicht betrügt er wieder die Leute, aber reiche Frauen gibt es hier nicht. Vielleicht hat er meine Schwester längst vergessen, und auch, daß es mich gibt.«
Myra Gloster macht eine Pause und trinkt einen Schluck Wasser.
»Für ihn ist Myra Gloster eine Unbekannte«, fährt sie dann leise fort. »Mein richtiger Name ist Moira Shields. Myra Gloster, das klingt besser für eine Sängerin. Als ich neulich im Camp war, hatte ich von jemandem eine Nachricht bekommen. Er hatte einen Mann gesehen, auf den Daytons Beschreibung paßte. Aber es war nicht Dayton. Es gibt kein Bild dieses Schurken, das ist sein Vorteil. Vielleicht hat er sich verändert, vielleicht läuft er wie ein Digger herum und nicht mehr als der Gentleman aus Saint Louis oder Kansas City. Der Mann hat kein Gewissen, Mr. Madison. Er ist ein Ungeheuer.«
»Also gut, Miss Shields«, antwortet Chuck ziemlich nachdenklich. »Sie haben nichts als eine Beschreibung dieses Burschen Dayton. Er soll hier irgendwo im Diggergebiet sein, aber ist das sicher?«
»Er hatte immer mit der Bahn zu tun, zuletzt unten in Scottsbluff«, sagt Moira Shields. »Dort fand ich seine Spur wieder, aber er war schon fort. Eine Gruppe Männer hatte das Bahncamp verlassen und war nach Norden aufgebrochen, um hierher in die Goldfelder zu gehen. Dayton verschwand zur selben Zeit. In Scottsbluff erzählte man mir, er hätte gespielt. Er soll einige Freunde besessen und zuletzt einen dieser fahrbaren Saloons gehabt haben. Ich fand den Mann, an den er den Saloon verkaufte. Der Mann sagte mir, Dayton hätte vorgehabt, in die Goldcamps zu gehen. Es muß so sein, denn sie benutzten die Kutschenlinie bis Bannack, das habe ich herausgefunden. In Bannack ging mir das Geld aus. Ich mußte etwas tun – und begann zu singen. Mr. Madison, dieser Mann ist in Bannack, Alder Gulch oder Virginia City.«
»Und wie lange sind Sie hier?« fragt Madison. »Wie lange Dayton, wenn Ihre Vermutung stimmt?«
»Er müßte sich etwa seit sechs Wochen in diesem Gebiet aufhalten«, gibt sie zurück. »Ich kam vor zwanzig Tagen. Als ich wieder etwas Geld hatte, lernte ich jemanden kennen. Der Mann kommt viel herum. Er redet nicht, er sieht sich für mich in den einzelnen Camps um.«
Die Nacht fällt Madison wieder ein, Richards rennt durch die Hütten und Bretterbuden des Diggercamps. Und an einer Hütte steht die Lady, eine etwas größere Hütte am Anfang des Camps, wo noch einige wenige anständige Leute hausen. Die Hütte – der Zaun, aber kein Licht im Hof oder in der Hütte.
»Brewster«, sagt Madison erstaunt. »Brewster also. Auf ihn haben Sie an diesem Abend gewartet. Er handelt mit allen möglichen Dingen und ist überall zu finden. Brewster muß an diesem Abend wegen des Regens später nach Hause gekommen sein. Sie warteten, stimmt es?«
»Ja«, entgegnete sie leise. »Es ist Brewster. Aber es war nicht Dayton – der Mann besaß nur eine Ähnlichkeit mit Dayton. Dayton ist groß, breitschultrig und blond. Sein Aussehen hat die Frauen getäuscht, die von ihm betrogen wurden. Er hat dunkle Augen und eine Angewohnheit, er trägt ständig die besten Anzüge. Seine Größe beträgt sechs Fuß – und sein Haar ist etwas licht. In Scottsbluff soll er einen Mann betrogen haben. Der Mann erzählte es überall herum. Zwei Tage später fand man ihn tot. Es ging um irgendeine Wagenliefung, erzählte man mir.«
»Also groß, blond und dunkle Augen – und immer gut angezogen«, brummt Madison nachdenklich. »Hier gibt es viele blonde Männer. Was für eine Geschichte war das mit der Wagenlieferung?«
»Ware – irgendwelche Ware«, erklärt Moira Shields achselzuckend. »Dayton hatte sie bestellt. Die Wagen wurden überfallen, der Brandy für Daytons Saloon und andere Dinge geraubt. Der Lieferant brachte einige Tage später eine neue Sendung zu Dayton, aber da nahm Dayton sie nicht ab. Er hatte Brandy genug, und der Lieferant behauptete, Dayton hätte die erste Sendung stehlen lassen. Zwei Tage später war der Lieferant tot. Der Mann hatte einen Partner, einen gewissen Ames. Ich hörte, Ames verkaufte dann und verschwand.«
»Ames? Und der Vorname, wie war der Vorname, Miss Shields?«
»Ich weiß nicht mehr, die Sache ging mich nichts an. Ja, ich glaube, ich habe ihn damals in Scottsbluff gehört, aber ich erinnere mich nicht mehr.«
»Anthony Ames – Anthony?«
»Ja, so heißt der Mann. Woher wissen Sie das, Marshal? Anthony Ames, das ist richtig. So heißt der Mann.«
»Er hieß so«, gibt Madison grimmig zurück. »Als ich herkam, ritt ich durch Bannack. Ich sah dort beim Sheriff rein und schaute mir die Totenliste an. Die gleiche Liste habe ich in meinem Office. Manchmal studiert man die Namen der Toten und denkt darüber nach, warum sie umgebracht worden sind. Auf der Liste steht auch Anthony Ames – erschossen aus dem Hinterhalt.«
»Marshal, auch Ames, auch dieser Mann? Dann ist Dayton hier, jetzt weiß ich es genau. Dayton hat ihn umgebracht. Ames soll geschworen haben, er würde den Tod seines Partners rächen. Er hat Dayton gekannt. In Scottsbluff nannte Dayton sich Worrey. Wann ist Ames gestorben?«
»Ich glaube, vor etwa vier Wochen, ich brauche nur nachzusehen«, antwortet Madison düster. »Ja, es muß so gewesen sein. Ames kam nach Bannack, forschte nach Worrey. Worrey oder Dayton, ganz gleich, wie viele Namen der Mann noch benutzt – erkannte ihn und erschoß ihn hinterrücks. Miss Shields, wer sind die Freunde, mit denen Dayton aus Scottsbuff verschwand? Kennen Sie die Namen?«
»Nein, Marshal, mich hat nur Dayton interessiert. Man sagte mir, er sei mit ein paar Freunden verschwunden, mehr weiß ich nicht.«
»Schade«, sagt er bitter. »Es dauert drei Wochen, ehe man Nachricht aus Scottsbluff erhalten kann. Wenn wir doch die Namen von Daytons Freunden hätten. Miss Shields, ich werde mich umhorchen und auf die Männer achten, auf die Daytons Beschreibung paßt.«
»Marshal, Sie wollen für mich...«
»Natürlich«, brummt Madison unwirsch. »Schließlich will ich nicht, daß Sie den Kerl umbringen, Miss Moira. Übrigens, Moira Shields klingt mir besser in den Ohren als Myra Gloster. Moira, sollten Sie eher als ich erfahren, wo dieser gewissenlose Halunke steckt, dann benachrichtigen Sie mich augenblicklich. Für diesen Mann sind Sie nicht hart, schnell und entschlossen genug. Sie begeben sich in eine Gefahr, von der Sie noch keine Ahnung haben, wenn Sie auf Dayton stoßen und ihn auf eigene Faust zu bestrafen suchen. Nun, Lady?«
Chuck Madison blickt ihr fest in die Augen. Er studiert dieses Gesicht, das ihn vom ersten Sehen an gefesselt hat.
Sie ist schön, denkt Madison, wenn sie die Härte verliert und nichts weiter sein will als eine Frau.
»Ja, Marshal«, flüsterte Moira Shields Augenblicke später. »Ich werde es tun, weil ich zu Ihnen Vertrauen habe. Es tut mir leid, Mr. Madison, daß ich mich wie eine Närrin benommen habe. Wenn ich etwas erfahre, hören Sie es sofort. Und noch etwas, Marshal: Manchmal hört jemand wie ich, wenn Männer sich über die Geschehnisse in der Stadt unterhalten. Gestern sprachen hier einige Männer über Sie. Sie meinten, es würde nicht lange dauern, und der dritte Marshal läge auf dem Boot Hill. Marshal, passen Sie auf sich auf.«
Madison nickt, nimmt seinen Hut.
»Ich würde mir keine Sorgen machen«, sagt er. »So leicht erwischt mich das Gesindel nicht. Ich werde jetzt zu Brewster gehen und mit ihm sprechen. Brewster ist ein guter Mann, doch vielleicht hat er die ganze Zeit nach dem falschen Burschen gesucht. Gute Nacht, Miss Moira.«
»Danke, Marshal«, murmelt Moira Shields. Sie erhebt sich, bringt ihn bis zur Tür und sieht verlegen zu ihm hoch. »Dies ist seit langer Zeit eine gute Stunde gewesen. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder.«
»Sicher«, antwortet Madison und macht dieTür auf. »Es wird schon morgen sein.«
Er spürt ihren Blick im Rücken, als er die Treppe hinabgeht.
»Danke, Chuck...«
Vielleicht hat er sich getäuscht, denn als er sich umsieht, ist sie bereits verschwunden.
Danke, Chuck, denkt Madison mit einem seltsamen Gefühl in sich – und sie hat es doch geflüstert, wetten? Sie hat mir gleich gefallen. Ich glaube, ich werde sie morgen zu einem Spaziergang einladen.
Augenblicke später hat Madison die Außentür erreicht. Er stößt sie auf, zieht die Luft tief ein und lehnt sich einen Moment an die Hauswand. Drüben sieht er Brennan im Frachthof verschwinden, während Sherwood, begleitet von einigen seiner Männer, weiter rechts die Straße hochgeht.
Chuck Madison überquert die Straße und schlägt den Weg zum Diggercamp ein. Dies ist sein abendlicher Rundgang. Es ist nicht immer derselbe Weg. Manchmal nimmt Madison den Fahrweg zum Südarm des Baches und kommt von dort aus in das Diggercamp. Diesmal geht Chuck Madison direkt auf das Diggercamp zu.
*
Was hat er denn, denkt Chuck Madison verwundert, als er den Wagen vor sich auftauchen sieht, fehlt dem Fahrer was?
Die Plane schaukelt, die Laterne schwankt. Wagenfurchen voller Wasser – das ist der Weg. Der Marshal will nicht durch die aufgeweichte Brühe gehen. Darum hält er sich links am Wegrand. Und dann sieht er den Fahrer.
Der Mann dort auf dem Bock grölt vor sich hin. Der Wagen ist an der Biegung. Gehorsam trotten die beiden Gespannferde weiter, obwohl der Fahrer nicht mehr lenkt. Statt die Hände an den Zügeln zu haben, hat der Fahrer sie an einer Flasche.
Er hebt die Flasche hoch, setzt sie an den Mund. Der Mann trinkt, schwankt, setzt die Flasche wieder ab. Er stellt sie links neben sich irgendwo zu seinen Füßen hin und beginnt wieder zu singen.
Danach rutscht er, neigt sich, nimmt das linke Bein hoch. Und nun stößt er gegen die Flasche.
Im Laternenlicht ist deutlich zu erkennen, wie die Flasche vom Brett kollert. Klatsch, da liegt sie im Dreck neben den Furchen voller Wasser. Sie blinkt im Laternenschein.
Der Mann sinkt nach rechts, stiert, als die Gäule stehen, nach unten zu seiner Flasche.
Der Marshal sieht zu, wartet, was passieren wird.
»A – absteigen«, lallt der Fahrer. »Bleibt ja – stehen, sage ich – verstanden – hick?«
Er beugt sich vor, will den Vorderholm packen.
»He!« murmelt Madison und sieht den Burschen wie einen ungefügen Klotz vorüberschießen. »Das soll man auch nicht machen, was?«
Es klatscht im Dreck – der Mann liegt still, die Hände ausgestreckt, als wolle er nach der Flasche greifen. Doch die liegt zwei Schritte weiter links.
Madison geht los. Vor jenem Mann im Dreck blickt er auf die Endplane des Wagens. Die ist geschlossen.
Zufall, denkt Madison und dreht sich leicht – Zufall? Oder Absicht?
Das Mißtrauen meldet sich sofort in ihm. Ein Mann, der ständig mit der Gefahr lebt, muß hinter jeder harmlos erscheinenden Sache etwas sehen.
Madison wendet sich etwas zur Seite. Sein Blick gleitet über die Büsche links und rechts der Biegung hinweg. Bei der Körperdrehung nimmt Madison die rechte Hand nach unten. Sie wischt wie nachlässig über den Revolverkolben. Aber der Daumen hakt den Ledersteg aus. Nun kann Madison die Waffe im Bruchteil eines Augenblicks ziehen.
Dann erst geht der Marshal weiter. Aber nicht auf den Mann zu, der irgend etwas brabbelt und sich aufstemmen will, jedoch sofort wieder auf das Gesicht fällt. Madison nähert sich dem Endbrett. Seine rechte Hand hebt sich dem Revolver entgegen. Die Linke faßt blitzschnell nach der Plane.
Er ist da, denkt Mike auf dem Wagen nervös. Er steht am Endbrett. Ich hab’s doch gewußt und es auch Bill gesagt: Der steckt voller Mißtrauen. Ein vorsichtiger Wolf, was? So vorsichtig war Sanders nicht. Der lief uns leichter in die Flinte.
Es wird jäh etwas heller. Die Plane ist auf – Mike weiß es nun. Und er spürt förmlich, wie der Marshal auf die Ladung blickt. Merkt er was?
Madison hat die Kiste vor sich, sieht über ihr die Sache aufgetürmt liegen. Dann läßt er die Planenkante los, die Plane schlägt wieder zu.
Schritte platschen los, aber nicht auf den Fahrer zu. Sie führen am Wagen entlang, während der Fahrer in seiner Trunkenheit vor sich hin lallt und vergeblich auf die Beine kommen will.
Auf dem Wagen kauert der zweite Mann vor Mike im Zwischenraum und hält den Atem vor Schreck an. Alle Teufel, der Marshal geht nicht zum Fahrer. Er kommt nach vorn, nähert sich dem Bock. Der Wagen knarrt, der Marshal steht auf der Radnabe. Er hat nach der Kastenkante gegriffen und sich hochgezogen. Nun blickt er unter die Plane. Was ist, wenn er aufsteigt und an den Sack stößt? Er braucht ihn ja nur mit einem Finger anzustoßen, um zu merken, daß kein Getreide in dem Sack ist.
Der zweite Mann hält die Luft an. Er hört den Fahrer rülpsen und heiser etwas sagen. Dann schwankt der Wagen erneut.
Madison ist von der Radnabe gesprungen. Dann geht er um die Pferde, nähert sich dem Fahrer. Der liegt nun auf Händen und Knien, lallt vor sich hin.
»Hallo, Mister!«
»Oh?« fragt der Fahrer und versucht den Kopf zu wenden. »Oh, verdammt – wo – was – ist das – naß!«
»Yeah«, sagt Madison. Er muß grinsen, als er sieht, wie sich der Mann zu seinen Füßen vergeblich bemüht, nach der Flasche zu greifen. »Yeah, mein Freund – naß ist es schon. Na, willst du die Flasche haben? Komm erst wieder auf den Sitz.«
Langsam nimmt Madison die rechte Hand vom Revolver. Er bückt sich, hat die Laterne im Rücken und sieht zum Hinterrad des Wagens. Dann greift er dem Mann unter die Achseln.
»Na, komm, steh auf, Mister!«
»Öh – was ’n los – hier? Wer – wer bis ’n du?«
»Ist doch gleich, wer ich bin. Komm hoch, mein Freund.«
Er hat nun beide Arme unter den Achseln des Mannes und will ihn anheben. Der Fahrer lallt, er stinkt nach Brandy wie ein voller Schnapskeller. Und er ist schwer wie ein Amboß.
Der Fahrer stöhnt, flucht, macht sich absichtlich schwer. Er denkt nur an den rechten Arm des Marshals. Den Arm muß er packen können, Madisons Revolverhand außer Gefecht setzen.
Nun ist der Arm vor seiner Brust. Madison hebt seinen Oberkörper an.
Du Narr, denkt der Fahrer giftig und voller Hohn, doch nicht vorsichtig genug gewesen, was? Ich hätte im Wagen nachgesehen, ich ja.
Und dann schnappt seine linke Hand nach Madisons rechtem Jackenärmel. Ein blitzschneller Griff, und nun auch kein Lallen oder Gestöhn mehr, sondern nur ein heiseres, scharfes Wort: »Auf ihn!«
Er hat den rechten Arm Madisons und stößt sich mit aller Kraft nach rechts ab, auf die Büsche zu. Dabei muß er Madison umwerfen. Der Plan ist bis jetzt in jedem Punkt geglückt. Sie haben ihren Hinterhalt gelegt. Madison ist hineingelaufen.
Und er soll nicht mehr hinauskommen.
Es geschieht unheimlich schnell für Madison, zu schnell selbst für ihn.
Madison fliegt auf die rechte Seite. Der Fahrer des Wagens reißt ihn glatt um. Und der Kasten links von Madison knarrt.
Großer Gott, denkt Chuck noch, als er auf die Seite prallt und die Gewalt des Griffes spürt, eine Falle.
Dann liegt er bereits am Rand der Büsche und muß handeln. Das Kastenknarren sagt ihm genug, jemand will vom Wagen herunter.
Es ist nur ein Schwung, den Madison sich gibt. Sein linkes Bein zuckt mit aller Macht hoch. Vor dem Knie der Rücken des heimtückischen Burschen. Der Stoß jagt in den Rücken des untersetzten, schweren Mannes hinein. Madisons linker Arm ist frei und fliegt herum. Die Faust des Marshals trifft den Mann von der Seite her am Hals, das Knie stößt den Kerl weg.
Noch nicht, denkt Madison, als er sich rollt und den ersten Kerl wegfliegen sieht. Der Mann stößt einen schrillen, schmerzhaften Ton aus. Marshal Madison wirft sich auf den Rücken zurück und handelt aus irgendeiner Eingebung heraus, als er die Beine anzieht und sofort wegstößt.
In der nächsten Sekunde sieht er den Mann auch schon auf sich zufliegen.
»Schnell, schnell«, sagt irgendwo jemand keuchend. »Packt ihn doch!«
Sie sind da wie eine Meute Wölfe, aber sie haben sich in einem Punkt verrechnet: Madison ist frei und nicht vom Wagenfahrer gehalten worden. Es ist der zweite Mann, der mitten in den Stoß von Madisons beiden Stiefeln hineinspringt und einmal japst. Dann fliegt der zweite Kerl gegen den Wagen zurück. Er schlägt an das Wagenrad, sieht noch verschwommen, wie Mike vom Wagen kommt, und greift zum Revolver.
In diesem Moment hat Madison bereits den Colt aus dem Halfter gerissen. Madisons rechte Hand fliegt hoch. Der nächste Mann hechtet vom Wagen auf Madison zu. Der sieht ihn kommen, hört aber gleichzeitig das Rauschen in den Büschen hinter sich.
Als der Mann springt, aufprallt und zum nächsten Satz herunterzuckt, drückt Madison ab.
Ein Brüllen über dem Weg, eine Feuerlanze in der Nacht. Es ist seltsam, daß Mike und der zweite Mann am Wagenrad in dieser Sekunde das gleiche denken. Der zweite Mann denkt es im Herausreißen des Revolvers. Und Mike im Sprung, der Madison niederhalten soll, bis die anderen beiden aus den Büschen sind:
Er schießt doch, der verdammte Marshal!
Die Feuerlanze ist da, Feuer vor Mike, grelles, bleckendes Schlaglicht. Und ein Hieb in Mikes Leib, nicht in der Schulter, weil Mike hochspringt. Schmerz danach im Brüllen des Schusses, Schmerz wie mit tausend glühenden Zangen. Ein Hieb, der Mike zurücktaumeln läßt.
Mike liegt plötzlich und hört den zweiten Knall und dazwischen Buck schrill sagen: »Nicht schießen – nicht!«
Zu spät geschrien.
Brüllendes Echo, eine Flamme aus dem Revolver des zweiten Burschen am Rad.
Feuer, denkt Madison, als ihn die Flamme blendet und der Schlag wie mit der Gewalt eines Hammers gegen sein Kopf knallt, lauter Feuer.
Seine Hand sinkt herunter, sein Kopf zuckt einmal. Dann liegt Madison still. Blut rinnt von seiner rechten Schläfe auf den nassen Boden.
»Verdammt!« sagt Buck keuchend – Mike hört es nur verzerrt. »Zum Teufel, konntet ihr nicht schneller aus den Büschen springen? Da liegt der Kerl, aber Mike, was ist denn mit Mike?«
»Wie sollten wir schneller sein«, mault einer der beiden Burschen, die in den Büschen gesteckt haben. »Es ging nicht, du hast zu früh gehalten, du Narr! Teufel, was hat Mike? Seid doch mal ruhig. Hört ihr was? Kommt jemand?«
Sie lauschen, während der zweite Mann sich die Lippen hält und neben Mike hinkniet. Alles still, dann das Patschen auf dem Weg, leises Huftacken nähert sich. Es ist der Mann, der die Pfeifsignale gegeben hat.
»Hinter mir kommt niemand, ich hole die anderen Pferde, macht schnell.«
»Ja, beeile dich! Los, nach vorn zum Weg, geh du, wir machen das hier schon. Paß auf, ob aus der Stadtrichtung keiner auftaucht. He, Mike?«
»Mensch, sieh mal nach Madison. Der hat die Kugel in den Schädel bekommen, der ist hin, der Narr!«
Mike hört sie reden, liegt still, beide Hände auf den Bauch. Sie reden und er wird sterben. Das weiß er. Verschwommen sieht er die Laterne über sich schwanken. Eine Hand ist da und nähert sich seinem Gesicht.
Einer der anderen blickt auf ihn herab, starrt in das schneeweiße Gesicht Mikes.
»Tatsächlich«, keucht einer. »Er hat Madison erwischt. Schnell, weg mit ihm.«
»Nicht in die Büsche, sondern in den Bach!«
»Ja, Buck, hast recht. Hier, faß doch an, du verdammter Narr, mach schnell!«
»Mike.«
Ray Nedford ist bei Mike, berührt seine Schulter. Die Laterne schwenkt und beleuchtet Mikes Leib. Nedford schließt einen Moment vor Schreck die Augen. Blut überall zwischen den verkrampften Händen Mikes.
»Mike, ist es schlimm, hast du Schmerzen?«
»Ray – auf den Wagen. Schafft mich – auf den Wagen! Vorsichtig.«
Mike wendet den Kopf. Er sieht sie gehen – zwei Männer tragen einen dritten. Dann erreichen sie die Büsche, zwängen sich, den leblosen, schlaffen Körper zwischen sich, durch und sind weg. Zwei Schritte nur bis zum Steilhang über dem Bachlauf.
»He, komm her, Ray! Die Laterne, bring sie her!«
Ray rennt mit der Laterne zwischen die Büsche. Er leuchtet den Steilhang an.
Elf Yards unter ihnen fließt der Bach. Der Uferrand ist kaum eine Handspanne breit.
»Also los, macht doch!«
Der Marshal, denkt Mike, rollt in den Bach.
Mike sieht Feuerräder und bunte Kreise. Irgendwann liegt er auf den Säcken und glaubt einen Pfiff zu hören.
»Teufel, jemand kommt. Schnell, weg mit euch. Der Hut und der Revolver – schmeißt ihn unter die Büsche, macht doch!«
Sie rennen weg, die Büsche rauschen. Noch ein Pfiff und Bucks heisere Stimme: »Verschwindet, ich fahre mit Mike los und bringe ihn weg. Ihr besorgt das mit Richards, verstanden?«
»Ja, aber wenn dich jemand nach den Schüssen fragt?«
»Laß mich nur machen. Mensch, die Flasche her, Teufel, die hätten wir beinahe vergessen!«
Ein Ruck geht durch den Wagen, Mike wird durchgerüttelt.
*
Buck blinzelt scharf – er hat wieder die Brandyflasche in der Hand. Hufschlag hinter ihm entfernt sich trommelnd. Alles in Ordnung, die anderen sind also weg. Aber von vorn kommt etwas herangeschwankt. Eine Laterne wirft ihren Schein auf den Weg. Buck starrt nach vorn und ist sicher, daß der Kerl da vorn den Hufschlag auch gehört haben muß. Der Mann hat zwei Maultiere bei sich. Er geht neben ihnen her, denn sie sind beladen. Es ist ein kleiner Mann mit krummen Beinen und einem Umhang.
Brewster, denkt Buck und senkt den Kopf – alle Teufel, Jim Brewster, der alte Lumpenhändler, der kennt mich nicht persönlich. Gesehen hat er mich schon mal, aber wenn ich den Kopf weiter senke und den Betrunkenen spiele...
»He, du – he, Mann!«
Brewster treibt seine Maultiere zur Seite und starrt dem Wagen entgegen, auf dem ein grölender Fahrer sitzt. Der Wagen nähert sich, Brewster hebt den Arm.
»He du, wer hat da geschossen?«
»Wa – was? Cowboys – ein paar Mann, hüpp! Reiten wie die Narren – Narren, verdammte...«
Der Wagen rollt an Brewster vorbei. Auf dem Sitz hockt Buck und grinst vor sich hin.
Cowboys, denkt Buck, das ist gut, ist mir gerade noch eingefallen, was? Ich habe doch gesehen, wie der Marshal am Abend mit einigen zusammengestoßen ist. Sie sollen ruhig seinen Hut und seinen Revolver finden, das macht gar nichts. Und wenn sie Madison wirklich aus dem Bach fischen sollten, na, was ist dann? Cowboys, werden sie sagen, es waren Cowboys.
Buck sieht sich vorsichtig um, aber Brewster trottet schon neben seinen Maultieren weiter. Jetzt ist er gleich an der Stelle.
Er geht weiter, denkt Buck. Er sieht nichts, der alte Lumpenhändler. Tatsächlich, er ist blind wie ’ne Eule am Tag.
Brewster trottet über den Wegsaum und döst vor sich hin. Der Alte ist müde. Er sieht nichts von den Spuren auf dem Weg, er denkt an einen guten Schluck Kaffee und sein Bett.
Drei Schritte weiter links ist derAbhang. Darunter rauscht der Bach. Und im Bach ist jemand gelandet.
Ertrunken wie eine tote Ratte.
*
»Sie?« fragt Brewster, als sich der Schatten am Tor bewegt. »Madam – Sie?«
»Ja, Brewster«, erwidert Myra Gloster. »Brewster, haben Sie die Schüsse gehört?«
Brewster macht das Tor auf. Er bringt die Tiere in den Hof.
»Sicher, ein paar Cowboys knallten in die Luft. Madam, warum sind Sie gekommen?«
»Der Marshal wollte zu Ihnen, Brewster. Ich dachte, ich sollte Ihnen sagen, daß er alles von mir weiß. Sie sind ihm doch begegnet?«
»Wem, dem Marshal? No, Lady, ich habe ihn nicht gesehen.«
»Brewster, Sie müssen Madison gesehen haben. Sie sind doch den Südweg heraufgekommen – sind Sie es?«
»Ja, bin ich, aber ich habe ihn nicht gesehen.«
»Nicht?« fragt sie entsetzt. »Brewster, die Schüsse, da waren doch die Schüsse. Er ist von mir aus direkt hergegangen. Ich habe ihn doch gesehen, ich bin ja gleich nach ihm den Weg entlanggekommen, und wenn er umgedreht wäre, als er bei Ihnen alles verschlossen fand, dann müßte er mich getroffen haben. Brewster, es gibt nur einen Weg von hier aus – den Südweg. Verstehen Sie?«
»Nein, warum? Er kann doch noch zwischen den Häusern und Hütten da unten sein.«
»Er ist es nicht – so lange nicht!« erwidert sie angstvoll und umklammert den Arm des Alten. »Mr. Brewster, begreifen Sie doch, er ist von hier aus den Südweg zurückgegangen. Er muß dort auf Sie getroffen sein. Und die Schüsse – man hat auf ihn geschossen.«
»Aber, Lady, da waren nur einige Cowboys. Ich denke, die Burschen schießen immer aus lauter Narrheit gen Himmel, das ist doch so hier. Warum sollte jemand auf Chuck geschossen haben?«
»Mr. Brewster, bitte, geben Sie mir Ihre Laterne, oder eine stärkere, wenn Sie eine besitzen. Ich muß ihn suchen. Ich weiß es, man hat auf ihn geschossen. Eine Laterne, Mr. Brewster, ich muß ihn finden!«
»Madam, es ist Unsinn, niemand hat auf Chuck...«
»Die Laterne, Brewster, bitte!«
Sie ist närrisch, denkt der Alte. Immer sind Frauen gleich verrückt. Was hat sie nur? Sonst ist sie doch die Kühle selbst.
»Madam, Sie können doch nicht allein durch das ganze Camp gehen, nicht um diese Zeit. Da treiben sich genug Leute herum, die auch einer Lady etwas tun. Madam...«
»Brewster, ich will die Laterne haben, ich muß nachsehen.«
»Ja«, sagt er mürrisch. Er kann sie nicht allein gehen lassen. Irgendein verrückter, betrunkener Halunke könnte sie überfallen. »Ist gut, ich habe eine Blendlaterne im Haus. Warten Sie, so können Sie nicht mit mir gehen. Nehmen Sie einen alten Umhang und einen Hut von mir. Der Weg dort hinten ist aufgeweicht. Mit Ihren Schuhen kommen Sie da nicht durch. Ich habe auch ein Paar Überstiefeletten im Haus.«
»Danke, Mr. Brewster, Sie sind ein guter Mann.«
*
Der scharfe Strahl der Blendlaterne schwankt und bleibt dann stehen. Lachen glänzen auf dem Weg, und an der Seite sind Fußspuren. Blut, denkt Brewster und leuchtet den Fleck zwischen den Furchen und den Tritten seiner Maultiere an, das ist Blut.
»Brewster!«
»Nicht so laut«, keucht derAlte heiser. Er ist plötzlich nicht mehr müde. Seine Gedanken jagen sich. Dies ist in etwa die Stelle, an der es geknallt haben müßte. Mitten in der Biegung, hier könnte es gewesen sein.
Der Alte macht vier hastige Schritte, steht neben dem Fleck. Dann hört er den halblauten, erstickten Schreckensruf der Lady. Sie hat das Blut gesehen und umklammert seinen Arm wieder.
»Madam, ganz ruhig«, murmelt der Alte und sieht sich scheu um. »Da ist auch noch Blut. Jemand ist hier aus den Büschen gesprungen. Die Zweige sind geknickt und...«
Danach schweigt er. Der Strahl der Blendlaterne ist zwischen die Büsche gefallen. Dort blinkt etwas, liegt ein runder Gegenstand zwischen den Zweigen. Der Alte zwängt sich durch, hebt den Hut auf, macht noch einen Schritt und hat auch den Revolver.
Klick, macht es, als er die Trommel abklappt und in die Kammern leuchtet. Eine Patrone fehlt.
»Sein Hut«, hört er die Lady flüstern. »O mein Gott, es ist sein Hut, Brewster.«
Und sein Revolver, denkt Brewster, ich kenne das Schießeisen genau. Außer ihm hat niemand hier einen Trubia. Das Ding ist selten.
»Bleiben Sie stehen«, sagt er gepreßt. »Madam, es tut mir leid, ich dachte schon, Sie bildeten sich etwas ein. Aber…«
Brewster bückt sich. Er versteht eine Menge von Spuren und kann noch ganz gut sehen. Der Alte geht vorsichtig los.
Grell fällt der Strahl auf den schmalen Ufersaum. Eine Spur dort, als wäre ewas ins Wasser gerollt.
Brewster steht da und stiert auf den Fleck, auf die gelblichen Wellen des Baches.
»Er liegt…«
Ihre Stimme ist neben ihm. Die Lady schwankt, sie droht zu fallen und setzt sich mit kreidebleichem Gesicht auf den feuchten Boden.
»Sie haben ihn in den Bach geworfen!« stammelt sie entsetzt. »Nein, nein, das können sie doch nicht getan haben, Brewster...«
Der Alte preßt die Lippen zusammen und schweigt. Ja, denkt er, sie hat recht. Man hat ihn in den Bach geworfen. Nun haben sie auch den dritten Marshal umgebracht.
»Brewster, ich muß es sehen. Ich werde suchen, ich muß es tun.«
»Warten Sie«, sagt er heiser. »Man kann nicht überall unten am Ufer entlanggehen, es ist an vielen Stellen unterspült und ausgebrochen. Bleiben Sie oben, ich gehe nach unten und leuchte. Lady, machen Sie sich keine großen Hoffnungen. Wer dort hineinfällt, der kommt nicht…«
Nicht heraus, denkt sie entsetzt, der kommt nicht mehr heraus.
*
Kälte, rasende Schmerzen in seinem Kopf. Er sieht alles verschwommen und hat das Gefühl, gelähmt zu sein. Um ihn das Wasser – und in ihm das Gefühl, in einer Tonne zu stecken und einen Berghang hinabzurollen.
Luft, denk Madison. Er holt Atem und spürt, wie das Wasser ihn mitreißt. Er hat einen Schlag gemerkt, danach die Kälte und das Wasser.
Mein Kopf, denkt Madison, was ist denn nur mit meinem Kopf passiert? Ist das Ufer dort drüben oder ist es der Himmel? Um mich dreht sich alles, mir ist schlecht.
Das Gefühl der Lähmung packt ihn immer heftiger. Er kann kaum die Beine bewegen und fühlt sich schwach wie nach einer Kugelverletzung. Nur nach und nach erkennt er das hohe Ufer, ein paar Büsche.
Noch läßt er sich treiben, versucht seine Gedanken zu ordnen. Es gelingt ihm nicht. Er spürt nur, daß er immer schwächer wird.
Dann macht der Bach einige Windungen, das Ufer kommt näher.
Heran, denkt Madison verzweifelt, näher heran. Da sind Büsche. Ich muß nach den Zweigen greifen, mich halten.
Als er es versucht, reißt der Busch aus. Das Wasser reißt ihn fort, das Ufer ist ganz nahe. Ihm fällt ein, daß er versuchen könnte, ob er Grund unter den Füßen findet.
Drei-, viermal läßt er sich sinken, bis er endlich an etwas stößt. Doch das Wasser hat eine derartige Gewalt, daß es ihn herumschleudert. Er prallt gegen Steine. Es reißt ihm die Beine weg, wieder taucht er tiefer hinein. Verzweifelt suchen seine Hände nach einem Halt, seine Beine strampeln mit letzter Kraft. Und dann erwischt er irgend etwas, bekommt einen Knüppel oder einen Stab zu packen. Sein Körper wirbelt mit der Strömung herum.
Nur verwischt wie durch Nebelschleier sieht er Zweige, eine Wurzel über sich. Direkt vor ihm eine Kante, die glatt und wie geschliffen aus der Wand ragt. Steiles Ufer – eine Felsplatte hier in einem schwarzglänzenden Steinabhang. Irgendein altes Diggerloch muß dort oben sein. Man hat die Steine in den Bach geworfen. Sie bilden einen Vorsprung.
Auf die Platte, denkt Madison, auf die Platte. Ich muß raus hier. Es muß gehen.
Zweimal rutscht er ab – der dritte Versuch gelingt ihm mit dem letzten Rest Kraft. Die Platte ist naß – er kriecht auf sie, kann nicht weiter. Zweige über ihm, Wurzelwirrwarr. Seine Brust hebt und senkt sich schwach, die rechte Schläfe brennt wie Feuer, der ganze Kopf scheint anzuschwellen.
Er greift nach den Wurzeln. Dann zieht er sich einen halben Schritt hoch, mehr Kraft hat er nicht.
In seinen Ohren rauscht es.
Es ist aus mit ihm.
*
Nein, denkt Brewster, nun ist es genug. Ich bin am Ende, ich bin alt und müde. Seit dem frühen Morgen bin ich unterwegs. Den Weg zurück habe ich zu Fuß machen müssen, weil die Maultiere zu beladen gewesen sind.
Er steigt den glitschigen Hang hoch, sieht die Gestalt oben im flatternden Umhang.
»Es hat keinen Sinn«, sagt er dumpf. »Eine halbe Meile sind wir gegangen.«
Er hockt sich auf einen Stein und starrt auf den Bach hinab. Der macht einen weiten Bogen. An diesem Ufer ist ein Riesenloch, als hätte man gebaggert. Dabei haben Digger hier einmal nur mit Hacken und Schaufeln gewühlt.
»Sie meinen, er ist tot?«
»Ich weiß nicht«, murmelt er keuchend. »Es ist nicht viel Hoffnung, Lady.«
»Mr. Brewster, nur noch ein kleines Stück, bitte.«
Er steht auf und nimmt die Laterne hoch. Schweigend geht er los, am Rand dieses Loches entlang. Unten ist kein Weg mehr. Erst nach 60 Yards kann man wieder, wenn man das Loch umgangen hat, ans Ufer. Die Laterne leuchtet jeden Stein an, nichts. Dann wandert der Lichtkegel über den Bach, streicht am anderen Ufer entlang, zuckt über Steine, den Hang, die Büsche. Er blendet bis an die Ecke hinten. Vom Nieselregen, der wieder eingesetzt hat, glänzt das Gestein drüben.
»Da, Mr. Brewster!«
»Wo?« fragt er müde und mit brennenden Augen. »Was ist, Lady?«
»Rechts, leuchten Sie nach rechts, schnell. Und jetzt höher. Dort an dem schwarzglänzenden Stein.«
Brewster blinzelt. Der Lichtkegel schneidet sich durch den Dunst, frißt sich das Gestein empor und bleibt auf einem Fleck liegen. Fast 50 Yards Entfernung. Und wie eine kleine Reihe von hellen, blinkenden Punkten glitzert etwas.
»Brewster, was ist das?«
»Ich bin nicht sicher. Warten Sie, Lady, ich muß zurück, von der anderen Seite aus kann ich vielleicht besser leuchten. Kommen Sie mit.«
Brewster hastet los, aber an der Gegenseite des Loches liegt lockeres Geröll. Dort rutscht Brewster ab, saust ein ganzes Stück in die Tiefe und knallt gegen einen Balken, der aus dem Geröll ragt.
»Madam, kommen Sie nicht nach«, sagt er schrill, als er sich mühsam fängt und das letzte Stück klettern kann. »Sie halten sich nicht.«
Gleich darauf fällt der Lichtstrahl nach drüben. Und nun erfaßt er ein Bein, wandert etwas höher, packt wieder die seltsamen Punkte.
Großer Gott, denkt der Alte, der Waffengurt. Die Jacke sitzt ihm unter den Armen, ist hochgerutscht. Es sind die Patronenböden in den Schlaufen des Waffengurtes.
Wie schnell er den Weg zurücklegt und wieder bei der Lady ist, weiß er nicht. Er ist plötzlich oben und packt ihren Arm.
»Madam – da drüben liegt er. Der Waffengurt, das Halfter ist leer, soviel habe ich sehen können. Er muß es sein. Schnell fort hier. Durch das Wasser kommt man nicht zu ihm. Wir müssen den Karren holen und über die Brücke am Diggercamp fahren. Hören Sie, wir müssen fort!«
»Lebt er?«
»Das sollte er eigentlich, wie wäre er sonst dort hinaufgekommen«, sagt Brewster. »Er muß leben. Und laufen Sie nicht so. Warum denn jetzt so laufen? Der Weg zurück ist weit.«
»Er lebt«, stammelt sie. »Brewster, wenn er da hinunterstürzt?«
»Er wird schon nicht, er liegt hinter Wurzeln. Keine Sorge, in einer halben Stunde können wir bei ihm sein. Halten Sie das Tempo durch?«
»Ja, ja, nur schnell.«
Der Alte sieht sich scheu um. Plötzlich denkt er daran, daß man sie beobachtet haben könnte. Hier gibt es überall Halunken – und wenn nun jene Burschen sich vergewissern wollen, ob Clark nicht etwa ans Ufer gekommen ist? Vielleicht fällt einem ein, Madison könnte doch nicht tot gewesen sein. Wenn sie dann suchen und ihn finden und ihn dazu?
Die bringen mich und die Lady um, denen macht das nichts aus, denkt der Alte beklommen. Wenn sie jemals herausbekommen, daß ich ihnen die Sache verdorben habe, dann bin ich ein toter Mann. Niemand darf erfahren, daß wir ihn gefunden haben.
Plötzlich hat der alte Mann Angst.
Er muß schweigen – oder er wird tot sein.
*
»He, Madison?«
Jemand kommt hinter Wilbur Sanders über den Gehsteig und bleibt stehen.
»Wilbur, ist was?« fragt Captain Bill Clark gähnend. »Er wird schlafen nach der Nachtwache.«
Wilbur Sanders dreht sich um, blickt den ehemaligen Captain an und schüttelt den Kopf.
»Bill, bei meinem Klopfen würde ein Toter munter. Hört mal, rührt sich was?«
Clark tritt an die Tür, lauscht und sieht, wie Sanders durch das Fenster lugt.
»Na?«
»Nichts, Wilbur. Wie sieht es drinnen aus?«
»Alles zu. DieTür zum Jail geschlossen, niemand drin. Aber einer müßte da sein. Bill, da kommt John Kinna. He, John.«
John Kinna, ein Storebesitzer, pafft seine Morgenzigarre.
»Na, wollt ihr Madison zu einem Morgendrink einladen?«
Sie sind gute Bekannte – und sie sind durch noch etwas verbunden, was die wenigsten Leute hier ahnen. Alle drei gehören zu den Köpfen der Vigilanten-Bewegung. Jeder von ihnen hat erst vor kurzer Zeit in John Kinnas Store geschworen, mit allen Mitteln gegen Mörder und Banditen vorzugehen.
»John, hast du Madison oder Shane gesehen?«
»No, sind sie nicht da?«
»Keiner von beiden, John.«
»Wilbur, du denkst doch nicht...«
»Frag mich nicht, was ich denke!« zischt Sanders scharf. »Los, gehen wir zu Shane.«
Die drei Männer gehen zusammen los, und Captain Clark sagt zwischen den Zähnen: »Wilbur, wir sollten damals nicht auf deinen Vetter gehört haben. Er hatte auch die verdammte Ansicht, daß man Banditen und Mörder nach dem Gesetz behandeln mußte. Daran ist er gestorben. Und was ist, wenn Madison…«
»Madison weiß, daß sein Freund mein Vetter war.«
Kinna hebt den Kopf und sieht Sanders scharf an.
»Hast du ihm auch gesagt, daß wir und einige andere uns zusammengetan haben?«
»Natürlich nicht«, erwidert Wilbur Sanders. »Er vermutet aber so was. Ich sage euch, mein Vetter und Madison haben die gleichen Ansichten. Für sie gilt nur der Orden etwas. Daß Bürger auch zur Selbsthilfe greifen könnten, werden Leute wie Madison nie dulden. Ich bin Rechtsanwalt, und ich bilde mir ein, kein schlechter. Ich kenne die Gesetze besser als Madison. Bis heute habe ich mich zurückgehalten. Ich habe mich geweigert, etwas ohne Marshal oder Sheriff zu tun. Aber ist Madison was passiert, dann müssen wir uns selbst helfen.«
»Und wie?« fragt Kinna. »Woher wollen wir erfahren, wer ein Mörder ist und wer nicht?«
»Geld!« sagt Bill Clark. »John, Geld macht gesprächig, glaubst du nicht?«
»Du meinst, wir sollten...«
»Ja«, murmelt Wilbur Sanders und beißt sich auf die Lippen.
»Wer will es auf sich nehmen, eine Belohnung für Hinweise auf die Mörder auszusetzen? Einer von uns muß es tun.«
Der Captain sieht ihn nur an.
»Ich werde eine Belohnung...«
Er schweigt, denn sie sind am Staketenzaun von Mrs. Willows’ Haus angekommen. Kaffeeduft zieht ihnen entgegen. Mrs. Willows taucht im Fenster auf.
»Guten Morgen, Captain... Mr. Kinna, Mr. Sanders. Wollen Sie zu Mr. Shane? Sagen Sie ihm, der Kaffee sei fertig.«
»Guten Morgen!« sagt Sanders freundlich. »Wir sagen es ihm.«
Sieben Schritte bis zum Anbau um die Ecke. Sanders streckt die Hand aus, faßt nach dem Türgriff. Abgeschlossen.
Also zum Fenster.
»Teufel!« sagt Sanders und wird bleich. Er sieht nur die Gestalt auf dem Bett liegen. Und er denkt an seinen Vetter, der immer ein einsamer Mann war, gerecht, hart, wortkarg. Genauso lag Marshal Sanders da. »Das Fenster!«
Sanders kann schnell sein, schnell und hart. Er stößt mit dem Ellbogen die Scheibe ein und hebt den Riegel hoch. Dann schwingt er sich in den Raum.
Shane liegt still, die Augen geschlossen, den Knebel zwischen den Zähnen. Die Stricke haben sich in die Haut seiner Gelenke geschnitten. Der Deputy ist ohnmächtig, aber Sanders hält ihn zuerst für tot. Erst Wasser bringt Shane wieder zu sich.
»Hölle!« knirscht John Kinna. »Wilbur – Bill, jetzt ist es genug! Mann, Shane, wo ist Madison?«
Shane würgt, er kann kaum reden. Seine Zunge ist geschwollen, die Kiefer wollen ihm nicht gehorchen. Wie ein Greis lallt Shane: »Wei – weiß nicht. Der – Gefangene.«
Chuck, denkt Shane und knetet seine Kiefer, sie haben ihn umgebracht. Irgendwo werden wir ihn finden, aber Richards nicht mehr. Sie haben ihn, verdammtes Packzeug.
Er kauert auf der Pritsche und starrt vor sich hin. Haß ist jäh in ihm, kalter, gnadenloser Haß. Er weiß, daß er in zwei Stunden tot gewesen wäre, hätte man ihn nicht gefunden.
Ich bringe sie um, denkt Shane und hört den Captain fragen, wie es passiert sei, wieviel Mann es gewesen wären. Ich bringe sie um. Gut, ich habe nicht viel Mut, ich mag ein Feigling sein, aber ich wäre erstickt. Als ich lag, habe ich Zeit gehabt, nachzudenken. Ich weiß genau, was ich tun werde. Sie sollen mich nur für ängstlich halten, für jemanden, den sie einschüchtern können, wenn sie ihm nur ein Messer an den Hals setzen. Aber sie sollen sich noch wundern.
»Shane, wieviel Männer?«
»Drei oder vier, alle mit Kapuzen wie die Road Agenten«, sagt er mühsam. »Sie waren durch das Fenster eingestiegen und hatten mich gleich. Captain Clark, wir müssen Madison suchen. Wir werden ihn irgendwo finden.«
Finden werden sie ihn nicht, nur seinen Hut und den Revolver – und ein paar verwaschene, vom Regen schon fast verlöschte Spuren. Sie werden am Bach stehen und auch dort suchen.
Madison bleibt verschwunden. Der Bach hat ihn verschluckt.
Madison ist für sie tot.
*
John Kinna hebt kaum den Blick, als der Mann seinen Store betritt. Dunkelheit draußen – scharfer, kühler Wind fegt über die Straße. Seit drei Tagen regnet es nicht mehr. Der scharfe Wind hat die Pfützen getrocknet. Am Tag scheint die Sonne, wenn es auch kalt ist.
Die Uhr hinten in der Ecke tickt laut. John Kinna rechnet, läßt den Mann kommen. Ein Digger, denkt er, er ist nun schon das dritte Mal hier. Bei Einbruch der Dunkelheit kam er zuerst und kaufte sich zwei Zigarren. Dann tauchte er vor einer halben Stunde wieder auf. Er wollte diesmal Pfeifenreiniger haben. Eine Frau kam herein, und der Bursche ging wieder hinaus. Ging er, weil die Frau im Store war? Seltsam, ob der gewartet hat, bis niemand mehr...
»Mr. Kinna?«
Der Mann ist klein, sieht schmutzig aus, blinzelt unter dem Hut hervor.
»Ja?« sagt Kinna. »Ja – und? Was soll es diesmal sein, Mister? Vielleicht Tabak? Sind die Zigarren alle?«
Der Mann blickt sich um, lugt zur Tür, schiebt sich an denTresen.
Vier Tage ist es her, seitdem die ersten Gerüchte durch die Stadt gelaufen sind, bei Captain William Clark wären fünfhundert Dollar für den zu holen, der etwas über Richards oder dessen Freunde weiß. In der Zwischenzeit wird es jeder Mann wissen.
»Mr. Kinna, ich habe gehört, Sie sind ein Freund von…«
Der Mann schweigt jäh. Draußen geht jemand vorbei. Die Schritte verlieren sich.
»Wessen Freund, Mister?«
»’n Freund von Mr. Clark, stimmt das?«
Großer Gott, denkt John Kinna, verdammt, das wird doch nicht etwa...
»Ja«, sagt er, seine Stimme klingt etwas heiser. »Und?«
»Ist das wahr mit dem Geld?«
»Ja, ich denke schon.«
»Wissen Sie’s sicher, Mr. Kinna?«
Der Mann ist erregt.
»Ja, Mann, sicher. Moment, soll ich die Tür zumachen? Ich wollte ohnehin schließen. Heute ist ein ruhiger Tag. Wenn Sie lieber wollen, daß ich die Tür schließe…«
»Ja, Mann!«
Der kleine Mann drückt sich in die dunkelste Ecke und wartet, bis Kinna die Tür geschlossen und das Licht herabgedreht hat.
»Nun?« fragt Kinna und hat Mühe, nicht laut zu reden. Der Mann, das fühlt John Kinna, ist kein Bluffer, er weiß etwas. Sanders behält recht mit seiner Mutmaßung, Geld löse viele Zungen. »Nun, Mann?«
»Ich kann nicht zu Mr. Clark, versteh’n Sie?«
»Also, was ist denn?«
»Weiß vielleicht, wo Richards wäre. Vielleicht.«
»Wo?«
»Das Geld, Mister, bekomme ich es, wenn’s was wird?«
»Mann, das ist sicher. Vorausgesetzt, du hast selbst nichts mit den Kerlen zu tun.«
»Ich? Würde ich dann hier sein?« fragt der Kleine. »No, lebe im Südcamp, wo der Richards seine Hütte hat und noch jemand wohnt, ’n Freund von Richards.«
Er leckt sich über die Lippen, schielt zum Zigarrenregal.
»Da, rauch, Mann – und erzähl!«
Der Kleine raucht hastig.
»Vor vier Tagen – als der Marshal verschwand, in der Nacht, da war ich unterwegs, kam an der Hütte vorbei und sah ihn.«
»Wen?«
»Freund von Richards, war in der Hütte von ’nem anderen Mister, den Richards auch gut gekannt hat. Wo der Marshal doch weg ist, dachte – ist es sicher wichtig. Wozu hat der Spaten, Schaufel und noch ’ne Hacke aus der Hütte von dem anderen geholt? Und mitten in der Nacht, he? Vielleicht wollte er einen eingraben, denke ich mal.«
»Also, nun mal langsam«, sagt Kinna heiser.
»Du warst unterwegs und sahst einen Freund von Richards in die Hütte eines anderen Mannes gehen. Er holte Hacke, Spaten und Schaufel. Stimmt das?«
»Ich sag’s doch, so war’s. Dann ist er weg und hat sich so verrückt umgesehen wie einer, der was zu fürchten hat. Ist weg, den Hang hochgestiegen. Und oben hat er dann den anderen getroffen – so war’s!«
»Den Besitzer der Hütte?«
»Eben nicht. Einen anderen, der hat dort gewartet und mich nicht gesehen. Den kannte ich auch, war ja Mondschein zwischen dem Regen ab und zu. Und dann sagt der eine zum anderen: ›Wir machen ihm ein schönes Loch. Da findet ihn keiner‹!«
»Was hat er gesagt?« fährt Kinna hoch. »Und das hast du gehört?«
»Ja, so wahr ich ’n ehrlicher Mensch bin.«
»Weiter, weiter, dieser Mann, ich meine, der Hüttenbesitzer, der war nicht dabei?«
»No, der ist manchmal paar Tage weg. Als ich das mit dem Marshal hörte, da habe ich gedacht, vielleicht haben sie den eingebuddelt, wo doch auch Richards weg war, Mr. Kinna.«
»Mann, wer waren die Burschen?«
»Bekomme ich das Geld, wenn’s was wird? Und verraten Sie mich auch nicht?«
»Mister, sicher bekommst du es, wenn alles stimmt. Und ich rede auch nicht über dich. Ich will deinen Namen gar nicht wissen. Stimmt das, was du gesagt hast, dann hast du morgen das Geld.«
»Krieg ich’s nicht sofort? Was man hat, das hat man.«
»Wie denn – erst das Geld? Und wir können nicht prüfen, ob du die Wahrheit gesagt hast? Das geht nicht.«
»Geben Sie mir fünfzig Harte, ich sage sonst nichts. Anzahlung muß sein!«
»Also gut, hier, nimm. Und nun erzähl, wer waren die Männer?«
Der Mann steckt das Geld hastig ein, beugt sich vor und flüstert: »Sie waren an der Hütte von Mike Silvie. Buck Stinson war da und hat das Werkzeug geholt. Auf dem Hügel hat Ray Nedford gewartet – und der hat’s auch gesagt, das mit dem feinen Loch, in dem ihn keiner finden würde. Nedford und Stinson wohnen zusammen ein paar Meilen von hier am Ostcamp oben vor dem Eightmile Creek. Habe sie oft mit Silvie zusammen gesehen und dessen Bruder Jake. Die arbeiten nie, verdienen auch so nichts beim Waschen von Gold. Woher sie Geld haben, weiß ich nicht.«
»Wo ist die Hütte der beiden, Mann, den genauen Platz brauche ich.«
»Abseits vom Ostcamp da oben. Geht ein Weg hoch zu den einzigen Bäumen auf der Kuppe. Da liegen drei Hütten. Die letzte ist die von den Burschen. Ist die einzige mit im Corral dabei. Ziemlich große Hütte. Möchte wetten, Richards sitzt bei denen.«
»Vielleicht«, sagt John Kinna leise. »Vielleicht auch nicht. Du bist sicher, die beiden Kerle das sagen gehört und sie auch genau erkannt zu haben?«
»Ich habe gute Augen, sie waren es. Und wen haben sie einbuddeln wollen, wenn nicht den Marshal?«
»Ja«, murmelt Kinna nachdenklich. »Also gut, stimmt das und erwischen wir Richards bei ihnen, dann bekommst du den Rest des Geldes. Morgen in meinem Store, verstanden? Komm gegen neun Uhr in den Stall, er wird offen sein.«
»Sie werden sehen, ich habe nicht gelogen, Mister.«
Kinna bringt den Mann zur Hintertür, geht vor ihm hinaus und sieht sich um. Aber es ist niemand da. Wortlos verschwindet der kleine Mann in der Nacht. Hinter John Kinna aber klappt die Tür, und seine Frau fragt leise: »John, gehst du noch weg?«
»Ja«, sagt er knapp. »Kann sein, daß ich noch reite. Mach dir keine Sorgen.«
»John, wer war der Mann?«
»Jemand hat ihn geschickt, ich soll mal zu Sanders kommen. Wir haben etwas zu besprechen.«
»Sieh zu, daß es nicht so lange dauert.«
»Nun ja, Beidler hat Besuch bekommen, einen alten Freund. Kann sein, daß wir noch hinreiten, aber ich bin bis Mitternacht wieder hier.«
Kinnas Frau weiß nichts von dem, was ihren Mann und einige andere Leute verbindet.
Drei Minuten später verläßt John Kinna das Haus.
Eine Viertelstunde darauf kommt er wieder und sattelt sein Pferd. John Kinna reitet auf die Ennis Road zu, hält bei einem Gebüsch nahe der Straße und sieht wenig später die ersten drei Männer kommen.
Sie sind neun Mann, als sie aufbrechen und Wilbur Sanders knarrend sagt: »Wenn der Mann gelogen hat, John, bist du fünfzig Dollar los. Wenn er aber die Wahrheit gesagt hat, kostet es uns den Wert einiger Stricke.«
Er blickt zu Beidler. Der untersetzte, bärtige Mann hat zwei Stricke am Sattel daneben die Sharps und einen Starr Karabiner.
John Xavier Beidler ist US-Deputy-Marshal gewesen. Und wie er reiten fünf andere Männer im scharfen Galopp nach Osten.
»Das ist die Sache wert«, brummt Beidler zu ihm hin. »Wir brauchen eine Dreiviertelstunde, mehr nicht, dann werden wir sehen.«
Ein Frosch quakt, und irgendwo in einer Hütte des Ostcamps schlägt eine Uhr elfmal. Der Wind bringt die Geräusche eines Wagens zu den Männern hoch. Unten schaukelt eine Plane zwischen den Hütten. Laternenschein schwankt über den Weg. Sie sind still, haben ihre Pferde verlassen und lauschen. In den wenigen Bäumen auf der Hügelkuppe fängt sich der Wind. Äste knarren, und Sanders sieht hoch.
Der Ast ist zehn Fuß über ihm, ein starker Ast mit wenig Laub.
Sie werden reden, denkt Wilbur Sanders, sie müssen es. Wenn der Mann John Kinna die Wahrheit gesagt hat.
»Beidler«, sagt Captain Clark heiser. »Du nimmst die eine Gruppe. Von zwei Seiten heran. Und keine Maus kommt durch, verstanden?«
Sanders zieht sein Halstuch hoch, denkt wieder an seinen Vetter. Einsam gelebt – und einsam gestorben, hinterrücks ermordet, weil er den Halunken auf der Spur war.
Ich hätte ihn nicht holen sollen, denkt Sanders bitter. Er war immer stolz darauf, nie etwas von seiner Verwandtschaft angenommen zu haben. Billy wollte seinen Weg allein machen. Und der Weg war hier zu Ende für ihn. Vielleicht lebte er noch, wenn ich ihm nicht geschrieben hätte.
Sanders blickt hoch, als Clark neben ihm ist und ihn anstößt.
»Gehen wir, Willie.«
»Ja«, sagt Sanders mit trockenem Mund. »Gehen wir.«
Vier Mann sind sie in dieser Gruppe. Sanders, Kinna, der Captain und Sam Nye. Clark ist der erste Mann in der Reihe. Keiner spricht, als sie auf die letzte Hütte zugehen. Sanders befeuchtet seine Lippen, schluckt zwei-, dreimal.
Anfangen, denkt Sanders düster, einmal anfangen. Und nicht eher aufhören, bis das Gesindel vertrieben ist. Wir müssen es tun. Er wirft einen Blick nach rechts und sieht die Männer der anderen Gruppe geduckt den Hang hinabgehen. Irgendwo kollert ein Stein, in der ersten Hütte weit vor ihnen lacht jemand. Lichtschein fällt aus den Fenstern, ein Pferd steht vor der Hütte. Zu sehen ist niemand.
So biegen sie um den windschiefen, kleinen Zaun und haben den Corral vor sich. Ein Wagen ist rechts an die Hauswand und einen Stall gefahren worden. Im Corral bewegen sich vier Pferde. Kein Licht im Haus, das etwa größer ist als die anderen beiden.
»John«, flüstert Clark, »zu den Corralpfosten. Und du, Nye, geh zum Wagen, aber leise.«
Clark winkt Sanders. Dessen Mund ist schon wieder trocken. Noch 20 Yards bis zum Blockhaus.
Sanders sieht es, ehe er das Geräusch hört.
Drüben ist Beidler blitzschnell an der Gegenseite des Corrals zu Boden gesunken. Hinter ihm ducken sich die anderen Männer.
»Bill.«
»Sssst!« zischt Clark und stürzt vorwärts auf den einen Busch zu. »Runter – an den Corral!«
Hufschlag wird laut. Sanders kauert sich hin. Am Eckpfosten ist John Kinna heruntergesunken. Er hält sein Gewehr im Schlagschatten des Pfostens und hört den Hufschlag näher kommen. Nye erreicht den Wagen nicht mehr, ihm bleibt nur das Gras, in das er sich wirft.
Großer Gott, denkt Sanders und lugt zwischen den Corralstangen durch – der kommt an der ersten Hütte vorbei. Er wird doch nicht herreiten wollen?Wo ist das Gatter des Corrals?
Sanders sieht es nun. Es ist dicht am Wagen an der Hofseite. Noch aber ist der Reiter auf dem Weg. Er hat ein Packpferd hinter sich, biegt nun ab und wird langsamer.
Der Mann hockt zusammengekauert im Sattel und reitet in den Hof.
Er muß Kinna sehen, denkt Sanders verstört. Wenn er nicht zum Haus reitet, sondern gleich zum Corralgatter will, sieht er John am Pfosten.
Der Mann ist da, und John Kinna bewegt sich.
»He!« sagt der Mann im Sattel heiser und laut. »He, wer ist da? Komm da raus, Bursche! Los, rauskommen! Willst du Pferde stehlen?«
20 Yards weiter rechts kommt nun Beidler hoch und ist mit drei langen, wilden Sätzen am Wagen. Beidler hat gesagt, er kenne zwei der Burschen.
»Stinson, streck die Hände hoch!«
Es ist Buck Stinson, als träfe ihn ein Schlag. Er kennt Beidler und weiß, daß der oft genug für das Gesetz geritten ist.
»Verdammt!« Das ist alles, was Stinson sagt, ehe sein Revolver kracht. Beidler ist mit einem Satz am linken Wagenrad verschwunden. Das Geschoß trifft den Reifen und prallt heulend ab. Im nächsten Moment duckt sich Stinson im Sattel. Mit einem Fluch schlägt er dem Pferd die Hacken ein. Er treibt es an, schwenkt den Revolver und sieht Kinna am Pfosten kauern.
»Halt«, sagt John Kinna scharf und rauh. »Den Revolver weg! Halt – oder ich schieße!«
Für den ehemaligen Sergeant John Kinna ist wieder Krieg. Er hat sein Gewehr hochgerissen, sieht Stinson herumfahren, sich ducken und den Gaul anspringen. Der Revolver zeigt nun auf ihn, Stinson wird schießen.
»Hunde – noch habt ihr mich nicht!«
Als der Revolverlauf ihn bedroht, drückt John Kinna ab. Der Rückschlag des Gewehres läßt Kinna nach hinten kippen. Er hat nur auf den Hacken gekauert, den Kolben der Waffe an der Hüfte gehalten und abgedrückt. John Kinna schießt von unten nach oben und sieht, wie Stinson zur Seite gestoßen wird. Brüllend der Krach des Gewehres – peitschend der Schuß aus dem Revolver.
Die Kugel singt grell an John Kinnas Gesicht vorbei.
Mein Gott, denkt Kinna, hört das Klatschen der Kugel in einer der Stangen hinter sich, der hätte mich in die Brust getroffen, wenn ich nicht umgefallen wäre. Er fällt vom Gaul.
Während er sich aufrappelt, sieht er Clark hochschnellen. Der rennt wie ein Tiger los und schreit: »Um das Haus, schnell, schneidet ihnen den Weg ab!«
Nye stürmt nach den ersten Schüssen auf den Wagen zu. Vor ihm rennt Beidler weg, links von ihm rast Wilbur Sanders mit seinen langen Beinen und ausgreifenden Sprüngen Bill Clark nach. Die Schüsse haben den Bann gebrochen – Sanders’ Mund ist nicht mehr trocken.
Warum hat er gleich geschossen, wenn er ein gutes Gewissen hat, denkt Sanders. Es ist also wahr, sie sind die Mörder.
Im Laufen hört Sanders irgend etwas in der Blockhütte poltern. Und dann hallt Beidlers scharfer, wilder Schrei in der Nacht, ehe Sanders noch um die Hütte gerannt ist.
»Halt – stehenbleiben – halt!«
Vor Sanders biegt der Captain um die Hausecke, fährt im Brüllen eines Schusses zurück. Clark hat kaum die Nase um die Ecke gestreckt und das Klirren gehört, als er den Schatten davonhetzen sieht. Der Mann springt wie ein Hase den Hang hinunter, auf das nächste Haus zu. Holz liegt dort zu einem Haufen aufgeschichtet – Knüppel und Äste bilden ein Wirrwarr. An diesem Haufen zuckt der Kerl herum.
Beidler brüllt wieder: »Stehenbleiben, Nedford!«
Nedford denkt nicht daran. Der ist aus dem Fenster gehechtet, als er an dieser Seite niemanden gesehen hat.
Am Holz dreht sich Nedford um und sieht den Schatten am Haus, Beidler aber linker Hand den Hang abwärts rennen. Blitzschnell schießt Nedford auf die Hausecke.
Vor Clark blitzt es grell auf. Der Captain wirft sich zurück, fällt hin und sieht Sanders vorbeistürmen. Drüben rennt Beidler in kurzen Sprüngen weiter und schreit noch einmal: »Stehenbleiben, Nedford!«
Ray Nedford kommt nun hinter dem Holz hervor und jagt im Zickzack auf den Bach zu.
»Teufel, der Halunke!« hört Sanders den untersetzten Beidler grimmig rufen.
»Dann nicht, du Hundesohn!«
Beidler feuert, aber Nedford schlägt gerade wieder einen Haken. Die Kugel faucht an dem flüchtenden Banditen vorbei. Dann ist Nedford kurz vor dem kleinen Bach. Er will zwischen die Büsche.
Schießen, denkt Sanders, der Kerl entwischt, der Halunke entkommt uns noch.
Er zielt und drückt ab. Sie schießen beide zugleich – auch Beidler feuert.
Ein gellender Aufschrei Nedfords. Die Kugel hat sein linkes Bein erwischt. Ein Hieb nur, der Nedford herumwirbelt. Der Bandit knickt ein und schlägt der Länge nach hin. Sein Revolver fliegt ihm aus der Hand und klatscht ins Wasser.
»Liegenbleiben!« brüllt Beidler, aber er ist nicht so schnell wie Sanders – der hat die längeren Beine und ist auch jünger.
»Rühr dich nicht, Halunke!« keucht Sanders und senkt den Gewehrlauf. »Ich drücke ab, Kerl!«
Er starrt auf das Blut an Nedfords Bein.
»Haben wir dich?« fragt Beidler grimmig. »Los, Schurke – aufstehen!«
»Ich kann nicht, mein Bein.«
»Kannst du nicht? Aber morden konntest du, was?«
Beidler bückt sich und reißt ihn am Hemd hoch. Als sie ihn zwischen sich nehmen und auf die Hütte zu führen, flucht Nedford greulich vor sich hin.
»Teufel!« sagt Clark, als sie ihn heranschleifen.
»Noch kämpfen wollen, was? Kerl, das Loch in meinem Arm bezahlst du mit deinem Leben!«
»Geh zur Hölle!« flucht Nedford wild. »Was wollt ihr von uns, wir haben nichts getan!«
»Was du getan hast, reicht aus, um dich zehnmal zu hängen!« faucht Beidler ihn an. »Was ist mit der Hüttentür – ist sie verschlossen?«
Totenstille in der Hütte, als sie an die Tür klopfen. Es rührt sich nichts.
»Brechen wir sie auf«, murmelt einer der Männer finster. »He, Ray, wer ist noch drinnen?«
»Keiner!« stößt Nedford durch die Zähne und setzt sich hin. »Laß mich in Ruhe.«
Beidler zaudert einen Moment unter dem Fenster. Dann nimmt er seinen Hut ab, streckt ihn hoch, aber es fällt kein Schuß von innen. Mit einem Schwung zieht sich Beidler hoch. Er verschwindet in der Hütte, macht wenig später die Tür auf und findet eine Lampe. Als sie brennt, sehen sie sich in den zwei Räumen des Blockhauses um. Drei Pritschen sind hier, rohe Bretterschränke und Verschläge enthalten eine Menge Dinge.
Es ist Beidler, der sich die Pritschen ansieht.
»Zwei sind warm«, sagt Beidler laut und scharf. »He verdammt, ist noch jemand hinausgesprungen, habt ihr ihn gesehen?«
Sie blicken sich an, nehmen ihre Waffen hoch und lauschen. Da ist die leere Pritsche. Die Decken auf ihr sind warm. Aber der Mann ist weg.
»Teufel!« knurrt Clark. »Wo ist der Kerl geblieben? Ich wette…«
Er macht einen Satz in die linke Ecke zum Herd. Dort steht eine Kiste. Sie ist leer. Auf ihr liegt ein breites Stück Sackleinwand. Mit einem Ruck reißt Clark die Sackleinwand fort. Er gibt der Kiste einen Stoß und starrt auf den Ring am Boden.
Im nächsten Augenblick ist Beidler auch schon heran. Mit dem Gewehrlauf fährt Beidler durch den Ring. Dann versucht er die Klappe anzuheben, aber er spürt deutlich, daß sie jemand von unten festzuhalten versucht.
Zwei, drei andere Männer stürzen hin. Gemeinsam ziehen sie die Klappe in die Höhe. Sanders hält die Laterne hoch. Und dann blicken sie in Richards’ angstverzerrtes blutleeres Gesicht.
»Richards!« knurrt Clark und weiß nun wie alle anderen, daß sie erfahren werden, wo Madison geblieben ist. »Richards, der Messerstecher! Raus mit dir, Hundesohn!«
»Ich war’s nicht – ich nicht!« kreischt Richards und versucht sich in dem Vorratsloch und an der Kante der Klappe festzuklammern. »Ich will nicht!«
Irgendwer tritt ihm auf die Finger, Hände zerren ihn heraus. Richards wirft sich zu Boden und beginnt zu heulen.
»Ich war’s nicht!«
Er hat den Strick gesehen – und Brennan in der Tür. Da ist Baily, er lehnt an der Wand und starrt den Mörder an – gnadenlose Härte in den Augen.
Oates, denkt Richards, sie werden Oates rächen. Die hängen uns auf.
*
»Du lügst!« sagt Sanders eisig. »Ihr habt die Werkzeuge dazu benutzt, den Marshal zu verscharren wie einen Hund. Gib es zu, Ray!«
»Nein, nein!« stammelt Ray und starrt auf den Baum, den Ast und die Schlinge. »Es war Silvie, wir haben Silvie begraben, nicht den Marshal. Laßt mich laufen, ich verspreche euch, ich komme nie wieder her, ich verlasse das Idaho Territorium für immer. Es war nicht der Marshal!«
»Er lügt, der Hundesohn!« knurrt einer der Männer. »Ihr habt Shane überfallen und Richards herausgeholt. Das genügt für den Strick. Wer waren die anderen – wer war noch dabei?«
Ray Nedfords Gesicht wird starr.
»Ich bin kein Verräter!« knirscht Nedford. »Was mich angeht – ich hab’s getan, in Ordnung. Ich habe Richards herausgeholt und war dabei, als Shane gebunden wurde. Aber mehr sage ich nicht. Hängt mich doch auf – ihr dürft es gar nicht! Richards, laß dich nicht einschüchtern. Sie bluffen nur, sie tun es nicht.«
Richards kauert auf den Knien, ein zitterndes Häufchen Elend. Tränenspuren zeichnen sich in Richards’ verschmiertem Gesicht ab.
»Ich war doch nicht dabei«, sagt er greinend und hebt die gebundenen Hände. »Ich habe nichts getan. Was weiß ich, wer die anderen waren. Ich habe immer nur mit Silvie, Nedford und Stinson zu tun gehabt. Die anderen kenne ich doch gar nicht. Gnade – Gnade!«
»Jammerlappen!« zischt Nedford verächtlich. »Heuler, ekelhafter. Du hast nichts getan, was? Und wer hat geholfen, die beiden Mexikaner in den Schacht zu werfen?«
»Sei still, sei still!« kreischt Richards los. »Er lügt, glaubt mir doch, er lügt. Ich war da gar nicht!«
»Was schreist du, he? Ein Glück, daß du nicht weißt, wer die anderen sind. Ich sage es nicht, niemand soll einmal von Ray Nedford behaupten, er habe seine Freunde verraten. Du würdest das tun, du Strolch. Bringt mich fort, ich will Hochzeit mit der Hanfbraut halten!«
Sanders läuft es kalt über den Rücken, als Ray ein Spottlied zu grölen beginnt. Er singt laut, während sie ihn packen und auf das Brett stellen, das über den beiden Tonnen liegt.
Erst als sie ihm die Schlinge um den Hals legen, hebt er die gebundenen Hände und zwängt seine Finger zwischen Strick und Hals.
»Na, singst du Vogel nicht mehr?« fragt Beidler grimmig. »Willst du noch beten?«
»Das habe ich nie getan – und jetzt erst recht nicht!« giftet Nedford und sieht höhnisch zu Richards, der die Beine einstemmt und schreiend versucht, seinen Transport auf das Brett zu verhindern. »Wie kann man nur ein so schmutziger Feigling sein? He, du Strolch, sie werden noch in hundert Jahren sagen, ich sei gestorben, wie ich gelebt habe. Aber von dir – was sollen sie über dich reden?«
»Ich will nicht!« brüllt Richards. »Laßt mich, ich will nicht...«
Er schafft es, sich loszureißen. Als er einen Sprung versucht und ausgleitet, kippt er gegen das Brett und die eine Tonne. Das Gestell bricht zusammen, Nedford saust ein Stück tiefer.
»Was?« fragt Richards und liegt am Boden, den Blick stier auf die Stiefel über sich gerichtet. »Da – das wollte ich – nicht. Ist er hinüber? Da geht er hin, der arme Ned! Jetzt richtet das Gestell auf, ich will ihm nachreisen. Habe ich es ihm doch noch zuletzt gegeben, was?«
Es schüttelt selbst die hartgesottenen Digger, die aus dem Camp hochgerannt sind. Sie halten sich in respektvoller Entfernung und sehen zu, wie auch Richards auf eine Tonne gehoben wird und auf das schnell hingelegte Brett steigt.
Richards’ Lippen bewegen sich. Sie sehen alle, daß er Worte formt, aber kein Laut ist zu hören. Seine schwarzen, glänzenden Augen glühen wie zwei Lichter.
»Fertig!« sagt Beidler kalt, und jemand tritt gegen das Faß.
»Das war es!« hört Sanders Beidler eiskalt sagen.
Es ist kalt hier oben. Sanders fröstelt, als sie den Hang hinabgehen und auf ihre Pferde steigen. Morgen, denkt Wilbur Sanders, weiß es das ganze Land. Das Gesindel wird es erfahren und aus seinen Rattenlöchern kriechen. Wir haben angefangen, es auszuräuchern. Dies ist der Anfang. Wer werden die nächsten sein?
*
Shane liegt auf dem Rücken, hebt die Hand und steckt die Pfeife in den Mund. Dabei sieht er auf sein Handgelenk. Die Haut ist verschorft von den Stricken. Stille im Office, aber Lärm auf der Straße.
»Ja«, sagt Shane, als der Mann an die Tür klopft und hereinkommt. »Hallo, Mr. Sanders.«
Sanders tritt an den Tisch, blickt auf den Deputy hinab, der sich nicht rührt.
»Und?« fragt Shane, als Sanders ihn nur betrachtet. »Was ist noch? Ich bin nur Town-Deputymarshal, nur in der Stadt und im Stadtbezirk zuständig, Sanders. Wer hat in dem Grab gelegen?«
Sie sind am Vormittag losgeritten mit Schaufeln, um nachzugraben, wo Nedford und Stinson angeblich Silvie unter die Erde gebracht haben wollten. Nedford hatte es beteuert: Es sei Mike Silvie gewesen, nicht der Marshal.
»Silvie«, erwidert Sanders heiser und hockt sich auf den nächsten Stuhl. »Und ich hatte geglaubt, wir würden Madison dort finden. Vielleicht haben sie ihn doch in den Bach geworfen. Wahrscheinlich haben sie die Wahrheit gesagt. Ein paar Mann reiten den Bach abwärts und sehen nach, ob sie etwas von Madison entdecken.«
»Er kann meilenweit getrieben worden sein«, sagt Shane düster. »Oder irgendwo festhängen, tief unter der Oberfläche. Wir müssen auf niedrigen Wasserstand im Bach warten, Sanders. Ich habe nachgedacht, ziemlich lange sogar. Die Burschen werden sich etwas vorsehen, denke ich. Aber deshalb hören die Überfälle doch nicht auf.«
»Sie werden aufhören!« antwortet Sanders finster. »Shane, Gewalt läßt sich nur mit Gewalt brechen. Und Sie sind nur zuständig für den Stadtbezirk, was? Wenn zehn Schritte außerhalb des Distrikts jemand umgebracht wird, dann geht Sie das nichts an. Das wollten Sie doch vorhin sagen – oder?«
Es klingt scharf, gereizt.
Shane schüttelt den Kopf.
»Nein«, murmelt er, »nicht so, wie Sie es sehen wollen, Sanders. Ich will damit sagen, daß ich genug in der Stadt zu tun habe. Jeden Abend ein Dutzend Schlägereien, Betrug am Spieltisch, Raub. Zehn Fälle an einem Tag in dieser Stadt. Ich kann mich nur um die Ruhe hier in der Stadt kümmern, zu mehr reicht es nicht. Das meinte ich – nichts sonst. Wo soll ich noch sein, Sanders? Wer hat euch das mit Stinson und Nedford gesagt?«
»Irgendwer, der Name tut nichts zur Sache. Es werden sich noch mehr melden, die etwas gesehen haben.«
»Ja«, brummt Shane. »Und dann hängen die Vigilanten die nächsten Mörder ohne Verhandlung auf.«
»Es gibt jedesmal eine Verhandlung«, erwidert Sanders hart. »Sie werden gefragt und können ihre verdammten Morde gestehen. Und danach gibt es das Urteil. Etwas dagegen zu sagen, Deputy?«
»Niemand wird etwas dagegen sagen«, murmelt Shane trocken. »Es ist das einzige Mittel, um das Gesindel zu vertreiben. Ich stelle nur fest, daß ich mich nicht auch darum kümmern kann. Ihr erfahrt nur etwas, wenn die Namen eurer Informanten geheim bleiben. Ich könnte das nicht tun, ich müßte Zeugen vernehmen, Protokolle schreiben. Sanders, was außerhalb der Stadt passiert, das geht mich nichts an. Ist das deutlich?«
»Sehr«, erwidert Sanders heiser. »Ich wollte es nur ganz genau wissen. In einem Monat gibt es hier keine Banditen mehr.«
Er tippt an den Hut, geht hinaus und sieht sich nicht mehr um.
Shane blickt auf die Uhr, lächelt grimmig und legt sich wieder hin.
»Stinson, Silvie und Nedford«, sagt Shane leise vor sich hin, »waren bei mir, aber da waren noch mehr. Und ich wette, diesen Halunken wird nun der Boden unter den Füßen zu heiß. Sie werden wissen wollen, was die Vigilanten über sie erfahren haben. Und da sie unmöglich mit einem der Vigilanten reden oder ihn aushorchen können...«
Er steht hastig auf, geht zum Schrank und hantiert eine Weile. Dann starrt er nach draußen in die Dunkelheit. Es wird Zeit für die erste Abendrunde des Deputys.
Es gibt jemanden, von dem sie es erfahren können, wenn er etwas wüßte, denkt Shane. Und der Mann bin ich. Ich weiß nur nichts über den Mann, der Nedford, Stinson und Richards verraten hat. Aber das ahnen die Burschen nicht. Ich bin neugierig, wann ich sie sehen werde.
Luke Shane blickt hinaus. Die Nacht ist immer günstig für jemanden, der nicht gesehen werden will, der Fragen stellen muß, wenn er um seine Sicherheit besorgt ist.
Wo sind sie, denkt Shane und faßt nach seinem Revolver. Vielleicht schon da, was? Er hat das Gefühl, daß sie auf ihn warten.
Und er wartet auch.
Sie sind ihm noch etwas schuldig.
*
»Sssst, Shane!«
Er bekommt einen Schreck, als das Zischen rechts hinter ihm ertönt.
Sie sind da, denkt Shane nach dem ersten Schreck und bleibt ohne Hast stehen. Ich habe es gewußt, daß es ihnen keine ruhige Minute lassen würde. Verräter bringen diese Halunken kaltblütig um. Sie wollen wissen, wer sie verraten hat.
»Weiter, Shane, komm nur.«
Der Mann winkt, Shane tritt um die Ecke.
Ja, er hat den Revolver im Kreuz und rührt sich nicht mehr. Das also war ihr Trick. Einer hat ihn hergelockt, der andere hinter der Ecke gelauert. Nun steckt er zwischen ihnen, den Colt im Rücken.
»Los, geh weiter, aber halt die Hand vom Gurt weg.«
»Ich bin doch kein Narr«, sagt Shane heiser. »Schon gut, ich gehe.«
Vier Schritte, dann ist er hinter dem Anbau. Der Mann vor ihm hält ihm den Colt nun auf den Bauch. Der Kerl hinter ihm zieht ihm den Revolver aus dem Halfter und lacht leise.
Das verdammte Lachen kennt Shane nur zu gut. Es ist der Bursche mit der Lampe, einer seiner Besucher, die ihn knebelten und banden.
»Na, Deputy, weißt du, wer wir sind? Hast wohl nicht damit gerechnet, was?«
»ZumTeufel!« zischt Shane gepreßt. »Was wollt ihr? Warum laßt ihr mich nicht in Ruhe?«
»Fragen stellen wir«, sagt der Kerl vor ihm knarrend. Und Shane erkennt auch diese Stimme. Es ist der Mann, der ihm in der Hütte drohte.
»Du vergißt was, Mister: Durch dich haben wir erfahren, wie nahe uns der verdammter Sanders schon auf den Fersen war. Hättest nicht reden sollen, Shane.«
»Damals war ich betrunken.«
»Ändert das was, du Narr?«
»Nein«, sagt Shane heiser. »Ihr habt mich in der Hand, ich muß tun, was ihr wollt, aber...«
»Er ist schlau«, erwidert der andere höhnisch. »Sieh mal an, ein Deputy, der Verstand im Kopf hat. Shane, Wilbur Sanders war heute bei dir, zweimal.«
Sie wissen es, sie haben das Office beobachtet, denkt Shane bestürzt. Also doch, sie haben überall Augen. Das verdammte Gesindel.
»Ja«, murmelt er gepreßt. »Stimmt. Na und?«
»Na und?« knurrt der Kerl hinter ihm wütend. »Stell dich nicht an, als wüßtest du nicht, was passiert ist, du Narr. Wir wollen etwas wissen. Und bekommen wir es nicht heraus, kannst du auch schwimmen.«
»Schwimmen, also, ihr seid das gewesen?« fragt Shane mit einem Kloß im Hals. »Dann ist Madison...«
»Ein Fisch geworden, was sonst?« höhnt der Kerl vor ihm. »Kann dir auch so gehen, Mister, wenn du nicht gehorchst. Also, was ist los, welche verdammte Ratte kennt uns? Wer ist der Hundesohn – und kennt er uns alle?«
So ist das, sie haben Angst, denkt Shane, und irgendwie meldet sich Schadenfreude.
»Bist du stumm, he?«
»Vielleicht«, sagt Shane trocken. »Vielleicht bin ich das. Ihr habt mich in der Hand, was? Wenn sie euch erwischen…«
»Damit du Bescheid weißt!« unterbricht ihn der Kerl vor ihm. »Sollten sie uns greifen und hast du nichts getan, um es zu verhindern, dann werden wir sagen, du hättest uns geholfen.«
»Was wollt ihr tun?«
»Genau das!« knurrt der andere in Shanes Nacken. »Hängen wir, baumelst du gleich mit. Das laß dir gesagt sein, Mister. Für dich gibt es keinen Weg aus der Sache.«
»Meint ihr?« Shanes Stimme klingt rauh. »Ihr denkt, ihr könnt alles mit mir machen, was? Aber ich habe verdammt lange über euch nachgedacht – und über mich. Hört mal zu. He, langsam, laß deinen Revolver sinken, Mister. Alle Dinge haben ihren Preis. Ich riskiere meinen Hals für euch – und ihr verschwindet eines Tages, ihr laßt vielleicht einen Brief zurück, in dem eure Lügen über mich stehen. No, Freunde, ihr könnt genug wissen, um sicherzugehen, daß euch nichts passiert, aber…«
Der Halunke hat den Revolver hoch, schlägt aber nicht zu. Er wartet, starrt über sein Halstuch hinweg Shane lauernd an.
»Was willst du?« fragt er zischend. »Ah, du Strolch, ich begreife langsam. So ein schäbiger Deputy verdient nicht viel, was?«
»Genau, das ist es«, sagt Shane gepreßt. »Wenn ihr verschwinden müßt, gehe ich mit. Aber nicht so arm, wie ich es jetzt bin, verstanden?«
»Verfluchter Erpresser!« keucht der Mann hinter ihm. »So hast du dir das gedacht? Wir könnten dich zwingen, etwas zu sagen, verstehst du?«
»Ihr könnt mich umbringen«, murmelt Shane. »Aber erfahren würdet ihr nichts – oder doch nicht die Wahrheit. Und es könnte in ein paar Stunden verdammt zu spät für euch sein.«
Der Mann vor ihm zuckt mit den Augen. Schreck, denkt Shane, was? Jetzt bekommen sie Angst.
Shane fühlt, daß er bereits gewonnen hat. Sie sind unsicher geworden, sie müssen sich sagen, daß etwas über sie bekannt sein könnte.
»Zu spät?« fragt der Bursche vor Shane. »Wie meinst du das? Was weißt du verdammter Kerl? Sage es, sonst…«
Er hebt den Revolver blitzschnell an. Die Mündung zeigt auf Shanes Kopf.
»Langsam«, warnt Shane. »Nur friedlich, Mister, sonst erfahrt ihr nie, wer der Kerl ist, der euch verraten hat.«
Das wirkt augenblicklich. Der Bandit nimmt den Arm herab, flucht leise.
»Also gut, wer ist der Kerl?«
»Nicht so«, sagt Shane heiser. »Nicht ohne Gegenwert, Freunde. Ich hab’s satt, das verdammte Hungerleben, ich will hier weg. Aber ich habe nur ein paar Dollar.«
Ruhig, denkt Shane eiskalt, und nun hat er plötzlich auch nicht die geringste Spur von Angst – nur ruhig, sie schlucken es.
»Fünfhundert«, sagt er kühl. Er sieht, wie der Mister vor ihm zusammenzuckt. »Nicht einen Cent weniger will ich. So viel wird euch euer Leben schon wert sein, denke ich. Ich verschwinde noch vor dem Morgen.«
»Hundesohn!« knurrt der Große vor ihm. »Versuchst du uns zu tricksen, dann hast du die längste Zeit gelebt. Ich denke, wir werden bei dir bleiben müssen, bis die anderen den Kerl erwischt haben. Ich kenne doch unseren Boß, der macht nichts ohne Sicherheit. Dreh dich um – Gesicht zur Wand, Shane!«
Er macht es, spürt den Colt des einen im Rücken. Der andere tastet ihn ab, greift sogar in die Stiefelschäfte.
»Keine Waffe«, stellt er fest. »Du bleibst hier und paßt auf, daß er keine Narrheiten macht. Ich beeile mich. Soll der Boß entscheiden, was zu passieren hat.«
Der Große dreht sich um, die Nacht schluckt seinen Schatten. Shane ist mit dem anderen Kerl allein. Der trägt sein Halstuch vor dem Gesicht, hält den Revolver in der Hand.
»Setz dich da hin, Shane!«
»Ja«, sagt Luke Shane mürrisch. Er hockt sich auf das Eisengestell für den Schachtflaschenzug. »Kalt heute, was?«
Der Untersetzte zuckt die Achseln, sein Gesicht liegt im Dunkel der Anbauwand. Auf der Straße grölen ein paar Digger – jemand jagt im vollen Galopp aus der Stadt.
»Dauert es lange?« fragt Shane. »Ich muß meine Runde machen.«
»Nicht lange – zehn Minuten wirst du schon Zeit haben, Gauner. Wohin willst du denn verschwinden, he?«
»Meine Sache.«
Shane gähnt, lehnt den Rücken an die Laufräder des Gestells. Dann greift er in die Tasche, zieht eine Zigarre hervor.
»He, was willst du? Kein Licht, Mensch!«
»Mach ich nicht, steck sie unter der Jacke an!«
»Laß das – wirf sie her, ich mach das!«
»Warum?« fragt Shane. »Vielleicht habe ich unter der Jacke eine Kanone, was? Vielleicht einen Dreizöller mit Kartuschenladung, he?«
»Du machst bald keine Späße mehr, du Narr. Wirf sie her, sag ich!«
Shane wirft die Zigarre dem Untersetzten zu. Der macht seine Jacke auf, reißt ein Streichholz an und hält es unter den Jackenflügel. Als die Zigarre brennt, lacht er leise und meckernd.
»Schmeckt mir auch, das Ding. Hast du noch eine?«
»Ja«, sagt Shane bissig. »Kauf dir nächstens selbst einen Glimmstengel. Da, steck den auch an!«
Der Bandit kichert spöttisch. Er wechselt den Revolver in die linke Hand, klemmt die Zigarre am Kolben fest und hält die andere daran. Dann saugt er.
Die Glut flammt auf, der Untersetzte saugt den Rauch tief ein.
Jetzt, denkt Shane und schiebt sich den Hut nach hinten – jetzt, Mr. Hundesohn!
Seine Hand fährt unter den Hut. Der Bursche vor ihm blickt auf die Glut. Und so schwach diese auch ist, sie muß ihn blenden.
»Da hast du...«
Er sagt nichts mehr, der Narr vor Shane. Er hört das Klicken und erstarrt. Seine Augen zucken, sein Mund bleibt vor Schreck geöffnet.
»Hand auf!« zischt Shane und hat den Bullcolt auf den Bauch des Untersetzten gerichtet. »Los, du Affe, laß deinen Revolver fallen!«
»Dafür stirbst du, Shane, du Lump. Ich schwöre dir, du wirst es bezahlen. Wo hast du den Colt her, du Hundesohn?«
»Aus dem Hut!« sagt Shane voller Hohn und steht blitzschnell auf. Er kommt auf den Kerl zu und sieht dessen Revolver zu Boden fallen. »Hände zur Seite ausstrecken. Und sitz ganz still, mein Freund! Ich habe dich – und ich werde auch den anderen erwischen. Und dann kaufe ich mir die nächsten. Ihr hättet mich nicht betrunken machen und über Bill Sanders ausfragen müssen. Ich wußte es nicht mal, daß ich geredet hatte. Vielleicht war ich ein Feigling mit dem Messer am Hals. Niemand stirbt gern sinnlos. Sitz still, Halunke!«
Er tritt seitlich an den Mann heran. Und dann holt er blitzschnell aus.
Das war es, denkt Shane und sieht den Mann zusammenrutschen, von dem schweren Eisenträger kippen und am Boden landen. Jetzt sollen sie mich kennenlernen. Warum nur hatte ich jemals Angst, sterben zu können. Ich bin kein Feigling mehr.
Luke Shane ist kein Feigling mehr.
*
Der Mann stöhnt heiser. Sein Kopf pendelt hin und her, bis Shane ihn an den Haaren packt.
»Ruhig!« zischt Shane. »Bist du wach, du Halunke? Schrei nur nicht. Versuch erst deine Arme zu bewegen – versuch es mal!«
Shane reißt ein Streichholz an. Die Flamme beleuchtet das Gesicht des Untersetzten. Der blinzelt, stößt den Atem pfeifend durch die Nase, weil Shane ihm den Mund zuhält. Danach versucht er sich zu bewegen.
»Siehst du, Cooper«, flüstert Shane eisig. »So ist das, wenn man andere für Narren hält. Mr. Johnny Cooper, du wohnst doch da unten im Diggercamp, was? Und wer noch aus eurer Horde? Maul auf – rede, aber leise!«
Cooper ist festgebunden. Er steht aufrecht an einem Eisenträger und sieht nun das Messer.
»So ist das«, sagt Shane noch einmal. »Ich kann sagen, es hätte einen Kampf zwischen uns gegeben. Dabei ist dir das Messer zu nahe an den Hals gekommen, glaubst du das? Paß auf, wie du redest!«
Die Klinge zuckt einmal, Cooper stößt ein Gegurgel aus.
Über seine Hand hinweg sieht Shane die Angst in Coopers Augen.
»Na?« fragt er leise. »Na, Mister, wie ist es jetzt? Paß auf, Halunke, paß gut auf! Du wirst hier stehen – der Träger hält dich fest. Ich hab’s probiert, umreißen kannst du ihn nicht. Und du hast die Hände auf dem Bauch gebunden. Der Strick ist nicht zu sehen, aber den Revolver wird dein Partner sehen, wenn er kommt. Du hältst ihn in der Hand – ohne Patronen. Spricht er dich an, wirst du ihm antworten, daß ich ganz friedlich gewesen bin, verstanden? Sagst du ein falsches Wort, dann schieße ich. Zuerst auf ihn, dann auf dich. Ist das klar, Cooper?«
»Du entwischst den anderen nicht – niemals. Irgendeiner bringt dich um«, sagt Cooper. »Ich werde tun, was du willst, aber du irrst dich, am Ende bist du tot, Deputy.«
»Meinst du? Leise jetzt – steh still, rede ganz ruhig, wenn er dich fragt. Er kommt schon zurück, dein Partner.«
Es raschelt links an den Büschen. Der Mann taucht auf, bleibt stehen.
»He, alles in Ordnung?«
Shane sitzt drei Schritte von Cooper entfernt, den Hut auf dem Knie. Und unter dem Hut den Bullcolt.
»Ja«, sagt Cooper. »Alles in Ordnung.«
Er schweigt, als Shane sich bewegt.
»Na?« fragt Shane. »Hast du das Geld, Mister?«
»Sicher, Mann. Aber wir werden bei dir bleiben, bis wir genau wissen…«
Er weiß noch etwas genau, der Bursche, denn Shane fegt jäh hoch. Shane sieht Geld in der Hand des Banditen und greift doch nicht nach ihm. Shanes Revolver ist da und stößt blitzschnell zu – mitten in den Bauch des zweiten Banditen hinein. Gleichzeitig hört Shane, wie Cooper keucht: »Vorsicht, Aleck. Vorsicht, er...«
»Zu spät!« knurrt Shane. Er hat seinen Mann und hält mit dem Daumen den Hammer des Bullcolts fest. »Keine Bewegung, Mister. Rührst du dich, drücke ich ab!«
Shanes Hut liegt am Boden, der Deputy hebt die linke Hand. Ein Ruck, dann hat er dem großen Banditen das Halstuch abgerissen und starrt ihm ins Gesicht.
»Carter!« faucht Shane. »Noch eine Ratte aus dem Diggercamp! Streck sie hoch, du Schurke, hoch mit ihnen, sonst blase ich dich mittendurch!«
Carter würgt, er hebt die Hände über den Kopf.
»Johnny«, sagt er halb erstickt. »Johnny, du verdammter Narr. Wie hat er das gemacht, du Idiot?«
Mit einem Stoß schiebt Shane ihn herum. Er setzt Carter den Colt in den Rücken und entreißt ihm seine Waffe.
»Ihr Ratten!« knurrt Shane grimmig. »Ihr werdet keinem mehr Lügen über mich erzählen. Habt ihr wirklich gedacht, ich ließe mich von euch Schurken bezahlen, ich würde euch auch nur ein Wort von dem sagen, was ich mit Wilbur Sanders geredet habe?
Einmal habe ich einen Fehler gemacht, als ich betrunken war und nicht wußte, was ich sagte. Es hat Bill Sanders das Leben gekostet. Jetzt kostet eure Narrheit euch den Hals. Hinknien, Carter, du Hundesohn. Auf die Knie und die Hände hochhalten. Dann nimmst du sie nach hinten. Los, runter!«
Noch bin ich das Gesetz, denkt Shane, ihr sollt es kennenlernen.
»Hände nach hinten, mach schon, Carter! Und jetzt...«
»Und jetzt mach die Hand auf!« sagte da der Mann hinter ihm, und es knackt, als wenn ein Stiefel einen morschen Ast zertritt. »Laß fallen, Deputy!«
Shane steht still. Einen Moment fühlt er gar nichts mehr, er ist wie gelähmt vor Schreck. Danach kommt die Furcht, die er überwunden zu haben glaubte. Die Angst ist wieder da, dieses verdammte Gefühl der Ohnmacht, jene Leere im Kopf.
Sie werden ihn umbringen, Shane weiß es. Er hat keine Stunde mehr zu leben, vielleicht nicht mal die. Das Spiel ist aus. Und nur die Furcht ist noch da.
Luke Shane wird sterben.
*
»Hat Bill doch recht gehabt?« fragt der Mann in seinem Nacken. Und vor Shane kommt Carter aus der Hocke hoch, wirbelt herum. »Traue nie einem Mann mit Orden, was? Du verdammtes Stinktier, dafür mußt du zahlen!«
Er zahlt schon, denn Carter schlägt zu. Shane fehlt jäh die Luft. Er knickt ein.
Mein Gott, denkt Shane, der schlägt mich tot.
Carter verwandelt sich in einen wilden Teufel. Die Hände packen Shanes Hals, drücken ihn blitzschnell zu, als Shane einen heiseren Laut ausstößt. Shane kippt auf den Rücken. Carter kniet auf ihm und preßt immer mehr.
»Du hinterlistiger Teufel!« keucht Aleck Carter. »Du schmutziges...«
»Aleck, Aleck, bring ihn nicht um. Er soll noch reden, ehe er auf die lange Reise geht.«
»Den mach ich fertig, den habe ich endlich, den Trickser!« knirscht Aleck Carter. »Blufft uns, schlägt mich. Da hast du was, dir zeige ich es. Bekommst du keine Luft, he? Aufhängen, was? Das werde ich mit dir machen, ich mit dir, hörst du?«
Shane versteht die Worte. Doch das Rauschen in seinen Ohren nimmt zu. Keine Luft mehr, Luke Shane. Carter kniet auf seiner Brust und wird ihn erwürgen.
»Aleck, zurück! Verdammt, zurück!«
Der dritte Mann bückt sich, reißt Carter an der Schulter herum.
»Bist du verrückt, Aleck? Er soll doch noch reden, er muß uns sagen, was er weiß, Aleck.«
Die schrille Stimme Coopers ertönt hinter ihnen. Sie schnappt jäh über, ist zu laut.
»Aleck – Zach. Vorsicht, da...«
Cooper sieht den Schatten vom Dach kommen. Ein Mann fliegt herab, hat den Colt in der Faust und schlägt auch schon zu. Der erste Hieb trifft Zach am Kopf und mäht den Burschen glatt um. Dann streckt der Mann die Linke aus und packt Aleck Carter von hinten am Kragen.
»Genug, Carter, du Wolf!«
Die Stimme, denkt Carter, die Stimme... Er fliegt herum, saust gegen die Wand des Anbaues. Und dann sieht er den großen, sehnigen Mann auch schon vor sich.
Nein, nein, denkt Carter entsetzt und stiert auf das Gesicht, das vom Mondlicht voll getroffen wird. Er ist doch tot. Ich habe ihn doch selbst den Abhang hinuntergerollt. Er ist tot.
Die Faust schießt auf ihn zu – das sieht er noch, steif vor Entsetzen. Dann knallt die Faust an sein Kinn und läßt ihn zusammenbrechen.
Cooper steht gebunden am Eisenträger, in den Augen das nackte Entsetzen.
»So«, sagt Marshal Chuck Madison fauchend.
»So wolltet ihr das machen? Schrei nicht, du Ratte, schrei ja nicht. Ich bin noch ganz lebendig, was?«
Kein Wort bekommt Cooper heraus. Er sieht, wie sich Shane herumwälzt und gurgelnd nach Luft ringt.
»Steh auf, Shane!« zischt Madison. »Los, komm schon hoch. Reiß dich zusammen, Mann!«
Shane wendet ganz langsam den Kopf. Einen Moment glaubte Luke Shane schon tot zu sein und irgendwo auf seiner Reise in das Land ohne Wiederkehr den anderen Toten getroffen zu haben.
»Luke, ich bin nicht ertrunken, Mann! Nimm dich zusammen, Luke, brüll nicht los!«
»Chuck«, quetscht Shane heraus und hat beide Hände am Hals. »Chuck – was – woher?«
»Später, Mann! Hilf mir die Kerle binden und ihnen einen Knebel geben. Wir müssen sie ins Jail schaffen und uns beeilen. Hat die Tür ein neues Schloß?«
»Ja«, sagt Shane, ohne nachzudenken. »Ich habe eins einbauen lassen, weil sie doch die Schlüssel hatten. Mein Hals, er hat mich beinahe umgebracht. Chuck, ich muß dir etwas sagen, sie haben...«
»Ich habe alles gehört. Ich lag die ganze Zeit auf dem Dach, seitdem Carter wegging. Erzähl es mir später, Mann. Einen Moment dachte ich, du wärst ein Hundesohn. Komm jetzt, wir müssen sie wegschaffen. Nimm ihre Halstücher und steck ihnen die zwischen die Zähne Die Beine lassen wir frei.«
Er lebt, denkt Shane verstört und doch erleichtert, er lebt. Aber wo ist er gewesen? Was hat er an der Stirn – einen Verband? Großer Gott, er lebt wirklich!
»Chuck, sie haben einen Boß. Aber wer soll das...«
»Das wissen wir bald, Luke. Mach schnell, hier ist ein Strick. Ich steckte ihn ein, als ich losging.«
Shane packt Carter.
Eine Jury, denkt Luke Shane, ich will, daß sie eine Jury bekommen. Es gibt nur ein Urteil, das weiß ich.
Nur ein Urteil für diese Mörder....
Den Strang.
*
Eine Decke hängt vor dem schmalen Fenster des Jails. Die Lampe brennt nur schwach. In ihrem Schein wirkt Coopers Gesicht wie eine Fratze.
»Jetzt reden sie nicht mehr dazwischen!« knurrt Shane von der anderen Zelle aus und kommt zurück. »Jetzt sind sie still, was? Los, weiter, Cooper!«
Cooper steht der Angstschweiß im Gesicht. Er hört nun keine Drohungen von Carter oder Zach mehr aus der Nachbarzelle. Scheu blickt er auf die Knebel im Mund der beiden Männer.
»Es war immer Gray«, würgt Cooper. »Er hat mehrere Freunde. Sie stecken überall. In Aldar Gulch, in Bannack und drüben im Ostcamp. Da sind Skinner Bunton und...«
»Weiter«, sagt Madison leise. »Wer noch? Und was ist mit diesem John Dolan? Warum führt er auch den Namen Coyle, warum? Wie sieht er aus?«
»Ich habe ihn nur zweimal gesehen, Marshal. Weiß nicht, warum er hier von Bill Gray mit Dolan angeredet wird und sich in Bannack Coyle nennt. Marshal, ich sage ja alles, aber halten Sie Wort, bekomme ich eine Chance?«
»Ja«, sagt Madison finster. »Meine Versprechen halte ich immer, du Lump. Du kannst verschwinden, sobald wir sie alle haben. Erzähl schon was über Dolan oder Coyle. Seine Haare, sind sie blond?«
»Nein, dunkel, aber die Arme... Ich hab’s gesehen, als er beim letzten Besuch die Ware auflud. Da habe ich gedacht, wie es doch zugehen kann, daß einer schwarze Haare auf dem Kopf und blonde an den Armen haben kann.«
Madison hat zu den anderen beiden Banditen geblickt. Jetzt fährt er herum.
»Was sagst du da?«
»Es ist wahr!« keucht Cooper. »Sie haben doch nach dem Mann immer wieder gefragt, Madison. Als ich eine Größe nannte, nickten Sie. Etwas stimmt mit Dolan nicht. Er hat blonde Haare an den Armen.«
Was hat Chuck denn, denkt Shane bestürzt, der sieht ja aus, als wolle er losrennen und alles andere vergessen. Dabei wissen wir mehr als jeder andere hier über die Schurken.
Madison hat zwei Schritte zur Tür gemacht, dreht wieder um, packt Cooper an der Schulter.
»Cooper, woher kennt Bill Gray diesen Dolan oder Coyle, weißt du das?«
»Nein, nicht genau. Er sagte bei dem ersten Besuch zu Gray, früher in den Bahncamps wären die Zeiten doch besser gewesen.«
»Mensch – Bahncamps? Wie lange ist Dolan in Bannack, weißt du das vielleicht?«
»Ja, noch keine zwei Monate, glaube ich. Er hat ein paar Freunde mitgebracht, ihm gehört der Mietstall dort. Marshal, er verkauft für Bill Gray die gestohlenen Maultiere und Pferde, das weiß ich genau. Sie haben vorher an der Bahn irgendwelche Geschäfte gemacht.«
Shane starrt zu Madison. Der hat die Lippen zusammengepreßt, die Augen halb geschlossen.
John Coyle, denkt Madison, John Dolan, – John Dayton, oder?
»Cooper, hat er volles Haar?«
»Nein, es ist schon ziemlich licht, Marshal!«
»Ja«, sagt Madison vor sich hin. »Ziemlich licht. Und wie ist er angezogen?«
»Heute? Er trägt einen grauen Anzug und…«
»Ich meine, ob er gut gekleidet ist«, unterbricht ihn Madison heiser. »Hat er einfache Sachen an oder bessere?«
»Oh, gute Anzüge, immer eine Weste und ein weißes Hemd. Was ist denn mit Doyle, Marshal?«
»Nichts«, erwidert Madison. »Fertig, Cooper, das andere kannst du uns nachher erzählen. Wir müssen uns beeilen, Luke, Gray könnte sonst auf die Idee kommen, jemanden nachsehen zu schicken, wo seine drei Burschen bleiben. Cooper, haben wir Gray, kannst du verschwinden.«
Er wirbelt herum, nimmt die Lampe mit und löscht sie vor der Tür aus. Sie treten in das dunkle Office und hasten zum Gewehrschrank.
»Nimm das neue Henry-Gewehr«, sagt Madison knapp. »Und dann hinten raus, Mann. Wie war das mit Bill Sanders, Luke?«
»Ich trank mit ein paar Leuten«, antwortet Shane gepreßt und folgt Madison zur Hintertür. »Ich war wirklich stockbetrunken, Chuck. Jemand brachte mich nach Hause. Als ich aufwachte, war es mir, als hätte der Mann mich nach Sanders gefragt, aber ich wußte es nicht genau. Dann starb Bill, und ich wurde nie den Gedanken los. Erst neulich erfuhr ich, daß ich wirklich geredet hatte. Ich habe Bill umgebracht.«
»Unsinn«, murmelt Chuck. »Warum hätten sie sich nach Bill erkundigen sollen, wenn sie nicht schon einen Verdacht gegen ihn hatten? Sie müssen gemerkt haben, daß er sie beobachtete und etwas über sie wußte. Vielleicht wäre Bill gestorben, ehe er einen von ihnen einsperren konnte. Sie müssen etwas gemerkt haben. Bill wird nicht vorsichtig genug gewesen sein. Raus jetzt!«
Madison schließt ab. Sie hasten über den Hof.
»Schnell!« zischt Chuck. »Luke, Gray wird sich fragen, wo seine Burschen bleiben, ich hab’s im Gefühl. Wenn er sie nicht findet, dann entkommen sie uns. Die Kerle haben bereits die Angst in den Knochen, seitdem die Vigilanten Stinson und die anderen erwischt haben.
Es stimmt sicher, was Cooper gesagt hat: Dieser Coyle ist aus Bannack hergekommen, um zu erfahren, was er tun soll. Sie fürchten alle den Strick. Ich wette, sie haben alles vorbereitet, um sofort verschwinden zu können.«
»Bestimmt«, erwidert Shane schnaufend. »Chuck, tut mir leid wegen Bill Sanders. Ich weiß, du bist jahrelang mit ihm geritten. Tut mir mächtig leid, Chuck.«
Chuck Madison sagt nichts. Sie rennen geduckt durch die nächste Gasse und haben nur noch 300 Yards bis zum Diggercamp. An seinem nördlichen Rand und der Straße nach Bannack liegt Bill Grays schmutziger, kleiner Saloon. Dort gibt es einen Brandy, der einem Mann die Magenwände durchbrennen kann. Aber die Digger haben nicht viel Geld – sie trinken jeden billigen Fusel. Kaum jemand nennt Gray bei seinem Namen. Er heißt bei den Diggern des Camps »Whisky Bill«.
»Wenn Cooper gelogen hat und doch Leute in der dreckigen Kneipe sind, Chuck?«
»Cooper hat nicht gelogen, das hast du doch am Geheul der anderen beiden Strolche gemerkt«, antwortet Chuck knapp.
»Luke, Cooper will seinen Hals retten, der hat die Wahrheit gesagt. Gray hat heute geschlossen. Weiter, weiter, ich hab’s im Gefühl, der Kerl schickt Skinner den anderen drei Halunken nach. Und dann ist es vielleicht schon zu spät. Ich muß sie haben – besonders diesen Coyle, Dolan oder wie der Kerl sich sonst noch nennt.«
»Warum, Chuck – was ist mit dem Mann?«
»Er ist der schlimmste Strolch, von dem ich jemals gehört habe«, gibt Madison zurück. »Wie viele Leute er betrogen und in den Tod getrieben hat, kann man wohl niemals feststellen. Aber ich hoffe, ich erwische ihn rechtzeitig, ehe er noch mehr Unglück stiften kann.«
Sie werfen sich hinter eine Buschgruppe, als ihnen ein paar Reiter entgegenkommen.
»Nicht hoch«, zischelt Madison. »Wenn sie mich erkennen, stellen sie Fragen und halten uns auf. Laß sie vorbei, Luke, runter mit dir! Es kostet Zeit, Mann. Vielleicht ist das Nest schon leer.«
Das ist seine einzige Furcht.
Ist das Nest etwa leer, wenn er hinkommt?
*
»Siehst du, Luke?«
Luke Shane nickt, er macht nun auch das Licht hinter dem einen Fenster aus. Es ist nur ein schmaler Streifen. Das Fenster muß von innen verhängt sein.
Im Hof steht ein Pferd am Balken, und alles ist still.
»Sie sind noch da, Chuck.«
»Ja, Luke.«
Langsam drückt Shane das Tor auf. Madison schiebt sich in den Hof, den Colt in der Faust. Nichts geschieht – keiner schreit los.
Sie schleichen am Stall entlang auf das Haus zu. Dann sind sie an der Hintertür. Madison streckt die Hand aus, probiert die Klinke.
»Offen!« zischelt der Marshal. »Warte, ich gehe voran. Erst die Stiefel runter. Vielleicht können wir sie reden hören, Mann.«
Eine halbe Minute später öffnet Madison die Hintertür. Er blickt in den Flur, sieht den Sack vor dem schmalen Fenster neben der Vordertür. Auch dort alles verhängt. Hier hinten gibt es kein Fenster. Durch die nun offenstehende Tür fällt Mondlicht in den Gang und vermischt sich mit dem matten Strahl der Flurlampe.
»Luke«, flüstert Madison. »Warte, bis ich vorn bin. Hier sind Dielen. Treten zwei Mann auf sie, könnten sie eher knacken, als wenn nur einer im Flur ist. Warte.«
»In Ordnung, Chuck.«
Madison setzt einen Fuß vorsichtig vor den anderen. Langsam nur kommt er voran. Sechs Schritte bis zu der Tür linker Hand. Unter ihr fällt ein schmaler Lichtstreifen durch. Und hinter ihr sind Stimmen.
»He, Cyrus, wo bleiben die verdammten Narren denn? Geh los, Mann. Die Burschen sind wohl verrückt, was?«
Madison hat die Linke hoch, winkt hastig nach hinten. Er preßt sich an die Wand, sieht kurz zu Luke Shane. Der deutet die Bewegung Madisons richtig und schiebt die Tür zu.
Verdammt, denkt Chuck, das geht nicht gut.
Da sind schon die Schritte. Cyrus Skinner kommt in den Flur. Er muß mich sehen.
Blitzschnell preßt sich Madison an die Wand, ist sprungbereit, als sich der Türgriff bewegt.
»Bill, ich denke...«
Der Mann kommt seitlich heraus. Er macht einen halben Schritt in den Flur.
In derselben Sekunde stößt sich Madison ab. Der Marshal fliegt mit einem Riesensatz los und sieht den Mann herumzucken.
»Bill!« brüllt Skinner los. »Bill, da…«
Zu mehr kommt er nicht. Madison ist schon da und wirft sich mit aller Gewalt gegen die Tür. Skinner will sie zuziehen, in den Raum zurück. Die Tür packt ihn und schleudert ihn gegen den rechten Türbalken. Dann kommt der Türflügel zurückgeschossen. Er prallt Madison gegen die linke Seite und bringt den Marshal leicht ins Straucheln.
Gebrüll im Zimmer – ein wilder Fluch ertönt. Madison stürzt auf die Knie, aber als er sich stemmt, sieht er Skinner bereits weghechten. In der Hand Skinners liegt der Revolver. Und Skinners Worte hallen durch das Haus: »Madison ist da!«
Noch im Wegfliegen reißt Skinner die Waffe hoch.
Madison erkennt die Absicht des Banditen. Er läßt sich fallen, hört den brüllenden Knall und das wilde Fauchen der Kugel.
»Licht aus!«
Chuck Madison schießt. Skinner zuckt zusammen, der Bandit prallt gegen den Tisch. Er liegt halb auf der Platte und streckt die Hände aus. Dann kippt der Tisch um. Das ist alles, was Madison noch sieht, denn die Lampe stürzt klirrend vom Tisch zu Boden, ehe sie jemand ergreifen und auslöschen kann.
Sie schießen durch die Tür, denkt Madison, weg hier.
Er rollt sich über die linke Seite ab und hat das berstende Krachen in den Ohren. Kugeln schlagen dort ein, wo er eben noch gelegen hat. Blitze zucken durch die jähe Dunkelheit und erhellen den Flur.
»Luke, nach vorn, schnell nach vorn! Laß sie nicht raus!« schreit Madison, als er hochschnellt und sich mit der Seite gegen die nächste Tür wirft. »Luke, nach vorn, Mann!«
Die Tür splittert, sie reißt aus den Fitschen und dem Schloß. Mit ihr fliegt Madison in den nächsten Raum hinein. Er rollt sich augenblicklich herum und feuert zweimal auf die Tür am anderen Zimmer.
»Raus, raus!« brüllt es im Zimmer schrill. »Die Lampe – die Lampe! Raus hier!«
Klirrendes Glas drüben, das Splittern von Holz.
Luke, denkt Madison, wenn Luke nur schnell genug herumgerannt ist. Dann haben wir sie zwischen uns, die Halunken.
»Nehmt mich mit. Meine Seite – nehmt mich doch... Hilfe, die Flammen, die Flammen!«
Skinner schreit entsetzt, die Stimme gellt bis in den Flur.
Draußen ist das Peitschen von zwei Schüssen. Sie feuern schon vor dem Haus. Einer ist zumindest hinausgekommen.
»Ich habe ihn erwischt!« brüllt es nach diesen Schüssen. »Komm, komm, weg hier!«
Ein abgerissener, schriller Schrei draußen. Und dann der nächste, dumpfe Abschuß, das Klirren einer Scheibe.
»Hölle, zurück!«
Madison steht am Türbalken. Er sieht das Flackern drüben hinter der offenstehenden Tür.
Die Lampe, denkt Chuck grimmig, ist zerplatzt und hat gebrannt. Da drüben ist die Hölle los. Sie werden versuchen, auszubrechen.
Er hebt den Colt und jagt die nächste Kugel in die Tür. Im Zimmer ein gellender Aufschrei, das Gepolter von Stiefeln.
»Chuck, sie stecken fest!«
Der Ruf ist leise, aber er erreicht Madison, ehe die Tür mit einem Knall zufliegt.
»Kommt raus!« sagt Madison scharf in die dumpfen, klatschenden Schläge und das schwere Krachen aus dem anderen Zimmer hinein. »Gray, rauskommen, sonst holen wir dich!«
Er bekommt keine Antwort, er hört Skinner schreien und jenes Klatschen immer wieder.
»Ich will raus, ich will raus! Du löschst es nicht, du schaffst das niemals. Es brennt, laß mich raus!«
»Geh weg, du Narr, geh weg!«
Jetzt husten sie schon, Rauch kriecht unter der Tür durch.
Und im Zimmer nun das Dröhnen, immer verzweifelter und schneller. Es kommt von links. Und Madison ahnt, was sie vorhaben. Irgendwer schlägt gegen die Trennwand zum nächsten Raum und hofft, daß er die Bretter zerschlagen kann.
»Bill – ich – ersticke!«
Also ist Gray noch drüben. Dann muß Coyle versucht haben, nach vorn zu entkommen. Die ersten beiden Schüsse sind aus einem Revolver gefallen. Wahrscheinlich hat Coyle sie abgefeuert. Und er muß Shane getroffen haben. Doch der hat danach noch mit dem Gewehr geschossen und gerufen. Allzu schlimm kann es mit Luke Shane nicht sein.
»Bill, hör auf, du schaffst es nicht!« kreischt Skinner. »Bill – raus – raus. Ich gebe auf, ich gebe auf!«
Immer mehr Rauch im Flur, durch den Madison mit einem wilden Satz fliegt. Es splittert drüben, als Madison durch den Flur hetzt und die linke Seitentür aufreißt. Dann sieht er es. Die Bretter sind geborsten. Schläge dröhnen von der anderen Seite dagegen. Das Loch wird immer größer. Holzsplitter fliegen in die Küche hinein.
Rasende Schläge und das Loch ist groß genug. Keuchend, nach Luft ringend, eine Hand an der Kehle, schiebt sich Bill Gray durch das Loch.
»Narr!« sagt Madison und schlägt blitzschnell zu.
Er packt den Mann an den Schultern und zieht ihn durch das Loch. Dann läßt er ihn fallen. Hustend taucht der nächste Kopf auf, eine Hand langt durch das Loch.
»Komm, Skinner.«
Madison befördert auch Skinner, der gellend vor Schmerz schreit, in die Küche.
Durch das Loch quillt der Rauch. Flammen lodern immer höher. Es knistert und prasselt drüben, bis es plötzlich zu knattern beginnt. Das Feuer hat Skinners Revolver erreicht, die Patronen gehen belfernd hoch.
Keuchend stößt Madison das Küchenfenster auf. Er hebt zuerst Skinner über das Fensterbrett, läßt ihn fallen und fährt in der nächsten Sekunde entsetzt herum.
Im Nebenraum gibt es einen Knall, als sei eine Granate in die Luft geflogen. Greller Feuerschein schießt durch das Loch in der Wand. Die hellrote Flamme packt sogar Gray und versengt ihm die Kleidung. Luftdruck läßt Madison torkelnd neben dem Fenster an die Wand prallen.
Großer Gott, denkt Madison, als mit Zischen und Tosen nebenan ein Feuersturm losbricht, was war das?
Er sieht nur noch Flammen, packt Gray und stößt ihn hastig ins Freie. Dann springt er nach, ist aber kaum draußen, als die nächste Detonation die halbe Wand zerschmettert. Holzteile fliegen wirbelnd aus dem Fenster, Glasscherben regnen.
Pulver, denkt Madison, aber es riecht nicht nach Pulver. Es riecht nach Brandy. Das ist es. Vielleicht jenes hochprozentige Zeug, das Whisky Bill mit anderen Dingen vermischt und aus ihm seinen Fusel zusammengebraut hat. Es muß reiner Alkohol sein, denn die Flammen schlagen nun bereits aus dem Dach. Das Brausen wird immer gewaltiger, bis es zum Sturm wird. Noch ein Knall, der die Hälfte des Daches in die Luft bläst.
Menschen schreien auf der Straße. Sie brüllen durcheinander.
Madison geht keuchend los. Er schleift mit der linken Hand Gray und mit der rechten Skinner hinter sich her. Sie haben keine Waffen mehr, auch kein Messer.
»Madison, wo bist du?«
»Hier«, sagt er heiser. Sie kommen durch das Tor, voran Taxton, der Schmied, mit einem großen Hammer. Dahinter John Kinna, Captain Clark und ein paar andere Männer. »Hallo, warum schreien die Leute so?«
»Der Wind!« brüllt Taxton. »Die Funken fliegen über das Diggercamp, Marshal! Mein Gott, Mann, du lebst? Wir wollten es Shane nicht glauben. Er ist drüben, Marshal.«
»Dolan, was ist mit Dolan?« fragt Madison scharf. »Hier, bindet die beiden Halunken, macht schnell! Was ist mit diesem John Dolan?«
»Der lebt, er hat eine Kugel in der Schulter. Shane bewacht ihn, obwohl er selbst ein Loch in der Hüfte hat. Marshal, wohin mit den Kerlen?«
»Auf die Straße und dann ins Jail!«
Clark wechselt einen Blick mit Kinna, sieht sich nach Brennan um. Der stürmt mit einigen seiner Männer heran.
»Wo habt ihr sie? Ah, Gray, der Satan. Chuck, ist er der Oberteufel? Rede schon, ist er der Oberteufel?«
»Ja, er hat Bill Sanders umgebracht.«
»Was, der Schurke! Ich hab’s doch immer gesagt – Rattengiftmischer taugen nichts!« brüllt Brennan. »Für ein paar Flaschen hat er doch genug verkommene Digger gefunden, die alles für ihn getan haben. He, was schreit ihr denn?«
Leute kommen gerannt.
»Wo ist der Marshal, wo ist Madison?«
»Hier, ihr Burschen. Was wollt ihr von ihm? Ihr habt ihn doch sonst nicht brauchen können – warum denn jetzt? Wird es euch warm unter dem Hintern?« schreit Taxton ihnen entgegen. »Brennen eure Hütten vielleicht?«
Madison steht still, den Colt in der Faust. Vor ihm Skinner und Whisky Bill. Skinner ist schon wieder bei Verstand und kreischt, als sie ihm die Hände binden und ihn auf die Füße zerren.
Dreißig, vierzig Digger stürmen auf Madison zu.
»Marshal, wir brauchen Hilfe zum Löschen. Unsere Hütten brennen, Marshal!«
»Dann löscht«, sagt er eisenhart. »Als ich kam, habe ich euch gesagt, es dürfte nie ein Feuer ausbrechen. Die Hütten stehen dicht bei dicht. Lauft, löscht oder rettet euren Besitz – die Hütten rettet niemand mehr. Lauft, sonst stehlen andere euch alles unter den Händen weg. Paßt auf, daß ihr noch etwas findet, wenn ihr hier noch lange steht und schreit.«
»Er hat recht!« schreit einer los. »Wir Narren sind losgerannt. Und die anderen plündern unsere Hütten leer. Schnell, zurück!«
»Ja, zurück in eure Rattenlöcher!« knirscht Brennan wütend. »Rennt doch, lauft nur! Wie oft habe ich gedacht, dieses ganze, dreimal verfluchte Loch müßte mit Feuer vernichtet werden. Ist es endlich soweit? Chuck, wohin mit Whisky Bill?«
»Ins Jail, Brennan. Aus dem Weg. Leute! He, Taxton, stütz mit deinem Gesellen Skinner, der kann nicht allein gehen.«
»Hölle – Verdammnis!« sagt irgendwo einer der Männer zornig. »Sie sollen noch ins Jail? Warum so viel Arbeit mit diesen Mördern machen?«
»Halt den Mund!« faucht Madison. »Vorwärts, gehen wir!«
Sie weichen aus, aber sie murren. Von hinten kommen Schreie. Und von der Straße her noch mehr Leute.
»He!« brüllt einer. »Shane sagt, sie haben schon drei Halunken im Jail. Habt ihr gehört, da sind noch drei Mörder!«
Im nächsten Augenblick sieht Madison Luke Shane heranhumpeln. Shane benutzt sein Gewehr als Krücke. Er hat den Colt in der linken Faust und geht hinter zwei Männern her, die John Coyle oder John Dolan zwischen sich schleppen. Vor Madison halten sie an. Dolan hängt stöhnend an den Armen der Männer.
»Dolan!« sagt Madison scharf. »Dolan oder Coyle, oder Worres, vielleicht auch John Dayton, erinnere dich an Gladys Shields und Saint Joseph.«
Der Mann hebt entsetzt den Kopf. Er stiert den Marshal an. Sein Stöhnen ist jäh verstummt.
»Du Teufel, woher weißt du das?« stammelt er und stiert Madison wie einen Geist an.
»Der Teufel bist du!« erwidert Madison schneidend. »Wie nahe war dir Ames, als du ihn erschossen hast? Mit dem schwarzen Haar hat er dich nicht erkannt, was? Aber du ihn bestimmt, wie?«
»Hund, das weißt du auch? Ich erwürge dich, ich...«
Sie reißen ihn zurück, als er zu toben beginnt. Madison aber dreht den Kopf herum. Er sieht die Lady kommen. Sie ist bleich wie der Tod und geht wie eine Marionette auf den Mann zu, der ihre Schwester in den Tod getrieben hat und ihren Vater ins Grab brachte.
Nein, denkt Madison, sie hat die Tasche nicht bei sich. Gott sei Dank, sie hat keine Tasche.
Drei Schritte vor dem Teufel bleibt sie stehen und schwankt, als wolle sie zusammenbrechen.
»Moira«, sagt Madison stockheiser und tritt auf sie zu. »Moira, geh fort, er ist keinen Blick wert. Geh besser fort, Moira!«
»Das ist er – das? Dieses Ungeheuer! Du Teufel, du hast meine Schwester umgebracht, du Teufel!«
Sie schlägt die Hände vor das Gesicht und taumelt zur Seite, als Madison den Männern winkt.
»Bringt ihn weg, den Kerl!« knurrt Madison grimmig. »Fort mit ihm!«
»Habt ihr gehört, habt ihr das gehört?« fragt jemand. »Er hat eine Frau umgebracht, der Schuft! Er hat eine Frau getötet, das Ungeheuer!«
»Weiter, weiter!« zischt Madison und stößt die beiden Männer an, die den Halunken stützen. »Macht schnell!«
»Ein Frauenmörder!« heult es links. »Er hat Frauen ermordet, hört ihr?«
Sie drängen heran und heben die Fäuste.
Großer Gott, denkt Chuck entsetzt, das geht nicht gut. Da sind ja auch Ladies aus denTanzhallen! Und wenn die losgelassen sind...
»Wo ist er…, da? Ah, er sieht schon wie ein Würger aus! Wie viele hat er umgebracht, was sagt ihr?«
»Man weiß nicht, wie viele er ermordet hat. Seht doch seine Hände an, seht nur diese Mörderhände!«
»Geht aus dem Weg!« brüllt Madison dazwischen. »Fort da – weg mit euch!«
»Chuck!« keucht Shane an seiner Seite. »Das gibt ein Unglück. Schieß über ihre Köpfe, Chuck!«
»Wenn ich das tue, ist es gleich vorbei«, erwidert Madison heiser. »Luke, wir müssen es versuchen, ohne zu schießen. Aus dem Weg da vorn.«
Madison hat plötzlich das Frieren im Nacken. Die Menge wächst schnell an, Frauen kreischen, die Männer fluchen, Püffe und Stöße treffen die Gefangenen.
Wenn jetzt einer anfängt, denkt Madison beklommen, dann ist es aus.
Und dann ist der Schrei da, nur ein einzelner, gellender und durchdringender Schrei.
»Hängt sie doch!«
Blitzschnell nimmt Madison den Colt hoch und drückt ab.
»Aus dem Weg, ich schieße!«
»Hängt sie, hängt sie!«
»Chuck!«
Shane schreit, Shane ist weg, verschwunden, als sie andrängen.
»Zurück!« brüllt Madison und feuert über ihre Köpfe. »Aus dem Weg! Ich halte tiefer!«
Zu spät, denkt er, als er sieht, wie die beiden Männer angerempelt werden und Coyle zu Boden stürzt – aus, alles aus!
Von hinten kommt der Druck der Menschenmauer. Das Brüllen steigert sich zum hysterischen, schrillen Heulen. Plötzlich rennt jemand Madison in den Rücken. Er sieht Hände nach seinem Arm schnappen. Die Worte gellen in seinen Ohren: »Nehmt ihm den Revolver weg!«
»Das Gesetz!« ruft Madison heiser. »Leute, das Gesetz…«
Seine Stimme geht unter. An seinem Arm hängen sie wie Kletten und winden ihm den Colt aus den Fingern. Irgend etwas umklammert seine Beine. Der erste Hieb trifft seine noch nicht verheilte Wunde. Ein Blitz vor seinen Augen, Schmerz zuckt durch seinen Kopf.
»Luke!« sagt er kaum hörbar. »Luke – wo…«
Und dann sieht er Stiefel, nichts als tausend Stiefel. Sie trampeln auf ihn zu, kommen immer näher. Ein Tosen in der Luft wie bei einem Hurrican.
Das ist das letzte Bild für Marshal Chuck Madison.
*
»Chuck!«
Schmerzen sind da – und Wasser hat er auch gespürt.
»Chuck, ganz ruhig, nur ruhig.«
Und da fällt es ihm ein – das gellende Geschrei. Tausend aufgerissene Mäuler, hysterische Schreie, Augen, die wie irre glänzen.
»Ruhig?«
Es ist ruhig, es ist sogar totenstill. Ihre Stimme ist ganz klar und wird durch keine anderen Geräusche gestört.
Chuck Madison blinzelt, will hoch. Da setzt der Schmerz wieder ein. Er stöhnt einmal, kann nur mühsam den Kopf wenden und sieht die Gehsteigkante neben sich.
»Chuck«, sagt Moira über ihm und preßt ein nasses Tuch auf seine Stirn. »Chuck, bleib liegen. Sie sind alle fort.«
»Was?«
Plötzlich setzt seine volle Erinnerung ein. Ganz langsam hebt er den Kopf. Der Schmerz ist wieder da, doch diesmal kämpft er gegen ihn an.
»Ich will sitzen!« keucht er. »Wo sind sie hin? Und die Gefangenen?«
»Chuck, laß doch, bleib liegen.«
»Nein!« sagt er so verbohrt wie immer, wenn er etwas will und bereit ist, es mit aller Gewalt durchzusetzen. »Nein, ich will stehen!«
»Chuck, du fällst um. Deine Wunde hat wieder geblutet, hör doch.«
»Soll sie bluten. Ich will stehen!«
»Dann helfe ich dir.«
Um ihn dreht sich alles, als er auf die Knie kommt.
Verschwommen macht er den Haltebalken aus. Er klammert sich fest und zieht sich an ihm hoch. Dann lehnt er an ihm und knirscht mit den Zähnen. Schweiß bricht ihm aus, aber sein Blick wird klarer, bis er den Mann rechts sieht.
Der Mann kauert an der Wand und schüttelt müde den Kopf.
»Chuck, sie haben mich umgerannt, ich konnte nichts tun«, sagt Luke Shane gepreßt. »Es ging alles viel zu schnell. Sie rannten zum Office. Und sie hatten deine Schlüssel. Das sah ich nicht, aber sie holten die drei Mann heraus, also hatten sie dir die Schlüssel abgenommen. Und dann brachten sie sie weg, drüben hin, links.«
Feuerschein erhellt dort den Himmel. Madison blickt hin. Er sieht den Rauch, die Flammen. Bis an den Bach hinunter ist nichts als ein einziges Feuermeer zu sehen. Rechts aber leuchten Hunderte von Laternen im Tal.
Dort, das weiß Madison, steht ein einzelner Baum. Und die Lichter umgeben ihn wie ein Kranz aus tausend Kerzen.
»Es ist schon vorbei«, sagt Shane. »Chuck, sie wären ja doch alle – ich meine…«
»Nein«, murmelt Madison. »Nicht so. Du kannst denken, daß eine Verhandlung das gleiche Resultat gehabt hätte, aber das dort ist nicht richtig. Es ist ein Unterschied, begreifst du, Luke?«
»Tot ist tot – oder?«
»Sicher, das schon, aber wie, Luke, das ist es. Es ist gegen das Gesetz und unsere Ordnung. Man kann nicht selber Richter sein, kein Mensch hat das Recht dazu. Was ein Richter sagt, das ist gültig und Gesetz. Man kann nicht hingehen und dem Gesetz die Verantwortung abnehmen.«
Er kann kaum noch stehen.
»Luke, ich habe mir geschworen, jeden Gefangenen dem Gesetz zu übergeben. Ich war auch immer stark genug, es zu tun. Jetzt weiß ich, daß ich immer Furcht vor einem Augenblick wie jenem vorhin haben werde. Ich würde das nie mehr zulassen können, ich würde auf die Leute schießen, wenn sie brüllen. Und danach könnte ich mich selbst nicht mehr im Spiegel sehen. Vielleicht würde ich auch versagen, wenn mich noch mal eine heulende Menge umgeben würde. Ich habe oft über diese Dinge nachgedacht und nie gewußt, was ich tun würde. Jetzt weiß ich es!«
»Chuck?« fragt Luke Shane entsetzt. »Was machst du denn?«
»Er war immer sauber«, sagt Chuck Madison bitter. »Ich war stolz darauf. Ich hätte sterben müssen, um die Gefangenen zu schützen, aber ich lebe. Und darum habe ich meine Pflicht dem Gesetz gegenüber nicht erfüllt, ich bin ein zu schwacher Mann gewesen, Luke. Von heute an trage ich den Stern nie wieder. Ein Mann muß wissen, wann er vor sich selbst bestehen kann – wie lange. Das ist alles, Luke. Verstehst du mich?«
»Nein, Chuck, du konntest doch nichts tun.«
»Meinst du?« fragt Madison.
»Ich meine, doch. Aber ich konnte nicht auf die aufgeputschten Menschen schießen. Luke, wer hat dich verbunden?«
»Der Doc. Er ist dann hingerannt zu den anderen, er sagte, man würde ihn sicher brauchen.«
»Sicher!«
Chuck Madison stößt sich ab. Irgendwie muß er doch noch von irgendwelchen Leuten wie Luke Shane vor das Office gebracht worden sein.
»Chuck, soll ich dich stützen?«
»No, Moira, den Weg mache ich allein.«
Er kommt ins Office, legt den Stern auf den Tisch und setzt sich auf den Stuhl. Dann sieht er hoch, in Moira Shields’ Augen.
»Denver«, murmelt er. »Du kennst die Stadt nicht, aber ich habe dir von ihr erzählt. Du kannst dich entscheiden, ob du mit mir kommen willst. Man soll nie in die Vergangenheit zurückgehen wollen. Du siehst so gelöst aus, wenn du lächelst. Und ich will, daß du niemals mehr traurig sein mußt. Überleg es dir, Moira. Du hast drei Tage Zeit. Danach verlasse ich dieses Land für immer.«
Sie lehnt an der Wand, die Hände vor der Brust verschränkt, das volle rötliche Haar zerzaust.
»Glaubst du, ich muß drei Tage überlegen?«
»Ich habe sie nie gebraucht, Moira.«
»Nun, ich auch nicht, Chuck. Fahren wir in drei Tagen.«
Sie kommt auf ihn zu und legt ihm die Hände auf die Schultern.
So bleibt sie stehen, den Blick auf ihn gerichtet.
In drei Tagen, denkt sie, wird die Sonne scheinen. Dann gibt es keine Schatten mehr. Und auch keine Angst um diesen Mann. Ich könnte ohne ihn nicht mehr leben. Ist er bei mir, bin ich ganz ruhig. Die Furcht ist dann verschwunden, daß man ihm, wenn er allein seinen Weg geht, einen Hinterhalt legen könnte.
Von nun an gehen wir alle Wege zusammen.
– E N D E –