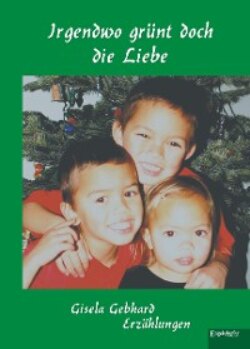Читать книгу Irgendwo grünt doch die Liebe - Gisela Gebhard - Страница 6
Das Bildnis der Schönen
ОглавлениеBei Halle, einst Halla, ließ Karl der Große im Jahre 809 eine Burg errichten. Die sollte an der Saale, nahe dem Einfluss der Elster, den Weg der alten Salzstraße sichern, die weit vom Südosten her kommend bis in den Norden führte. Halle an der Saale, wichtiger Übergang der alten Salzstraße, besaß und besitzt auch heute noch eine eigene Salzquelle, die genutzt wird.
Otto der Große beurkundete im Jahre 961 das Stadtrecht für Halle und führte die Stadt bald darauf in das neu gegründete Erzbistum Magdeburg ein. 1281 wurde die Stadt Mitglied der Hanse.
Von der Burg Karls des Großen ist heute kein Stein mehr zu finden. In den sich oft verzweigenden Armen der Saale ist sie wohl untergegangen. Eine neue, Oberburg genannte Festung, erwuchs Anfang des 12. Jahrhunderts am Rande der nahegelegenen Siedlung Giebichenstein. Sie bestand aus einem Wohnturm, einer Kapelle und mehreren Wirtschaftsgebäuden. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erbaute man die Unterburg dazu. Da gab es dann ein großes Torhaus, weitere Wirtschaftsgebäude, ein Kornhaus und eine Vorburg, alles umgeben von einer Ringmauer und einem Burggraben.
Ein Brand vernichtete während des Dreißigjährigen Krieges weitgehend sowohl Ober- wie Unterburg. Die Reste der Oberburg, die noch heute über der Saale thronen, heißen seit dem letzten Jahrhundert nun Burg Giebichenstein, wurden renoviert und ausgebaut. Seit Jahrzehnten lehrt und werkt nun darin die Kunsthochschule von Halle.
Dies ist die lange Einleitung einer Geschichte. Die erzählt von Andreas Rufer, 27 Jahre alt, dunkelblond, schlank, 1,82 Meter groß, verhältnismäßig schmales Gesicht mit blauen Augen. Der junge Mann hat Geschichte, Kunst und Philosophie studiert. Jetzt arbeitet er als Assistent am historischen Institut, will da auch promovieren und später an der Hochschule bleiben. Er wohnt in der Innenstadt. Zur Arbeit führt ihn sein Weg durch Gassen der Altstadt zum Institut nahe dem Dom. Früh muss er sich eilen. Am späten Nachmittag dagegen kann er sich, falls keine Verabredung ansteht, Zeit nehmen.
Heute hat er die Zeit. Mit seiner Freundin gab es einen leichten Disput. Sie wollte in die Disko. Ihn interessierte die nicht. Sie deshalb schnippisch: „Dann gehe ich eben allein!“
„Tu das“, war seine Antwort und damit trennten sie sich.
Er schlendert zum Antiquariat. Dort hat er schon oft gekauft und beim Stöbern erstaunliche Bücher gefunden. Am Morgen prangte im leeren Schaufenster nur ein Anschlag, der NEUZUGÄNGE anpries. Also hin!
Jetzt zeigt das Schaufenster Alt-Halle in kolorierten Stadtplänen, Radierungen, Kupferstichen und Skizzen vom Roten Turm und der Burg Giebichenstein. Zwischen zwei Zeichnungen von Ritterspielen überrascht den jungen Mann das Portrait einer jungen Frau. Haartracht und Ansatz des Kleides weisen ins Mittelalter. Ihr Blick, der sich direkt auf Andreas richtet, scheint aber zu leben. Das Bild im dunklen Holzrahmen steht fast im Schatten der anderen Bilder, hat die Größe eines DIN-A5-Blattes und beherrscht plötzlich das ganze Schaufenster. Andreas ist fasziniert. Die junge Frau scheint ihm zuzulächeln. Ganz leise sitzt dieses Lächeln in ihren Mundwinkeln. Es war vorhin nicht da! Oder doch? Dieses Lächeln scheint mit ihren Augen zu leben. Die Lider senken sich leicht, als läge ein Schatten darauf. Dann blicken sie wieder klar und direkt zu Andreas hin. Hat eines ihrer Lider gezuckt. Will sie ein Zeichen geben?
Andreas schüttelt den Kopf, schließt die Augen, öffnet sie wieder, meint, er habe geträumt. Als er aufschaut, lächelt die Schöne noch – aber anders. Die untere Lippe, leicht vorgezogen, erscheint voller. Dieses Lächeln fordert ihn auf zurück zu lächeln. Er tut es – und findet sich albern. Hier stimmt mit ihm etwas nicht! Weder Alkohol noch Drogen hat er konsumiert, ist völlig nüchtern und kommuniziert mit einem kleinen Frauenbild im Schaufenster des Antiquariats. Das muss ein Fixierbild sein, wo mehrere durchsichtige Lagen übereinander beim Verändern des Sichtwinkels eine Bewegung vortäuschen.
„Ich muss reingehen und fragen“, denkt er, wendet sich nicht mehr hin sondern den beiden Stufen zu, die zur Tür führen. Als er die Klinke der Tür drückt, ist das Bild außer Sicht. Andreas tritt ein. Im Hintergrund kramen schon zwei Bekannte in Bücherstößen.
Er wird freundlich von der Inhaberin empfangen.
„Sie haben unsere Auslagen studiert“, meint sie. „Wir konnten aus einem Nachlass sehr schöne Stücke von Alt-Halle erwerben. Mein Mann und ich haben heute mit besonderer Freude dekoriert. Sie werden aber auch hier noch außer den Büchern alte Stiche und Karten finden.“
Sie deutet auf einen seitlichen Tisch.
Andreas Rufer findet sehr gute Radierungen alter Stadtansichten, Kupferstiche von Fachwerkbauten, Landsknechte in Rüstung. Eine weitere Frau erscheint zwischen den Bildern nicht.
„Haben Sie noch ein Bild von der Dame im Schaufenster?“, fragt er deshalb.
Frau Landau schüttelt bedauernd den Kopf.
„Leider nicht. Das Bild gehört auch nicht zu der Serie. Wir haben es einzeln erworben.“
„Von wem?“
Sie lacht: „Das Bild hat ein Saale-Schiffer beim Aufräumen in einem alten Verschlag seines Vaters gefunden. Es war schmutzig und der Spannrahmen der Leinwand verzogen. Er wollte es wegwerfen, brachte das aber nicht fertig. Deshalb hat er’s zu uns gebracht. Er sagte: Bitte nehmen Sie es. Das ist ein komisches Bild. Wenn ich es beiseite schaffe, kommt es irgendwie wieder zurück. Ich sehe nicht, wie es wandert, aber plötzlich ist es wieder da. Ich schenke es Ihnen. Vielleicht hat es ein Eigenleben und will restauriert werden. Wir haben gelacht. Dann haben wir das Bild gesäubert und entdeckt, dass es ein sehr gutes Ölgemälde ist. Wir haben es wieder gespannt und in den Rahmen gegeben. Wer es gemalt hat, wissen wir nicht. Auf der rückwärtigen Leinwand entzifferten wir ›Anna von G.‹. Weil wir G. für eine Abkürzung von Giebichenstein halten, haben wir das Bild mit ins Schaufenster zu Alt-Halle gestellt. Obwohl es im Hintergrund steht, gibt es dem alten Halle ein besonderes Licht.“
„Das stimmt. So ist es mir auch aufgefallen. – Ist es verkäuflich?“, fragt Andreas nach kurzem Bedenken.
„Ja! Wir werden es gerne verkaufen, möchten es aber noch eine Weile im Schaufenster lassen. Es gehört zur Dekoration.“
„Das kann ich verstehen. Darf ich es mal in die Hand nehmen?“
Frau Landau nickt, entriegelt die Rückwand des Schaufensters und reicht Andreas das Bild. Er nimmt es entgegen, fühlt, dass es schwerer in der Hand liegt, als er gedacht hat, greift noch mit der anderen Hand zu und hält in der Länge seiner Arme das Bild vor sich hin. Er sieht in das ebenmäßige Gesicht einer leicht lächelnden jungen Frau mit sehr schönen Augen. Die treffen genau seinen Blick ohne sich zu verändern. Andreas muss sich draußen geirrt haben. Als sich Frau Landau den anderen Kunden zuwendet, küsst er, wie unter einem Zwang, das Bild auf den Mund. Er fühlt einen Gegendruck, zuckt zurück, erkennt aber keine Veränderung der Gesichtszüge.
„Ich habe einen Hau“, denkt Andreas, „stehe heute abseits von mir. Die Freundin fehlt. Aber deshalb knutsche ich doch kein Bild. Wenn es Ilses Foto wäre, könnte ich’s noch verstehen. Aber das Bild einer fremden Frau, die längst tot ist! Idiotisch!“
Er öffnet die Rückwand des Schaufensters, stellt das Bild wieder zurück und besieht sich auf dem seitlichen Tisch die Kupferstiche und Radierungen. Ein Bild der Ruine hoch über der Saale, jetzt Giebichenstein genannt, wählt er aus, überlegt, öffnet die Rückwand des Schaufensters wieder und legt das Bildnis der Frau neben das von Giebichenstein. Die Bilder harmonieren, müssten auf die leere Wand über seinem Schreibtisch gut passen. Frau Landau beobachtet ihn. Sie findet die Kombination der Bilder sehr gut.
„165 Euro kosten beide Bilder zusammen“, sagt sie. „In dieser Zusammenstellung könnte ich auf 140 Euro herabgehen.
Andreas stellt die Bilder im passenden Abstand vor die helle Wand hinter dem Tisch.
„Okay“, antwortet er, „gemacht! Ich nehme sie beide. Wann darf ich die Dame dann abholen?“
„Am Ende der nächsten Woche. Für den Montag dekorieren wir dann anschließend wieder neu.“
Andreas Rufer zahlt und erhält seine Quittung. Während er das Bild von Giebichenstein in seiner Tasche verstaut, entnimmt Frau Landau der Kasse ein Kärtchen mit der Aufschrift ›verkauft‹ und platziert es mit ›Anna von G.‹ nun ins Schaufenster.
„Sie werden sehr viel Freude an diesem Kauf haben“, sagt sie zum Abschied.
„Das weiß ich“, versichert Andreas.
Er winkt ihr zum Abschied, geht durch die offene Tür nach draußen und die Stufen zur Straße hinab. Im Hintergrund des Schaufensters grüßt ihn Anna von G. mit kurzem Wimpernschlag so leicht und schnell, dass er meint, der Schatten eines vorbeifliegenden Vogels habe ihn irritiert. So muss es gewesen sein.
Zu Hause freut er sich über seinen Kauf. Er packt seine Tasche aus, stellt den leicht aquarell-getönten Kupferstich auf den Schreibtisch, holt Hammer und Nägel, misst ab und platziert das Bild jetzt so an die Wand, wie es im Abstand zu Anna später auch bleiben soll. Die Bewegungen in deren Bild irritieren. Er will sie als Einbildung abtun. Aber er hat sie gesehen – und sogar ihren Mund gefühlt!
„Ich muss besser schlafen“, denkt er, „bin übermüdet. Die Recherchen für die Promotion und die Arbeit als Assistent, beides zusammen, belasten doch sehr. In dieser Nacht schläft er traumlos und gut.
Wenn er früh ins Institut eilt, schaut er bewusst nicht ins Schaufenster des Antiquariats. Auf dem Rückweg bleibt er davor stehen. Da grüßt ihn ein Wimpernschlag oder die Andeutung eines Lächelns. Einmal steht ein Kollege neben ihm. Andreas macht den auf die Bewegung der Schönen aufmerksam. Sie schürzt jetzt leise die Lippen. Der Kollege bemerkt nichts, findet das Antlitz reizvoll und meint, Andreas sei wohl etwas Staub ins Auge geflogen. Später versucht es Andreas noch einmal mit einer Bekannten. Die lacht ihn nur aus. Das macht ihm den Anblick noch mysteriöser. Früh geht er jetzt winkend vorbei. Am Nachmittag bleibt er stehen und schürzt seine Lippen. Sie antwortet darauf mit der gleichen Bewegung. Manchmal bewegt sie die Augen.
Am nächsten Wochenende holt er sein Zauberbild ab, lässt es sich vorsichtig einpacken und packt es zu Hause ganz vorsichtig wieder aus. Er küsst den Mund seiner Schönen, fühlt aber keinen erwidernden Druck ihrer Lippen.
„Alles ein Irrtum“, denkt er und hängt das Bild über den Schreibtisch.
Zum Abendessen brutzelt er knusprige Bratkartoffeln, schlägt sich ein Ei drüber und isst mit Genuss. Anschließend wäscht er ab, räumt das Geschirr ein und setzt sich an den Schreibtisch. Seine Freundin ist übers verlängerte Wochenende zu ihren Eltern gefahren. Er kann also in Ruhe arbeiten. Seine Habilitation soll das Mittelalter von Halle und Umgebung besonders erfassen. Die Halloren genannten Salzwirker sind seit dem 15. Jahrhundert in einer anerkannten Bruderschaft hier vereinigt. Längst steht ihre Geschichte in alten Büchern verzeichnet. Die Übersetzung aus Latein und Mittelhochdeutsch liegt für Interessenten im Lesesaal des Rathauses aus.
Andreas soll die Zeit zwischen den Jahren 1000 und 1200 durchforsten, das Leben von Freien, Unfreien, Bauern und solchen mit Stadtrecht in alten Urkunden suchen, zusammenfügen und lebendig darstellen. Das alte Latein der Mönche und Stadtschreiber ist oft schwer zu verstehen, Umschreibungen und fremde Begriffe tauchen da auf. Auch Fantasie ist gefragt. Weil die Gegend hier früh lutherisch wurde und der Dreißigjährige Krieg hin und her durch das Land gezogen ist, sind alte Klosterbücher und Chroniken kaum noch vorhanden. Andreas hat deshalb weiter nördlich und südlich der alten Salzstraße geforscht da, wo er meinte, das könne interessant sein, hat er Teile von Seiten fotografiert. Die liegen ihm jetzt in Vergrößerung vor. Er sortiert, nimmt seine Schreibmaschine und beginnt mit der ersten Übersetzung.
Als er aufblickt, erkennt er, dass Anna von G. ihm interessiert zuschaut. „Du müsstest mir helfen können. Das ist deine Zeit“, spricht er grinsend hoch zu dem Bild.
In ihrem Antlitz erscheint eine leichte Bewegung. Kann das sein? Weil er’s für ein Spiel hält, spricht er weiter: „Reizend von dir, aber lesen kannst du ja nicht, geschweige Latein.“
Er starrt weiter auf Anna, schaut sehr bewusst hin und ist sich jetzt sicher, dass sich ihr Mund zu einem spöttischen Lächeln verändert.
„Du bist ein Wunder“, flüstert er. „Du bist mein Wunder! Verstehst du Latein?“
Das Lächeln verändert sich wieder, wird zu einem wissenden Lächeln während sich ihre Augen im Blick auf seine Schreibarbeit senken. Er empfindet den Blick nun als Aufforderung, fragt deshalb erstaunend: „Willst du mir helfen?“
Die Andeutung einer Zustimmung antwortet. Dann senkt sich ihr Blick wie zu einem Befehl. Andreas nimmt diesen Befehl an und arbeitet weiter. Die Übersetzung geht jetzt rascher voran als bisher. Schon während des Lesens kann er den deutschen Text in die Maschine tippen. Die Freude wächst mit der Arbeit. Erst kurz nach Mitternacht wird er müde. Da ist sehr vieles geschafft. Er liest, was er schrieb und ist erstaunt über die Formulierungen. Die entsprechen der damaligen Zeit und sind doch ins Heute perfekt übersetzt. Er blickt zum Bild wieder auf, erkennt Müdigkeit in den schönen Augen, bedankt sich für ihre Hilfe und wünscht ›eine gute Nacht‹.
Andreas schläft heute schnell ein. Als der Tiefschlaf vorbei ist, träumt er von Anna. Die wandert in langem Gewand durch die Oberburg, rafft ihren Rock bei den zwei Stufen, die sie in die Kapelle führen. Da betet sie, beichtet, lernt aber auch Latein in einem kleinen Nebenraum, in dem der Kaplan sonst allein seine Bibel studiert.
„Ich helfe dir nur, wenn du schweigst“, sagt sie dann direkt zu Andreas Beschwörend drückt sie eine Hand auf den Mund und verschwindet.
Das Läuten des Telefons reißt ihn aus dem Schlaf. Andreas tastet zum Nachttisch, greift daneben, hat es nach weiterem Tasten endlich am Ohr. Seine Freundin wünscht ihm einen guten Morgen. Die Uhr zeigt bereit kurz nach 10. Ilse wähnte ihn längst bei der Arbeit.
„Du wolltest doch fleißig sein. Ist wohl nix“, meint sie kichernd.
„Doch“, sagt er drauf, „ich habe bis tief nach Mitternacht gesammelte Texte übersetzt und bin weit gekommen.“
„Lob, Lob“, antwortet sie und erzählt, dass sie noch eine Woche zu Hause bleiben muss, weil es ihrer Oma sehr schlecht geht und ihre Mutter die Pflege kaum schafft. Das tut ihm sehr leid. Er verspricht ihr, die Zeit allein gut zu nützen, damit sie bei ihrer Rückkehr dann umso mehr voneinander haben.
„Okay, das ist gut. Ich werde wieder anrufen. Küsschen!“ Dann legt Ilse auf.
Andreas erhebt sich, eilt ins Bad, wäscht sich, zieht sich an und grüßt, als er zur Küche eilt, winkend das Bildnis. Ihre Antwort könnte ein Lächeln sein. Sicher ist Andreas sich nicht.
Gut gestärkt setzt er sich wieder zum Schreibtisch, blickt zu ihr auf und sagt: „Ich habe deine Botschaft verstanden. Ich werde schweigen. Sei dessen gewiss.“
Jetzt lächelt sie deutlich und senkt den Blick wieder nach unten wie einen Befehl. Die Arbeit geht weiter im gleichen Tempo wie gestern. Jetzt weiß er, dass Anna Latein wie ihre Muttersprache beherrscht. Für eine Dame des Mittelalters kaum vorstellbar. Selbst viele Fürsten konnten nicht lesen und schreiben, schickten ihre Söhne zu Mönchen, die ihnen das beibrachten.
Gegen 14 Uhr Pause. Der Befehl von oben drückt deutlich auf seine Hände. Die lässt er sinken, schaut Anna an und bedankt sich. Ihr Blick wirkt verschleiert.
„Wir brauchen eine Ruhepause“, sagt er zu ihr. „Ich habe eine Dose mit Spargelsuppe im Schrank. Die Suppe werde ich zu einem Toastbrot genießen, mich auch etwas ausruhen und dann zusammenstellen, was ich aus den Übersetzungen gebrauchen kann.
Andreas setzt sich dann zum Ordnen seiner Übersetzungen auf die Couch, streicht an, was ihm wirklich ganz neu erscheint und nummeriert diese Angaben. Als er sie zusammenfügend aufschreiben will, wird sein Blick wie zwanghaft nach oben gelenkt. Annas jetzt wache Augen blicken nach links, wo die noch nicht übersetzten lateinischen Auszüge liegen. Also geht die Arbeit jetzt weiter. Am Abend sind alle Übersetzungen in erstaunlichem Tempo geschafft. Gut, dass Andreas die vorher geordneten Auszüge noch nicht zusammengeschrieben hat. Einiges Neue passt jetzt dazwischen.
„Ich danke dir, Anna!“, ruft er und wirft einen Handkuss zum Bild. „Warum tust du das alles für mich?“
Ihr Lächeln verstärkt sich ein wenig und ihre Augen erscheinen feucht. Dann schließt sie die wie zum Schlafen und öffnet sie wieder mit einem andeutenden Kopfnicken. Nur dem Schlafenden wird sie antworten. Er lächelt zurück. Jetzt möchte er müde sein, ist aber nach allem mehr angeregt als erschöpft. Er isst in der Küche etwas, trinkt Apfelsaft und verspürt Lust auf einen Spaziergang.
Der Abend ist kühl und mild. Andreas wandert durch die angrenzen Straßen der Saale zu, genießt die Aussicht über den Fluss, geht die steilen Stufen nach unten und wandert am Ufer entlang. Als jenseits der Brücke auf dem Felsen Giebichenstein in Sicht kommt, bleibt er stehen. Die restaurierten Reste der Oberburg sieht er jetzt als Zeugnis eines Schicksals, das ihm immer noch rätselhaft ist, aber längst menschliche Nähe annimmt.
Andreas steht da, bis die ersten Sterne erscheinen. Dann eilt er zurück, duscht sich und geht zu Bett. Vieles geht ihm durch den Kopf, bis ihn endlich der Schlaf einholt – und nach dem ersten Tiefschlaf der Traum, in dem das Bildnis der Frau wieder Wirklichkeit wird.
Ich bin Anna aus Giebichenstein, nicht von G., bin die älteste Tochter eines verarmten Landedelmannes aus der Siedlung Giebichenstein, nahe der Stadt Halle gelegen. Mein Vater hatte fünf Töchter, bis ihm seine Frau endlich den Sohn gebar. Ich wollte als Kind schon ins Kloster, aber da nahm man mich nicht, weil ich keine Mitgift mitbringen konnte. Da sah mich dreizehnjährig der Herr von der Oberburg, Ritter Robert der Alte. Der war eben zum dritten Mal kinderlos Witwer geworden. Er kaufte mich meinem Vater für gutes Geld ab, schenkte ihm noch ein Stück Land dazu und nahm mich zur Frau. Ich sehe noch die Tränen meiner Mutter, als er mich holte. Er war ein elender Bock von Ende der vierzig, hatte nur ein Auge und einen mächtigen Bauch. Ich ekelte mich entsetzlich vor ihm, durfte das aber nicht zeigen, weil es ja nun meine eheliche Pflicht war, ihm ständig zu Willen zu sein – und er wollte es ständig. Er schlug mich sogar, wenn ich einmal zurückzuckte. Nach fast zwei Jahren der Qual gelang es mir endlich, meinen Körper gefühllos zu machen indem ich intensiv betete, wenn er seine Lust an mir ausließ. Die täglichen Morgenandachten in der Kapelle spendeten Trost. Ich floh in den Beichtstuhl, wollte wissen, wie sündig meine Abwehr gegen diesen Bock von Ehemann war. Der Priester nahm mich an, wie ich sprach, führte mich in die Heilige Schrift ein, zeigte mir andere Pflichten und zusätzlich noch, selber vergeben zu lernen.
So verlor ich meine kindliche Angst und wurde zur Frau, die auch Nöte anderer erkannte und zu der Hilfe, die in meinen bescheidenen Kräften lag, immer bereit war. Dem Vogt, der das Gesinde beherrschte, wies ich nach, dass er zum eigenen Vorteil wirtschaftete, Lügen verbreite, sich selber voll fraß und den anderen oft weniger als das Notwendigste gönnte. Der Alte warf ihn raus. Ich erhielt die Schlüssel für Küche und Speicher. Der erfahrenste Knecht teilte nun die Arbeiten vom Gesinde ein. Die Leute dankten es mir.
Der Alte kümmerte sich wenig um meine Arbeit. Ich ordnete an, überprüfte und sorgte mich um die Ernährung, wie ich es bei meiner Mutter gelernt hatte. Die Burg verließ ich nie, durfte sie ja nur zusammen mit meinem Herrn verlassen. Diese Begleitung wollte ich nicht. So drängte es mich auch nicht, obwohl ich an manchem Tag gern meine Mutter gesehen hätte. Nur zufällig erfuhr ich von ihrem Tod, weinte und betete zehn Ave-Maria für sie.
Der Alte ritt gerne zur Jagd, brauchte ein stämmiges Pferd und passende Helfer, hatte dann immer den Knappen und einige Knechte dabei. Knappe Udo von Remmerswehr trug immer die Waffen des Alten, lebte bereits drei Jahre an seiner Seite und sollte innerhalb der nächsten zwei Jahre nach entsprechender Prüfung vom Sachsenherzog den Ritterschlag erhalten. Mit ihm wäre ich gerne geritten. Ihm gehörte meine heimliche Liebe. Nur einmal hatte er mir im Vorübergehen die Hand küssen können. Nie wieder hatte sich diese Gelegenheit ergeben. Sie musste uns beiden außer den Blicken genügen. Ich träumte von ihm und sehnte mich in seine Arme. Du siehst ihm ähnlich, Andreas. Deshalb helfe ich dir und hoffe, dass du bald meine Geschichte aufschreiben kannst. Dann könnte mein Geist endlich ruhen. Bitte hilf mir nach Hause zu kommen.
Das Mittelalter war auch für den Adel eine schreckliche Zeit. Fehden zwischen den Rittern, hohe kalte Räume, Dreck, Seuchen, verschwitzte Prunkgewänder und immer wieder Kreuzzüge, bei denen viele schon unterwegs starben und nur wenige zurückkamen. Heilig waren diese Kreuzzüge auch nicht. Viel unschuldiges Blut floss für eine absurde Idee.
Als Kaiser Rotbart zu seinem Zug ins Heilige Land rief, schickte der Alte an seiner Stelle den Knappen mit einer Gefolgschaft. Ich erfuhr einen Tag später durch meinen Beichtvater davon. Durch ihn hatte mir Udo noch einen Gruß schicken können. Der Alte hatte es ihm verboten. Ich schrieb in schönen Lettern das Vaterunser, ließ es segnen und schickte es Udo nach. Es fiel in die falschen Hände und kam zurück. Der Alte tobte, hielt das wohl gesetzte Latein für einen Liebesbrief – der das ja im Grunde auch war – und verurteilte mich zum Tode durch Gift. Bei bewiesener Untreue besaß er als mein Herr das Recht mich so zu verurteilen. Den Giftbecher gab er nicht heimlich. Im Gegenteil! Ich musste den vergifteten Wein in seiner Gegenwart trinken. Er wollte meine angstvollen Schlucke und meine Schmerzen genießen. Mir bedeutete der Tod eine Erlösung von ihm. Ich habe den Becher lachend genommen und seinen Inhalt in einem Zuge runtergekippt. Als dann die Schmerzen kamen, nichts von Vergebung in mir – nur Rache. Unter Krämpfen sprach ich ganz ruhig: „Jetzt habt Ihr Euer Kind mit getötet. Ich bin schwanger.“
Ich hörte ihn schreien. Dann war mein Leben zu Ende. Nur ein Teil meiner Seele blieb geistig da, schwebt durch die Zeit, wird sich orten, wenn ihre Geschichte bekannt wird. Suche sie. Ich bin keine Sagengestalt sondern ein Mensch gewesen, der unsäglich gelitten hat. Weshalb ich nicht ganz sterben konnte, weiß ich nicht. War es die lachende Lüge im Tod? Oder war es nur Zufall, dass mir im Sterben nicht alles entglitten ist? Ich weiß nur, dass, wenn mein Schicksal in Büchern steht, alles vorbei sein wird. Die wichtigste Urkunde für deine Arbeit fehlt noch. Es gibt sie – aber ich weiß nicht genau, wo du jetzt suchen musst.
Höre deshalb: Weil er sein Schweigegelübte nicht brechen durfte, hat mein Kaplan nach der Beichte des Alten die Geschichte niedergeschrieben. Sie quälte ihn derartig, dass nur das Schreiben ihm half, für andere ganz wieder da zu sei n. Er hat sein Schreiben versiegelt und in einem Gefäß mit alten Berichten vergraben.
Während des Dreißigjährigen Krieges haben die Schweden die Burg besetzt. Ein verheerender Brand hat sie dann aber zerstört. Nur der Turm der Oberburg auf dem Felsen hoch über der Saale blieb als Ruine zurück. Über den Trümmern der Unterburg wurde viel später ein barockes Herrenhaus gebaut. Das wurde durch andere Gebäude eingeengt und verfiel. Verwaltungsgebäude gibt es heute an dem alten Stück Ringmauer, das du vielleicht kennst. Mehr kann der Traum nicht erzählen – beinahe war’s schon zu viel.“
Andreas erwacht schlaftrunken, setzt sich auf, schwingt die Beine über den Rand des Bettes und bleibt so sitzen. Was er geträumt hat verwirrt und erklärt ihm doch vieles. Er greift seinen Notizblock vom Nachttisch, schreibt sich Stichworte auf, liest die immer wieder durch, schreibt noch etwas dazu und ist dann endlich zum Aufstehen bereit.
Im Bad wäscht er sich und kleidet sich an. Auf dem Weg zur Küche geht er am Schreibtisch vorbei, blickt zum Bild auf und grüßt. Kein Zeichen der Antwort!
„Es war zuviel“, wiederholt er ihren letzten Gedanken, frühstückt nur kurz. Dann eilt er ins Institut. Die Woche fängt gleich mit einer Vorlesung an. Kurz vor Mittag fragt ihn Professor Warnke nach dem Stand seiner Ermittlungen. Er legt ihm die lateinischen Texte, die Auszüge daraus und die Übersetzungen vor. Die genaue Zusammenfassung verschweigt er. Professor Warnke ist wegen der ausgezeichneten Übersetzungen sehr überrascht.
„Ich sehe, dass Sie in der letzten Zeit viel studiert und gelernt haben. Das Thema, das ich für die Promotion vorschlug, liegt Ihnen wohl doch mehr, als Sie anfänglich glaubten.“
Andreas bestätigt: „Ich lebe mich langsam in die damalige Zeit ein und empfinde mit ihr. Weil meine Freundin verreist ist, konnte ich mich über das Wochenende ohne Unterbrechung mit dem Thema beschäftigen. Das hat mich vorangebracht.“
„Ich hoffe Ihre Freundin lässt Sie noch länger allein“, meint der Professor schmunzelnd, „die Geschichte von Halle wird es ihr danken.“
Auf dem Heimweg besucht Andreas erneut das Antiquariat. Er sucht eine sehr alte Karte von Halle, findet auch eine, in der sogar andeutungsweise die Umrisse der alten Burg noch erhalten sind.
„Ein absolutes Einzelstück – und sehr alt“, erklärt ihm Frau Landau. „Ich wollte es dem Museum anbieten.“
„Ich zahle den Preis des Museums“, fällt ihr Andreas beinah ins Wort und legt gleich drei Scheine hin. „Ich kann die Karte in meine Doktorarbeit einbauen.“
Sie nimmt lachend die Scheine, glättet sie liebevoll, schreibt eine Quittung, legt die Scheine in die Kasse und packt die Karte sorgfältig ein.
„Ich danke Ihnen“, sagt sie, „so schnell hätte das Museum bestimmt nicht gezahlt. Ich gebe Ihnen 35 Euro Discount zur Verwendung auf Ihre weiteren Einkäufe.“
„Später!“, antwortet Andreas, winkt und verlässt schnell das Geschäft.
Zu Hause enthüllt er den Einkauf. Danach breitet er die Karte ganz vorsichtig auf dem Fußboden vor seinem Schreibtisch aus. Er stellt sich auf einen Stuhl und fotografiert sie mehrmals. Die Bilder sind okay. Nun widmet er sich genau dem Teil, der andeutend die alte Burg drunter zeigt. Er schlägt sehr behutsam die anderen Teile nach hinten. Jetzt passt, was er studieren will, genau auf den Schreibtisch. Die Straßenführung war damals anders als heute. Vieles fehlt ganz. Die Burg liegt am nördlichen Rand. Eigentlich gehörte Giebichenstein damals noch nicht dazu. Der Ort wurde erst im Jahr 1900 ins Hallesche Stadtgebiet eingemeindet.
Andreas genügt, was er sieht. Er braucht das Terrain vor dem Brand. Hat da einer die zarten Konturen nach eigener Fantasie mit eingegeben, oder hat er sie wirklich noch messen können? Fragend blickt Andreas nach oben. Nichts regt sich in Annas Gesicht.
„Bitte“, flüstert er, „bitte, schau her!“
Kein Zeichen entwickelt die Schöne. Vielleicht war das Zeichen schon da; er hat es nur nicht verstanden. Andreas sucht seine Morgennotizen, liest sie so lange, bis er sie auswendig kennt. Dann geht er nach draußen. Die Dämmerung senkt sich bereits. Er versucht von der Burgruine aus den längst verschütteten und nun überbauten Weg zur Kapelle, die es ja auch nicht mehr gibt. Er versinkt in Meditation, erhofft in ihr einen Hinweis. Ruhe kehrt in ihn ein, aber seine Füße werden in keine Richtung gelenkt.
„Du bist verrückt“, denkt Andreas, „nur weil ein lächelndes Antlitz dir Träume geschickt hat, willst du hier Verborgenes ausmachen. Geh nach Hause und denke nach!“
Trotzdem sucht er im letzten Licht noch den Weg in die Unterburg. Ihn treibt der Gedanke, dass eine abfallende Grünfläche einstmals vielleicht ein Stück Burggraben war. Da hat der Priester damals bestimmt nichts vergraben! Schluss mit dem Grübeln!
Die Straßenbeleuchtung führt Andreas auf Umwegen wieder nach Hause. Beim Klingeln des Telefons schließt er die Wohnungstür auf. Ilse begrüßt ihn, will wissen, wie es ihm geht. Er erzählt ihr vom Lob des Professors und dessen Bemerkung dazu. Sie kichert und meint, der Alte könne gut reden, sie aber habe Sehnsucht. Ein paar Tage muss sie noch bleiben. Dann aber will sie kuscheln und möglichst noch mehr! Darauf freut er sich mit ihr, schickt ihr viele Gute-Nacht-Küsse und legt dann auf.
In der kommenden Nacht holt den Andreas kein Traum ein. Er erwacht zeitiger als sonst. Er grüßt Annas Bild über dem Schreibtisch, erhält wieder keine Antwort und eilt früher als sonst ins Institut nahe dem Dom. Wenn er heute sehr zeitig beginnt, kann er auch früher Schluss machen. Bei den Stichworten, die er auswendig lernte, ist ihm in der Nacht aufgegangen, dass Verwaltungsgebäude in Giebichenstein im Schutt der Unterburg liegen, die Keller wenigstens, falls welche vorhanden. Er will sich erkundigen, wo Berichte über die Legung des Grundsteins zu finden sind. Bis 17 Uhr ist heute das Bauamt geöffnet. Gut eine Stunde vorher meldet er sich bei der Auskunft.
Andreas trägt sein Anliegen vor. Der Beamte überlegt und weist ihn zur Registratur. Die Dame dort schüttelt den Kopf. Hier wird registriert, was jetzt geplant, neu gebaut oder verändert wird. Die Baupläne für diese Gebäude hier sind nicht einzusehen. Sie fragt ihn, weshalb er daran interessiert ist. Er erzählt von seiner Arbeit und der vagen Hoffnung, dass man beim Ausschachten etwas fand, das ihm weiter hilft. Sie weist ihn ans Stadtarchiv in der Rathausstraße gleich neben dem Markt. Da ist Andreas schon früher gewesen. Dort finden Touristen, allgemein Interessierte und Schulklassen, das Halle der Neuzeit mit Dom, Marktkirche, Rotem Turm, Händel, Francke, der Saline, Kunsthochschule und Museen.
Die Dame überlegt, ruft dann den Amtsleiter an. Sie berichtet ihm vom Anliegen ihres Besuchers, fragt, ob er helfen kann. Doktor Volkert hört interessiert zu, überlegt und bittet dann zum Erstaunen der Dame den Herrn tatsächlich zu sich. Andreas bedankt sich und sucht nun Zimmer A in der ersten Etage auf.
Der Amtsleiter wollte gerade sein Zimmer abschließen, als der Anruf kam. Nun hat er Zeit. Doktor Volkert hat sich schon immer für Geschichte und speziell die seiner Stadt interessiert. Von der alten Burg, die ja eine der ersten an der Saale war und heute zur ›romantischen Straße‹ gehört, ist vieles bekannt. Dennoch gibt es zeitliche Lücken, die sein Besucher mit einer Promotionsarbeit möglichst füllen soll. Andreas möge ihm bitte erzählen, was er bereits zusammengetragen hat und weshalb er speziell meint, dass gerade hier bei den Ausschachtungsarbeiten alte Unterlagen zerstört oder zu Tage gekommen seien.
Andreas weist auf einige Angaben in seinen Übersetzungen hin. Außerdem wurden die Verwaltungsgebäude an dem noch erhaltenen Stück der alten Ringmauer erbaut. Man kennt die Herrschergeschlechter, weiß aber kaum etwas über die Burgherren hier. Die ›Sage vom Springer‹ wurde längst als Fehler aus einer Lateinübersetzung geortet. Andreas sucht Namen, die ihm vielleicht Schicksale mitteilen. Er weiß um eingemauerte Dokumente in alten Wehranlagen anderer Gegenden. Warum nicht auch hier?
Doktor Volkert will nach den Berichten über die Ausschachtungen suchen lassen. Irgendwo müssen sie ja sein. Dabei fällt ihm aber etwas ganz anderes ein. Sein Vater, im Kriege als Flakhelfer eingesetzt, musste mit 14 Jahren schon Munition zureichen und ab und an selber die Geschütze bedienen. Die Angst saß immer im Nacken. Schlimmer noch empfand er aber die Aufräumarbeiten nach den Bombenangriffen, wenn es Verletzte oder Tote gegeben hatte. Einmal hatte er in einem Scherbenhaufen teilweise zerrissen alte Schriften gefunden. Er brachte sie mit nach Hause. Seine Mutter reagierte entsetzt, weil sie meinte, das seien Schriftstücke aus der von den Nazis zerstörten Synagoge.
„Bring sie bloß weg!“, sagte sie.
Da steckte er diese Reste in Zeitungspapier, klemmte sie unter seine Uniform und ging in den Dom um zu beten, schlich aber dann in den Keller und versteckte alles in dunkler Ecke hinter einem zerbrochenen Tabernakel. Der heute evangelisch-reformierte Dom ist ja eigentlich die alte Klosterkirche der Dominikaner, nur immer wieder renovierte und neu ausgemalt.
„Ich weiß“, antwortet der längst hellhörig gewordene Andreas. „Das historische Institut liegt ja nahe dem Dom. Ich liebe seinen gewaltigen Innenraum ohne Querschiff. Unser Dom ist in seiner stabilen Gewalt für mich einzigartig und ein Stück echtes Mittelalter.“
Dann aber drängt ihn die Frage: „Hat Ihr Vater der neuen jüdischen Gemeinde später die Schriften wiedergebracht?“
„Davon weiß ich nichts. Er hat es nur einmal beiläufig erwähnt. Sie können ja nachschauen, ob sich da noch was findet.“
Bereits am nächsten Tag besucht Andreas den Domprediger in der Kleinen Klaus Straße. Sie sind einander gut bekannt. Andreas hat ihm schon vor Monaten von seiner Arbeit erzählt und die alten Kirchenbücher studieren können, ohne darin Hilfreiches gefunden zu haben. Die neue Geschichte interessiert den Pfarrer natürlich.
„Sie können mit dem Küster da unten gern suchen“, meint er. „Es wurde viel aufgeräumt und auch neu geordnet. Das alte Tabernakel muss es noch geben. Schließlich ist es eine Erinnerung an die Dominikaner.“
Der Küster weiß genau, wo sie suchen müssen. Das Tabernakel ist zwar zerbrochen, aber in den Einzelteilen noch gut erhalten, sollte geschützt werden und erhielt eine Plastikumhüllung. Das Museum wollte es zur Renovierung abholen lassen, hat das anscheinend aber wohl vergessen. Dahinter ganz in der Ecke zeigt sich im Lichte der Taschenlampe tatsächlich etwas, das vom Staub der Jahrzehnte bedeckt, kaum zu erkennen ist. Andreas kriecht hin, umhüllt mit seinem Halstuch den seltsamen Fund, kann ihn so vorsichtig aus der Ecke lösen und an sich nehmen. Der Küster freut sich, dass er hier helfen konnte.
In der Sakristei wartet der Prediger auf die beiden. Er hat genau wie Andreas auf den Fund gehofft und einen kleinen Tisch zum Ablegen bereitgestellt. Andreas legt da sein verschmutztes Halstuch vorsichtig ab. Noch vorsichtiger entfaltet er es. Das alte Zeitungspapier vom Völkischen Beobachter hat sich fast aufgelöst. Nur noch rote Stellen einer Überschrift sind zu erkennen. Auf den fest zusammengepackten, brüchigen Lagen darunter liegt dicker, teilweise klebriger Staub. Der Prediger entnimmt seiner Tasche einen sehr weichen Pinsel und versucht eine erste behutsame Reinigung. Auf fast lederartigem Grund erscheinen einige Buchstaben. Das ist kein Hebräisch! Latein!
Andreas muss vom Tisch zurücktreten. Er weint vor Freude und Dankbarkeit.
„Der Schatz gehört jetzt dem Dom“, sagt er. „Ich möchte ihn aber restaurieren lassen und für meine Arbeit verwenden.“
„Das Kuratorium des Doms wird im eigenen Interesse die Restaurierung ausführen lassen und später das hoffentlich gute Stück ausstellen, gegen Bezahlung an Museen und Wissenschaftler ausleihen. Der Finder soll es übersetzen und seine Übersetzung als Erstdruck in seine Doktorarbeit geben. Ist das ein Wort?“
„Nicht nur ein Wort! Ein ganzes Kapitel!“, erwidert Andreas, drückt beide Hände des Predigers und fügt hinzu: „Sie sind ein wahrer Vertreter unseres Herrn.“
Andreas hastet nach Hause, betritt seine Wohnung voll innerer Freude, drängt zum Schreibtisch und blickt zu der Schönen auf.
„Ich glaube, wir haben gefunden, was dir und mir hilft. Wenn ich’s übersetzt gedruckt habe, bist du frei!“, ruft er ihr zu.
Er meint, ein ganz feines neues Lächeln in ihrem Gesicht zu entdecken. Ganz sicher ist er sich nicht.
Seine Freundin kommt nach einer Woche zurück. Die Trennung hat sie näher zueinander gebracht. Andreas kann ihr jetzt mehr seiner Zeit widmen, weil er nicht viel Neues zur Doktorarbeit beitragen kann. Er wartet auf die restaurierten Blätter, die früher einmal zusammengerollt waren, sehr brüchig sind und schwer voneinander zu trennen. Auch manche Passagen können mehr erahnt als erkannt werden. An verschiedenen Rändern fehlen Teilstücke des Textes. Andreas muss fast fünf Monate warten, bis er mit einer Übersetzung beginnen kann.
Das Original bleibt im Dom. Andreas fotografiert vorsichtig in Zeitaufnahmen, was er zur Übersetzung dann mit nach Hause nimmt. Er hofft wieder auf die Hilfe der Schönen. Ilse darf während der Übersetzungen nicht in seiner Nähe sein. Er braucht absolute Konzentration. Das kann sie verstehen.
Andreas weiß längst, dass sein Kontakt zu der Schönen, nur als ihr beider Geheimnis lebendig bleibt.
Er entziffert einiges über Renovierungen in der Kapelle. Der Maler, ein Klosterbruder, wird auch genannt. Dann – kaum noch als Schrift zu erkennen – die Beichte zweier Knechte, die Robert den Alten, als er vor ihnen ausrutschte, mit Fußtritten in die Saale befördert haben. Das geschah Wochen nach Annas Tod. Weil keine direkten Erben vorhanden, wurde Annas Bruder danach Herr auf der Burg.
In der folgenden Nacht träumt Andreas wieder von Anna. Sie erscheint freudig und stammelt fast unter Tränen: „Mein Geist muss in tiefem Schlaf lange geruht haben, sonst hätte mich der Tod des Alten vielleicht längst schon befreit. Ich habe auch nie empfunden, dass ich so lange still unterwegs war. Erst das Bild, das einer, meine wandernde Seele erahnend, von mir malte, hat mich wieder geweckt. Ich arbeite gern mit dir, weil du mich verstehst und mit deiner Veröffentlichung endlich nach Hause führst. Wo das ist, weiß ich nicht. Vielleicht kann ich da aber auch meinen Udo finden, der im Saleph, als er den Kaiser retten wollte, mit ihm ertrank.“
Am Morgen ist dem Andreas der Traum noch sehr gegenwärtig. Er lächelt zum Bild auf.
„Ich hoffe, du findest ihn“, sagt er leise.
Dann beginnt die Übersetzung von Annas Geschichte. Die kennt Andreas aus seinen Träumen. Vieles an Einzelheiten kommt jetzt hinzu, die Erschütterung des Priesters, seine Erkenntnis über Recht und Unrecht in dieser Welt. Die ist mit Herren und Knechten keine Welt unseres Herren. Päpste und Gegenpäpste suchen die weltliche Macht, nicht die Seelen, stürzen ihre Priester deshalb in eigene Not, weil nicht jeder im Beichtstuhl um Vergebung bittet, vielmehr da Hilfe erfleht. Gebete und Vertröstung aufs Jenseits wirken schal, wenn ein Mensch an seinem Schicksal zerbricht. Die Kirche muss auch echte Wege aufzeichnen, tätige Hilfe im Hier und Heute versuchen, eine neue Straße weisen und zu ihr hinführen. Bei Anna ist es dem Priester gelungen. Er weiß, dass es im päpstlichen Sinne falsch war, einer Frau im Lehren oft so nahe zu sein. Obwohl kein fleischliches Begehren dabei war, zählt es zur Sünde. Die beichtet der Priester nicht, schreibt nur nieder und gibt sein Bekenntnis in die Erde, die Gott für alle erschuf.
Damit enden die lesbaren Zeilen. Sie wurden auf Tierhaut geschrieben. Die Tinte konnte da gut einziehen. Es scheint, als seien einige Lagen besonders präpariert worden, um sie vor dem Verfall schützen zu können.
Andreas schaut auf. Das Bild zeigt keine Bewegung. Ist Anna jetzt schon zu Hause, weil dies hier gedruckt werden wird?
„Ich danke dir“, sagt er leise. „Du hast mir beim Übersetzen die Gedanken geführt. So konnte ich in deine Zeit einsteigen, in ihr leben und nun den Vorgaben meines Professors absolut gerecht werden. Wenn meine Arbeit gedruckt ist, werde ich sie dir zeigen, dann bist du zu Hause.“
Haben ihm ihre Augen mit leiser Bewegung der Lider eben geantwortet? Vielleicht. Manchmal glaubt er fast, alles geschehe nur in seiner Fantasie, weil er sich in das Bild der Schönen verliebt hat. Aber nie hat er so gut und auch so schnell übersetzt. Im Traum ist ihm Anna erschienen, hat von ihrem Leid und ihrem Leben erzählt. Er konnte in ihren Blick und ihr Lächeln einsteigen. Während seiner Arbeit wuchs das Verstehen der Zeit, die er ergründen sollte. Er weiß, wie sie war durch Annas Blick und die Träume von ihr.
„Du bist mein Wunder“, flüstert er noch einmal leise. „Wunder geschehen auch in der heutigen Zeit. Wir müssen nur an sie glauben.“