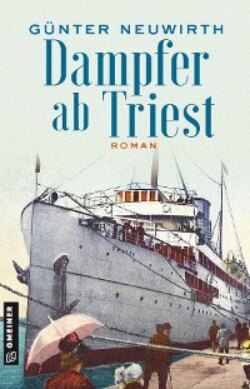Читать книгу Dampfer ab Triest - Günter Neuwirth - Страница 7
Möwen über Triest
ОглавлениеDer anhebende Frühlingstag brachte lebhaften Wind, schnell ziehende Wolken und Helligkeit mit sich. Ein guter Tag für die Arbeit im Garten. Heidemarie Zabini legte ihre Strickweste ab, griff nach dem Werkzeug und lockerte mit langsamen, routiniert gesetzten Bewegungen die Erde. Die Beete mit dem Salat und dem Frühgemüse waren längst bestellt, jetzt galt es, die Beete für das Sommergemüse vorzubereiten. Der Garten rund um ihr Haus war nicht sehr groß und lag am Hang, aber durch viele Jahre der Arbeit wusste sie genau, wie sie ihre Beete ertragreich bewirtschaften musste. Sie liebte den Geruch der fruchtbaren Erde. Die Gartenarbeit war erstens ihre Leidenschaft, zweitens füllte sie den Vorratskeller und drittens förderte sie ihre Gesundheit. Und noch war sie nicht zu alt für harte Arbeit. Nach einer Weile war das erste Beet umgegraben, also holte sie die Kisten mit den Setzlingen und pflanzte sie ein. Aus dem großen Fass unter der Regenrinne schöpfte sie Wasser mit der Gießkanne.
»Guten Morgen.«
Heidemarie drehte sich um und schaute zur Gartentür. »Guten Morgen, Signora Cherini.«
»Darf ich eintreten?«
»Natürlich. Kommen Sie nur.«
Fedora öffnete die Gartentür und trat in den Garten. Sie blickte sich um. »Sie kommen gut voran.«
»Man tut, was man kann. Haben Sie schon die Beete bestellt?«
»Natürlich. Meine Söhne essen so viel, da muss ich rechtzeitig mit der Arbeit beginnen.«
»Es freut mich, dass Sie die Gartenarbeit auch so lieben wie ich.«
»Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, Signora Zabini. Ein Haus ohne Küchengarten kann ich mir gar nicht vorstellen.«
»Kommen Sie, um wieder in meiner Bibliothek zu stöbern?«
Fedora hob ihre Tasche. »Diesmal bringe ich ein Buch. Es enthält drei Stücke von Franz Grillparzer in einem Band. Ich habe es wirklich versucht zu lesen, aber so gut ist mein Deutsch nicht. Irgendjemand hat das Buch auf dem Schiff vergessen, da hat mein Mann es mir gebracht. In Ihrer Bibliothek ist es besser aufgehoben als bei mir. Und da ich auf dem Weg in die Città Vecchia bin, habe ich gedacht, ich komme bei Ihnen vorbei.«
Heidemarie stellte die Gießkanne ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Vielen Dank. Haben Sie heute schon Kaffee getrunken?«
»Noch nicht. Die Buben haben herumgetrödelt, also musste ich ihnen Beine machen.«
»Was halten Sie von einer Tasse?«
»Sehr gerne.«
Die beiden Frauen betraten das Haus. Heidemarie führte Fedora in die Stube und bat sie, Platz zu nehmen. Wenig später servierte sie eine Kanne Kaffee und setzte sich zu ihrem Gast.
»Sind Sie alleine zu Hause?«
»Ja. Bruno ist beim ersten Hahnenkrähen los.«
»Wieder den Verbrechern auf der Spur?«
»Ach, wie immer halt. Ich habe ihn nicht gesprochen, ich habe nur gesehen, dass er fortgegangen ist. Er schien in Eile zu sein.«
»Ihr Sohn scheint immer in Eile zu sein.«
Heidemarie lächelte Fedora an. »Zumindest tut er immer sehr beschäftigt. Das machen Beamte so, damit niemand bemerkt, dass sie den lieben langen Tag faulenzen.«
Fedora lachte. »Diesen Verdacht hege ich auch. Die Gartenarbeit geht Ihnen leicht von der Hand. Ihre Beete sind prachtvoll.«
»Gott sei es gedankt, die alten Knochen sind noch belastbar.«
Für eine Weile saßen die beiden Frauen schweigend beisammen und nippten an ihren Kaffeetassen.
»Wann kommt Ihr Mann zurück?«
»Laut Plan wird die Bohemia am Samstag wieder anlegen.«
Heidemarie schaute sinnierend zum Fenster. »Mein Salvatore, Gott hab ihn selig, fuhr nicht zur See. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er aus dem Bureau nach Hause gekommen ist, sich an den Tisch gesetzt hat, ich ihm das Essen aufgetragen habe und er sich von den Kindern über ihren Tag Bericht hat geben lassen. Es war ein geregeltes Leben. Regeln geben den Menschen Sicherheit. Seit ich damals als blutjunges Mädchen mit meiner Herrin von Wien nach Triest gekommen bin, lebe ich hier, und ich habe keinen Tag bereut.«
»Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?«
Heidemarie wiegte sinnierend den Kopf. »Obwohl es schon so lange her ist, kann ich mich noch an alle Einzelheiten erinnern. Als meine Herrin, die Gräfin Windischgrätz, den Sommer über in Triest verbrachte und ich bei ihr als Zimmermädchen im Dienst war, hat sie mich regelmäßig auf den Markt geschickt. Bald ist mir der gut aussehende Herr aufgefallen, der täglich um die Mittagsstunde den Markt besuchte. Es hat sich ergeben, dass ich ihm öfter über den Weg gelaufen bin. Irgendwann hat er mich angesprochen. Dann hat das eine das andere ergeben. Ich habe sehr schnell bemerkt, dass Salvatore sich Hals über Kopf in mich verliebt hat. Ich war ein süßes Wiener Mädel, blond, blauäugig, pausbäckig, und der Herrgott hat es gut mit mir gemeint, er hat mir auch ein bisschen Verstand mitgegeben. So bin ich nicht bloß eine sommerliche Liebelei des eleganten Herrn geworden, sondern seine Ehefrau. Es war so rührend, wie er bei der Gräfin Windischgrätz vorstellig geworden ist und wie er meinen Eltern ellenlange Briefe geschrieben hat. Salvatore ist noch im Herbst, knapp vor der Abreise der Gräfin, mit dem Zug nach Wien gefahren und hat bei meinen Eltern um meine Hand angehalten. Im Frühling sind dann meine Eltern aus Wien zur Hochzeit gekommen. Es war ein schönes Fest. So ist aus dem Zimmermädchen aus einfachen Verhältnissen die Ehefrau des bedeutenden Beamten Salvatore Zabini geworden, so kam ich von der Donau an die Adria.«
Fedora lachte. »Irgendwie ganz ähnlich klingt meine Geschichte. Nur bin ich nicht aus Wien nach Triest gekommen, sondern aus einem kleinen Dorf im Karst. Auch ich habe einen Mann in bedeutender Stellung geheiratet.«
»Welchen Rang hat er inne?«
»Zweiter Offizier.«
»Respekt.«
»Seine Zeit auf der Bohemia ist bald zu Ende. Im Lloydarsenal stehen zwei Dampfer vor der Fertigstellung. Er ist als Erster Offizier für die Baron Beck vorgesehen. Im Spätsommer wird er mit dem neuen Dampfer die Jungfernfahrt unternehmen.«
»Ein Seemann durch und durch.«
»Das ist mein Carlo.«
Heidemarie fasste Fedora ins Auge. »Signora Cherini, erlauben Sie ein persönliches Wort?«
Fedora bemerkte den geänderten Tonfall, sie zog die Augenbrauen hoch. »Ja, natürlich.«
»Sie gehen ein sehr hohes Risiko ein.«
»Was meinen Sie?«
»In den fast vier Jahrzehnten, die ich nun schon in Triest lebe, habe ich viele Frauen kennengelernt, deren Männer zur See gefahren sind. Ich habe manche gesehen, die mit der Zeit des Alleinseins gut zurechtgekommen sind, andere wieder weniger. Und ich habe auch gesehen, dass manche Frau von ihrem Mann verstoßen worden ist. Nicht wenige Ehen sind gescheitert. Der Mann versank in der Trunksucht, die Frau im Elend, die Kinder lebten auf der Straße, einige gerieten auf die schiefe Bahn. Das meine ich mit Risiko.«
Fedora umklammerte mit beiden Händen die Tasse und schaute auf den Rest von Kaffee darin. »Hat Bruno geplaudert?«
»Nein, nicht geplaudert, aber mein Sohn kann mir nichts verheimlichen. Ich sehe doch, wie das Leben seinen Lauf nimmt. Und als ich ihn direkt fragte, hat er mir eine klare Antwort gegeben. Er hat nicht gelogen.«
»Werden Sie Gerüchte in den Umlauf bringen?«
»Niemals! Hören Sie, Signora Cherini, ich bin mittlerweile neunundfünfzig Jahre alt, ich habe manches im Leben gelernt. Ja, ich war auch einmal jung und viele Männer haben sich für mich interessiert. Eine blonde Wienerin in Triest, eine Zeit lang war ich das Stadtgespräch. Ich habe so manche Liebesbriefe vor meinem Mann verstecken müssen, aber ich hatte das Glück, dass er kein Seemann war. Oder das Pech, je nachdem, wie man es nimmt. Die eine oder andere interessante Liaison ist mir dadurch entgangen, aber die Kinder, das Haus und ein gewisses Guthaben sind mir geblieben. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will?«
»Ich glaube, ja.«
»Nehmen Sie das bitte ernst. Ich habe Frauen gesehen, die an einem Tag noch in geordneten Verhältnissen gelebt haben und am nächsten Tag im Armenhaus gelandet sind. Oder bei den Dirnen. Gerade wir Frauen geraten durch gescheiterte Ehen in die Armut. Das ist unser Schicksal.«
»Im Armenhaus möchte ich nicht landen.«
»Deswegen seien Sie stets auf der Hut. Als Frau eines Seemannes wird man in Triest von den anderen Frauen argwöhnisch beobachtet.«
»Wem sagen Sie das! Meine Schwiegermutter lauert wie ein Fuchs.«
»Sie, Signora Cherini, sind eine auffällig schöne Frau. Schönen Frauen wird immer hinterhergeschaut.«
»Ja, das kann ich bestätigen.«
»Bruno wird regelrecht hitzig, wenn er sie trifft.«
»Ich werde auch hitzig, wenn ich ihn treffe. Vor allem, wenn mein Mann gerade auf See ist.«
»Ich habe meinen Sohn scharf ins Gebet genommen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm, dass er nicht geheiratet hat und Kinder großzieht, aber damit habe ich mich abgefunden. Zum Glück hat meine Tochter mir Enkel geschenkt. Ich weiß nicht, was ich in seiner Erziehung falsch gemacht habe. Er will nicht heiraten, er will frei bleiben, er will sich nicht binden. Das hat er mir so gesagt. Schön und gut, er ist ein erwachsener Mann und trifft seine eigenen Entscheidungen. Aber dass er Sie in Gefahr bringt, Signora Cherini, das kann ich nicht tolerieren. Das nehme ich ihm sehr übel.« Heidemarie war laut geworden. Sie entdeckte einen Hauch von Schwermut in Fedoras Miene. Oder war es Verzweiflung? Heidemarie war sich nicht sicher.
»Gehen Sie mit Bruno nicht zu hart ins Gericht. Auch er geht ein Risiko ein.«
»Allerdings. Die einmalige Affäre mit einer verheirateten Frau sieht die Öffentlichkeit einem Mann leicht nach, selbst einem Beamten, aber ein andauerndes Verhältnis ist schon wieder etwas anderes. Das erregt Ärger.«
»Ich habe großes Vertrauen in ihn.«
»Aber, Signora Cherini, muss das sein? Muss es wirklich sein, dass Sie einen Liebhaber haben?« Jetzt war sich Heidemarie sicher. Es war tatsächlich eine Spur von Verzweiflung in Fedoras Miene.
»Vielleicht ist es ein Dämon.«
Heidemarie spitzte die Ohren. »Ein Dämon?«
»Ja. Meine Großmutter würde sagen, ich wäre verhext. Sie hat bis zu ihrem Tod an Hexen und Geister geglaubt.«
»Werden Sie von einem Dämon verfolgt?«
»Bruno hilft mir, den Dämon in Schach zu halten. Er ist gut zu mir, er lässt mich nicht fallen. Ihr Sohn hilft mir, dass ich bei meinen Söhnen bleiben kann, dass ich mich meinem Mann, wenn er zu Hause ist, völlig zuwenden kann, dass ich bei ihm sein kann, dass Carlo sich niemals über meine Missachtung beklagen kann.«
»Erzählen Sie von Ihrem Dämon.«
»Nachts, wenn ich allein im Bett liege, dann überkommen mich Träume. Phantasien. Sehnsüchte. Sehr starke Gefühle. Als ich noch jünger war, habe ich meine wollüstigen Träume gebeichtet, doch der Pfarrer konnte mir nicht helfen. Ich glaube eher, dass er von diesen Beichten schwer belastet wurde. Vielleicht, weil er sich nach mir verzehrt hat? Ich weiß es nicht. Ich beichte meine Träume nicht mehr, denn die Beichte verschafft mir keine Erleichterung. Bruno verschafft sie mir. Ich bin also eine Frau, die mit der wochenlangen Abwesenheit ihres zur See fahrenden Mannes nicht gut zurechtkommt. Sehr schlecht sogar. Bruno hilft mir, keine Dummheiten zu begehen.«
Heidemarie verschränkte nachdenklich ihre Arme.
»Vielleicht werde ich Carlo davon erzählen«, fuhr Fedora fort. »Nicht vielleicht, bestimmt werde ich es tun. Wenn wir beide alt sind. Vielleicht wird er mir dann auch erzählen, was er auf seinen Reisen erlebt hat. Carlo ist ein stattlicher Mann, er ist Offizier, er kennt viele Städte und trifft viele Menschen. Zahlreiche Engländer fahren auf der Linie Triest-Bombay, auch Engländerinnen. Frauen aus dem Norden haben ein ganz eigenes Faible für italienische Seeleute. Ich gönne es ihm. Vielleicht wird er mir meine Freiheit auch gönnen. Weil er mich liebt. So wie ich ihn liebe.«
Heidemarie verzog beeindruckt ihren Mund und griff zur Kanne. »Noch Kaffee?«
»Gerne.«
»Signora Cherini, jetzt wo wir uns besser kennen, sollten wir einander duzen. Sag bitte Heidemarie zu mir.«
»Fedora.«
»Hast du das auch mit Bruno besprochen?«
»So ähnlich.«
»Offenbar genügt es ihm, der Nebenmann zu sein.«
»Offenbar. Mir genügt es auch, nur seine Nebenfrau zu sein.«
»Du weißt davon?«
»Ich weiß, dass ich nicht die einzige verheiratete Frau bin, deren Alleinsein er erträglich macht.«
Heidemarie lachte und legte ihre Hand auf Fedoras Unterarm. »Wahrscheinlich hat deine Großmutter recht. Du bist verhext.«
Fedora stimmte in das Gelächter ein. »Wahrscheinlich.«
*
Der Palazzo del Governo wurde vom Wiener Architekten Emil Artmann errichtet, erst seit zwei Jahren residierte der Statthalter der Reichsunmittelbaren Stadt Triest in diesem Prachtbau an der Piazza Grande. Die bunten Mosaiksteine an der Fassade zeigten orientalischen Stil und bildeten so einen auffälligen Kontrast zu den anderen Palazzi auf der zentralen Piazza der Stadt. In diesem Palazzo warteten Oberinspector Gellner und die Inspectoren Zabini und Pittoni auf den Grafen Urbanau, um alsdann zum Statthalter vorgelassen zu werden.
Bruno schaute auf seine Taschenuhr. »Der hohe Herr könnte sich langsam bequemen, die Piazza zu überqueren. Ein besonders weiter und beschwerlicher Fußmarsch ist das ja nicht.«
Gellner verzog seine Mund. »Hüten Sie Ihre Zunge, Signor Zabini. Der hohe Herr kommt dann, wenn es dem hohen Herren konveniert, nicht wenn Sie wieder einmal vor Ungeduld von einem Bein auf das andere steigen.«
Emilio stellte sich neben Bruno an das Fenster und schaute zur Piazza hinab. »Da ist er! Da kommt Graf Urbanau.«
Bruno nickte und steckte seine Taschenuhr ein.
Wenig später führte ein Amtsdiener den Grafen in das Bureau des Statthalters. Auch die drei Polizisten wurden hineingebeten. Der Statthalter thronte mit ernster Miene auf seinem Stuhl, ein Sekretär saß an seinem Nebentisch und hielt für die Protokollierung des Gesprächs eine Füllfeder in der Hand. Der Statthalter erhob sich, ging dem Grafen entgegen und begrüßte ihn mit ausgesuchter Höflichkeit in deutscher Sprache. Den drei Polizisten wies er mit einem Kopfnicken ihre Plätze zu. Die Herren setzten sich.
»Hochgeschätzter Herr Graf, Euer Gnaden, ich danke Euch verbindlichst, dass Ihr trotz der frühen Stunde den Weg in mein bescheidenes Arbeitszimmer gefunden habt. Ich erlaube mir, das Gespräch in Deutsch zu führen. Alle anwesenden Herren sind der Amtssprache mächtig.«
»Das ist gut. Mein Italienisch lässt zu wünschen übrig.«
»Der Herr Polizeidirektor konnte in so kurzer Zeit leider seinen lange geplanten Verpflichtungen nicht entgehen, der Herr Polizeidirektor hat frühmorgens den Zug bestiegen und ist auf dem Weg zu einer bedeutenden Konferenz. Deshalb mache ich Euer Gnaden mit den anwesenden Herren bekannt. Oberinspector Gellner ist der Leiter des k.k. Polizeiagenteninstituts der Polizeidirektion Triest. Begleitet wird Herr Gellner von seinen beiden Inspectoren, die im vorliegenden Falle die Ermittlungen führen.«
Graf Urbanau schaute kurz zu den Inspectoren. »Die beiden Herren sind mir seit gestern bekannt.«
»Sehr gut, also können wir die Unterredung eröffnen?«
»Darum bitte ich.«
»Herr Gellner, ich bitte um Ihren Vortrag.«
Gellner räusperte sich und richtete seinen Rücken gerade. »Vielen Dank, Eure Exzellenz. Vielen Dank auch, Euer Gnaden, für die Bereitschaft, aus dem Stegreif dieser Besprechung beizuwohnen. Der Grund unserer Unterredung ist der schreckliche Unfall in den Morgenstunden des gestrigen Tages, bei dem ja Euer Gnaden Fahrer, Herr Rudolf Strohmaier, auf tragische Art und Weise sein Leben gelassen hat und bei dem Euer Gnaden Automobil erheblich zu Schaden gekommen ist. Selbstredend ist die Polizei in einem derart bedeutungsvollen Fall bemüht, die Ereignisse auf gewissenhafteste Weise zu erforschen. Aus diesem Grund habe ich meine beiden Inspectoren mit der Klärung betraut. Und wie eine eingehende Untersuchung ergeben hat, haben sich leider besorgniserregende Umstände ergeben.«
»Besorgniserregende Umstände? Was meinen Sie, Herr Gellner?«, fragte Graf Urbanau.
»Nun, eine gründliche technische Inspektion des Fahrzeuges und insbesondere der Bremse hat ergeben, dass wir hier nur bedingt von einem Unfall sprechen können.«
»Das ist eine sehr dunkle Andeutung«, brummte der Graf mürrisch.
»Das Bremsseil des Automobils wurde absichtsvoll mit einer Säge bearbeitet, sodass das Reißen des Seils nur eine Frage der Zeit war.«
Die Stirn des Grafen verdüsterte sich. »Das Bremsseil wurde angesägt?«
»Ja. Der Verdacht eines heimtückischen Anschlags gegen Euer Gnaden steht im Raum. Zumal, wie mir berichtet wurde, Euer Gnaden eine Fahrt mit dem Automobil zur Steilküste nach Duino im Sinn gehabt haben.«
Längere Zeit lag Stille im Bureau des Statthalters.
»Das ist in der Tat besorgniserregend«, sagte Graf Urbanau.
»Allerdings«, setzte schließlich der Statthalter fort. »Deshalb ist die Polizeibehörde mit der gründlichen Erforschung der Vorfälle beschäftigt.«
Der Graf wandte sich dem Statthalter zu, ganz so, als ob die niedrigen Beamten nicht mehr im Raum wären. »Wenn ich das also richtig verstehe, habt Ihr mich vorgeladen, um mich zu warnen.«
»Jawohl, Euer Gnaden, um Euch zu warnen. Aber auch, um Auskunft von Euch zu erfragen.«
»Auskunft?«
»Selbst wir hier an der Adria wissen von der Bedeutung, die Euer Gnaden im Wirtschaftsleben der Steiermark innehat, vor allem aber wissen wir, welch bedeutendes Amt Euer Gnaden vor Eurer Pensionierung im Kriegsministerium bekleidet haben. Ich habe vorgestern vom Wiener Polizeiagenteninstitut ein dienstliches Telegramm auf höchster Ebene erhalten, welches Eure Ankunft in Triest angekündigt hat.«
Der Graf winkte verdrießlich ab. »Mischen sich diese Leute noch immer in meine Angelegenheiten. Das ist ärgerlich.«
Der Statthalter räusperte sich, seine Miene war ernst. »Herr Graf?«
»Ja bitte?«
»In diesem Telegramm wurde ich darauf hingewiesen, dass es vonseiten ausländischer Mächte Morddrohungen gegen Euch gibt.«
Bruno hörte nur das kurze, scharfe Einatmen von Oberinspector Gellner, ansonsten hätte man im Raum eine fallende Stecknadel hören können.
Nach einer Weile düsteren Schweigens erhob sich der Graf. »War es das, was Ihr mir mitteilen wolltet, Eure Exzellenz?«
Auch der Statthalter erhob sich, und mit ihm eilig die drei Polizeibeamten.
»Jawohl, das war der wesentliche Inhalt unserer Unterredung.«
»Dann kann ich ja wieder gehen.«
»Auf ein Wort, Herr Graf.«
»Noch eines?«
»Ja.«
»Also bitte.«
»Ein schwerer Unfall im Hafen, bei dem ein Mann getötet sowie zwei unbescholtene Hafenarbeiter verletzt wurden und bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist, welcher auf einen heimtückischen Anschlag auf eine hohe Persönlichkeit der Monarchie zurückzuführen ist, ist meines Erachtens ein schwerwiegender Grund, die Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich verlange eine Erklärung!«
»Was wollt Ihr wissen?«
»Wer ist hinter Euch her?«
»Niemand, den Ihr kennt.«
Stille lag im Raum. Die Mienen der beiden hohen Herren waren angespannt.
»Ihr verweigert die Auskunft?«
»Fragt doch Eure Freunde von der Wiener Polizei.«
»Ich fürchte, Herr Graf, dass Ihr weiterhin in Gefahr schwebt und der Attentäter auf eine erneute Gelegenheit lauert.«
»Der Dilettant soll nur kommen! Dem werde ich Mores lehren. Und ihn bezahlen lassen für den feigen Mord an meinem tüchtigen Fahrer.«
Es war für Bruno, Emilio und Gellner klar ersichtlich, dass der Statthalter durch die unnahbare Haltung des Grafen sehr irritiert war und um Fassung rang.
»Herr Graf, es ist meine Pflicht, eine offizielle Warnung auszusprechen und Euch während des Aufenthalts in Triest Schutz zukommen zu lassen.«
Graf Urbanau winkte ab. »Das ist nicht nötig. Sollen Eure Wachleute Hühnerdiebe und Kirchenräuber fangen, ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen.«
Der Statthalter stützte sich mit beiden Händen auf die Tischplatte. Er schien mehr als beunruhigt. »Denkt bitte an die Komtess.«
»Meine Tochter hat mit der Sache nichts zu tun! Und jetzt verbitte ich mir weitere Einmischung in meine Angelegenheiten.«
»Ist das Euer letztes Wort?«
»Jawohl.«
»Dann, Herr Graf, bedanke ich mich für Euer Kommen.«
»Und ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Ich wünsche einen angenehmen Tag.«
Damit verließ der Graf das Zimmer. Die Beamten im Bureau starrten eine Weile zur Tür, dann ließ sich der Statthalter auf seinen Stuhl fallen. Die drei Polizisten setzten sich ebenso. Der Statthalter blickte sinnierend zur Decke.
»Herr Gellner?«
»Ja, Eure Exzellenz?«
»Sie haben ja gehört, dass Graf Urbanau eine äußerst starke Persönlichkeit ist.«
»Das war unverkennbar zu vernehmen.«
»Dennoch bereitet alleine die Möglichkeit, dass dem Herrn Grafen in Triest etwas zustoßen könnte, mir größtes Unwohlsein.«
»Mir gleichfalls.«
Der Statthalter fasste nun die drei Polizisten scharf ins Auge. »Herr Gellner, ich erteile Ihnen den Auftrag, alle Bewegungen des Herrn Grafen und der Komtess auf diskrete Art zu observieren, und zu jeder Zeit eine ausreichende Anzahl von Beamten in Rufweite zu positionieren, sodass es zu keinem weiteren Anschlag mehr kommen kann.«
»Sehr wohl.«
»Und wenn ich diskret sage, meine ich es auch so!«
»Selbstverständlich.«
»Der Graf hat doch vor, eine Seereise zu unternehmen. Ist das korrekt?«
»Das ist korrekt. Der Graf und die Komtess haben Schiffskarten für die Thalia.«
»Sticht die Thalia wieder zu einer Vergnügungsfahrt in See?«
»Jawohl.«
»Wohin geht die Reise?«
»In die Ägäis und nach Konstantinopel.«
Der Statthalter pochte auf den Tisch. »Wir brauchen inkognito einen verlässlichen Mann an Bord des Schiffes!«
»Jawohl.«
»Können Sie das veranlassen, Herr Oberinspector?«
»Selbstverständlich, Eure Exzellenz! Inspector Pittoni zu meiner Linken wird die diskrete Überwachung des Grafen in Triest besorgen. Und Inspector Zabini zu meiner Rechten wird inkognito an Bord der Thalia gehen.«
»Vortrefflich!«
Der Statthalter erhob sich und verabschiedete die drei Polizisten mit Händedruck.
Bruno ging neben Gellner die Treppe hinab. »Herr Oberinspector, die Thalia wird dreieinhalb Wochen auf See sein.«
»Ja, und?«
»So lange soll ich an Bord sein?«
»Na, ich hoffe doch, dass Sie nicht über die Reling stürzen werden.«
»Ich gebe zu bedenken, dass ich an der Seekrankheit leide.«
Gellner glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Er hielt inne und donnerte: »Sagen Sie mal, Zabini, sind Sie geborener Triestiner?«
»Das ja.«
»Also werden Sie ja wohl zur See fahren können.«
»Es erscheint mir schwierig, drei Wochen an Bord inkognito zu bleiben. Meine Profession wird dem Kapitän und der Mannschaft kaum zu verheimlichen sein.«
»Als Triestiner Polizist haben Sie auf See keinerlei Dienstbefugnis, die Idee Seiner Exzellenz ist daher vortrefflich. Denken Sie sich eine plausible Tarnung aus.«
»Aber warum ich?«
»Weil Ihr Deutsch nicht so klingt, dass einem dabei übel wird, und weil das eine dienstliche Anordnung ist! Sie haben Seine Exzellenz gehört.«
Bruno schluckte. Dreieinhalb Wochen auf See, um den Grafen Urbanau zu beschützen? Porca miseria! Was würde Luise dazu sagen?
*
»Wartest du schon lange?«
»Nein, gar nicht. Nur eine Stunde.«
»Ich weiß, ich bin spät. Papa hat beim Frühstück lange gebraucht.«
Friedrich fasste Carolina an den Händen »Du bist niemals zu spät, denn du bist wie die Sonne. Du kommst, wann du kommst, und du füllst die Welt mit Licht, Liebe und Leben.«
Carolina kicherte. »Das hast du schön gesagt.«
»Lass uns gehen«, sagte Friedrich.
»Ja.«
»Den Auflauf am Hafen habe ich natürlich bemerkt. Als ich dazukam, wurde der Wagen abgeschleppt. Es ist so tragisch. Ein Leben ist ausgelöscht.«
»Ich habe Rudolf gut leiden können, gerade weil er ein wenig verschroben und eigen war. Er war ein großartiger Mechaniker. Einmal habe ich ihm zugesehen, wie er einen Reifen gewechselt hat. Rudolf hat die Arbeit mit völliger Hingabe verrichtet. Das war sehr beeindruckend. Jetzt ist er tot.«
»Wie kam es zu dem Unfall?«
»Ein Defekt der Bremse.«
»Werdet ihr trotz des Vorfalls an Bord gehen?«
»Ja. Papa hat das so entschieden.«
»Dann haben wir noch den heutigen und morgigen Tag in Triest und hernach dreieinhalb Wochen auf dem Schiff. Ich bin so glücklich in deiner Nähe sein zu können.«
»Ich bin auch glücklich.«
»Gestern hast du wahrscheinlich wegen des Unfalls unseren Morgenspaziergang ausgelassen«, mutmaßte Friedrich. »Ich habe den ganzen Tag auf dich gewartet, dann endlich hat mich deine Nachricht erreicht.«
Carolina hielt inne und schaute sich um. Ihre Miene verriet Bestürzung. Friedrich wurde mulmig zumute. »Komm in die Seitengasse.« Carolina zog Friedrich in den Schatten eines Torbogens.
»Carolina, was ist mit dir? Du zitterst ja förmlich.«
»Ich konnte dich gestern nicht treffen, weil ich den ganzen Tag geweint habe.«
»Hat dich der Unfall so mitgenommen?«
»Schlimmer. Es ist eine Katastrophe!«
»Was hast du?«
Sie schnappte nach Luft. »Papa hat Heiratspläne für mich.«
»Oh nein!«
»Doch.«
»Hat er einen Bräutigam ausgesucht?«
»Ich soll Arthur von Brendelberg heiraten.«
»Aus dem Hause Brendelberg?«
»Ja.«
»Das ist in der Tat eine Katastrophe!«
»Ich habe Arthur schon vor Jahren kennengelernt, und einmal, oder zweimal im Jahr laufen wir einander über den Weg. Er ist mir absolut zuwider.«
»Kannst du deinem Vater diese Pläne nicht ausreden?«
Carolina seufzte bitter. »Wenn sich mein Vater etwas in den Kopf gesetzt hat, dann ist er nicht davon abzubringen. Er ist die Sturheit in Person.«
»Was sollen wir nur tun?«
»Lieber stürze ich mich kopfüber vom Schiff ins Meer, als Arthur von Brendelberg zu heiraten.«
Friedrich umarmte Carolina und drückte sie fest an sich. »Wir stürzen uns gemeinsam ins Meer. Im Reich Poseidons sind wir auf ewig vereint.«
*
Das Leben an Bord barg manche Entbehrungen, manchmal war der Alltag eintönig und die Arbeit eine Last, aber wie schon bei den drei vorherigen Fahrten der Thalia spürte er auch diesmal ein wohliges Fieber. Wer würde an Bord kommen? Waren schöne Frauen dabei, die auf hoher See mehr als nur spektakuläre Sonnenuntergänge erleben wollten? Waren Männer dabei, die bei einem guten Blatt auch größere Beträge setzten? Würde es Streit unter den Passagieren geben? Würden die Passagiere sich über das Leben an Bord beklagen? Über die Verpflegung auf den Schiffen des Österreichischen Lloyds hatte es noch nie Beschwerden gegeben. Im Gegenteil, die Norddeutschen, die Engländer, die Holländer und die Schweden konnten es oft gar nicht glauben, dass auf den Schiffen so gut gekocht wurde. Und dass immer erstklassiger Wein serviert wurde.
Georg Steyrer hatte in seinem Leben manches versucht. Den Beruf des Barbiers hatte er in Wien erlernt, später hatte er als Croupier im Casino gearbeitet, in Klosterneuburg war er Mundschenk bei einem versoffenen Baron und danach war er Buchmacher auf der Trabrennbahn in der Wiener Krieau gewesen. Doch nichts kam bislang gegen das Leben als Steward an. Ferne Länder, die hohe See, der weite Horizont. Seine Heimatstadt Marburg war ihm schon in jungen Jahren zu eng geworden, also war er zur Lehre in die Hauptstadt gegangen. Er hatte sich sofort in Wien verliebt, hatte sich in Spielhöllen, Varietés und Bordellen herumgetrieben, war regelmäßig Gast in Bierhäusern und Heurigen gewesen. Das Leben war ein einziges Spiel gewesen, eine verruchte Affäre und ein bombastischer Rausch. Leider war ihm das Glück nicht dauerhaft hold gewesen, und Pech im Spiel hatte sich hinzugesellt. Schnell hatte er sich bei gewissen Subjekten der Wiener Halbwelt unbeliebt gemacht, sodass er das wunderbare Leben in Wien hatte beenden müssen. Ein halbes Jahr war er von Stadt zu Stadt gezogen, zuerst hatte es ihn nach Budapest, dann nach Brünn, später nach Prag und Linz verschlagen, schließlich war er wieder in Graz gestrandet. In Lumpen gehüllt, ohne Wohnsitz, ohne Geld, ohne Perspektive, aber immer randvoll mit Wein. Er hatte schon befürchtet, dass er vor die Hunde gehen würde.
Dann, eines Tages, hatte er in einer Schenke in einer alten Zeitung einen Artikel gelesen, der sein Leben verändert hatte. Er handelte von den Plänen, den Liniendampfer Thalia in die erste Yacht für Vergnügungsfahrten des Österreichischen Lloyds umzubauen. Sofort war er von Fernweh gepackt. Warum hatte er nicht früher an diese Möglichkeit gedacht? Der große Hafen von Triest war das Tor zur weiten Welt, zahlreiche Schiffe dampften unter der rot-weiß-roten Fahne in den sonnigen Süden. Und der Gedanke, auf einem Schiff zu arbeiten, das gebaut wurde, allein um dem Vergnügen zu dienen, ergriff von ihm Besitz. Was für eine großartige Idee, was für ein famoser Plan!
Von Bekannten hatte er Geld geliehen. Er hatte die unmäßige Trinkerei bleiben lassen, hatte seine Garderobe aufgebessert und war in den Zug nach Triest gestiegen. Schon während der Fahrt hatte er begonnen, Italienisch zu lernen. In den ersten Wochen in Triest hatte er jede nur erdenkliche Arbeit angenommen, bei der er Italienisch sprechen musste. So hatte er im Fluge so viel erlernt, dass der Alltag in Triest und an Bord eines Schiffes kein Problem mehr darstellte. Daraufhin hatte er sich bei der Direktion des Österreichischen Lloyds um eine Stelle als Steward beworben. Er wurde sofort eingestellt. Ein Steward, der einen Gesellenbrief als Barbier vorweisen konnte, da wurde nicht lange gefackelt. Die Schifffahrtsgesellschaft suchte händeringend nach tüchtigem Personal, das mehrsprachig und herzeigbar war. Das war er! In der Uniform eines Stewards sah er richtig schneidig aus. Und seine Muttersprache war Deutsch, darüber hinaus sprach er recht gut Französisch, ein bisschen Ungarisch und immer besser Italienisch. Zwei Fahrten hatte er auf der Persia gemacht, ehe er im Februar dieses Jahres für die Jungfernfahrt der Thalia als Vergnügungsdampfer das Schiff wechselte. Seitdem gehörte er zum Personal der großen Yacht.
Das Schiff lag an einem Molo im Lloydarsenal und wurde für die Fahrt beladen. Georg zählte die Weinkisten und machte auf seiner Liste entsprechende Vermerke. Laufend schoben Hafenarbeiter ihre Karren die Gangway hoch. Fleisch, Wurst, Kartoffeln, allerlei Gemüse, Vorrat für über hundertsechzig Passagiere und die Besatzung. Der Schiffskommissär und der Küchenchef kontrollierten die Warenlieferungen.
Paolo Glustich, der Schiffskommissär, rief Georg zu sich. Glustich zog die Nähe zu Männern derjenigen zu Frauen vor, das war Georg beim ersten Blickkontakt klar geworden. Die beiden Männer waren schnell gute Freunde geworden, nachdem Glustich verstanden hatte, dass Georg zwar kein Interesse an intimen Kontakten hatte, aber Homosexuellen diskret, tolerant und ohne jede Herablassung gegenübertrat.
»Georg, bitte bringe die Liste mit den Fahrgästen dem Ersten Offizier auf die Brücke«, sagte Glustich und reichte Georg einen Umschlag.
»Ist die Liste jetzt vollständig?«
»Ja. Wir haben alle Namen.«
»Wird gemacht«, sagte Georg, klemmte die Mappe unter die Achsel und stieg die Treppe zum Brückendeck hoch. Als er das Bootsdeck erreicht hatte, siegte die Neugier. Wer würde sich in zwei Tagen einschiffen? Waren vielleicht berühmte Persönlichkeiten dabei? Schauspieler? Sänger? Adelige? Er stellte sich hinter eines der Rettungsboote und blätterte den Umschlag auf. Unverkennbar, der Schiffskommissär hatte die Namensliste persönlich geschrieben. Georg kannte keinen Mann, der über eine so ausgesucht schöne Handschrift wie Glustich verfügte. Georg überflog die Namen. Wer hatte die vier Luxuskabinen reserviert?
Georg erschrak. Für eine Weile hielt er die Luft an. Dann starrte er hinaus auf das offene Meer. Was sollte er jetzt tun? Wie sollte er sich verhalten? Würde die Situation eskalieren? Hatte er sich geirrt? Er las den Namen erneut. Kein Zweifel. Die Namen waren deutlich zu lesen. Eine der Luxuskabinen auf dem Promenadendeck war reserviert für Maximilian Eugen Graf von Urbanau, die gegenüberliegende Kabine für die Komtess Carolina Sylvia von Urbanau.
Georg klappte den Umschlag zu. Innerlich war er aufgewühlt, aber seine Miene verriet nichts. Echte Spieler durften sich niemals etwas anmerken lassen.
*
Der Abend war über die Stadt gesunken, und mit dem Sonnenuntergang hatte der kühle Wind aufgefrischt. Dennoch war Bruno warm, er öffnete die Knöpfe seines Sakkos. Er war mit schnellen Schritten den Hang von Gretta hochgestiegen. Vorsichtig schaute er sich um. In den Häusern der kleinen Siedlung brannten Lichter, niemand war mehr auf der Straße, niemand hatte ihn gesehen, also duckte er sich in das Unterholz und schlich von hinten auf das Haus zu. Durch das Fenster sah er einen Lichtschein in der Stube. Er lehnte sich an die Mauer und spähte vorsichtig in das Innere. Auf dem Tisch spendete eine Petroleumlampe auf kleiner Flamme ein bisschen Helligkeit. Schliefen die Buben schon? Er wartete eine Weile. Dann hörte er knarrende Dielen und schaute wieder durch das Fenster.
Da war Fedora! Sie trug ihren Strickkorb und setzte sich an den Tisch. War sie allein? Er wartete. Fedora drehte den Docht etwas höher und schon wurde es heller. Sie griff nach ihren Stricknadeln. Zweifellos schliefen ihre Söhne und sie ließ den Tag mit ihrer Handarbeit ausklingen.
Bruno tippte mit dem Fingernagel gegen die Scheibe. Ihr vereinbartes Signal. Fedora blickte sofort zum Fenster, erhob sich, ging zur Treppe und horchte in das Haus, ob wirklich alle schliefen. Dann eilte sie auf leisen Sohlen zum Fenster.
»Bruno! Für heute sind wir doch nicht verabredet.«
»Morgen muss ich an Bord der Thalia, übermorgen legt der Dampfer ab.«
»Du musst auf See?«
»Für dreieinhalb Wochen. Ich bin hier, um mich zu verabschieden.«
Fedora biss sich auf die Lippen. »Ich komme raus.«
Sie schloss das Fenster. Bruno huschte hinüber zur Scheune und wartete im Dunklen. Wenig später kam Fedora, küsste Bruno und sperrte die Scheunentür auf. Die beiden verschwanden darin. In der kleinen Scheune hinter dem Haus befanden sich der Hühnerstall, ein Lagerraum für den Pferdewagen und das Gartenwerkzeug, eine gemauerte Waschküche und ein Heuboden. Da Carlo Cherini schon vor Jahren sein Pferd verkauft hatte, wurde der Pferdewagen nur selten verwendet und der Heuboden stand leer. Fedora wartete, bis Bruno ihr in die Waschküche gefolgt war, dann schloss sie die Tür, zog die Vorhänge zu und zündete eine Kerze an.
»Wie kommt es, dass du auf See musst?«
»Setz dich zu mir«, sagte Bruno. Er nahm auf der breiten Bank Platz und erzählte in kurzen Worten von seinem Auftrag.
Fedora rückte näher und strich Bruno durch das Haar. »Du bist also den Berg hochgestiegen, um dich von mir für dreieinhalb Wochen zu verabschieden?«
Auch Bruno rückte näher. »Nur deswegen.«
»Ich fühle mich durch deine Aufwartung geschmeichelt.«
Bruno umfasste Fedoras Hüfte und schmiegte seine Wange an die ihre. »Und ich fühle mich geschmeichelt, weil du mich wieder in deine Waschküche eingelassen hast.«
»Ein Ort der Sauberkeit und Pflege.«
»Und ein Ort wiederholt erquicklicher Begegnungen.«
»Ich wäre dir monatelang böse gewesen, wenn du ohne Abschied zur See gegangen wärst.«
»Ich wäre monatelang untröstlich darüber gewesen.«
»Hast du einen Pariser dabei?«
»Ein kleines Päckchen der bewährten Marke Sigi befindet sich in der Innentasche meines Sakkos.«
»Du bist so gewissenhaft.«
»Es freut mich, dass du meine Tugenden schätzt.«
»Küss mich, Herr Inspector.«
*
»Wann kommt der Wagen?«
»Er kann jeden Moment hier sein.«
Heidemarie Zabini überblickte das bereitstehende Gepäck ihres Sohnes. Drei Koffer standen in der Stube seiner Wohnung. Darunter war neben zwei großen Koffern für die Kleidung auch der dunkelbraune Lederkoffer, den Bruno bei Tatortbesichtigungen stets dabeihatte. Heidemarie verschränkte die Arme. »Wirst du den Tatortkoffer brauchen?«
Bruno zuckte mit den Achseln. »Das weiß ich nicht, aber da ich dienstlich im Einsatz bin, möchte ich meine Kommissionstasche jederzeit in Griffweite haben.«
»Fährst du ins Arsenal?«
»Nein. Die Thalia hat ihren Liegeplatz am Molo San Carlo eingenommen. Das Schiff ist laut Plan in den Morgenstunden vom Arsenal in den alten Hafen gelaufen. Der Vorrat für die lange Reise ist an Bord, jetzt fehlen nur noch die Fahrgäste.«
»Und dieser Graf ist wirklich eine so bedeutende Persönlichkeit, dass er einen Wachmann braucht?«
»Offenbar. Sonst wäre mir nicht dieser Auftrag übertragen worden.«
Wie üblich sprachen Mutter und Sohn in für Triest unüblichem Wienerisch. In ihrer beider Muttersprache.
»Wird es gefährlich werden?«
»Möglich, aber es ist auch gefährlich, bei einer Rauferei in einem Bierhaus einzuschreiten.«
Heidemarie grinste schief. »Wahrscheinlich wird überhaupt nichts geschehen und du bist auf Staatskosten dreieinhalb Wochen auf Vergnügungsfahrt in der Ägäis. Du wirst dich fadisieren.«
»Das hat Emilio auch gesagt.«
»Wahrscheinlich frisst diesen Wicht wieder der Neid, weil du den Befehl zur Vergnügungsfahrt erhalten hast und nicht er.«
Bruno schmunzelte. »Kann es sein, dass du meinen Arbeitskollegen persönlich kennst?«
»Hast du Bücher mit?«
»Nur eines. Die Thalia verfügt über eine gut bestückte Bibliothek.«
»Ein Wunder, dass du so kurzfristig überhaupt noch eine Kabine erhalten hast. Die Vergnügungsfahrten der Thalia sind außerordentlich beliebt und die Kabinen viele Wochen vor der Abfahrt ausverkauft.«
»Ich habe die Reservekabine erhalten, in der normalerweise Ausrüstung und Ersatzkleidung für die Mannschaft gelagert wird.«
Heidemarie runzelte die Stirn. »Ein seltsamer Auftrag ist das schon. Kannst du dein Amt als Polizist der Stadt Triest auf hoher See überhaupt ausüben?«
»Kann ich nicht. Ich reise in verdeckter Mission. Offiziell bin ich ein Angestellter des Lloyd auf Inspektionsreise. Nur der Kapitän und die Offiziere dürfen wissen, dass ich Polizist bin.«
Heidemarie lächelte hintergründig. »Na, vielleicht wird deine Geheimmission doch spannend. Wie ich dich kenne, wirst du um ein paar Geheimnisse mit den an Bord befindlichen Damen der guten Gesellschaft nicht umhinkönnen.«
Bruno schüttelte mit säuerlicher Miene den Kopf. »Du und deine Vorstellungen vom Leben auf Schiffen. Ich fürchte eher die ersten Tage auf See. Wenn wir hohen Seegang haben, sterbe ich.«
»Ach, ein echter Triestiner muss ein bisschen Seekrankheit aushalten.«
»Das hat Herr Gellner auch gesagt.«
»Übrigens, ich habe mich mit Signora Cherini angefreundet.«
»Wie das?«
»Dumme Frage! Menschen freunden sich durch Gespräche miteinander an.«
Bruno verdrehte die Augen. »Ich hoffe, ihr habt nicht allzu abfällig über mich gesprochen.«
»Nur ein bisschen. In jedem Fall ist Fedora eine beeindruckende Frau. Sie hat Persönlichkeit.«
»Das ja.«
»Und ich habe gesehen, dass du gestern knapp nach Sonnenuntergang außer Haus gegangen bist. Ich kann mir denken, wo du warst.«
»Du bist schlimmer als jeder Polizeiagent.«
»Darauf bin ich stolz! Und jetzt, mein Herr Sohn, lebe wohl, passe auf dich und diesen Grafen Sowieso auf und komme heil von deiner Seereise zurück. Der Wagen ist gerade vorgefahren.«
*
Das Leben war bloß Mummenschanz. Eine lächerliche Täuschung. Ein peinlicher Irrtum. Nichts hatte Bestand. Als Knabe hatte er gebetet. An Gott und an den Segen der Heiligen geglaubt.
Unfug.
Der einzige Gott, der es Wert war, angebetet zu werden, war der Kriegsgott Mars. Die einzigen Heiligen, denen man Ehrerbietung entgegenbringen sollte, waren die Manen, die Geister der Toten der römischen Mythologie.
Alles andere war Humbug.
Als er in der prallen Mittagssonne vor dem weißen Schiff stand, dachte er an den Fährmann Charon, der die Seelen der Toten über den Styx in den Hades übersetzte. Die einzige Reise, für die sich lohnte, Münzen zu entrichten.
Wie viele Menschen würden sterben, wenn das Schiff von einem Orkan gegen schroffe Klippen geworfen würde? Oder wenn auf hoher See ein großes Leck in die Bordwand geschlagen würde? Vielleicht durch eine mächtige Explosion?
Sollte er vorsorglich die Rettungsboote manipulieren?
War für eine amüsante Idee!
*
Bruno las den eben verfassten Brief, setzte noch einen Beistrich und blies auf das Papier, damit die Tinte schneller trocknete. Er hatte sich Zeit genommen und Mühe gegeben, die Zeilen aufzusetzen.
Luise hatte ihm in den letzten vier Wochen vier Briefe geschrieben, und jeder einzelne war nicht nur Schrift auf weißem Papier, es waren in Worte gekleidete literarische Perlen von sinnlicher Schönheit. Von Anfang an hatte Bruno Luises geradezu zauberhafte Poesie bewundert. Er war außerstande, solche Briefe wie Luise zu schreiben, diese Fähigkeit fehlte ihm. Er konnte sich lediglich bemühen, ihren hohen Geschmack nicht zu beleidigen. Und bislang war es ihm gut gelungen. Behauptete zumindest Luise.
Bruno faltete den Brief und steckte ihn in ein Couvert. Mit klarer Schrift schrieb er die Adresse ihrer Stadtwohnung darauf. Natürlich würde er niemals einen persönlichen Brief an die Adresse ihres Landhauses schicken. Ihr Mann war zwar die meiste Zeit des Jahres auf Reisen, aber wenn er zu Hause war, dann kontrollierte er Luises Korrespondenz. Bruno schüttelte den Kopf. Wie hatte eine so falsche Ehe bloß geschlossen werden können? Nichts, rein gar nichts verband Luise mit ihrem Mann, außer die vor Gott und dem Kaiser geschlossene Ehe, in die sie als halbwüchsiges Mädchen gedrängt worden war. Hier der bullige Freiherr von Callenhoff, ein Großwildjäger, ein seelen- und geistloser Tyrann, der sich ungeniert in aller Öffentlichkeit ordinäre Mätressen hielt, dem allein Macht und Geld Vergnügen bereiteten, und dort die feinsinnige und edle Tochter des alten Unterkrainer Adelsgeschlechts von Kreutberg. Diese Ehe war von vornherein dazu verdammt gewesen, unglücklich zu sein. Ehen wie diese waren für Bruno der Anlass, unverheiratet zu bleiben.
Vier Wochen war Luise zu Besuch bei ihrer älteren Schwester in der Nähe von Brünn gewesen. Diese hatte einen mährischen Adeligen geheiratet, in dessen Landhaus sie zusammen mit ihren Kindern lebten. Die vier schönen Töchter des Barons Kreutberg waren allesamt standesgemäß verheiratet worden, Luise an die obere Adria an den Freiherrn von Callenhoff. Die Wünsche und Sehnsüchte der jungen Baronessen waren nicht der Rede wert gewesen. In zwei Tagen würde sie von ihrer Reise zurückkehren. Mit steigender Intensität hatte sie in ihren Briefen von der Vorfreude geschrieben, Bruno wiederzutreffen. Und jetzt würde er nicht auf dem Bahnsteig warten können, wenn sie ankam, sondern befand sich auf einem Schiff irgendwo inmitten der Adria. Bruno wusste, wie sensibel Luise war, er ahnte ihre Verzweiflung, ihn nicht zu treffen, er sorgte sich um sie. Einen Brief zu schreiben, war das Mindeste und gleichzeitig das Äußerste, was er in dieser Situation tun konnte.
Als er an Bord gekommen war, hatte er sich gleich in seine Kabine zurückgezogen, seine Koffer abgestellt und sich an das kleine Tischchen gesetzt, um zu schreiben. Rund eine halbe Stunde saß er nun daran. Bruno klebte das Couvert zu und schrieb als Absender seinen Decknamen.
Es klopfte. Bruno erhob sich und öffnete die Kabinentür. Vor ihm stand der Schiffsjunge.
»Ja, bitte?«
»Der Kapitän wünscht Sie zu sprechen.«
»Ich komme.«
Bruno schlüpfte in sein Sakko und steckte den Brief ein. Nach der Unterredung würde er noch zum Hafenpostamt laufen. Einerseits, um den Brief aufzugeben, und andererseits, um nachzusehen, ob das erwartete Telegramm aus Wien eingetroffen war. Natürlich hatte er bei seinem ehemaligen Kommilitonen Robert Bernsteiner im Ministerium angefragt, ob er für den bevorstehenden Auftrag noch vertiefende Informationen bekommen könnte. Sie hatten gemeinsam in Graz Vorlesungen bei Professor Gross besucht und waren in Brunos Grazer Jahr dicke Freunde geworden. Robert bekleidete mittlerweile als Jurist im Ministerium ein bedeutendes Amt. Die beiden schrieben einander regelmäßig, und einmal hatte Robert mit seiner Familie Bruno in Triest besucht.
Der Schiffsjunge flitzte die Treppe zum Brückendeck hoch und öffnete Bruno die Tür. Bruno trat auf die uniformierten Männer zu und nahm Haltung an.
»Guten Tag, Herr Kapitän, meine Verehrung, die Herren. Bruno Zabini meldet sich wie befohlen zur Stelle.«
Kapitän Karl Freiherr von Bretfeld nahm Bruno in Augenschein. »Ah, ja, sehr gut. Die Offiziere bleiben hier, alle anderen bitte ich, die Brücke für die Dauer der Unterredung zu verlassen.«
Die anwesenden Herren waren von diesem Befehl überrascht, führten ihn aber unverzüglich aus. Der Kapitän, der Erste, der Zweite und der Dritte Offizier standen Bruno gegenüber, drei weitere Seeleute verließen die Brücke. Der Kapitän zog aus der Tasche seines Uniformrockes einen Brief hervor und reichte ihn dem Ersten Offizier.
»Sie sind von der Triester Polizei, Signor Zabini?«
»Jawohl, Herr Kapitän. Inspector I. Klasse des k.k. Polizeiagenteninstituts.«
»Der Brief des Statthalters ist in mancher Hinsicht dunkel, in anderer sehr konkret. Dunkel, wenn es um die Bedrohungslage des Herrn Grafen geht, sehr klar, was den Auftrag des Statthalters an Sie betrifft.«
»Herr Kapitän, ich hoffe sehr, dass meine Anwesenheit an Bord zu keinen Unannehmlichkeiten führt.«
»Das hoffe ich auch. In jedem Fall teilt mir die Direktion des Österreichischen Lloyds mit, dass Ihre Anwesenheit ausdrücklich erwünscht ist und ich Sorge zu tragen habe, dass Sie bei aller nötigen Diskretion Ihre Aufgabe erfüllen können.«
»Ich danke im Namen der Polizeidirektion für die Kooperation.«
»Sobald wir ablegen, befinden wir uns nicht mehr im Hoheitsgebiet der Stadt Triest. Ihre Amtsgewalt erlischt damit.«
»Das ist mir klar.«
»Sie wissen, dass ich an Bord absolute Befehlsgewalt habe?«
»Jawohl.«
»Der Plan ist, dass Sie sich mit verdeckter Identität an Bord aufhalten?«
»Das ist der explizite Wunsch Seiner Exzellenz des Statthalters. Ich gebe mich als Mitarbeiter des Lloyds aus, der an Bord ist, um eine technische Inspektion des Umbaus der Thalia während der Fahrt durchzuführen.«
Der Kapitän zog die Augenbrauen hoch. »Wenn Sie diese Geschichte gut erzählen, werden die Passagiere sie wohl glauben, aber achten Sie auf Fragen der Bordmannschaft. Wenn Sie falsche Antworten geben, werden die Leute skeptisch.«
»Ich bin vorbereitet. Mein langjähriger Freund und Billardpartner Lionello Ventura ist Schiffbauingenieur im Lloydarsenal. Er arbeitet im Konstruktionsbüro und war auch beim Umbau der Thalia beteiligt. Sämtliche Rohrpläne der Wasserversorgung sind auf seinem Reißbrett entstanden. Ich bin zwar Polizist, habe aber ein großes Interesse an Technik und beschäftige mich seit Jahren mit den Grundlagen des Schiffsbaus.«
»Und warum geben Sie sich nicht als Mitarbeiter des Lloyds auf Urlaubsreise aus? Das wäre doch einfacher.«
»So ist es leichter zu erklären, wenn ich Bereiche betrete, die normal für Fahrgäste verboten sind. Etwa den Kesselraum. Oder Lagerräume. Ich brauche volle Bewegungsfreiheit an Bord. Und im Fall des Falles brauche ich auch Zugang zur Marconi-Station, um schnell über Funk Mitteilungen zu versenden.«
»Sie haben sich also Ihre Identität wohl überlegt.«
»So gut es in der kurzen Zeit möglich war.«
»Haben Sie einen entsprechenden Pass?«
»Ich reise unter meinem echten Namen, daher kann ich auch meinen Pass verwenden. Die Direktion des Lloyds hat mir die nötige Befugnis für die Nutzung von Telegraphen und sonstiger Postdienste in den fremdländischen Niederlassungen ausgestellt.«
»Also dann, die Herren Offiziere wissen hiermit über Ihre wahre Identität Bescheid, ansonsten bewahren wir Stillschweigen. Wir entsprechen den Wünschen des Herrn Statthalters.«
»Besten Dank. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass Graf Urbanau mich persönlich kennt. Als der Mordanschlag an seinen Fahrer verübt worden ist, sind wir einander begegnet.«
»Ich verstehe. Also werde ich auch den Herrn Grafen zu einer Unterredung bitten.«
»Das wäre bestimmt hilfreich.«
»Sind Sie bewaffnet, Herr Inspector?«
»Ja. Ich habe meine Dienstwaffe im Gepäck.«
»Ich erlaube Ihnen, die Dienstwaffe zu behalten, aber ich fordere Sie offiziell dazu auf, die Waffe in einem versperrten Behälter zu verwahren. Verfügen Sie über einen derartigen Behälter?«
»Ja, ich habe eine Metallkassette dabei, in die der Revolver bereits verschlossen ist. Den Schlüssel zur Kassette trage ich immer bei mir.«
»Gut. Sollten Sie einen Verdacht hegen, dass es an Bord zu einem Anschlag kommen könnte, bitte ich um sofortige Nachricht. Die Herren Offiziere und ich müssen über alle polizeilich relevanten Vorfälle unverzüglich und vollständig informiert werden.«
»Selbstverständlich, Herr Kapitän.«
Kapitän Bretfelds Miene entspannte sich, er trat auf Bruno zu und reichte ihm die Hand. »Nun denn, Herr Inspector, dann hoffe ich für Sie und für uns, dass Sie lediglich ein paar erholsame Tage an Bord der Thalia verbringen werden. Das ist schließlich ein Vergnügungsdampfer.«
Bruno lächelte und schüttelte zuerst die Hand des Kapitäns, dann die der Offiziere. »Das hoffe ich auch, Herr Kapitän. Zuerst aber hoffe ich, dass sich die Seekrankheit in Grenzen hält. Ich bin eine Landratte.«
Der Kapitän klopfte Bruno aufmunternd auf die Schulter. »Das wird schon werden. Das Wetter ist gut, in den nächsten Tag sind weder Stürme noch raue See zu erwarten.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr. Herr Kapitän, meine Herren, ich empfehle mich.«
*
»Nun seht euch dieses Meisterwerk schiffsbaulicher Kunstfertigkeit im adriatischen Licht der untergehenden Maiensonne an! Welch wohlgeratenes Stück Eisen, geschmiedet im Aufgang einer neuen Zeit und Hoffnung. Ich bin auf das Äußerste enthusiasmiert!«
»Oh ja, ein schönes Schiff.«
»Wohl gerecht, dass die göttliche Thalia diesem Schiffe ihren Namen lieh, denn Menschen, die solches im Schweiße ihres Angesicht zu verfertigen verstehen, müssen gar von der lieblichen Muse geküsst worden sein. Inspiration nenne ich es, das Seefahrzeug strahlend weiß im Korpus über der Wasserlinie und grün unter der Wasserlinie zu tünchen, wozu auch das Gelb des Schornsteins trefflich sich fügt.«
Ferdinand Seefrieds Ohren schmerzten. Seit der Abfahrt des Zuges noch vor Sonnenaufgang teilten seine Frau Hermine und er das Coupé mit Therese Wundrak. Von Wien bis Triest, mehr als zwölf Stunden Bahnfahrt! Die bekannte Reporterin und Reiseschriftstellerin Wundrak war so entzückt darüber gewesen, im Zug reizende junge Menschen getroffen zu haben, die nicht nur mit ihr bis nach Triest fuhren, sondern auch beabsichtigten, dasselbe Schiff für eine Vergnügungsfahrt zu besteigen, dass sie in einem nicht enden wollenden Strom von den Abenteuern auf ihren vielen Reisen erzählt hatte. Praktisch ohne Pause.
Ferdinand war vor Kurzem einunddreißig Jahre alt geworden und noch nie hatte er solche schändlichen Gedanken gehegt, doch bereits knapp nach Graz hatte er überlegt, Frau Wundrak aus dem Zugfenster zu werfen. Und knapp vor Laibach hatte er ernsthaft erwogen, sich selbst aus dem Fenster zu stürzen. Zwischenzeitlich gelang es ihm immer wieder durch Vortäuschung einer Blasenschwäche, seinem Gehör für wenige Minuten Linderung zu verschaffen. Denn Frau Wundrak redete nicht nur unmäßig viel, sie verfügte auch über eine Stimmkraft, die jedem Feldwebel am Kasernenhof Respekt abringen musste. Erstaunlicherweise schien Hermine nicht unter der Fülle der auf sie niederprasselnden Worten zu leiden, im Gegenteil, Hermine war sehr schnell sehr vertraut mit Frau Wundrak geworden.
Doch selbst eingedenk seiner mittlerweile höchst gereizten Nerven konnte Ferdinand nicht umhin, die Begeisterung der beiden Damen zu teilen. Die Thalia bot im letzten Licht der Abendsonne einen prächtigen Anblick. Und ja, der strahlend weiße Lack des Salondampfers schien in der Abendstimmung förmlich zu glühen. Fernweh ergriff ihn. Über drei Wochen würde dieser Dampfer sein Zuhause sein. Was für eine großartige Idee, die Kreuzfahrt zu unternehmen! Anfangs war er davon nur wenig begeistert gewesen. Warum sollte er sich in eine stählerne Kabine zwängen? Wozu die antiken Orte in Griechenland besuchen? Weshalb am Markt der osmanischen Metropole Konstantinopel spazieren gehen? Aber Hermine war so voller Vorfreude gewesen, dass diese auch langsam auf ihn übergeschwappt war. Und sie hatte mehrmals in der Buchhandlung am Graben Bücher über das Mittelmeer und über die Kultur der alten Griechen gekauft. Auch Reisebeschreibungen hatte sie verschlungen. Er hatte nicht alle Bücher gelesen, die Hermine gekauft hatte, aber doch einige mit wachsendem Interesse.
Therese Wundrak hakte sich mit der Linken bei Ferdinand ein und funkelte ihn an. »Nun, mein Lieber, was sagen Sie zu unserem Schiff?«
Die unmittelbare körperliche Nähe der groß gewachsenen Frau war ihm unangenehm, doch er wagte nicht, sich von ihr zu lösen. »Frau Wundrak, ich stimme Ihnen zu. Das Schiff sieht großartig aus.«
Mit der Rechten hakte sich Therese bei Hermine ein und zog sie an sich. »Liebe Freundin, ich bitte dich inständig, ein Wort an deinen Göttergatten zu richten. Ich habe ihm schon dreimal streng aufgetragen, mich bei meinem Kosenamen zu nennen. Nein, er weigert sich beständig, mir diese Intimität zu gewähren.«
Hermine schaute mit strengem Blick zu Ferdinand. »Ferdi, jetzt tu doch, wie die Resi sagt.«
»Also gut«, sagte Ferdinand seufzend. »Liebe Resi, ich stimme dir zu. Die Thalia ist ein Prachtstück.«
Therese lachte lebhaft. »Sieh an, es geht ja! Was bin ich hocherfreut. Und stellt euch nur vor. Morgen schon stechen wir in See. Das Leben ist erquicklich und schön, nicht wahr?«
Ferdinand löste sich von Therese. »Da kommt der Dienstmann mit unserem Gepäck. Ich kümmere mich darum, dass es an Bord gebracht wird.«
Am Molo San Carlo herrschte wie zu jeder Zeit Hochbetrieb. Eben legte ein Dampfer der dalmatinischen Eillinie ab. Der Zug aus Wien hatte weitere Fahrgäste gebracht, die nun vor der Gangway der Thalia standen. Es wurde lebhaft.
*
Das erste Licht des anhebenden Frühlingstages näherte sich der oberen Adria, begleitet von einem milden Südwind. Friedrich regte sich, brummte und schlummerte weiter. Carolina hingegen erwachte. Welch ein Wunder! Friedrich schlief neben ihr. Es war kein Traum, der nun verschwand. Nein, der Traum begann erst, als sie verstand, dass sie nicht alleine war. Ein Mirakel fürwahr, und doch die Wirklichkeit. Was für eine Nacht! Wohlige Schauer durchliefen sie. Sie schmiegte sich an Friedrich, fühlte seine nackte Haut, seinen schlanken Körper und seine Nähe.
Die wahre Liebe! Hier und jetzt!
Beim gestrigen Abendessen war es zu einer unschönen Szene gekommen. Ihr Vater hatte von ihr wissen wollen, was sie nun nach einem Tag Bedenkzeit von der geplanten Vermählung hielt. Carolina war erst vorsichtig gewesen und hatte um weitere Bedenkzeit gebeten. Ihr Vater hatte nicht lockerlassen wollen und auf eine Stellungnahme insistiert, also hatte sie ihre Ablehnung vom Vortag bekräftigt. Daraufhin hatten Vater und Tochter das Abendessen in gedämpfter Stimmung und ohne weitere Worte hinter sich gebracht. Carolina war auf ihr Zimmer gegangen. Dort hatte sie ihr Vater aufgesucht und zur Rede gestellt. Ein Wort hatte das andere ergeben, beide waren laut geworden, ihr Vater hatte mit einem Abbruch der Reise gedroht und weitere Strafmaßnahmen angekündigt, falls sie es weiterhin an Folgsamkeit derart mangeln ließ. Im äußersten Falle würde er, so hatte er ihr gedroht, sie bis zu ihrem einundzwanzigsten Geburtstag in ein Kloster stecken. Damit hatte er ihr Zimmer verlassen und sich in den Rauchsalon des Hotels begeben. Carolina hatte eine Stunde in ihrem Zimmer gewartet, und als sie gehört hatte, dass ihr Vater sich für die Nachtruhe zurückgezogen hatte, war sie losgelaufen, um sich mit Friedrich zu treffen.
In Tränen aufgelöst hatte sie ihm vom Streit mit ihrem Vater berichtet. Hatte ihm von der Aussicht erzählt, für mehrere Monate in ein Kloster gesperrt zu werden. Stundenlang waren sie durch die Straßen der Stadt gelaufen, irgendwann waren sie zu Friedrichs Herberge gelangt, hatten sich geküsst, immer und immer wieder, und ohne das Küssen zu unterbrechen, hatten sie auf einmal nackt in seinem Bett gelegen.
Er war es. Er war der Richtige und Einzige, Friedrich war ihre ganze Liebe. Und sie die seine. Das war nun und auf ewig verbrieft und besiegelt. Es war das gemeinsame Bad in einem Ozean des Glückes.
Sie strich mit ihrer Hand über seinen Rücken und küsste seine Schulter. Friedrich schlug die Augen auf, er brummte wohlig und regte sich.
»Der Himmel hat mir einen wunderschönen Traum geschickt.«
Carolina kicherte. »Du träumst nicht.«
»Bist du wirklich hier?«
»Ja.«
Er umschlang ihre Hüften und zog sie näher. »Dann ist das Leben schöner als jeder Traum.«
»Viel schöner.«
Ein Kuss, der scheinbar ewig währte, ein Kuss, der Schicksale aneinanderschmiedete, ein Kuss endloser Liebe.
Draußen am Hafen reckte eine Möwe ihren Hals, breitete die Flügel aus, fing eine Bö und ließ sich vom Wind mit wenigen Flügelschlägen in luftige Höhe hieven. Eine weitere Möwe folgte. Und mit ihr viele weitere. Die Rufe der Vögel hallten über das Hafenbecken. Die Morgensonne warf ihr erstes Licht in den Golf von Triest. Ein neuer Tag zog ins Land am Meer.