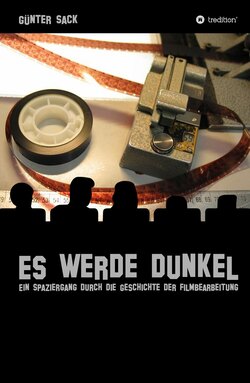Читать книгу Es werde dunkel - Ein Spaziergang durch die Geschichte der Filmbearbeitung - Günter Sack - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEs werde dunkel – Ein Spaziergang durch die Geschichte der Filmbearbeitung
Vorwort
Als Geburtsjahr des Kinos wird gern das Jahr 1885 genannt. Zu der Zeit experimentierte man in vielen Ländern an Verfahren zur Darstellung des bewegten Bildes. Der entscheidende Durchbruch auf dem Weg zur industriellen Anwendung war allerdings die Einführung des Zelluloids als Schichtträger durch die Eastman Kodak Company im Jahre 1889. Das Patent ging zwar bereits 1887 an den Amerikaner Hannibal Goodwin, der nach elf Jahren Rechtsstreit gegen Eastman gewann, jedoch hatte dieser den Filmmarkt bereits für sich erobert und konnte problemlos die Geldbuße von 5 Mill. Dollar zahlen. In Zusammenarbeit mit dem Erfinder Edison entstand der 35mm breite Film mit einer Perforation von 4 Löchern pro Bild. Am 24.08.1889 zum Patent angemeldet, wurde er zehn Jahre später zum internationalen Standard. Weltweit baute man Geräte für das neue Medium Film und schuf mit Kopieranstalten Arbeitsplätze für viele tausend Mitarbeiter. Aus dem anfänglich schwarzweißen Film mit Zwischentiteln und Klavierbegleitung wurde der Tonfilm, dessen Beginn nach etlichen Patentstreitigkeiten auf das Jahr 1929 datiert werden kann. 1936 schließlich war das Geburtsjahr des modernen Farbfilmverfahrens in Europa. Verbunden damit war die Notwendigkeit einer exakten Verarbeitung des neuen Mehrschichten-Materials unter sensitometrischer Kontrolle. Nach dem 2. Weltkrieg begann man Ausbildungsberufe für die industrielle Filmbearbeitung zu schaffen und die folgenden Jahrzehnte führten mit der Entwicklung neuer Emulsionen und präziserer Geräte zur ständigen Verbesserung der Bild- und Tonqualität im Filmtheater. Im Jahr 2003 war jedoch die Digitalisierung des Kinos absehbar und die Majors der Kinobranche legten mit einer Auflösung von 4K die technische Untergrenze für das neue Medium fest. Computerfirmen schufen mit neuer Hard- und Software die erforderlichen Voraussetzungen und in wenigen Jahren vollzog sich, vom Publikum fast unbemerkt, der Wandel vom analogen zum digitalen Kinozeitalter. Wenn man also 1889 als das Geburtsjahr der Filmrolle bezeichnen dürfte, kann man 2009 das Ende dieser Ära nennen.
Wenige Jahre später traf ich durch Zufall einen alten Schulfreund, mit dem ich ins Gespräch kam und der mich bat, etwas über meine Zeit in den Kopierwerken zu erzählen. So ergaben sich zwanglose Treffen, während denen ich rückblickend über meine Erinnerungen berichtete. Vieles konnte zu Gunsten der leichten Verständlichkeit nur ohne allzu theoretischen Ballast behandelt werden. Im Text vorkommende Namen bekannter Konstrukteure sollen stellvertretend für unzählige, hier nicht erwähnte Filmpioniere stehen.
Kaum ein anderes Medium hat die Menschen so bewegt wie der Film, der für Menschen aller Schichten 90 Minuten Entspannung vom Alltag bedeutete.
Das digitale Kino wird auch weiterhin seine Zuschauer verzaubern, aber eine Filmrolle wird sich in absehbarer Zeit in keinem Projektor mehr drehen.
„Denn es ist zuletzt doch nur der Geist,der jede Technik lebendig macht. “
(Johann Wolfgang von Goethe)
Unsere Begegnung begann an einem warmen Spätsommertag im August, ich hatte gerade meinen Einkauf an der Supermarktkasse bezahlt, der Verkäuferin einen schönen Feierabend gewünscht und meinen Einkaufswagen in Richtung Ausgang bugsiert. Kurz bevor ich ins Freie trat, hörte ich hinter mir eilige Schritte.
„Ich glaube, wir kennen uns!“ Noch während ich überlegte, woher ich diese Stimme kannte, hatte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehte mich um und sah einen schlanken, braungebrannten Typen. „Kalli Blumenthal? – das gibt’s ja nicht!“ Nach fast 50 Jahren hatte ich ihn sofort wiedererkannt. Kalli trug hellblaue Jeans zum weißen Oberhemd, dazu einen modischen Blazer und braune Sandalen. Eine Sonnenbrille steckte in seinem dunkelblonden Haar und mit seinen 1,90 m überragte er mich um fast einen halben Kopf. Seine leicht gebogene Nase in einem von feinen Fältchen durchzogenen, lederartigen Gesicht gaben ihm das Aussehen eines würdevollen Häuptlings aus einem Indianerfilm. Er fiel schon damals in unserer Klasse durch seine Größe auf, um so paradoxer war es, dass die meisten Mädels ihn „Blümchen“ nannten.
„Ich beobachte dich schon eine ganze Weile hier im Supermarkt und ehrlich gesagt, erst als ich deine Stimme hörte, wusste ich, dass du es wirklich bist“, lächelte er.
Na klar, dachte ich, meine wenigen Haare waren grau geworden, ich trug einen Dreitagebart und war etwas nachlässig gekleidet.
„Wie kommt es, dass du dich kaum verändert hast und was machst du hier in der Stadt?“ fragte ich mit leichtem Neid. „In meiner Firma musste Personal abgebaut werden und mit einer akzeptablen Abfindung hatte ich plötzlich ein paar Jahre früher Freizeit als geplant“, erwiderte er und überging den ersten Teil meiner Frage. „Und da dachtest du, mal sehen, was sich in unserer Geburtsstadt so getan hat, richtig? Das Letzte, was ich von dir wusste, war, dass du in München bei einer Zeitung gearbeitet hast“, sagte ich.
„Richtig“, meinte er, „da blieb ich auch bis zum Schluss. Wohnen tue ich allerdings in Murnau, das liegt ca. 70 km von München entfernt.“ „Murnau“, sagte ich, „da fällt mir spontan der Blaue Reiter ein, und der Stummfilm-Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau.“ „Stimmt“, sagte mein alter Schulfreund. „Du meinst die Künstlergruppe um Kandinski und Münter, dein Regisseur, der mit der Gruppe übrigens befreundet war, hieß eigentlich Friedrich Wilhelm Plumpe. Er nannte sich nach der Stadt Murnau und wurde unter diesem Namen berühmt. Hast du eine besondere Beziehung zu dem Regisseur? Du warst ja damals unser Klassenfotograf, wie ich mich entsinne.“
Ich schlug vor, bei einer Tasse Kaffee alte Erinnerungen aufzufrischen und so saßen wir uns kurz darauf in einem Restaurant gegenüber.
„Wann haben wir uns eigentlich aus den Augen verloren?“, fragte ich, nachdem die Kellnerin unsere Bestellung aufgenommen hatte. „Das kann ich dir genau sagen, Thomas“, begann mein alter Schulfreund. „Es war im August 1960. Mein Vater bekam ein Angebot von seinem Bruder, also meinem Onkel, nach München umzusiedeln. Es war dort bei einer Zeitung eine Stelle als Redakteur frei und da unsere Familie nach dem 2. Weltkrieg in alle Winde zerstreut war, bekamen wir die Gelegenheit wieder näher zusammen zu rücken.“ „Du warst nach den großen Ferien plötzlich nicht mehr da“, erinnerte ich mich. „Es muss wohl eine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein.“ „Kann man so sagen“, meinte er und sah mich mit seinen blaugrauen Augen über den Rand seiner Tasse an. „Das Land war schon geteilt, aber verriegelt war es erst nach dem 13. August 61, wie du weißt.“ „Ja“, sagte ich. „Das war eine bedrückende Zeit damals, wir waren gerade in der Pubertät und träumten von der weiten Welt, die plötzlich eng und klein wurde. Du hattest da Glück.“ „Ja, siehst du, in dem Alter ist man von den Entscheidungen der Eltern abhängig und manchmal waren sie richtig“, meinte er. „Bist du, als du erwachsen wurdest, nie in die andere Stadthälfte zurückgekehrt?“ fragte ich ihn. „Es gab doch Fördergelder und zum Bund brauchte man auch nicht.“ „Ich war öfter zu Besuch hier, fühlte mich aber immer eingeengt obwohl viele es die Insel der Glückseeligen nannten“, schmunzelte er, „aber erzähl doch mal, wie es dir in der Zwischenzeit ergangen ist, bist du verheiratet und was machst du beruflich?“
Nachdem wir uns über unsere Ehepartner, Kinder und Enkelkinder ausgetauscht hatten, fragte mich Kalli, ob ich denn, wie unsere Klassenlehrerin empfohlen hatte, Fotoreporter geworden bin.
„Nein“, lächelte ich. „In meinem späteren Beruf hatte ich zwar eine fotografische Grundausbildung, aber für eine Reporter-Karriere fehlten mir ein paar Voraussetzungen, die man damals in der DDR brauchte. Mein Plan, nach der Schulzeit Fotolaborant zu werden, wurde mir schnell von einem bekannten Berliner Fotohändler mit dem Verweis auf die erbärmlich niedrige Bezahlung ausgeredet. In den 80er Jahren fotografierte ich dann allerdings, zusammen mit meiner Frau, die ebenfalls seit ihrer Kindheit fotobegeistert ist und eine Kopierwerksausbildung hat, einige Zeit nebenberuflich.
Ich war, wie du dich richtig erinnert hast, als Schüler oft mit meinem Fotoapparat unterwegs, aber eine besondere Faszination ging für mich immer vom bewegten Bild aus. Es ist wahrscheinlich auf ein kindliches Erlebnis zurückzuführen. In den frühen fünfziger Jahren ging ich mit meinen Eltern an der Jannowitzbrücke durch eine nächtliche Straße, die so verlassen aussah, wie die Straße auf dem Bild von Franz Radziwill, weißt du? Berlin litt noch unter den Schäden des zweiten Weltkriegs, es gab viele Ruinen und aus einem offenen Fenster projizierte jemand mit einem kleinen Projektor einen Film auf die seitliche Wand einer fensterlosen Fassade. Am liebsten wäre ich bis zum Ende der Vorführung stehen geblieben, aber es war Herbst und schon recht kalt. Ein richtiges Kino hatte ich noch nie von innen gesehen und das Fernsehen steckte noch in den Kinderschuhen. Dies war, glaube ich, mein Schlüsselerlebnis. Dann kam das Jahr 1960, in den Kneipen, im Westteil der Stadt, spielten die Musikboxen Wunderland bei Nacht, von Bert Kaempfert und ich sah in einem Kino am alten Potsdamer Platz den abendfüllenden Dokumentarfilm Traumstrasse der Welt von Hans Domnick. Die Fahrtaufnahmen auf der Panamericana in CinemaScope und Farbe waren für die damalige Zeit überwältigend. Man hatte die Illusion, selbst in dem Auto zu sitzen. Das Filmplakat mit einer anmutigen jungen Frau in mexikanischer Tracht sehe ich noch vor mir. Den später gedrehten zweiten Teil konnte ich dann nicht mehr sehen, denn es kam die Teilung Deutschlands. Ein weiteres unvergessliches Ereignis war einige Jahre später die Aufführung des Films Die glorreichen Sieben in einem Freilichtkino in unserem Ort. Das war der erste Western bei uns im Osten und die Kinokarten waren im Nu ausverkauft. Wer nicht mehr reinkam saß auf den Parkbäumen oder stand an der Umzäunung. Man setzte den Film sehr schnell ab, wohl aus Angst vor Unruhen, die Grenzen waren zu der Zeit schon geschlossen. Wenn ich in unser Freilichtkino ging, versuchte ich immer einen Platz in der Mitte der letzten Reihe zu erwischen, denn von dort aus konnte man die Vorbereitungen der Filmvorführer beobachten, wenn sie an den großen, in einem Bus installierten Maschinen hantierten.“ „Den alten Potsdamer Platz habe ich noch in Erinnerung“, sagte Kalli. „Auch an die Kinos entsinne ich mich schwach.“ „Ja“, sagte ich. „Sie hießen Aladin und Camera und waren, wie ich später erfuhr, als Grenzkinos speziell für Ostberliner gedacht.“
„Von deiner Kinoleidenschaft hattest du aber in unserer Klasse nie etwas erwähnt“ sagte mein alter Schulfreund. „Ich dachte, du bist sicher Fotograf geworden.“
„Manche Zusammenhänge werden einem oft erst später klar, aber ich hatte großes Glück alles über die Entwicklung der Kinotechnik von den Anfängen bis zum Ende zu erfahren.“
„Ok“, meinte Kalli, wie wir Jungens Karl Heinz in unserer Klasse immer nannten, „Anfang gut und schön, aber ein Ende ist sicher nicht in Sicht.“ „Gut“, korrigierte ich mich. „Wenn du die Säle meinst, in denen von elektronischen Projektoren, sogenannten Beamern, Filme von Festplatten oder Servern abgespielt werden, hast du sicher Recht. Aber das Kino, wie ich es meine, begann und endete mit einer Filmrolle.“
Offenbar hatte ich Kalli´s Neugier geweckt, denn er bat mich, davon etwas genauer zu erzählen.
„Weißt du“, sagte ich, „wenn du zum ersten Mal in deinem Leben eine Filmbüchse öffnest und den Geruch einer Filmrolle in die Nase bekommst, bist du wahrscheinlich mit dem Virus Film für dein Leben infiziert. So erging es mir und sicher vielen in der Branche, die in ihrem Leben nie mehr etwas anderes machen wollten.
Wenn man in den sechziger Jahren in einem Filmkopierwerk arbeitete, konnte man sicher sein, dass die alten Hasen dort einen riesigen Erfahrungsschatz hatten und nur zu gern von ihrer Jugendzeit erzählten; wie es war als der Stummfilm vom Tonfilm abgelöst wurde, als die Filme farbig wurden und wie manches Mal ein brennender Nitrofilm ein Inferno im Kino anrichtete.“
Kalli lächelte. „Du arbeitest also in einem Kopierwerk. Das ist eine Firma, die Filme fürs Kino vervielfältigt, richtig?“
„Vervielfältigt hat“, berichtigte ich ihn, „denn die Zeiten der Filmrolle sind vorbei, aber die Geräte die dort zum Einsatz kamen und meistens nur noch im Technik-Museum zu besichtigen sind, waren das Werk vieler kluger Köpfe.
Mein Einstieg in die Filmbranche war wie gesagt in den sechziger Jahren und das betreffende Kopierwerk erst wenige Jahre alt.
Da zu Beginn im Bereich Staatliches Filmarchiv die leicht entflammbaren Nitrofilme auf Sicherheitsfilm umkopiert werden sollten, mussten bestimmte Bauauflagen eingehalten werden. Es galt in großen Teilen noch die Polizeiverordnung von 1937, die sogenannte Zellhornvorschrift. Die Gebäude in denen Filmmaterial bearbeitet wurde, durften nicht höher als 2 Etagen sein. Die Arbeitsräume bekamen selbstschließende Stahltüren und die Gänge zwischen den Projektionsräumen, den Vorführungen, wurden mit Sprinkleranlagen ausgerüstet.“
„Bei zwei Etagen“, meinte Kalli, „hatte man sicher nicht das Gefühl in eine Fabrik zu gehen.“ „Das stimmt“, bestätigte ich. „Als ich bei meiner Einstellung den ersten Rundgang machte, war ich von der Ruhe auf den Gängen beeindruckt. Alles wirkte gediegen und sauber. Einzelne Gebäudetrakte waren durch verglaste Brücken miteinander verbunden, Negativ-Schneideräume sonnige Arbeitsplätze und überall hörte man leise Musik vom hauseigenen Studio. Selbst in den Kopierkammern, in denen maximal zwei Maschinen standen, war in der Anfangszeit, als es noch keine wirklich schnell laufenden Automaten gab, das Grundgeräusch niedrig. Deutlich lauter ging es im Bereich Entwicklung zu, denn dort standen viele Entwicklungsmaschinen auf großer Fläche nebeneinander. Die Prüfräume waren, ähnlich kleinen Kinos, mit Leinwand, Sitzreihen und einem Pult ausgerüstet. Sie wurden von den Projektorräumen durch Kabinenfenster getrennt und hatten untereinander eine Sprechfunkverbindung. Dann gab es noch den Bereich Tontechnik mit der Lichtton-Umspielung, das Labor mit angeschlossener Film-Messtechnik, der sogenannten Sensitometrie, und den Bäder-Ansatzraum für die Chemikalien. Nicht zu vergessen, die Lichtbestimmung, sie war die Nahtstelle zwischen künstlerischen Vorgaben der Studios und technischer Realisierbarkeit im Kopierwerk. Weiterhin gab es noch die Räume, in denen die Filmmaterialien geschnitten und geklebt wurden. Dazu gehörten: die Rohfilmkleberei in der bei völliger Dunkelheit die zu verarbeitenden Filmlängen konfektioniert wurden, die Negativmontage, die Filmnegative kopierfertig einrichten musste, und die Positivkleberei als letzte Station vor der Auslieferung durch die Expedition an den Filmverleih. Außerdem gab es Werkstätten für alle Maschinen, ein Elektronik-Labor, einen Fuhrpark und ein Verwaltungsgebäude mit einem separaten großen Kinosaal, der sogenannten Kundenvorführung.“
„Was ist denn dein Spezialgebiet, wenn man das so sagen darf?“, fragte Kalli. „Es ist, wie du dir denken kannst, die Lichtbestimmung“, sagte ich. „Durch die ständigen Kontakte mit Kameraleuten, konnte ich einiges über Kameras und Kameratechnik erfahren. An all den anderen Geräten, die bei der Filmbearbeitung zum Einsatz kamen, habe ich während der Lehrausbildung selbst kurze Zeit gearbeitet.
Aber ich möchte dich jetzt nicht mit meinen persönlichen Erinnerungen langweilen, Kalli!“
„Im Gegenteil“, sagte mein alter Schulfreund. „Ich war zwar mal kurze Zeit in der Technik-Redaktion, hatte aber nie die Gelegenheit, mich mit dem Kino näher zu beschäftigen. Du wirst also in mir einen interessierten Zuhörer haben.“ „Wenn es so ist, dann will ich dir gerne einiges erzählen. Ich glaube allerdings, unsere Zeit wird heute nicht ausreichen.
Nach dem Krieg hatte sich in der damaligen DDR, der Industriezweig Filmbearbeitung mit der Ausbildung zum Filmkopierfacharbeiter etabliert. Bei euch im Westteil nannte man ihn anfangs Filmkopienfertiger, später dann Film- und Videolaborant. Während der Lehrzeit lernte man alle Maschinen kennen und bedienen, um sich später dann für einen geeigneten Arbeitsplatz zu entscheiden. Auch eine fotografische Grundausbildung gehörte dazu. Fotografieren mit großformatigen Plattenkameras, bei denen man anstelle eines Verschlusses den Objektivdeckel kreisend abnehmen und nach einigen Sekunden wieder aufstecken musste, über die Mittelformat-Fotografie mit einer Meister Korelle, bis zur Fotografie mit der Kleinbildkamera Praktica gehörte dazu, ebenso das eigenständige Ansetzen der Chemikalien, die Filmentwicklung und das Vergrößern der selbst aufgenommenen Bilder in der Dunkelkammer. Aber, bevor wir den Weg des Films vom Drehort bis zum Kino verfolgen, lass uns von den notwendigen Maschinen sprechen“, schlug ich vor.