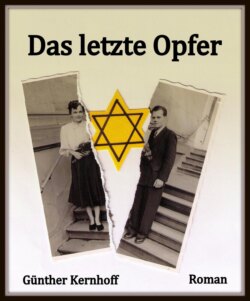Читать книгу Das letzte Opfer - Günther Kernhoff - Страница 4
2. Das Kriegsende
ОглавлениеAls im Frühjahr 1945 der Krieg seinem Ende entgegenging, wurde das von den Menschen ganz verschieden wahrgenommen. Alle warteten jedoch darauf, denn dass er verloren war, ließ sich nicht mehr leugnen. Die im Reichsgebiet befindlichen sogenannten Fremdarbeiter hofften natürlich auf ihre Befreiung durch die einmarschierenden alliierten Truppen, während die deutschen Menschen der Besetzung durch die Siegermächte mit Bangen entgegen sahen. Die Alliierten hatten im Osten wie im Westen die Reichsgrenzen überschritten und bestimmten bereits das Geschehen in den von ihnen besetzten Gebieten. Hier war der Krieg schon vor der bedingungslosen Kapitulation beendet, während andernorts noch verbissen gekämpft, und sinnlose Einsätze gegen einen übermächtigen Gegner befohlen wurden. Unendliches Leid hatte der Krieg nicht nur den Menschen in den angegriffenen Ländern, sondern auch der deutschen Bevölkerung gebracht, und im Stillen wurde sein Ende von den Meisten sehnsüchtig erwartet. Was würde jetzt kommen? Was hatte man von den Siegern zu erwarten? Wie würden sie sich rächen? Diese Frage bezog sich vorwiegend auf die Russen, denen wurde ja von den deutschen Besatzern unermessliches Leid zugefügt, und es war zu erwarten, dass die russischen Soldaten sich dafür rächen würden. Durch die Nazi-Propaganda war immer wieder verbreitet worden, dass die Russen Barbaren und Untermenschen seien, von denen nichts Gutes zu erwarten wäre. So waren es eigentlich nur die Fremdarbeiter, welche der Ankunft der sowjetischen Truppen hoffnungsvoll entgegen sahen und sie als echte Befreiung verstanden.
Die deutschen Landser waren kriegsmüde nach all dem Schlamassel, welches sie in den vergangenen Jahren erlebt hatten, außerdem konnten sie gegen die Übermacht der Gegenoffensive ohnehin nichts ausrichten. So kam es, dass viele Ortschaften in den letzten Kriegswochen kampflos übergeben wurden. Plötzlich tauchten russische Panzer auch in Windhusen auf. Im Dorf waren kurz vorher bereits weiße Fahnen gehisst worden. Die Panzer, es waren nur zwei, hielten auf dem Marktplatz des Dorfes und wurden sofort von einigen polnischen Fremdarbeitern umringt. Die Panzerfahrer stiegen aus und unterhielten sich mit ihnen, offensichtlich gab es keine Verständigungsschwierigkeiten. Die deutschen Dorfbewohner waren natürlich nicht zu sehen, sie hatten sich versteckt, oder waren in ihren Wohnungen geblieben und beobachten, am Fenster hinter der Gardine versteckt stehend, das Geschehen.
So ging es auch Alfred Hitschke, er hatte schon rechtzeitig alles belastende Material im Büro in der unteren Etage verbrannt. Ebenso hatte er seine Parteiuniform und alles, was dazu gehörte, entfernt und unauffindbar gemacht. Er war jetzt in Zivil und hoffte so diese unruhige Zeit überstehen zu können. Nun hatte er sich mit seiner Frau und der acht Monate alten Helga in der Wohnung versteckt. Nachdem er durch das Fenster geschaut, die weißen Fahnen und die heranfahrenden russischen Panzer gesehen hatte, konnte er nur hoffen, dass die einziehenden Untermenschen ihn nicht erkennen würden. Alfred Hitschke blieb am Fenster stehen und beobachtete das Szenarium auf dem Marktplatz. Jetzt fuhr ein, mit Offizieren besetzter, Jeep vor. Sie stiegen aus und unterhielten sich mit den Polen. Dann fuhren noch mehrere Lastwagen mit Soldaten vor, so dass der Platz jetzt mit sowjetischem Militär angefüllt war. Die Soldaten warteten, ungeordnet herum stehend oder sitzend, offensichtlich auf weitere Befehle. Die Offiziere dagegen unterhielten sich immer noch mit den Fremdarbeitern. Ihnen galt Alfred Hitschkes besondere Aufmerksamkeit, denn unter ihnen befand sich der polnische Jude Oleg, der von der Deportation verschont geblieben war. Der Bauer, bei dem er als Zwangsarbeiter eingesetzt gewesen war, hatte den damaligen Blockleiter dringend gebeten, diesen Mann vorerst noch behalten zu dürfen. Er sei sehr fleißig und würde dringend gebraucht. Alfred Hitschke hatte dem damals stattgegeben. Jetzt konnte er beobachten, wie der mit den russischen Offizieren sprach. Dabei zeigte er mit dem Arm auf seine Wohnung, und Alfred Hitschke atmete auf, denn er vermutete, dass der polnische Jude zu seinen Gunsten sprechen würde. Auch wenn er eigentlich nicht viel zu seinem Überleben beigetragen hatte, denn der polnische Jude gehörte zu den Kriegsgefangenen, die ohnehin gesondert von den deutschen Juden zu behandeln waren. Der erneute Fingerzeig auf das Gemeindehaus und seine Wohnung bestärkte ihn in seiner Überzeugung, dass Oleg nur Gutes über ihn berichtet hatte. Er entfernt sich vom Fenster und setzte sich erleichtert aufatmend auf die Couch. Seine Frau stand derweil an der Zimmertür und beobachtete ihn besorgt. “Was wird nun werden?”
“Ich glaube, Oleg hat gut über mich gesprochen, denn ich habe ja dazu beigetragen, dass er verschont geblieben ist.”
Das Gespräch zwischen dem polnischen Juden und dem Offizier war aber ganz anders verlaufen als Alfred Hitschke sich das vorgestellt hatte. Oleg hatte ihn als Kriegsverbrecher bezeichnet, der dazu beigetragen hatte, dass die Juden im Dorf deportiert wurden. Warum ausgerechnet er verschont geblieben war, hatte er mit keinem Wort erwähnt. Er war auf den sowjetischen Offizier zugegangen, hatte mit dem Finger auf das Gemeindehaus gezeigt und erklärt, dass dort ein Nazi sei, der bestraft werden müsse. Die Russen gingen mit Wehrmachtsoffizieren, SS-Leuten und Parteifunktionären nicht gerade zimperlich um. Der Offizier hatte jedoch Oleg anfangs gar nicht nach irgend welchen Schuldigen gefragt, sondern wollte nur wissen, wo es Unterkünfte für den Regimentsstab gab. Der Hinweis von Oleg hatte ihn aber aufhorchen lassen, und so begab er sich mit zwei Rotarmisten und einem Dolmetscher zu Alfred Hitschkes Wohnung. Es wurde ziemlich hart an die Tür geklopft, Alfred schreckte auf, ging aber hin und öffnete. “Mitkommen”, sagte der Dolmetscher nur.
Der ehemalige Blockleiter wurde von den zwei Soldaten ziemlich unsanft in die Mitte genommen und die Treppe hinunter geschleift. Zurück blieben seine völlig verdatterte Ehefrau mit Helga, dem acht Monate alten Töchterchen auf dem Arm.
Alfred Hitschke wurde unter den hämischen Blicken der umstehenden Zwangsarbeiter in einen Kleintransporter gestoßen, der sofort abfuhr. Vorher hatte er noch Gelegenheit gehabt, einen kurzen Blick auf Oleg zu werfen, und dabei ein schadenfrohes Grinsen bemerkt. Nach einer etwa einstündigen Fahrt erreichte der Transporter die bereits von den Russen besetzte Kreisstadt und hielt vor einem größeren Haus. Er musste aussteigen und man brachte ihn in einen völlig leeren und dunklen Kellerraum.
Die Tür wurde zugeschlagen und verriegelt. In diesem Raum verbrachte Alfred den Rest des Tages und auch die darauffolgende Nacht.
Die sowjetische Militäradministration ging mit Parteigrößen und hohen Wehrmachtsoffizieren in den besetzten Gebieten nicht gerade zimperlich um. Man schnappte sich die Schuldigen und steckte sie kurzerhand in Lager mit Zwangsarbeit und schlechtem Essen, wobei die ehemaligen KZ-Lager der Nazis weitgehend genutzt wurden. Zuvor gab es Verhöre in russischer Sprache ohne Dolmetscher und natürlich auch Folterungen. Der Hass und die Verbitterung der Russen gegen die Verantwortlichen war verständlich. Dieser Hass traf alle, auch Mitläufer, die niemanden umgebracht hatten, dafür aber reichlich andere Menschen denunziert hatten.
So erging es auch dem ehemaligen Blockleiter Alfred Hitschke, der zwar ein überzeugter Nazi und Judenhasser, aber nie an irgendwelchen Exekutionen und Folterungen beteiligt gewesen war. Eine Denunziation, und die ausgerechnet von einem Juden, hatte ausgereicht, um an seiner Person Vergeltung zu üben.
Ansonsten normalisierte sich die Lage nach den ersten Wirren der Nachkriegszeit in der sowjetischen Besatzungszone. Man begann mit dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft nach Moskauer Vorbild. Diese Entwicklung fand natürlich nicht die Zustimmung aller Menschen, aber die einfachen Leute, die Landarbeiter, wie Erich Damrau, waren mit dieser Entwicklung durchaus einverstanden. Erich hatte, wie auch viele andere Dorfbewohner, nie viel von den Nazis gehalten, ja er war schon immer eher linksgerichtet eingestellt gewesen. Deshalb fanden die durchgeführten Maßnahmen in der Zone auch seine volle Zustimmung, und das sollte auch in Zukunft so bleiben. Man begann die Ländereien der Gutsbesitzer und Großbauern an die landlose Bevölkerung zu verteilen. Die damaligen Landbesitzer wurden kurzerhand enteignet. Auch Bauer Fritz verlor sein Land, weil es die Größe von 100 Hektar überstieg. Die Landarbeiter erhielten kleine Parzellen von jeweils etwa 10 Hektar Land und konnten sich Häuser und Stallungen bauen. Das ging ungefähr zehn Jahre in dieser Form weiter. Dann stellte sich heraus, dass die Produktivität in der Landwirtschaft zu wünschen übrig ließ. So beschloss das ZK der SED der inzwischen gegründeten DDR auf seiner 33. Tagung im Herbst 1957 die Kollektivierung der Landwirtschaft.
Nun erhielt auch Bauer Fritz, der seine Enteignung keinesfalls überwunden hatte, aber sich den Gegebenheiten anzupassen suchte, eine neue Aufgabe. Er wurde Vorsitzender der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Seine langjährigen Erfahrungen in der Bewirtschaftung der Flächen und in der Tierhaltung wusste man sicher zu nutzen. Erich Damrau, jetzt Genossenschaftsbauer, wurde sein Assistent. Beide waren nun auch Mitglied der Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, jedoch aus unterschiedlichen Motiven. Während Erich von der Sache hundertprozentig überzeugt war, hatte sich Bauer Fritz nur mehr oder weniger überzeugen lassen, was das auch heißen mochte. Dessen ungeachtet arbeiteten beide nach wie vor gut zusammen.
Der kleine Heinz Damrau, wie er jetzt hieß, wuchs heran und war der Liebling seines Ziehvaters, weil er ein ganz aufgewecktes Kerlchen war. Erich Damrau hatte viele Kinder, aber Heinz stach irgendwie von ihnen ab, nicht nur durch sein etwas anderes Äußeres, sondern auch durch seine Intelligenz und Lebhaftigkeit. Kein Mensch jedoch wusste etwas von seiner tatsächlichen Herkunft, wenn auch böse Zungen vermuteten, dass er vielleicht einen anderen Vater hatte, was Erich jedoch kategorisch abstritt. Die anderen Kinder waren alle älter als er, wurden von ihren Eltern ebenfalls geliebt, und waren dem Nesthäkchen Heinzi nicht minder zugetan. Besonders die Älteste, Lisa, mochte ihren kleinen Bruder sehr gern. Eine Geschwisterliebe, die offensichtlich dadurch entstanden war, dass sie ihn mit groß gezogen hatte. Sie war damals, als Heinz in die Familie aufgenommen wurde, bereits zwölf Jahre alt gewesen. Vielleicht wusste oder ahnte sie etwas. Erich Damrau jedoch hatte Heinz ganz besonders in sein Herz geschlossen, und übte somit auch einen großen Einfluss auf seine Entwicklung aus. Er hatte ihn schon sehr früh, entsprechend seiner Überzeugung über den, seiner Meinung nach richtigen Weg bei der Entwicklung einer sozialistischen Gesellschaft aufgeklärt.
Diese Aufklärung war bei Heinz auf fruchtbaren Boden gefallen, denn er war sehr wissbegierig und wollte alles über die Geschichte der Arbeiterklasse wissen. Ganz im Gegensatz zu Erichs eigenen Kindern, deren Interesse hierfür nicht sonderlich groß war. Auch in der Schule war Heinz sehr erfolgreich, und es gab Vorschläge seitens der Lehrer, ihn auf eine höhere Schule zu schicken. Heinz jedoch wollte das nicht, er las viel und sein Wunsch war, Buchhändler zu werden. Später gäbe es immer noch diverse Möglichkeiten der Weiterbildung, womit er nicht ganz unrecht hatte.