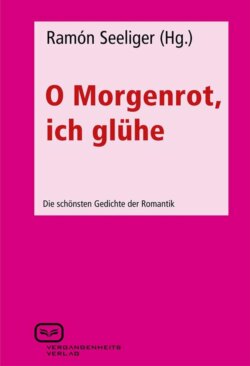Читать книгу O Morgenrot, ich glühe - Группа авторов - Страница 5
Einleitende Bemerkungen
ОглавлениеMit der Französischen Revolution (1789) setzten in ganz Europa tief greifende gesellschaftliche und politische Veränderungen ein. Die Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mündeten in der Abschaffung des absolutistischen französischen Staatssystems. Besonders die Erklärung der Menschen-Bürgerrechte vom August 1789 weckte die Hoffnung, dass sich die Demokratie als Grundprinzip des modernen Staates durchsetzen würde. Die Aufbruchsstimmung der Zeit, verstärkt durch die Aufklärung und langsam beginnende Industrialisierung, steckte an. Außerhalb Frankreichs, das sich als dominierende Macht in Europa zeigte, ging ein revolutionärer Geist umher. Auch in den deutschen Kleinstaaten wurde der Ruf nach Reformen und einem einheitlichen Nationalstaat laut. Dass die politischen Systeme Europas erneuert werden mussten, war selbst den Regenten klar. In Preußen gewannen Reformer wie Hardenberg oder vom Stein enormen Einfluss. Als die die Franzosen 1815 bei Waterloo vernichtend geschlagen wurden, war das aber auch ein Sieg der Reaktion. Die Ideen von 1789 wurden zurückgedrängt. Den vorherigen Hoffnungen wurde durch die Karlsbader Beschlüsse 1819 mit umfangreichen Maßnahmen zur Bekämpfung liberaler oder nationaler Tendenzen zunächst ein Ende gesetzt. Pressezensur und Geheimpolizei griffen in das gesellschaftliche und politische Leben ein.
Die kollektiven Enttäuschungen über den Fortlauf der Französischen Revolution, das Ausbleiben eines Erneuerungsprozesses der Monarchien als Regierungsform, aber auch die Industrialisierung, damit die radikale Veränderung von Lebens- und Arbeitsverhältnissen, führten sowohl zu einer Abgrenzung von politischen Idealen der Aufklärung als auch zu einer Verlagerung des Lebensschwerpunktes ins Private. So bildeten die gesellschaftspolitischen Umbrüche einen wesentlichen Ausgangspunkt für die Romantik, einer geistig-künstlerischen, vor allem aber literarischen Strömung, die sich auf den Zeitraum von 1790-1850 erstreckte.
Als Reaktion auf die rational-zweckorientierte geistige Bewegung der Aufklärung, aber auch die politischen Enttäuschungen, erregten romantische Positionen schnell die Aufmerksamkeit einer neuen Generation von Schriftstellern. Noch um 1800 trafen sie sich zunächst in Hinterhäusern, später in Salons, um dem Vernunftdiktat der Aufklärung zu widersprechen und dem bürgerlichen Nützlichkeitsdenken eine Absage zu erteilen.
Als bekannteste Vertreter in der Poesie lassen sich Friedrich von Hardenberg (Novalis), Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff und vor allem auch Heinrich Heine nennen. Sie alle richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Entdeckung – oder vielmehr die Rückkehr zum ganzen Menschen, den nicht nur Rationalität und Vernunft konstituierten. Neben der Literatur erstreckte sich die Romantik auch auf andere Gebiete, insbesondere auf die Bildende Kunst und hier die Malerei. Als prominenteste Beispiele gelten vor allem die Werke Caspar David Friedrichs, die mit ihren düster-sehnsuchtsvollen Naturpanoramen wesentlich zur Visualisierung der romantischen Epoche beigetragen haben.
Den Literaten wie Malern war dabei die Betonung idealistischer Perspektiven gemein. Hierzu zählte auch ein Abwenden von der Wirklichkeit. Das äußerte sich nicht nur in der Kritik an dem Gewinndenken der aufkommenden Industrialisierung, sondern auch in der Ablehnung des Nützlichkeitsdenkens der modernen Naturwissenschaften, die der Welt die Geheimnisse nahmen und den Alltag eintönig werden ließen. Eine Reaktion darauf war für die Vertreter der Romantik deshalb auch die Hinwendung zur Religion. So entwickelten die Romantiker eine starke Bindung zur Kirche, zum Mittelalter, welches nach deren Ansicht die christliche Gesellschaft wieder einigen konnte und nicht zuletzt als Ursprung der deutschen Nation galt.
Neben der religiösen Vereinigung entwickelte sich aber auch der Gedanke der kulturellen Gemeinschaft, in der das Individuum unabhängig von Geltungs- oder Profitstreben seinen Beitrag für die Weiterentwicklung der Gesellschaft leisten konnte. Auf Basis dieser Ideen entstand allmählich auch der Begriff der Kulturnation. Während der französischen Besatzung deutscher Gebiete durch Napoleon und den Freiheitskriegen in der Zeit von 1806 bis 1813 setzte sich schließlich aufbauend auf die Idee der Kulturnation der Nationalismus als treibende Kraft der Zeit durch.
Die Romantik, die Gefühligkeit und Naturbezogenheit dieser Epoche, spiegelt sich eindrücklich in den ausgewählten Gedichten dieses Sammelbandes wider. Typische Motive der Romantik wie Nacht oder Dämmerung, die besonders außerhalb städtischer Zivilisation intensiv erlebbar werden, tauchen immer wieder auf. Die Natur selbst ist zentrales Thema romantischer Lyrik. Die Verbindung von Mensch und Natur wird idealisiert. Die Themen verlagern sich von der Stadt in den Wald oder auf das Land. Hier kann sich das Individuum seinen Sehnsüchten hingeben, sich dabei ganz auf sich und die eigenen Empfindungen konzentrieren. Das Erleben und Empfinden der vom Menschen unberührten Umgebung wird dabei zum zweiten großen Thema der romantischen Lyrik. Obwohl die Gedichte teilweise von volksliedhafter Einfachheit geprägt sind, zeichnen sie sich dennoch durch ein hohes Maß an sprachlicher Kunst aus. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Werken Wilhelm Müllers, die teilweise zu echten Volksliedern, wie „Das Wandern ist des Müllers Lust“ geworden sind. Gemein ist den Gedichten dabei stets, nicht die nüchterne Wirklichkeit, sondern immer auch das unnormale Wunderbare im Erlebnis zu beschreiben, welches sich in Traum- und Sehnsuchtsmotiven wiederkehrend ausdrückt. Einen hervorragenden Eindruck, was den Leser dieser romantischen Gedichte erwartet und was sie auszeichnet, vermittelt schließlich der Dichter Novalis selbst:
„Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnißvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisire ich es“.