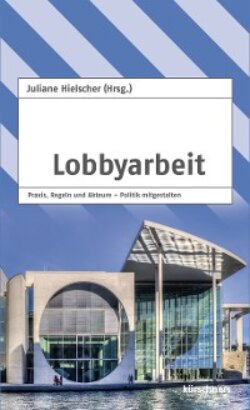Читать книгу Lobbyarbeit - Группа авторов - Страница 7
1. KAPITEL
ОглавлениеWas ist Lobbyarbeit?
Interessenvertretung. Das Bemühen, Entscheidungsträger von eigenen Argumenten zu überzeugen. Dazu gehören alle Maßnahmen, die dazu dienen, die öffentliche und politische Meinungsbildung zu beeinflussen und bestenfalls auf Gesetzgebungsverfahren einzuwirken.
Seit sich Menschen in festen gesellschaftlichen Strukturen mit Regeln und Gesetzen organisiert haben, gibt es Einzelne oder Gruppen, die die Spielregeln bestimmen und andere, die sich daran halten müssen. Dass Letztere versuchen, auf die Gestaltung der Spielregeln im eigenen Interesse Einfluss zu nehmen, ist verständlich und nachvollziehbar.
Sicher hatten auch schon in grauer Vorzeit Horden- oder Clanführer Besuch von Sippenmitgliedern, die um Verständnis und Unterstützung baten. Menschen waren und sind in ihrem Zusammenleben stets auf Bündnisse und Gruppenzugehörigkeit angewiesen. Wir sind schon rein biologisch gesehen keine Einzelkämpfer. Im Gegenteil: Die moderne Psychologie weiß heute, dass Menschen in der Isolation verkümmern und vorzeitig sterben.
Über den Ursprung der Begriffe Lobbyismus oder Lobbyarbeit kursieren unterschiedliche Geschichten, die im Kern immer das Gleiche erzählen. So gab es in der Römischen Republik vor der Curia, wo der Senat tagte, eine Lobia, eine Wandelhalle, in der die Bürger Roms auf ihre Senatoren treffen konnten, um ihnen ihre Sorgen, Wünsche oder Vorschläge zu unterbreiten. Auch die französischen Könige wurden von Bittstellern aufgesucht. Solche Besuche nannte man Antichambrieren, denn die Aufwartung fand im Vorzimmer der königlichen Privatgemächer statt. Zutritt erhielt nicht das einfache Volk, nicht einmal Kaufleute oder Händler wurden vorgelassen. Wer etwas beim König erreichen wollte, musste zunächst einen ranghohen Adligen für sein Begehr gewinnen, denn nur dieser hatte überhaupt eine Chance, an den Hof und in das Vorzimmer der Macht zu gelangen. Da sich diese Adligen ihre Bemühungen mit Gefälligkeiten oder sachlichen Gegenleistungen vergüten ließen, werden sie zuweilen als frühe Lobbyisten tituliert.
Die heutige Schreibweise Lobby geht auf das britische Unterhaus und den US-Amerikanischen Kongress zurück. Auch hier bezieht sich der Begriff auf die Räumlichkeiten vor dem Sitzungssaal, in dem Abgeordnete und Kongressmitglieder hinter verschlossenen Türen tagen. Zu diesen Vorhallen erhält man nur auf Einladung, nach gründlicher Prüfung oder durch hartnäckiges Bitten Zutritt. Und auch hier finden Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern statt. In diesem Sinne wird der Begriff aktuell in Deutschland verwendet.
Die Vorstellung, dass Bürger oder Interessenvertreter wichtige Angelegenheiten direkt mit den Parlamentariern in den Fluren des Reichstagsgebäudes besprechen, entspricht natürlich nur zum Teil der Realität. Gleichwohl kommt es vor, dass beispielsweise ein Verbandsgeschäftsführer einen Termin in einem Abgeordnetenbüro hat und auf dem Weg dorthin im Fahrstuhl einem weiteren Parlamentarier begegnet und rasch die Gelegenheit nutzt, um eine Visitenkarte weiterzureichen oder ein Treffen zu verabreden. Die Mehrheit der Gespräche findet dann tatsächlich in den Büros hinter verschlossenen Türen statt. Oder während eines gemeinsamen Mittagessens, bei einem Kamingespräch oder auf einer der vielen Veranstaltungen im Parlaments- und Regierungsviertel. Weitere Informationen dazu finden sich im 12. Kapitel über Kontaktpflege.
Das Lobbygeschäft ist keine Einbahnstraße. Neben denjenigen, die ihre Interessen vortragen oder vortragen lassen, besteht für Politiker selbst eine Notwendigkeit des Informationsaustausches mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, Unternehmen, Verbänden und Experten. Von keinem Abgeordneten kann erwartet werden, dass er per se alles über ein Thema weiß. Auch sein Büro und seine Referenten sind auf den Austausch außerhalb des Politikbetriebes angewiesen. Wie sonst sollten Abgeordnete über einen Gesetzesvorschlag aus einem Fachministerium entscheiden, wenn sie nicht zuvor alle beteiligten Seiten angehört und verstanden haben? Parlamentarier und auch Bundesminister können oder sollen – so steht es in den jeweiligen Geschäftsordnungen – Themen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und zuständige Interessengruppen anhören. Die Expertise unterschiedlicher Disziplinen von Fachleuten aus der Praxis ist hierfür unverzichtbar. Dabei wird vorausgesetzt, dass Abgeordnete und Ministeriumsmitarbeiter ihre Funktionen nicht zum eigenen Vorteil ausnutzen. Das Stichwort Verwaltungsethik befasst sich mit diesem Thema. Politiker sollen stets die Allgemeinheit, das ganze Volk, im Blick haben. Dabei gilt: Die Summe der Einzelinteressen bildet noch nicht das Gemeinwohl ab.
Zum großen Bereich der Lobbyarbeit gehören ganz unterschiedliche Personengruppen, die auch in sehr unterschiedlichen Funktionen tätig sind. Da gibt es zum einen den klassischen Lobbyisten, der über vielfältige Kontakte zur Politik verfügt und im Auftrag Dritter Themen lanciert. Diesen Beruf kann man mittlerweile sogar von der Pike auf erlernen. Ein Studium der Politischen Kommunikation wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt Lobbyisten, die als selbstständige Solisten arbeiten, und Lobbyisten, die für eine Agentur tätig sind. Erkennbar sind diese an Namen wie Agentur für Strategische Kommunikation oder Büro für Public Affairs. Auch Consultingunternehmen aller Art bieten Lobbyleistungen an.
Neben diesen hochprofessionell aufgestellten Beratungsunternehmen gibt es noch etliche weitere Akteure. Jeder Verband, egal ob Sozial-, Wohlfahrts- oder Wirtschaftsverband, betrachtet Interessenvertretung als seine Kernaufgabe. Gleiches gilt für Vereine. Ob Hundezüchter oder Schützengilde, stets gibt es jemanden, dessen Job es ist, für das Anliegen der Mitglieder zu werben sowie ihr Image zu optimieren, und der für die Verbesserung der Bedingungen im Sinne des Vereinszweckes zuständig ist.
Auch viele andere Institutionen betreiben Lobbyarbeit: Kirchen, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, Fach- und Berufsvereinigungen, NGOs, der Frauenrat, das Männerforum, der Kinderschutzbund – sie alle streben danach, in der politischen Willensbildung berücksichtigt zu werden. Nicht zu vergessen die Handels-, Handwerks- und Industriekammern. Auch sie suchen stetig den Dialog mit Politik und Gesellschaft und streiten für die Interessen ihrer Mitglieder. Führende Positionen werden dabei gerne an ehemalige Abgeordnete vergeben. Denn die sind exzellent vernetzt und wissen, wie der parlamentarische Hase läuft. Diese Erfahrungen können sie dann nach Beendigung ihrer Karriere als Politiker zielgerichtet einsetzen, um Auftraggeber bei der Vertretung ihrer Interessen zu unterstützen. Dass sie sich diese Arbeit entsprechend honorieren lassen, wird niemanden wirklich verwundern.
Es gibt auch Politiker, die direkt in die Kommunikationsabteilung eines Großkonzerns, in die Hauptstadtrepräsentanz eines Unternehmens oder an die Spitze eines Verbandes wechseln. Man spricht hier vom Drehtüreffekt. Seit 2015 sind Kabinettsmitglieder dazu verpflichtet, der Bundesregierung einen solchen geplanten Seitenwechsel schriftlich anzuzeigen. Wenn der Verdacht besteht, dass ein Politiker sein Amt dafür genutzt hat, um sich für einen hochbezahlten Job in der Wirtschaft ins Spiel zu bringen, kann eine Ethikkommission einberufen werden, die eine Sperrfrist von einer Länge bis zu 18 Monaten verhängen darf. Bis zur Veröffentlichung dieses Buches ist dieser Fall allerdings noch nie eingetreten.
Fast alle Bemühungen der Lobbyarbeit zielen in zwei Richtungen. Ein Adressat ist die Politik, der andere die Gesellschaft. Denn das Einwirken auf die öffentliche Meinung oder das Volksempfinden ist für das Gelingen von Lobbyarbeit genauso wichtig wie die Verbindung zur Politik. Am Ende entscheiden ja immer die Bürger mit ihrer Wahlstimme, wer in der nächsten Legislaturperiode stellvertretend für sie Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen kann. Aus diesem Grund wird die Kontaktpflege in die Politik häufig von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen flankiert.
Jede Anstrengung, direkt und persönlich auf einzelne Politiker oder Fraktionen einzuwirken, dient wiederum dem Ziel, eine Parlamentsmehrheit für die eigene Sache zu organisieren. Das Ergebnis eines monate- eventuell sogar jahrelangen Einsatzes besteht dabei manchmal nur aus einem einzigen Wort, das aus einem Gesetzentwurf gestrichen wird. Schließlich kann von juristischen Feinheiten das Geschick einer ganzen Branche abhängen. So wurde zum Beispiel in der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages die Mietpreisbremse beschlossen. Ein Passus erlaubt jedoch den Bundesländern, Gebiete der Gültigkeit selbst auszuweisen. Sämtliche Immobilienverbände haben intensiv für diese Eingrenzung gekämpft. Die Mietpreisbremse hatte schon im Wahlkampf als Schlagwort für Unruhe gesorgt, deshalb konnten die Lobbyarbeiter frühzeitig in den Diskussionsprozess einsteigen und mit ihren Argumenten bei den Entscheidungsträgern vorsprechen. Einige Politikertüren standen ihnen dafür offen, denn wie oben schon beschrieben, sind die Abgeordneten ja angehalten, Experten und Vertreter aus der Praxis anzuhören. Im Idealfall findet dieser Austausch zwischen Politik und Interessenvertretung transparent statt, d. h. ganz ohne Geheimniskrämerei über Häufigkeit und Inhalte der Gespräche. Später im Verfahren der Gesetzgebung diskutieren die Abgeordneten dann im Parlament alle an sie herangetragenen Informationen und prüfen, inwieweit sich die Inhalte mit ihrer politischen Meinung decken. Dabei sollen sie Partikularinteressen abwägen und ein Ergebnis finden, welches dem Allgemeinwohl am gerechtesten wird. Am Ende wird darüber abgestimmt.
Wie so oft klaffen Idealfall und Realität auch beim Thema Lobbyarbeit ab und zu auseinander. Dahinter stecken nicht zwangsläufig intrigante Absichten profitorientierter Vertreter von Partikularinteressen. Diese unseriöse Variante kommt allerdings auch vor und wird im 3. Kapitel über das schlechte Image von Lobbyarbeit thematisiert. An dieser Stelle sei zunächst nur auf einige wichtige Punkte hingewiesen, die den Traum nach absoluter Transparenz ad absurdum führen.
Da ist zunächst einmal der Datenschutz. Politiker und Interessenvertreter können selbstverständlich vertraulich über alles Mögliche sprechen. Nach außen dürfen aber weder Namen noch sonst irgendwelche personenrelevante Daten kommuniziert werden. Unternehmen und ihre Vertreter unterliegen zudem häufig gegenüber Vertragspartnern einer Verschwiegenheitspflicht. Werden Einzelheiten aus Lobbygesprächen bekannt, müssen die Unternehmen unter Umständen mit hohen Vertragsstrafen rechnen. Das gesamte Feld der inneren Sicherheit beispielsweise ist, genau wie das internationale diplomatische Geschäft, von so vielen sensiblen Informationen geprägt, dass es geradezu fahrlässig wäre, alle Gesprächsinhalte zu veröffentlichen. In vielen Fällen dient die Vertraulichkeit also dem Schutz einzelner Menschen, Personengruppen, Unternehmen oder gar des ganzen Landes. Kritiker ignorieren diesen Umstand oft.
Den meisten Akteuren im Lobbygeschäft ist der Drahtseilakt ihrer Arbeit durchaus bewusst, inklusive aller moralischen Herausforderungen. Auch aus diesem Grund wurde 2002 der Verein Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e. V. gegründet, von Insidern kurz de’ge’pol genannt. Laut Statuten ist der Verein unabhängig und parteiübergreifend. Sein Ziel: Die Förderung der Weiterbildung und die Professionalisierung im Bereich Politikberatung, die Sicherung von Qualität und ethischer Standards. Damit ist die de’ge’pol im Grunde eine Art Lobbyvereinigung für Lobbyisten. Weitere Interessenvertreter sind die Deutsche Public Relations Gesellschaft, DPRG, der Bundesverband deutscher Pressesprecher BdP, die Gesellschaft der Public Relations Agenturen, GPRA sowie der Deutsche Rat für Public Relations, DRPR. Viele Mitglieder dieser Institutionen sind auf dem Feld der Lobbyarbeit tätig und finden innerhalb dieser Organisationen Unterstützung – auch in Bezug auf gesellschaftliche Anerkennung und politische Rahmenbedingungen. Besonders deutlich wird dies beim Thema Compliance, zu dem sich diese Lobby-Lobbyisten bei öffentlichen Diskussionen regelmäßig äußern.
Deren Aussagen werden nicht nur von den Medien kritisch beäugt und kommentiert. Denn den Vereinigungen von Lobbyisten stehen die Vereinigungen von Lobbykritikern gegenüber. Die bekanntesten sind Transparency International, schon 1993 in Deutschland gegründet sowie die Vereine Lobby Control und Parlamentwatch, wovon letzterer die mittlerweile recht bekannte Internetplattform abgeordnetenwatch.de betreibt. Diese Vereinigungen sind sozusagen die Interessenvertretung der Interessenvertretungskritiker. Derzeit werben alle drei für die zügige Einführung eines verpflichtenden Lobbyregisters. Das wird in Deutschland schon seit Langem diskutiert. Denn weder das freiwillige Meldemodell der EU noch die Auskunft der Bundestagsverwaltung über die im Parlament zugelassenen Verbände können dem großen Wunsch nach Transparenz gerecht werden. Bislang gibt es dazu aber noch keine offizielle Entscheidung. In jedem Falle erwähnenswert bleibt der Umstand, dass die Kritiker der Lobbyarbeit genau die gleichen Werkzeuge benutzen wie die Lobbyisten selbst. Vom Campaigning über Veranstaltungen bis zur Veröffentlichung eines eigenen Gesetzesvorschlags zur Lobbyregistrierung ist alles dabei, was auch hier in diesem Buch ausführlich als Instrument vorgestellt wird.
All dies ist in einer pluralen Gesellschaft möglich.
Ein Hoch auf die lebendige Demokratie!