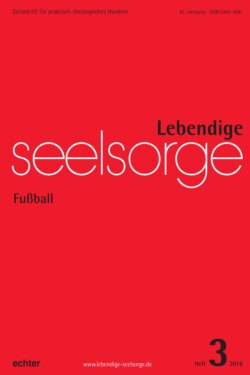Читать книгу Lebendige Seelsorge 3/2016 - Группа авторов - Страница 6
ОглавлениеVon einer nutzlosen Leidenschaft, dem Fußball, oder: Vom Religionstier Mensch
Sollte Ekstase – gerne auch mystisches Erleben genannt – Indiz für ein tatsächliches religiöses Erleben sein, so wäre das Erleben von Fußballleidenschaften als ein solches Erleben zu beschreiben. Jedenfalls dann, wenn man genau zu sagen wüsste, dass religiöses Erleben notwendig ein ekstatisches Element enthält. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail, anders formuliert: Man müsste wissen, was tatsächliches religiöses Erleben von nichtreligiösem Erleben zu unterscheiden erlaubt. Ich bin in den Fragen, was denn nun was sei, nicht so sicher – aber mit irgendeiner Festlegung muss das beschreibende Denken ja anheben. Magnus Striet
Von einer Gewissheit darf aber getrost ausgegangen werden: Dass in den Fußballarenen der Gegenwart nicht weniger, wenn nicht gar mehr Ekstasen zu beobachten wären als bei den großen Religionsevents der Gegenwart. Zumal in den Stadien weltweit aber eben ja Indizien liturgischer Bildung unübersehbar sind. Ob dies reflexiv gewusst ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Auch der zumal im Bereich des Römisch-Katholischen sich bewegende Gottesdienstbesucher ist religiös gebildet, man kann auch nüchterner sagen: sozialisiert. Wer an der participatio actuosa teilhaben will, muss schließlich wissen, was zu tun ist.
Im Normalfall wird dies aber nicht bewusst studiert, sondern in Prozessen von Sozialisation eingeübt. Dieser so eingeübte Modus des Wissens reicht aber aus, um teilnehmen zu können. Der Katholizismus funktioniert in dieser Hinsicht bis heute erstaunlich gut. Aber immer, wenn etwas gut funktioniert, wird es auch in andere Kontexte transferiert. Und wenn der Katholizismus hierzulande im 20. Jahrhundert als Vorbild politischer Form herhalten musste (mit im Übrigen verheerenden Folgen), so heute seine Liturgie als Vorbild fußballerischer Ästhetik.
Wer katholisch gebildet auch nur einmal ein Stadion betreten hat, sich hat hineinziehen lassen in das Spiel zwischen den Mannschaften und den Fans (es wird ja nicht nur auf dem Platz gespielt), weiß, dass es nicht der doch deutlich wortbetontere Protestantismus ist, der hier formgebend ist. Die Liturgie ist eingeübt: Der Einzug der Mannschaften folgt einem vorgeschriebenen Ritual, die Spieler werden in einer Art Heiligenlitanei aufgerufen, das Spiel auf dem Platz wird von Wechselgesängen begleitet, es gibt Fußballgötter im Kampf zwischen Gut und Böse (und der Manichäismus feiert fröhliche Urstände: es gibt Mannschaften, die sind nur in der eigenen Stadt gemocht – sozusagen Inkarnationen des schlechthin Bösen), ein Amt entscheidet zwar nicht unfehlbar, aber es entscheidet, Pokale werden gen Himmel gereckt, es gibt Helden und Märtyrer – und die wahren Fans würden das Spiel am liebsten im Weihrauchdunst erleben… Ist nicht angesichts dieser liturgischen Inbrunst im Stadion von religiösem Erleben oder gar von Religion zu reden?
Magnus Striet
Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg; Arbeitsschwerpunkt: Frage, wie heutzutage noch (wenn überhaupt) verantwortet von Gott geredet werden kann und was überhaupt mit diesem Menschheitsbegriff gemeint sein könnte; den großen Sieg gegen die Bayern verpasste er, weil er auf Vortragsreise in diesen Fragen war.
SCHWIERIGKEITEN MIT DEM RELIGIONSBEGRIFF (UND THEOLOGISCHEN ÜBERTRAGUNGEN)
Um etwas nüchterner zu werden: Der Begriff des Religionsersatzes ist zwar beliebt, aber er verwischt das damit angesprochene Problem eher, als dass er dies löst. Würde man im Fall von Fußball von Religionsersatz sprechen, so würde im Hintergrund die Überzeugung arbeiten, dass mit hinreichender Gewissheit und d.h. mit ausweisbaren Gründen zwischen einer oder gar der wahren oder falschen, d.h. wahre Religion ersetzenden Religionen unterschieden werden kann. In den engeren religionstheologischen Debatten hat diese Überzeugung zu heftigen Auseinandersetzungen und zur Ausbildung entsprechender Extrempositionen geführt.
Während die einen meinen, sagen zu können, die eigene Religion sei die einzig wahre Religion, bleiben andere skeptisch, führen die eigene religiöse Überzeugung beziehungsweise das eigene religiöse Erleben auf biographische Prägung zurück, begreifen konkrete Ausformungen von Religion als anthropomorphe Konzeptionen des einen, aber prinzipiell unsagbaren, durch keinen menschlichen Begriff bestimmbaren Göttlichen und meinen so, die Welt befrieden zu können. Denn wenn alle erst einmal begriffen haben, dass sie nur Annäherungen an das ‚Eine‘ sein können, muss man sich nicht mehr streiten.
Auf die Welt des Fußballs übertragen hieße dies: Alle müssten nur begreifen, dass sie für ihre spezifische Vereinsleidenschaft nichts können, man kann eben nicht zugleich Schalker und Dortmunder sein, beides ist – wie man dann will – Glück oder Unglück der Geburt zugleich. Es wäre somit durchaus möglich, im Fußballstadion Toleranz zu erlernen, eine gemeinsame Lektüre von Lessings Ringparabel in ökumenischen Fanprojekten könnte hier sehr hilfreich sein. Wenn es nur nicht die mit der Muttermilch eingesogene Anhängerleidenschaften gäbe, welche die Fairnessforderung so manches Mal dem Fegefeuer doch recht ähnlich werden lässt.
Aber nur von Geschick zu sprechen, griffe dann doch zu kurz. Siege und Niederlagen fallen im Fußball schließlich nicht vom Himmel. Nur wer verantwortet diese? Ich bin skeptisch, ob das von so manchen Spielern und Zuschauern gen Himmel gerichtete Gebet wirklich dazu verhilft, dass der Ball ins gegnerische Tor geht. Gottes willkürliche Gnadenwahl bei Augustinus hat die Menschheit lange genug geplagt, diese Denkfigur sollte nicht zusätzlich bei denen, die zumeist mit Niederlagen zu rechnen haben, zusätzliche Trübsal verursachen. Nein, Siege beim Fußball sind das Ergebnis harter Arbeit, die Theologie hat hierfür den Fachbegriff Pelagianismus ausgeprägt, und von Geld. Dies ruft die Differenzidentifikationskünstler auf den Plan, was mich zu der Frage zurückführt, ob der Fußball nicht doch eine reine Ersatzreligion sei. Immerhin könnte es ja sein (hier entstehende namentliche Assoziationen sind nicht von mir zu verantworten), dass der Fußball von heute nichts anderes als Götzendienst ist, das hinterlistige Ergebnis des einen großen Götzen, der die Welt regiert – Geld. Unter einer solchen Hinsicht hätte Fußball immer noch etwas mit Religion zu tun, jedenfalls mit einer, die die Unterscheidung von Gott und Götze und damit die Unterscheidung von einem wahren und einem falschen Leben kennt. Ich komme darauf zurück.
Nun bin ich immer wieder irritiert, wie unkritisch – zumal in der Theologie – der Religionsbegriff verwendet wird beziehungsweise wie leichthin Phänomene als Religionsphänomene, als religionsaufgeladene oder auch als religionsbeerbende Phänomene beschrieben werden. Als ob feststünde, was Religion sei. Oder als ob der Mensch von Natur aus religiös sei, was christlich theologisch denkende Menschen dann gar dazu verleitet, zu behaupten, ein jeder Mensch habe eine natürliche Gottesbegabung, so dass aus Religiosität Gottesbezug wird. Allerdings bleibt natürlich die Frage, ob ein bis ins Ekstatische gesteigertes Erleben bereits eine Gotteserfahrung verbürgt. Man könnte sich zu dieser Behauptung verleiten lassen angesichts der im Stadion zu beobachtenden Leidenschaftsausbrüche. Man denke nur an die Freiburger, die anlässlich des Sieges gegen den übermächtigen Götzen Bayern im Jahre 2015 in einen gen Schwarzwald brausenden, geradezu orgiastischen Jubel verfielen.
Normalerweise sind es andere Grenzerfahrungen, die SC-Anhänger im Schwarzwaldstadion machen, die von Niederlagen. Zumindest dann, wenn der SC in der ersten Bundesliga spielt. Dies gehört zum Schicksal von Menschen, die ins Dasein geworfen dazu verurteilt sind, einem kleinen Verein anzuhängen. Häufig sind es Niederlagen, aber manchmal auch die Erfahrung unbändigen Glücks. Die Erfahrung schlechthinniger Abhängigkeit ist in solchen leidenschaftlichen Verbindungen, die ja zumeist halten, bis dass der Tod sie scheidet, sehr verbreitet. Man kann den Ort aus beruflichen Gründen wechseln oder weil eine Beziehung dazu verlockt, aber im Herzen bleibt man auf ewig Gladbacher. Selbst Herzensentscheidungen können eine bittere Seite haben. Kein Stadionbesuch mehr. Aber religionsphilosophisch betrachtet, ist eine solche Innerlichkeit der eigenen Leidenschaften aufregend. Gibt es nicht die Überzeugung, dass Erfahrungen von Abhängigkeit oder, wie diese Erfahrungen auch gerne genannt werden, Kontingenzerfahrungen, bereits religiöse Erfahrungen seien? Ist das Stadion ein Anders-Ort religiöser Erfahrungen?
NÜCHTERNHEIT UND DIE ALTE PHYSIOTHEOLOGIE
Ich rate zur Nüchternheit, auch wenn es – zumindest den von der Leidenschaft für den Fußball Betroffenen – kaum möglich ist, diese beizubehalten. Gemacht werden im Stadion zunächst einmal Erfahrungen. Wer hingeht, weiß zumeist, was ihn erwartet – und freut sich darauf. Soziologen können beschreiben, warum gerade in auf Rationalität und damit auf Selbstkontrolle setzenden Gesellschaften der Fußball seine Sogwirkung entfaltet: Er entlastet vom Alltag, setzt einen Gegenakzent. Niemand fragt, warum ich jubele oder fluche, eine Wurst esse. Alle tun dies, das Leben ist selbstverständlich. Man darf sich ungehemmt freuen, und wenn es eine Niederlage hagelt, ist man auch nicht allein. Es macht schlicht Spaß. Nach der Saison ist vor der Saison, einmal katholisch, immer katholisch – die Dauerkarte wird erneuert.
Selbstverständlich kann man jetzt aus der Beobachterperspektive Theodor W. Adorno zitieren, es gebe nun einmal kein richtiges Leben im falschen – übersetzt: Wer sich der Leidenschaft eines Anhängers hingibt, hat dies noch nicht begriffen. Ob Adorno aus dieser Einsicht freilich die praktische Konsequenz gezogen hätte, sich zu weigern, auch nur einen Fuß ins Stadion zu setzen oder aber Stadiongänger zu maßregeln, bin ich nicht so sicher. Auch Adorno wusste, dass es zu leben gilt. Und dass die Welt im Medium des Geldes organisiert wird, das Geld zum Mammon werden kann und auch wird, ist selbstverständlich auch richtig. Aber kommt man nur moralisierend durch das Leben oder aber kann Moralisierung nicht auch zum wohlbeglückenden Habitus werden?
Ich rate deshalb nochmals zur Nüchternheit: Wer Lust hat, erfreue sich des Fußballs. Dass alles ambivalent ist, ist als Einsicht geschenkt. Sauber kommt niemand durchs Leben. Und wenn ich es recht sehe, war Jesus alles andere als ein Kostverächter. Zu deutlich sind diesbezüglich die Signale, welche die Evangelien aussenden. Man muss sich Jesus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Aber ich rate noch in einem anderen Punkt zur Nüchternheit.
Das bis ins Ekstatische gehende Selbsterleben im Stadion, das immer ein Erleben in der Masse ist, entgrenzt zweifelsohne, aber was bedeutet dies schon? Entgrenzungserfahrungen sind Erlebnisse von Entgrenzung, aber: Woraufhin sie entgrenzen ist damit weder gesagt noch entschieden. Sie zeigen nur an, dass der Mensch ein begeisterungsfähiges Tier ist, ja mehr noch: Dass er die Sehnsucht in sich hat oder doch zumindest ausprägen kann, leidenschaftlich zu leben. Wunderbar! Deshalb war das von Theologen immer noch insinuierte Paradies, in dem die reine Unschuld herrschte, auch wenig attraktiv. Dort gab es keine Leidenschaften. Es muss dort recht langweilig zugegangen sein. Dass es mit dem Erwachen der Leidenschaft auch sehr schnell brutal in der Menschenwelt zuging, ist freilich auch hinzuzufügen.
Das Problem ist nur, dass allein der Begriff Paradies bereits wieder in die scheinbare Gewissheit verleitet, diese Welt verdanke sich einem Gott, so dass auch alles Erleben Gotteserfahrungen vermittele. Dies scheint mir sehr voreilig zu sein. Was Menschen machen, sind leidenschaftliche Erfahrungen (hoffentlich). Aber ob sich hinter dieser Welt des Erlebens einer zeigt, den Menschen Gott genannt haben und bis heute nennen, der sich an den Leidenschaften des Menschen erfreut, ist eine nicht zu entscheidende Frage. Schön wäre es. Das gäbe die Hoffnung, dass so manche Lebensniederlage doch noch versöhnt werden könnte. Philosophisch kann ich nur sagen, dies ist abzuwarten. Mehr geht nicht – und wenn es sich bestätigen sollte, umso besser.
Übrigens entstand eine erste Fassung dieses Textes im Januar 2016 in Freiburg. Sollte der SC aufsteigen, so wäre dies wunderbar, auch wenn es dann wieder Niederlagen hageln würde. So hieß der Schluss ursprünglich. Inzwischen steht der SC als Aufsteiger fest. Wunderbar, aber jetzt kommen die übermächtigen Bayern wieder. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering, dass sich nochmals ein Wunder ereignet. Wenn es damals überhaupt ein Wunder war und nicht das Ergebnis von Leidenschaft und Glück. Macht nichts, denke ich, ich bin ja katholisch. Da muss man viel aushalten, und die im Kirchenraum erlebte Liturgie verarbeitet ja nicht nur das Leben in seinen Auf und Abs, sondern lässt einen manchmal auch verzweifeln, schafft mithin Wirklichkeit. Aber einmal katholisch, immer katholisch. Die Leidenschaft bleibt.
Ist das jetzt Religion? Oder ist es nicht so, dass Fußball Fußball ist, aber man auf die Idee kommen könnte, da das Leben immer wieder einmal schlicht und einfach Spaß macht, dass da oben vielleicht noch einer sein könnte? Die alte Physikotheologie, nach der diese Welt doch nur durch einen weisen Weltorganisator so eingerichtet worden sein kann, funktioniert nicht mehr, und über Gerechtigkeit wurde in deren Rahmen nicht nachgedacht. Aber sie hat gesehen, dass das Leben in seiner brüchigen Schönheit ein Fingerzeig Gottes sein könnte. Um Fußball in diesem Sinn genießen zu können, braucht es allerdings eine Portion Selbstironie. Sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, schadet im Übrigen nie. ■