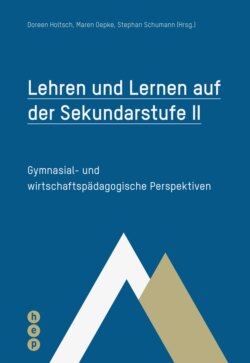Читать книгу Lehren und Lernen auf der Sekundarstufe II (E-Book) - Группа авторов - Страница 13
ОглавлениеLucien Criblez
Die gymnasiale Matur als allgemeiner Hochschulzulassungsausweis – bildungshistorische Reminiszenzen
«Ein neues kantonales Rahmenkonzept stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler an den Zürcher Gymnasien die notwendigen Kompetenzen erwerben, die es für ein Studium braucht. Der Bildungsrat des Kantons Zürich hat das Rahmenkonzept ‹Basale fachliche Kompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit› verabschiedet. Es verpflichtet die Zürcher Gymnasien dazu, grundlegende Kompetenzen in Mathematik und Erstsprache gezielt zu fördern. Damit kommt der Kanton Zürich den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) aus dem Jahr 2016 nach und sichert den prüfungsfreien Zugang zu den universitären Hochschulen langfristig.»38
Die Medienmitteilung der Zürcher Bildungsdirektion weist auf ein Projekt der EDK hin, das 2016 mit entsprechenden Empfehlungen (EDK, 2016) abgeschlossen wurde. Mit unterschiedlichen Maßnahmen soll gesichert werden, dass das eidgenössisch anerkannte Maturitätszeugnis der Gymnasien auch in Zukunft als allgemeiner Hochschulzulassungsausweis39 erhalten bleibt. Dass solche Maßnahmen notwendig sind, hängt einerseits mit der stark angestiegenen Maturitätsquote, andererseits mit wiederkehrenden Klagen über die mangelnde Leistungsfähigkeit der Maturandinnen und Maturanden durch die Abnehmerinstitutionen, allen voran durch die ETH Zürich, zusammen. Dass die Leistungen vieler Maturandinnen und Maturanden in einzelnen Gymnasialfächern, die für viele Studiengänge als wichtige Vorbildung gelten, nur teilweise den Erwartungen genügen, hat der zweite Teil der Evaluation zur Maturitätsreform 1995 (EVAMAR II; vgl. Eberle et al., 2008) deutlich gezeigt, insbesondere weil hohe gymnasiale Maturitätsquoten einzelner Kantone mit geringeren Schulleistungen korrelierten.
Die gymnasiale Maturitätsquote liegt in der Schweiz bei rund 20 Prozent eines Schülerjahrganges und ist seit einigen Jahren relativ konstant. Allerdings erlangten in der Schweiz in der Mitte des 20. Jahrhunderts nur 2 bis 3 Prozent eines Schülerjahrgangs eine Matur im herkömmlichen Sinn der Hochschulreife. Die meisten waren männlich, stammten aus bildungsbürgerlichen Milieus, absolvierten ein neuhumanistisches, seltener ein mathematisch-naturwissenschaftliches Programm; noch seltener erwarben sie sich eine kantonal anerkannte Hochschulzulassungsberechtigung über eine Handels- oder eine Lehramtsmatur. Meist setzten sie ihre Ausbildung nach der Matur direkt an der Universität fort (vgl. Criblez, 2003).
Die Situation hat sich inzwischen also grundlegend verändert: Seit 1993 erlangen mehr junge Frauen als junge Männer einen gymnasialen Maturitätsausweis, und die Maturitätsquote nähert sich allmählich der 40-Prozent-Grenze, wenn man alle drei Maturitätstypen zusammenzählt, also auch die Berufs- und die Fachmatur.40 Wesentlich zur Veränderung beigetragen haben denn auch die beiden neuen Maturitätstypen, die je mit einer – unterschiedlichen – Hochschulzulassungsberechtigung verknüpft sind. Die in der Mitte der 1990er Jahre eingeführte Berufsmatur ist quantitativ ein Erfolgsmodell, und nach politischem Willen soll die Absolvierendenquote weiter zunehmen.41 Die 2003 geschaffene Fachmatur (vgl. EDK 2003) zeigt ein deutliches Wachstum, wenn auch auf tiefem Niveau. Allerdings bestehen bei allen drei Maturitätstypen große kantonale und zum Teil geschlechterspezifische Differenzen.
Wenn über die Maturität als Hochschulzulassungsausweis debattiert wird, müssen heute also immer alle Maturitätstypen einbezogen werden – was gerade in öffentlichen Diskussion oft nicht der Fall ist; da wird häufig nur die gymnasiale Maturitätsquote berücksichtigt. Wenn man diese Debatten verstehen will, gilt es, sich kurz mit der Geschichte der Maturität auseinanderzusetzen. Dazu wird im folgenden Text erstens auf die Situation vor 1880, zweitens auf die Schaffung der Maturitätsanerkennung hingewiesen, drittens werden die Entwicklungen im 20. Jahrhundert nachgezeichnet, und abschließend werden einige Entwicklungen seit Mitte der 1990er Jahre skizziert, die erst das eingangs erwähnte EDK-Projekt als notwendig erscheinen ließen.
1Zur Situation vor 1880
Vorformen heutiger Gymnasien existierten bereits in der frühen Neuzeit. Grundsätzlich waren zunächst drei Modelle für die Vorbereitung auf ein Universitätsstudium bekannt: durch wie auch immer gearteten Privatunterricht, durch eine Vorbildungsinstitution im Sinne von Vorformen heutiger Gymnasien und durch entsprechende Institutionen an den Universitäten selbst: Die Ausbildung in den sogenannten septem artes liberales war an vielen Universitäten dem Studium an den Berufsfakultäten (Theologie, Jurisprudenz, Medizin) zunächst vorgelagert. Erst die neuhumanistische Bildungskonzeption trennte Gymnasium und Universität und erhob die septem artes liberales zur eigenständigen (Philosophischen) Fakultät (vgl. Criblez, im Druck).
Die Zulassung zum Studium an den kantonalen Universitäten war vor 1880 durch den ausgeprägten Bildungsföderalismus geprägt: Die Kantone waren sowohl für die Gymnasien als auch für die Universitäten zuständig. Die Regelung der Schnittstelle zwischen Gymnasien und Universität war damit bei den drei ältesten Universitäten (Basel, Gründungsjahr 1460, Zürich, 1833, und Bern, 1834) eine staatshoheitlich-kantonale Aufgabe, der Bund regelte die Zulassung zum 1855 eröffneten Polytechnikum (heute: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).
Die im 19. Jahrhundert noch sehr kleinen Universitäten hatten ein Interesse an Studierenden, was für eine großzügige Zulassung sprach. Gleichzeitig sollte im Sinne einer allmählichen Demokratisierung der Gesellschaft der Zugang zur höheren Bildung nicht mehr durch Geburt, Stand oder finanzielle Möglichkeiten definiert sein. Als Alternative dazu etablierte sich für die Zulassung zur Universität deshalb immer deutlicher das Leistungsprinzip. Eine hinreichende Vorbildung für das Studium wurde zur Zulassungsbedingung – der Maßstab für diese Vorbildung wurde die Maturität. Aber auch diesen neuen Leistungsausweis «Matur» regelten die Universitätskantone hoheitlich, jedoch der bildungsföderalistischen Logik folgend immer nur für ihr Kantonsgebiet und ihre Universität. Deshalb stellte sich das grundsätzliche Problem, wie die Zulassung von Studierenden aus andern Kantonen (oder aus dem Ausland) geregelt werden sollte. Eine Lösung dieses Problems waren bis in die 1880er Jahre Verträge zwischen den Gymnasien der Nicht-Hochschulkantone und den Universitäten bzw. dem Polytechnikum. Die Universitäten konnten so Einfluss auf die Maturitätsprogramme der Nicht-Hochschulkantone nehmen und eine Art Minimalstandards durchsetzen. Auch wenn die Anzahl der Gymnasien in der Schweiz zunächst relativ klein blieb,42 hatte diese Problemlösung eine Schwäche: Sie setzte auf je individuelle Verhandlungen zwischen den Gymnasien und den Universitäten und ließ keine einfache, allgemeine und institutionalisierte Lösung zu. Am Beispiel des Kantons Zürich lässt sich der Regelungsbedarf idealtypisch wie folgt beschreiben; der Kanton musste definieren:
(1)ein gymnasiales Programm und Bestehensnormen für die Maturität an der Zürcher Kantonsschule (Gymnasium und Industrieschule Zürich, später auch Winterthur);
(2)die Zulassung von Zürcher Maturanden und später auch Maturandinnen an die Universität Zürich;
(3)Absprachen über die Zulassung von Zürcher Maturanden und Maturandinnen an außerkantonale Universitäten (zunächst v. a. Basel, Bern);
(4)Absprachen über die Zulassung von Zürcher Maturandinnen und Maturanden ans Polytechnikum bzw. an die ETH;
(5)(vertragliche) Regelung der Bedingungen für die Zulassung von außerkantonalen Maturanden und Maturandinnen an die Universität Zürich;
(6)Zulassung von ausländischen Studierenden an die Universität Zürich.
Die Regelungen konnten nur in den Fällen 1, 2 und 6 kantonshoheitlich getroffen werden, was in den 1830er Jahren auch erfolgte. Alle andern Regelungen waren von Verhandlungen mit andern Kantonen, außerkantonalen Gymnasien oder dem Polytechnikum abhängig. Dabei kamen drei unterschiedliche Regelungen zur Anwendung, die auch miteinander kombiniert wurden: a) Die Universitäten schlossen mit Gymnasien Verträge ab, welche die Zulassung regelten; b) die Hochschulen führten Zulassungsprüfungen ein, wie sie etwa für die Zulassung zum Eidg. Polytechnikum üblich waren; c) die Zulassung erfolgte «sur dossier», dies insbesondere bei ausländischen Studierenden. Auf diesem Weg erfolgte 1864 auch die Zulassung der ersten Frau an eine Schweizer Universität, einer Russin an die Universität Zürich (vgl. Rogger & Bankowski, 2010). Sie verfügte selbstredend nicht über einen Maturitätsausweis aus der Schweiz.
2Neuregelungen in den 1870er und 1880er Jahren
Alle diese Regelungen waren kompliziert und aufwendig. Vor allem drei Entwicklungen begünstigten nun nach der Revision der Bundesverfassung 1874 eine generelle Regelung der Schnittstelle zwischen Gymnasium und Universität (vgl. Criblez, 2012): Erstens waren die radikalen und zentralistisch eingestellten politischen Kräfte bis zur «Schulvogt»-Abstimmung 1882 im Bundesstaat dominierend (vgl. Criblez & Huber, 2008). Zweitens näherten sich die Vorstellungen über die Zulassung zu den Universitäten und zum Polytechnikum einander an: Die Gymnasien mussten ihre bislang stark neuhumanistisch ausgerichteten Programme den Entwicklungen in den Naturwissenschaften anpassen, und das Polytechnikum setzte zunehmend auf allgemeine Bildung statt wie bisher auf technische und naturwissenschaftliche Vorbildung. Drittens sollte die Ausbildung in den Medizinalberufen im Kontext des starken Aufschwungs der Naturwissenschaften neu geregelt und vereinheitlicht sowie die Mobilität des Medizinalpersonals zwischen den Kantonen gewährleistet werden.
Schon 1867 hatten sich verschiedene Kantone auf ein Konkordat über Freizügigkeit der Medizinalpersonen geeinigt und mit den Reglementen für die Medizinalprüfungen 1867, 1870 und 1873 die Vereinheitlichung der Prüfungsanforderungen eingeleitet (Fischer, 1927, S. 7ff.; Lattmann, 1978, S. 20). Die neue Bundesverfassung von 1874 ermöglichte es dem Bund nun, die Freizügigkeit in den wissenschaftlichen Berufen für die ganze Schweiz zu regeln:
«Den Kantonen bleibt es anheimgestellt, die Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten von einem Ausweise der Befähigung abhängig zu machen. Auf dem Wege der Bundesgesetzgebung ist dafür zu sorgen, dass derartige Ausweise für die ganze Eidgenossenschaft gültig erworben werden können.» (BV, 1874, Art. 33)
Auf der Grundlage eines Bundesgesetzes betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals von 1877 (BG Medizinalpersonal, 1877) erließ der Bundesrat 1880 eine Verordnung für die eidgenössischen Medizinalprüfungen (Medizinalverordnung, 1880). In dieser Verordnung wurden aber nicht nur die Medizinalprüfungen geregelt, sondern sie enthielt auch Vorgaben zur Vorbildung:
«Um den Zutritt zur propädeutischen Prüfung zu erlangen, hat der Kandidat folgende Nachweise beizubringen: a. über vollständig und befriedigend absolvierte Gymnasialstudien durch ein als Ergebniss einer Prüfung ausgestelltes Abgangs- resp. Reifezeugnis (vgl. die Bestimmungen des Maturitätsprogramms für Mediziner im Anhang). […]» (Verordnung Medizinalprüfungen, 1880, Art. 10)
Im Anhang der Verordnung wurden die Maturitätsprogramme für Mediziner, Pharmazeuten und Kandidaten der «Thierarzneikunde» geregelt.
De jure verfügte der Bund auch mit der Bundesverfassung von 1874 nicht über die Kompetenz, die Zulassung zu den kantonalen Universitäten einheitlich zu regeln. Er konnte auf der Grundlage des Artikels 33 lediglich die Zulassung zu den Medizinalstudien definieren – und natürlich diejenige zur eigenen Hochschule, also zum Polytechnikum. Mit der Revision der Verordnung über die Medizinalprüfung (Verordnung Medizinalprüfungen, 1888) wurden dennoch zwei weitere Schritte in Richtung Generalisierung der Bundesvorgaben für die Maturitätsprüfungen eingeleitet. Erstens setzte der Bund eine eidgenössische Maturitätskommission ein. Sie sollte prüfen, ob die Maturitätsprogramme der Kantone den Vorgaben der Verordnung über die Medizinalprüfungen entsprachen. Und sie organisierte nun neu auch individuelle eidgenössische Maturitätsprüfungen – zunächst allerdings ausschließlich für Studierende der Medizinalberufe.
3Von der ersten Anerkennungsverordnung 1906 zur Maturitätsrevision 1972
Die gymnasiale Maturität veränderte sich im 20. Jahrhundert in mehreren Schritten sehr weitreichend. Als eher kleiner Reformschritt gilt die Revision von 1906 (Fischer, 1927, S. 164ff.; Maturitätsverordnung, 1906; Vonlanthen & Lattmann, 1978). Erstmals war die Verordnung nun explizit auf die Maturitätsausweise bezogen, wenn auch nach wie vor auf diejenigen der Kandidatinnen und Kandidaten der medizinischen Berufsarten. Allerdings hatte sich die 1897 gegründete EDK nun stark in die Verhandlungen eingemischt. Hauptsächlicher Konfliktpunkt war die mögliche Anerkennung eines realistischen Gymnasialprogramms neben dem klassisch-neuhumanistischen. Es kam aber lediglich zur Akzeptanz eines Maturitätsprogramms ohne Griechisch. Mit «status quo» fasste Fischer (1927, S. 225) das Ergebnis der Verhandlungen zusammen. Deshalb wurden die Diskussionen um das neuhumanistische und das realistische Ausbildungsprogramm auch nach 1906 fortgesetzt. Sie mündeten auf der Grundlage einer viel diskutierten Expertise des Basler Rektors Albert Barth (1919) in der Schaffung der Typenmaturität 1925 (MAV, 1925). Zugleich wurde nun die Generalisierung der Bundesvorgaben über die Medizinalberufe hinaus deutlich, denn erstmals zielten die Regelungen auf die Anerkennung kantonaler Maturitäten unabhängig von den gewählten Studienrichtungen. Maturitäten der kantonalen Gymnasien konnten nun anerkannt werden, wenn sie einem der drei Maturitätstypen entsprachen: A (neuhumanistisch, altsprachlich), B (mit Latein und einer modernen Fremdsprache) oder C (ohne Griechisch und Latein, mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt). Allerdings blieb das Nacharbeiten des Lateins für Studierende mit C-Matur, die ein Medizinstudium aufnehmen wollten, obligatorisch, und die Universitäten hielten auch für viele andere Studienfächer am Latein als obligatorischer Vorbildung fest.
Zwischen 1880 und 1925 wurde das ursprünglich nur für die Medizinalberufe geltende Maturitätsprogramm Schritt für Schritt zur generellen Norm für die Maturität. Allerdings ließ sich die «Einheit» der Matur im Sinne eines neuhumanistischen Gymnasialprogramms vor dem Hintergrund des Aufstiegs der Naturwissenschaften nicht aufrechterhalten. Die Typenmatur, die bis Ende des 20. Jahrhunderts Bestand hatte, war die Lösung des Streits um die Ausrichtung der gymnasialen Maturitätsprogramme.
Eine eidgenössisch anerkannte, aber nach kantonalen und vielfach einzelschulischen Normen definierte Typenmatur war damit zum «Königsweg» in die Universität geworden. Die Verträge zwischen den Gymnasien und den Universitäten wurden so Schritt für Schritt obsolet. Die ehemals lose Koppelung, die Weick (1976) für die Organisation von Bildungssystemen als typisch bezeichnet hatte, war an der Schnittstelle zwischen Gymnasium und Universität über die Anerkennungsbedingungen für die kantonalen Maturitätsausweise enger geworden. Die eidgenössische Anerkennung kantonaler Maturitätsausweise war zugleich eine einfache Lösung für ein komplexes Problem im föderalistischen Bildungssystem. Im Effekt regelte aber spätestens seit der Revision von 1925 (MAV, 1925) der Bund die kantonalen Maturitäten im Sinne von Rahmenvorgaben (Dauer, Fächer, Anteile von Fachbereichen, formale Prüfungsvorgaben, Maturanoten und Bestehensnormen, Maturitätsausweis) und damit weitreichend auch die Zulassung zu den kantonalen Universitäten.
Während der Bildungsexpansionsphase der 1950er bis Mitte der 70er Jahre sollte aufgrund des Nachwuchsmangels und der Forderung nach besseren Zugangschancen für bislang benachteiligte Gruppen die höhere Bildung geöffnet werden (vgl. Criblez, 2001). Die Maturitäts-Anerkennungsverordnung wurde deshalb in kurzer Zeit zweimal revidiert (vgl. Egger, 1987; Meylan, 1996): 1968 wurde der Maturitätstyp C den andern Maturitätstypen gleichgestellt und die Lateinauflage für das Medizinstudium aufgehoben (MAV, 1968). Zudem wurde der «gebrochene» Bildungsweg (Kurzgymnasium im Anschluss an eine Sekundar- oder Bezirksschule) aufgewertet. Vier Jahre später (MAV, 1972) wurden zwei neue Maturitätstypen geschaffen, um sogenannte «Begabungsreserven» besser fürs Gymnasium mobilisieren zu können. Insgesamt blieben aber Funktion und Konstruktion der Matur weitgehend erhalten.
4Die Maturitätsreform 1995 und die Folgen – ein Ausblick
Schon im Umfeld der Revision 1968/1972 war die Anerkennung weiterer Maturitätstypen diskutiert und zum Teil gefordert worden. In den 1980er Jahren kam es aber zu einem Umdenken: Die Matur sollte nicht weiter differenziert, sondern wieder stärker an gemeinsamen Anforderungen ausgerichtet werden. Mit der Maturitätsreform 1995 wurden deshalb die Maturitätstypen abgeschafft und eine «Einheitsmatur» mit zehn Grundlagenfächern, Wirtschaft + Recht, einem Schwerpunkt-, einem Ergänzungsfach und einer Maturarbeit eingeführt. 2018 wurde zudem beschlossen, zusätzlich Informatik zu einem obligatorischen Fach zu machen. Zudem wurden die Bestehensnormen neu definiert. Die Reform wurde nun erstmals von Bund und Kantonen (EDK) gemeinsam angegangen: Sie erließen je einen identischen Rechtstext und schufen mit einer Verwaltungsvereinbarung die Grundlagen für gemeinsame Organe, insbesondere die Eidgenössische Maturitätskommission.
Mit der Reform war eine formale Vereinheitlichung der Maturitätsprogramme verbunden: Die Differenz zwischen unterschiedlichen gymnasialen Programmen ist dadurch geringer geworden und besteht eigentlich nur noch im Schwerpunkt- und Ergänzungsfach. In allen andern Fächern gelten – anders als bei der früheren Typenmatur – für alle Schülerinnen und Schüler dieselben Leistungserwartungen. Die von der Reform zunächst erwartete Individualisierung durch Wahlmöglichkeiten im Schwerpunkt- und Ergänzungsfach ist weitgehend nicht eingetreten, weil die Gymnasien aus Ressourcengründen nicht das ganze Spektrum von Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern anbieten können.
Die gymnasiale Ausbildung hat durch die Schaffung der Berufsmatur und der Fachmatur in den letzten zwanzig Jahren Konkurrenz erhalten: Sie führt nicht mehr als einziger Weg zu einem Hochschulstudium. Gleichzeitig ist sie durch den Numerus clausus in Medizin nicht mehr hinreichender Zulassungsausweis für dieses Studium. Durch die Möglichkeiten der Passerelle von der Berufsmatur und der Fachmatur zur Universität und die Zulassung zum Studium ohne Matur (in Genf und Freiburg) wurde die Bedeutung als Zulassungsausweis ebenso relativiert wie durch die selektiven Assessmentphasen an den Hochschulen. All dies sind Gründe, sich um die Sicherung der Matur als allgemeiner Hochschulzulassungsausweis bildungspolitisch zu kümmern. Der Streit zwischen den allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen um schulleistungsstarke Schülerinnen und Schüler oder um die Maturitätsquoten43 dient angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels, der die Sekundarstufe II in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren wesentlich verändern wird, nicht der Lösung anstehender gesellschaftlicher Probleme.
Literatur
Barth, A. (1919). Die Reform der höheren Schulen. Basel: Kober.
BG Medizinalpersonal (1877). Bundesgesetz betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der schweizerischen Eidgenossenschaft vom 19. Christmonat [Dezember] 1877. In G. Finsler [Hrsg.], Die Lehrpläne und Maturitätsprüfungen der Gymnasien in der Schweiz (S. 5–8). Bern: Stämpfli.
BV (1874). Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874. In H. Nabholz & P. Kläui, Quellenbuch zur Verfassungsgeschichte (S. 326–352). Aarau: Sauerländer.
Criblez, L. (2001). Bildungsexpansion durch Differenzierung des Bildungssystems – am Beispiel der Sekundarstufe II. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 23(1), 95–118.
Criblez, L. (2003). Reform durch Expansion – Zum Wandel des Gymnasiums und seines Verhältnisses zur Universität seit 1960. VSH-Bulletin, 29(4), 30–36.
Criblez, L. (2012). Der Berner Gymnasialstreit – ein bildungspolitisches «Lehrstück». In C. Aubry, M. Geiss, V. Magyar-Haas & D. Miller (Hrsg.), Positionierungen. Zum Verhältnis von Wissenschaft, Pädagogik und Politik (S. 268–288). Weinheim: Beltz Juventa.
Criblez, L. (im Druck). Die höhere Bildung in der Schweiz – von der neuhumanistischen Neukonstituierung bis Mitte des 20. Jahrhunderts. In I. Brühwiler et al. (Hrsg.), Schweizer Bildungsgeschichte – Systementwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Zürich: Chronos.
Criblez, L., & Huber, C. (2008). Der Bildungsartikel der Bundesverfassung von 1874 und die Diskussion über den eidgenössischen «Schulvogt». In L. Criblez (Hrsg.), Bildungsraum Schweiz – Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen (S. 87–129). Bern: Haupt.
Eberle, F., Gehrer, K., Jaggi, B., Kottonau, J., Oepke, M., & Pflüger, M. (2008). Evaluation der Maturitätsreform 1995 (EVAMAR). Schlussbericht zur Phase II. Bern: Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF).
EDK (2003). Reglement über die Anerkennung der Abschlüsse von Fachmittelschulen vom 12. Juni 2003. Online: https://edudoc.ch/record/32197/files/Regl_FMS-d.pdf; [20.10.2018].
EDK (2016). Gymnasiale Maturität – Langfristige Sicherung des prüfungsfreien Hochschulzugangs: Entscheid über den Abschluss der Teilprojekte – Folgemaßnahmen. Beschluss der Plenarversammlung vom 17. März 2016. Online: https://edudoc.ch/record/121444/files/PB_gym_maturitaet_d.pdf [20.10.2018].
Egger, E. (1987). Die Reformetappen 1946 bis 1978. In A. Vonlanthen, U. P. Lattmann & E. Egger, Maturität und Gymnasium (S. 101–130). Bern: Haupt.
Fischer, H. (1927). Die Mediziner, der Bund und die schweizerischen Gymnasien. Bern: Francke.
KSGR [Konferenz schweizerischer Gymnasialrektorinnen und Gymnasialrektoren] (2013). Das Schweizer Gymnasium. Köpfe, Ziele, Positionen. Zürich: Chronos.
Lattmann, U. P. (1978). Die Entwicklung der Maturitätsordnungen bis um 1900. In A. Vonlanthen, U. P. Lattmann & E. Egger, Maturität und Gymnasium (S. 17–28). Bern: Haupt.
Maturitätsverordnung (1906). Verordnung betreffend den Maturitätsausweis für die Kandidaten der medizinischen Berufsarten vom 6. Juli 1906. Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen der schweizerischen Eidgenossenschaft, Neue Folge XXII, 400–415.
MAV (1925). Verordnung über die Anerkennung von Maturitätsausweisen durch den schweizerischen Bundesrat vom 20. Januar 1925. Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen der schweizerischen Eidgenossenschaft, Neue Folge XLI, 25–46.
MAV (1968). Verordnung über die Anerkennung von Maturitätsausweisen (Maturitäts-Anerkennungsverordnung – MAV) vom 22. Mai 1968. Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen, 693–703.
MAV (1972). Verordnung über die Anerkennung von Maturitätsausweisen. Änderung vom 18. Dezember 1972. Sammlung der eidgenössischen Gesetze, 2847–2851.
Medizinalverordnung (1880). Verordnung für die eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 2. Juli 1880. Amtliche Sammlung der Bundesgeseze [sic!] und Verordnungen der schweizerischen Eidgenossenschaft, Neue Folge V, 115–151.
Meylan, J.-P. (1996). Die Erneuerung des Gymnasiums und die Anerkennung der Maturitäten – Stationen der Debatte 1968–1995. In EDK (Hrsg.), Von der «Mittelschule von morgen» zur Maturitätsreform 1995 (S. 7–45). Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
Rogger, F., & Bankowski, M. (2010). Ganz Europa blickt auf uns! Das schweizerische Frauenstudium und seine russischen Pionierinnen. Baden: Hier + Jetzt.
Sarasin, P. (2014). Bildung in der Wissensgesellschaft – oder: Sind tiefe Maturitätsquoten sinnvoll? In F. Eberle, B. Schneider-Taylor & D. Bosse (Hrsg.), Abitur und Matura zwischen Hochschulvorbereitung und Berufsorientierung (S. 111–141). Wiesbaden: Springer VS.
Strahm, R. H. (2014). Die Akademisierungsfalle. Warum nicht alle an die Uni müssen. Bern: hep.
Verordnung Medizinalprüfungen (1888). Verordnung für die eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 19. März 1888. Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen, Neue Folge X, 497–536.
Vonlanthen, A. & Lattmann, U. P. (1976). Die Reform der Maturitätsordnungen von 1906 bis 1946 und ihre Auswirkungen auf das Gymnasium. In A. Vonlanthen, U. P. Lattmann & E. Egger, Maturität und Gymnasium (S. 29–99). Bern: Haupt.
Weick, K. E. (1976). Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative Science Quarterly, 21(1), 1–19.