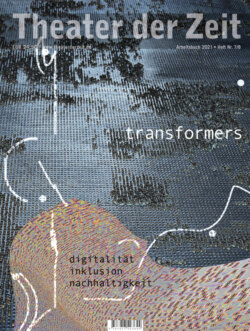Читать книгу transformers - Группа авторов - Страница 6
design und desaster vorrede zur transformation des theaters
ОглавлениеNachhaltigkeit, Digitalisierung, Inklusion – die Themen der Großen Transformation unserer Zeit waren alle schon vor Corona da. Die Pandemie katalysiert und beschleunigt ihre Effekte. Ein oft gebrauchtes Bild, deswegen nicht weniger wahr: Corona zeigt uns im Brennglas, was los ist. Kein Zufall, dass wir gerade jetzt verstärkt über Rassismus und die Fleischindustrie sprechen, über Klassismus und Bildung, über das Anthropozän oder die Veränderung unserer Innenstädte. Doch was ist das überhaupt, diese ominöse Transformation, von der auf einmal alle reden? Und was bedeutet sie für den Theaterbetrieb?
Zum Einstieg in das Arbeitsbuch befragt JONAS ZIPF die Soziologin SILKE VAN DYK und den Architekten FRIEDRICH VON BORRIES. Ein Gespräch über Begriffe und ihren Gegenstand, über Form und Inhalt, über das Erzählen und Erleben und darüber, ob sich die ganze Sache mit dem Theater noch irgendwie verändern lässt.
JONAS ZIPF: Unser Gespräch setzt den Einstieg und Rahmen für ein Arbeitsbuch zur Transformation des Theaterbetriebs. Es steht unter dem Titel Transformers und widmet sich drei thematischen Schwerpunkten, mit denen wir Herausgeber*innen die Transformationsthemen, die das Theater und den Kulturbetrieb betreffen, clustern. Die drei Schlagwörter lauten Nachhaltigkeit, Inklusion – wir sprechen bewusst von Inklusion und nicht von Diversität – und Digitalisierung. In unserem Buch versammeln wir Texte und Thesen, Ansätze und Ausblicke, skizzieren Prozessdesigns der Transformation. Als Pendant zu unserem heutigen Gespräch steht am Ende des Buchs der gedankliche Austausch zwischen Rahel Jaeggi und Carsten Brosda. Da wollen wir darüber sprechen, wie das gehen soll: die große Veränderung und der Alltag der Theater- und Kulturbetriebe. Top down oder Bottom up? Mit euch möchte ich in dieses Buch einsteigen: Was ist das eigentlich, die Große Transformation, die gerade in aller Munde ist und so unendlich unterschiedlich aufgeladen wird. Wie ereignet sie sich? Wen betrifft sie? Und wen erreicht sie? Aber zunächst zum Transformationsbegriff selbst: Worin unterscheidet sich Transformation von Reform?
FRIEDRICH VON BORRIES: Ich sehe da zwei Ansätze. Einerseits trägt die Reform das „Re“ in sich, also eine Vorstellung davon, dass es mal eine Form gegeben hätte, die es wieder herzustellen gälte. Andererseits sehe ich diesen Begriff stark im politischen Raum verortet, der häufig noch von der Vorstellung geprägt ist, dass Politik ein prägender gesellschaftlicher Treiber sei, während wir bei den gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen andere Akteure erleben: Akteure aus Kunst und Kultur, aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der Wirtschaft. Ich verstehe Transformationsprozesse also so, dass es nicht mehr das Primat der Politik gibt, sondern – und darin besteht ja vielleicht auch ein Problem der Gegenwart – das Feld der Politik der Wirklichkeit hinterherhinkt, weil viele gesellschaftliche Bereiche sich bereits transformiert haben. Ich sehe den Unterschied zwischen den beiden Begriffen also darin, dass Reformen etwas beschreiben, was es schon gegeben hat und wieder herzustellen gäbe, also Re-Formieren, Transformationen dagegen von anderen, neuen Akteurskonstellationen ausgehen. In dieser Veränderung der Akteurskonstellationen zeigt sich dann auch noch ein dritter Aspekt: Denn ich glaube, dass die Transformation ein Verwandlungsprozess ist, in dem das ursprüngliche Wesen erhalten bleibt, sich zwar die Form verändert, aber das, was darin liegt, dennoch als Energie erhalten bleibt – nur eben transformiert. Anders als eine Revolution, die alles umkehrt und grundlegend verändert, ist die Transformation ein langsamer Prozess.
JONAS ZIPF: In deinem Buch Weltentwerfen entwickelst du allerdings eine „politische Designtheorie“ und beschreibst gesellschaftliche Veränderung als Gestaltungsanspruch an die kleinen und die großen Dinge. Um zunächst beim Abgrenzen der Begriffe zu bleiben: Würdest du dich als Transformationsdesigner bezeichnen?
FRIEDRICH VON BORRIES: Mir gefällt an solchen Begriffen nicht, dass sie den gerade im akademischen Raum ständig wiederkehrenden, stark konkurrenzorientierten Versuch darstellen, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. Oft geht es dabei um akademische Selbstbehauptung oder -vermarktung. Was ich aber an dem Begriff mag, ist, dass eine Gestaltungsdimension nach vorne geschoben wird, also dass der Begriff einen Gestaltungsvorgang beschreibt – also dass Transformation nicht unwillkürlich über uns hinwegrollt, sondern gestaltbar ist, ein Prozess, an dem übrigens viele Menschen beteiligt sind, ob sie wollen oder nicht. Aus der Praxis eines Architekten heraus gesprochen fällt mir negativ auf, dass in den Transformations- und Nachhaltigkeitsdiskursen der Gegenwart diejenigen, die sich mit der Gestaltung von Veränderungen aktiv auskennen – also Architekt*innen, Designer*innen oder Künstler*innen – überhaupt nicht vorkommen. Im Rat für Nachhaltigkeit sitzen Sozialwissenschaftler*innen, die das alles beschreiben können; da sitzen Technikwissenschaftler*innen oder Ingenieur*innen, die alles technisch neu erfinden wollen – aber die, die genau die Zwischenschritte zwischen technischen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Machbarkeiten machen, diejenigen, die mit diesen Möglichkeiten kreativ und gestalterisch, im wahrsten Sinne des Wortes, umgehen, die fehlen. Es ist mir also wichtig, daran zu erinnern, dass man die auch braucht: Ihr seht: Letztlich verstehe ich Begriffe wie Transformation und Transformationsdesign in ihrer praktischen Dimension. Zur theoretischen Begriffsdefinition würde ich lieber an die Sozialwissenschaftlerin in der Runde weitergeben.
SILKE VAN DYK: Tatsächlich verwenden wir den Begriff der Transformation mittlerweile relativ breit im Alltag. Der Begriff markiert, jenseits der alten linken Kontroversen zwischen Reformisten und Revolutionären, etwas dazu Querliegendes. Indem er tatsächlich breitere Akteurskonstellationen adressiert und auf unterschiedlichen Ebenen ansetzt, beschreibt Transformation einen Prozess der kleinen Schritte, der gleichzeitig auf ein radikales Ziel hin orientiert sein kann. Daher halte ich es für keinen Zufall, dass jetzt aktuelle Bewegungen sich nicht mehr im Gegensatz von Reform und Revolution verkämpfen und sich lieber darum bemühen, Transformationsprozesse anzustoßen. Ihre Fragestellung ist eine andere: Wie verhält sich, um auch beim Designbegriff zu bleiben, Transformation by Design zu Transformation by Desaster? Damit wären wir bei der eingangs erwähnten Wegscheide zwischen aktiver Gestaltung und durch Katastrophen erzwungener Transformation. Dieses Fragen danach, ob wir voranschreiten oder uns den Entwicklungen ergeben, kennzeichnet ja schon die globalisierungskritischen Bewegungen der 90er, erst recht aber die Klima- oder Emanzipationsaktivist*innen unserer Zeit: Der Unterschied zu der alten Debatte zwischen Reform und Revolution besteht darin, dass diese Bewegungen – und das ist ein ganz entscheidender Punkt – auch radikal damit arbeiten, dass sich die Akteure der Transformation im Prozess der Transformation selbst verändern. Sei es durch neue Formen der Kooperation im Protest, das Erproben solidarischer Alltagsökonomien oder durch räumlich situierte Konzepte, etwa den Platzbesetzungen der Occupy-Bewegung. Auch wenn solche Praktiken in ihrer Wirkung bisweilen überakzentuiert und überschätzt worden sind und zu schnell und zu euphorisch zu einem neuen Gesellschaftsmodell aufaddiert wurden, so glaube ich trotzdem, dass die Idee, dass Akteure sich in Transformationsprozessen wandeln, extrem wichtig ist. Und mehr noch: dass sie auch ihre Ziele dynamisch modifizieren, dass bisweilen radikale Lösungen im Prozess denk- und lebbar werden, die es in den Anfängen vielleicht noch gar nicht gab.
JONAS ZIPF: Für das Arbeitsbuch geht unser Verständnis des Transformationsbegriffs stark aus von Karl Polanyi, also vom historischen Rückblick auf das sogenannte lange 19. Jahrhundert, die soziale, gesellschaftliche, ökonomische und politische Entwicklung bis hin zum Dritten Reich. Polanyi beschreibt Transformation letztlich als Veränderung, die stattfindet, ob wir wollen oder nicht. Seine zwangläufige Frage ist, wer sie zu welchem Zweck, in welche Richtung gestaltet. Angesichts kommender oder laufender Transformationen haben gesellschaftliche Gruppen keine Wahl, diese zu verhindern, nur die Wahl, sie in ihrem Sinne zu gestalten. Entspricht das auch deinem Transformationsverständnis?
SILKE VAN DYK: Voll und ganz. Das, was Polanyi als Great Transformation bezeichnet, macht eine strukturell historische Dynamik auf, die sich möglicherweise auf heute übertragen lässt. Seine zentrale Idee ist es zu zeigen, dass es im Kapitalismus keine nicht eingebetteten Märkte gibt. Der Kapitalismus ist für sein Funktionieren immer darauf angewiesen, nicht-marktförmige Ressourcen, Strukturen und Institutionen für seine Reproduktion zu nutzen. Polanyi begreift diese Muster als Pendelbewegung: Auf Phasen der Liberalisierung, Deregulierung und Flexibilisierung folgen deshalb Gegenkräfte der Marktbegrenzung, -einbettung und -einschränkung. Was uns nun im Postwachstumskolleg in Jena interessiert hat, war die im Anschluss an Polanyi gestellte Frage, ob wir uns aktuell nicht in einer Konstellation befinden, die vielleicht nicht in jeglichem Sinne ähnlich, aber immerhin vergleichbar mit der Situation der Zwischenkriegszeit ist, die Polanyi analysiert hat: Ob auch wir uns in einer Phase befinden, in der nach radikalen Deregulierungen und Liberalisierungen verschiedene Kräfte miteinander um die Vorherrschaft neuer Formen der Einbettung und Regulierung ringen. Für die aktuelle Situation ist das Interessante an Polanyis historischer Analyse, dass man an den 1920er- und 30er-Jahren sehen kann, wie offen die politische Situation war. Es war nicht absehbar, von welcher politischen Seite die Wiedereinhegungen und Regulierungen, die postliberalen Antworten auf die Krise des liberalen Kapitalismus kommen. Heute wissen wir, dass sich Nationalsozialismus und Faschismus gegen die sozialistischen und kommunistischen Projekte durchgesetzt haben; auch heute lässt sich erkennen, dass es wieder verschiedene postliberale Projekte gibt, die auf eine Wiedereinhegung des Kapitalismus zielen. Zwar zeigen sich nicht alle erstarkten rechten und rechtspopulistischen Akteure als radikal neoliberalismuskritisch – das Spektrum ist äußerst heterogen, wie wir immer noch innerhalb der AfD, aber zum Beispiel auch bei den rechten skandinavischen Parteien sehen – wir erleben aber in Ungarn, in Polen oder auch in Frankreich eine im wirklich sprichwörtlichen Sinne national-soziale Politik, wie wir sie historisch in Deutschland auch von der NSDAP kennen, die tatsächlich ebenfalls ein postliberales Projekt der Wiedereinbettung ist. Damit zeigt sich die Offenheit der Transformation: Es gibt verschiedene Kräfte, die den Anspruch der Gestaltung erheben. Nicht jede postliberale Antwort oder jeder postliberale Protest ist emanzipatorisch oder progressiv. Auch wenn wir uns natürlich in einer ganz anderen Situation als in der von Polanyi analysierten Zwischenkriegszeit befinden, erleben wir doch eine ähnlich offene Konstellation.
JONAS ZIPF: Ähnliche historische Parallelen werden momentan immer häufiger, gerade im Osten Deutschlands, bemüht. In der Pandemie erklingt der Transformationsbegriff plötzlich auch in der Kultur. Die Kulturpolitische Gesellschaft, der Kulturrat, alle möglichen Dach- und Fachverbände verwenden diesen Begriff. Jeder verwendet ihn anders, einige Diskussionen verlaufen noch sehr ungenau. Schon steht der Vorwurf im Raum, dass der Begriff eine kulturpolitische Ummantelung für die gleichzeitig im politischen Hintergrund längst begonnenen Kürzungsdiskussionen sei. Lässt sich da von den historischen Analogien lernen? Welchen Einfluss können denn Gestalter*innen und Künstler*innen auf solche offenen Situationen überhaupt nehmen?
SILKE VAN DYK: Zwei Punkte dazu. Erstens gälte es, das vorhandene rebellische Potenzial in der Kultur oder Kunst zu analysieren. In der Kritischen Theorie wird die These der Kulturindustrie schon seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts untermauert: Kunst und Kultur finden, so die These, vornehmlich in ihrer verwerteten, angepassten und damit nicht mehr subversiven Form statt. Weitergeführt wurde der Gedanke in Ansätzen, die analysieren, wie im Neoliberalismus selbst Kritisches und Subversives in Ressourcen einer flexibilisierten Produktion und Gesellschaft umgearbeitet werden. Das könnte durchaus eine Rolle bei der Frage spielen, warum die künstlerische oder kulturelle Perspektive aus den aktuellen Transformationsdebatten so sehr herauskippt. Zweitens wird Gestaltung innerhalb des Bereichs der Kultur und Kunst vielleicht immer noch allzu sehr im engeren Wortsinne von rein ästhetischem Design verstanden und eben nicht im Sinne von politischer Gestaltung. Dabei postuliert doch schon vor hundert Jahren das Bauhaus ein breiteres Design-Verständnis: Dass Ästhetik immer politisch ist, dass jede Form einen Inhalt transportiert. Die Kernfrage macht sich tatsächlich an der in der Postwachstums- und Degrowth-Debatte gebräuchlichen Gegenüberstellung von Transformation by Desaster vs. Transformation by Design fest. Ein derartig breites Begriffsverständnis von Design beinhaltet selbstverständlich auch die künstlerische oder kulturpolitische Gestaltung von Transformation.
FRIEDRICH VON BORRIES: Stellt euch vor, wir sollten ein nachhaltiges Gebäude entwerfen. Die Techniker*innen schlagen vor, eine künstliche Belüftungs- und Klimatisierungsanlage einzubauen, die optimal zu den Wind- und Wetterbedingungen passt, vollautomatisiert auf die Raumbelegung reagiert, die Jalousien betätigt usw. usf. Die Sozialwissenschaftler*innen stellen fest, dass die Nutzer*innen das überhaupt nicht mögen und total paralysiert reagieren, wenn plötzlich die Jalousie runterfährt und sie eigentlich nicht wissen, warum. Beide haben aber keine Lösung dafür, was sie jetzt machen sollen. Genau dafür, wie man mit diesem Dilemma umgeht, dass eine bestimmte technische Lösung rechnerisch, ökobilanzseitig perfekt aufgeht, aber von den Nutzer*innen nicht angenommen wird, braucht es die Leute, die Lösungen gestalterisch, explorativ, iterativ, spielerisch entwerfen und andere Vorschläge machen. Die kommen aber in unseren bisherigen gesellschaftlichen Problemlösungsmodellen nicht vor. Auch die ganze manageriale Praxis sieht doch ein iteratives und kreatives Vorgehen überhaupt nicht vor. Deshalb kommen die Unternehmen ja auch mit der Krise nicht zurecht. Ich behaupte dabei übrigens gar nicht: Künstler*innen, Gestalter*innen, Architekt*innen können es besser. Eher stelle ich fest, dass die bisherigen Problemlösungsmodelle an ihre Grenzen geraten sind und wir deshalb andere ausprobieren müssen. Ob die aus der Kunst, aus dem Design, aus der Architektur kommen – als gestalterisch agierender Mensch würde ich dazu ja sagen: Das entwerfen wir im Prozess und finden es heraus. Aber genau dieses zunächst ergebnisoffene Arbeiten, das ständige Verändern im Prozess, was ja das Wesen von Transformation ausmacht, kommt als Handlungsmodell nicht vor. Das gilt es zu üben, zu lernen, zu erproben!
SILKE VAN DYK: Gleichzeitig gibt es aber in den progressiven Bewegungen der jüngeren Vergangenheit eine Tendenz hin zur Technokratie, eine Tendenz dazu, sich an Kenntnissen der Wissenschaft festzuhalten und dafür zu plädieren, diese umzusetzen. Das ist eine Entwicklung, die wir zum Beispiel in der Fridays-for-Future-Bewegung sehen, die das Motto „Listen to the Science“ als Scharnier versteht und dafür wirbt, dass die Politik jetzt endlich exekutieren soll, was die Wissenschaftler*innen schon lange sagen. Nehmen wir nur die Autorin und Aktivistin Naomi Klein, die den Klimawandel als ein Geschenk an die Linke beschreibt, weil er objektiv notwendig macht, was die Linke doch immer schon wollte. Ich halte diese Tendenzen für gefährlich, weil ich glaube, die Suspendierung von Politik, Streit und Auseinandersetzung ist undemokratisch, auch wenn sie aus den normativ richtigen Gründen erfolgt. Natürlich sollen wissenschaftliche Erkenntnisse eine zentrale Rolle spielen, sowohl was den Klimawandel oder die Pandemie angeht – aber die Entscheidung, was damit zu machen ist, ist einfach eine politische. Dieses technokratische Verständnis von Transformation, dass progressive Politik jetzt nur noch das umzusetzen habe, was die Wissenschaftler*innen ihr sagen, versperrt den Blick auf das, was Friedrich von Borries einfordert: die eher suchenden, kreativen Prozesse.
JONAS ZIPF: Ich möchte an dieser Stelle ein spezifisches Transformationspotenzial des Theaters einbringen: das Erzählen von Geschichten. Und zwar in zweierlei Richtungen: Zum einen als Erzählen von utopischen Geschichten, die nach dem fragen, was außerhalb dessen steht, was gerade möglich scheint. Was ist nach der Transformation? Welche Gelingensgeschichten beschreiben uns, wie wir zusammenleben wollen? Welche Dystopien zeigen uns, wo es hingehen kann, wenn die Transformation nicht gelingt bzw. gestaltet wird? Zum anderen als Mittel der Inklusion: Wir haben deswegen Inklusion als dritten Begriff bestimmt – und nicht etwa Diversität oder Emanzipation –, weil wir keine Zustandsbeschreibungen identitätspolitischer Stellungskriege einbeziehen wollen, sondern lieber etwas beschreiben, was vielleicht als Gelingen in der Zukunft liegt. Das Geschichtenerzählen ist ein probates und dem Theater innewohnendes Mittel, um Hochschwelligkeit runterzubrechen auf Erzählweisen, die die Menschen verstehen. Der von Silke van Dyk beschriebene aktivistische Diskurs hat in den letzten Jahren dagegen in Teilen einen technokratischen, szientistischen, wissenschaftsbezogenen Dreh bekommen, der ihn per se stark elitär macht. Die Kunst kennt das ähnliche Phänomen der Avantgarde: Diejenigen, die die Transformationen gestalten wollen und können, denken voraus, wissen schon ein bisschen mehr, schauen über den Tellerrand. Dabei kann die Gestaltung der Transformation nur gelingen, wenn eine kritische Masse der Gesellschaft mitkommt – gerade, wenn wir uns noch mal die Situation ausgangs der Weimarer Republik vergegenwärtigen.
FRIEDRICH VON BORRIES: Da regen sich bei mir sofort Anti-Theater-Reflexe. Was du „Geschichten erzählen“ nennst, nenne ich Imagination von Zukunft, von möglichen Zukünften, extrem unwissenschaftlich, total spekulativ. Das ist eigentlich etwas, das Politik können sollte, sich aber kaum traut und schon gar nicht macht. Aber alle gestalterischen Dimensionen machen es, natürlich auch das Theater. Der große Unterschied zwischen Theater, Design und Architektur besteht aber darin, dass Design und Architektur immer auch die Machbarkeitsebene in den Blick nehmen: Wie setzen wir Zukunft denn nachher technisch und ökonomisch um? Das machen die Theaterleute nicht. Das Erzählen von Geschichten alleine reicht nicht. Denn Geschichten werden erzählt, und andere hören der Geschichte zu; d. h. wir haben einen aktiven und einen passiven Part, wir haben einen Produzenten oder eine Produzentin, und wir haben Konsument*innen. Genau das ist der falsche Weg. Wir leben doch in einer Zeit, in der ein ganz großer Teil der Bevölkerung extrem gut informiert ist und Situationen ständig mit historischen Dimensionen über Kenntnisse von Problemen vergleichen kann. Das Kernproblem für gelingende Transformationen besteht nicht in fehlendem Wissen, sondern im Zutrauen, im Sich-vorstellen-Können oder auch in mangelnder Erfahrung. Dafür brauchen wir keine Vermittlungsräume, in denen mir Neues erzählt wird, sondern Erfahrungsräume, in denen Menschen erfahren können, dass etwas möglich ist. Erleben, erfühlen, erspüren. Eigentlich muss das Theater aufhören, Theater zu sein, und zum performativen Raum werden, in dem es keine Zuschauer*innen mehr gibt, die passiv etwas konsumieren, sondern jede*r Beteiligte zur*m Performer*in seiner*ihrer möglichen Zukunft wird, da rausgeht und sagt: Ich hab hier was gespürt, ich hab hier was erlebt, ich war Teil von etwas, das mir glaubhaft werden lässt, dass eine andere Zukunft möglich ist. Theater können nur dann zum Mitgestalter von Transformationen werden, wenn sie experimentelle, geschützte Räume des Erlebens und Mitgestaltens öffnen. Da ist das Theater in seiner didaktisch-aufklärerisch-erklärenden Tradition einfach immer noch auf dem falschen Dampfer!
JONAS ZIPF: Hast du nicht selbst ein Kinderbuch geschrieben – Die Freiheit der Krokodile –, das kraft des Erzählens einer Geschichte einen Unterschied machen kann? Da geht es um Krokodile unter dem Bett deines Sohns. Um seine Angst vorm Einschlafen. Und dann erzählst du ihm, dass er sich vorstellen soll, mit den Krokodilen schöne Dinge zu machen, Eis essen zu gehen etc. und nimmst der Vorstellung der Krokodile somit die Gefahr. Das ist doch eine Geschichte, die kraft der Imagination, ganz ohne den Raum der Immersion, den du gerade für das Theater eingefordert hast, einen mentalen Wechsel evoziert. Und zwar in der elementarsten Form des Geschichten-Erzählens überhaupt: der Gute-Nacht-Geschichte für dein Kind. In einer Form, die jeder kennt und für jeden funktioniert. Liegt darin nicht ein elementar inklusives Potenzial?
SILKE VAN DYK: Ich finde auch, dass es mehr Geschichten braucht, Gelingens-Geschichten, die Erfahrungsräume schaffen, die die emotionale Ebene berühren; die damit anschlussfähig für eigenes Erleben werden und einfach über eine rein kognitive Wissensvermittlung hinausgehen. Aus einer soziologischen Perspektive sehe ich aber auch Grenzen des Geschichtenerzählens. So schön das mit der Inklusion klingt, so wahnsinnig schwer ist es, Geschichten über strukturelle Zusammenhänge, insbesondere strukturelle soziale Ungleichheiten zu erzählen. Geschichten brauchen Personen, handelnde Akteure, sie brauchen eine Form von Konkretion, Identifikationsmöglichkeiten. Es gibt bestimmte Dinge, die sich hervorragend in Geschichten erzählen lassen; es gibt aber gerade große strukturelle Probleme und Zusammenhänge, die wir eher in Daten und Statistiken sehen und die wahnsinnig schwer in solche Geschichten zu übersetzen sind. Geschichten des Gelingens, z. B. über solidarische Ökonomien, nachhaltige Nachbarschaften etc. bergen immer das Risiko, Möglichkeitsfiktionen zu erzeugen, dabei aber kleine Nischengeschichten zu bleiben. Um die einfache und spannende Form der Geschichte nicht zu verlassen, benennen sie die strukturellen, oft unsichtbaren Zusammenhänge, die dem Gelingen eben sehr häufig entgegenstehen, nicht. Der Impuls könnte dann sein zu sagen: „Seht her, geht doch! Man muss es nur wollen.“ Manchmal aber muss man nicht nur wollen, sondern auch können. Die hinderlichen Zusammenhänge können wir häufig nur durch aufwendige, repräsentative und komplexe Studien erfassen. Erfahrungen von Sexismus oder Rassismus lassen sich natürlich auch auf der Mikroebene des individuellen Erfahrungsraums problematisieren, aber ihre strukturelle Dimension verschwindet in den Geschichten.
Noch mal zu den Möglichkeitsfiktionen: Es gibt Geschichten, die stark affizieren und sich als Beispiele für die Veränderung oder gar Überwindung gesellschaftlicher Verhältnisse darstellen, ohne dass diese aber so einfach zu überwinden sind. Um beim Thema der sozialen Ungleichheit zu bleiben: Wir erleben aktuell einen anhaltenden Boom der sogenannten Arbeiterkinder-Literatur, eine Konjunktur der literarischen Verarbeitung von Klassenerfahrung und Herkunft. Die Bücher von französischen Autor*innen wie Annie Ernaux, Didier Eribon oder Édouard Louis, genauso wie im deutschen Kontext Deniz Ohde, Christian Baron und einige weitere, erzählen etwas, das wir alle schon lange wissen, über das auch sozialwissenschaftlich extrem viel geschrieben worden ist: die Bedeutung von Klassenzugehörigkeit und sozialer Herkunft für den Lebensweg. Trotzdem hat dieses sozialwissenschaftliche Wissen nicht in der Weise gezündet und für eine breite öffentliche Debatte gesorgt, wie es diesen Erfahrungsberichten gelungen ist. Sie sind in der Regel biografisch und leben davon, dass sie zwar autofiktional, aber eben nicht reine Fiktion sind. Daraus beziehen sie eine starke Wahrhaftigkeit. Die Autor*innen werden oft eher als Zeitzeugen denn als Literaten eingeladen. Aus einer soziologischen Perspektive sind diese Geschichten aber total unwahrscheinlich. Hier wird etwas gefeiert, für seine Wahrhaftigkeit, für einen Wirklichkeitssinn, das empirisch betrachtet äußerst selten passiert: Wie Didier Eribon aus einem subproletarischen Haushalt zum besten Freund von Foucault und gefeierten Pariser Intellektuellen wird, das ist eine absolute Ausnahmegeschichte. Diese Geschichte kommt aber dennoch als Gesellschaftsanalyse daher und suggeriert damit Möglichkeitsräume, die es zwar prinzipiell gibt, die aber extrem unwahrscheinlich sind.
FRIEDRICH VON BORRIES: Daran sieht man doch, dass Geschichten etwas sehr Spezifisches sind und sich von Erfahrungsräumen unterscheiden. Der große Unterschied besteht in der erlebten Empirie: In dem Moment, in dem mir ein Erfahrungsraum eröffnet wurde, erlebe ich eine Erfahrung und keine fiktive Geschichte des Gelingens, von der ich gar nicht weiß, ob sie auch mir gelingen wird, gelingen kann oder wie wahrscheinlich das Gelingen ist. Erst wenn mir tatsächlich ein Erlebnis widerfährt, ich einen Erfahrungsraum betrete und nicht die Geschichte von jemand anderem höre, erst wenn ich auch mit mir selbst eine andere Erfahrung mache, dann entsteht das zumindest temporäre Potenzial für Veränderung. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen gestaltender Kunst und literaturbezogener Kunst. In der Bildenden Kunst, im Design und der Architektur geht es um reale, physische Räume, in denen ich etwas erlebe und erfahre. Solche Kunstwerke erlebe ich fast immer durch physische Ko-Präsenz, während Geschichten und Literatur die Vorstellung von etwas Abwesendem vermitteln.
Daneben möchte ich noch einen anderen Vorbehalt zum Versuch des Triggerns von Veränderung durch Geschichten formulieren: Es ist ein Phänomen politisch motivierter Kunst, auch in Architektur und Design, dass diese oft innerhalb ihrer Disziplin nicht die beste ist …
JONAS ZIPF: Warum ist das so?
FRIEDRICH VON BORRIES: Das weiß ich nicht. Ich beobachte es nur. Zum Beispiel an meiner Diskussion mit Produkt- und Industriedesigner*innen. Ich sage zwar immer, dass jedes gute Industriedesign auch gutes Soziales Design sein muss und jeder, der gutes Soziales Design macht, das auch mit einer Gestaltqualität nach klassischen Gestaltungskriterien versehen soll. Wenn man sich aber die Wettbewerbe für Social Design anschaut, dann sind viele eingereichte Arbeiten nach klassischen Gestaltungskriterien einfach nicht so gut. Genauso in der Bildenden Kunst: Es gibt viele Künstler*innen, die mit so etwas wie „Klimakunst“ nichts zu tun haben wollen, weil sie die Sorge haben, sich ihren Ruf als Künstler*innen zu ruinieren. Denn aus einer starken politisch-inhaltlichen Agenda entsteht nicht zwangsläufig auch eine starke künstlerische Form.
JONAS ZIPF: Das ist ein spannender Punkt für ein Arbeitsbuch, in dem wir versuchen zu beschreiben, wie das Theater die drei großen Transformationsthemen beackern kann. In diesem Kontext kommt der Rolle von Kunst, Kultur und Theater aus unserer Sicht immer zwei Dimensionen zu: Die der potenziellen Gestalter*innen von Transformation, aber auch die als Teil der Transformation selbst. Ob es die durch neue digitale Erzählweisen und Distributionswege veränderten Gewohnheiten der Zuschauer*innen sind oder die CO2-Bilanz des Theaterbetriebs als integralem Bestandteil jeder künftigen Ressourcenverwaltung: Auch in dieser Hinsicht sind die Theater keine Elfenbeintürme, die sich im Vakuum der Kunsttradition verschließen können.
SILKE VAN DYK: Ich frage mich da als Sozialwissenschaftlerin, ob man die Form so vom Inhalt abschirmen kann. Darin liegt ja offenkundig die Sorge, durch Aktionskunst oder anderweitig politisierter Kunst den Nimbus der Unabhängigkeit zu verlieren. Vielleicht ist es aber auch so, dass die „klassischen“ Qualitätskriterien für ästhetische Formen den sich so stark transformierenden Feldern nicht genügen bzw. ihrerseits elitär oder ausschließend sind und zu den verfolgten inhaltlichen Zielen gar nicht (mehr) passen. Gerade wenn soziale Ungleichheit ein so zentrales Thema für Transformationsbewegungen ist, auch und gerade im Zusammenhang mit der ökologischen Frage, dann müssen wir doch auch beim Hochhalten der ästhetischen Form fragen: Setzt sich hier ein bürgerliches Kunstverständnis gegenüber den Künstler*innen und Gestalter*innen durch, das einen anderen Anspruch oder eine andere Idee von Kunst verfolgt als diese selbst? Und wessen Kunst grenzt das aus?
FRIEDRICH VON BORRIES: Diesen Punkt finde ich sehr wichtig, da in der Nachhaltigkeitsdebatte immer wieder die Frage aufkommt, ob Kunst und Kultur nicht die vierte Säule der Nachhaltigkeit sein müssten. Es stimmt ja: Um die Große Transformation zu ermöglichen, brauchen wir auch Kunst und Kultur. Deshalb ist genau diese Frage nach Qualitätskriterien wichtig. Es ist unheimlich schwierig, über Qualitätskriterien von Kunst zu reden. Und dabei fällt mir auf, wie die Kräfteverhältnisse zwischen den Themen der Transformation und der rein fachlandschaftlichen Brille verteilt sind: Einerseits gibt es die Kulturstiftung des Bundes, die Kunstförderprogramme aufsetzt, bei denen man Summen ab 60.000 Euro beantragen darf; andererseits gibt es den Fonds für Nachhaltigkeit, der ebenfalls künstlerische Projekte fördert, da darf man bis 60.000 beantragen. Natürlich geht mit den Geldsummen so etwas wie Durchdringungstiefe einher. Bösartig gesprochen scheint genau da die Grenze zu verlaufen, an der die richtige Kunst erst anfängt.
SILKE VAN DYK: Wir sollten bei der Diskussion über die Qualität oder Durchdringungstiefe noch mal auf die Seite des Publikums und der Zielgruppen schauen. Wir sprachen angesichts des Transformationspotenzials von Kultur vorhin von der Anschaulichkeit und notwendigen Personalisierung von Geschichten. Daraufhin hatte Friedrich von Borries geantwortet, dass die Schwelle dadurch umgangen werden kann, dass nicht nur Geschichten erzählt werden, die die Leute passiv als reine Rezipient*innen hören, sondern dass Erfahrungsräume erzeugt werden. Da möchte ich widersprechen und darauf hinweisen, dass die Leute ja auch mit selbst gemachten Erfahrungen in Möglichkeitsfiktionen verharren können. So lässt sich bei den Occupy-Bewegungen vor zehn Jahren beobachten, dass äußerst reale Erfahrungen der Partizipation und Gemeinschaft, des Teilens und Konsens-Findens auf den besetzten Plätzen zu einer radikalen gesellschaftlichen Transformationsperspektive hochskaliert wurden, ohne die komplexen Rahmenbedingungen jenseits der Plätze in diese Perspektiven einzubeziehen. Auch die Erzeugung von Erfahrungsräumen schützt so nicht ganz vor Möglichkeitsfiktionen, weil sie dazu einladen können, Praktiken vorschnell zu verallgemeinern.
FRIEDRICH VON BORRIES: Also, wenn ich mich mit meinen Studierenden, zu denen ich mich in einem hierarchischen Verhältnis befinde, weil ich sie bewerte und sie mich nicht – wenn ich mich mit denen vor einem Seminar zusammensetze und ihnen sage: Ich bin auch ein Lernender, und ich lerne von euch, und wir sind ganz offen, und wir duzen uns miteinander, und es ist alles ganz supipupi, dann ist das die eine Angelegenheit. Wenn ich mit denen am Anfang des Semesters eine Yogastunde mache, wo ich selber Schüler bin, und die sehen: Dieser von Borries kriegt es nicht so gut hin wie ich, aber er bemüht sich auch, und er hat auch Schmerzen, und manches kann er – das hätte ich ja gar nicht gedacht –, und anderes kann er nicht, dann haben sie eine Erfahrung gemacht, die eine andere Angelegenheit ist als das reine Gespräch, in dem ich die flache Hierarchie in einer Kunsthochschule beteuere. Auch wenn es eine Fiktion bleibt und ich am Ende so eine Note geben muss und wir ein Wissensgefälle und einen Hierarchieunterschied behalten, so ist es trotzdem etwas anderes, wenn wir eine physische, sinnliche Erfahrung geteilt haben.
JONAS ZIPF: Mir als Theatermann fällt es dennoch schwer, das Eine vom Anderen zu unterscheiden. Das Beispiel mit dem Kind und den Krokodilen zeigt doch, dass auch das, was Silke van Dyk Möglichkeitsfiktionen nennt, einen realen Unterschied machen kann. Friedrichs Geschichte ist zunächst nur eine Geschichte und findet innerhalb der Imagination statt, aber dennoch erlebt das Kind mit sich und seiner Angst eine Erfahrung der Veränderung. Zwar keine physische, ko-präsente, immersive Erfahrung, aber eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Das ist auch eine Erfahrung. Für mich liegt der Unterschied an einer anderen Stelle, und zwar genau an der eben beschriebenen Schwelle der Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes. Was kommt denn mit der Frage nach dem oberhalb und unterhalb der 60.000 zum Ausdruck? Da gibt es ein elitäres Kunstverständnis auf der einen Ebene und alles das, was es sonst noch so gibt, auf einer anderen. Es gibt den Spielplan und die großen Positionen, und die kosten viel Geld, insbesondere das Musiktheater. Die Transformationsthemen finden im Theater allerdings bislang größtenteils innerhalb einer anderen Kategorie statt. Sie bilden die Peripherie des Spielplans, sind oft abhängig von externen Finanzierungen durch Dritte, dürfen auch gerne mal von einer Freien Gruppe irgendwo im Stadtraum beackert werden. Beliebt ist dabei auch die transdisziplinäre Zusammenarbeit mit Soziolog*innen oder Architekt*innen, aber das Abo-Publikum darf dann weiter Meistersinger auf der großen Bühne sehen, dafür wird das Zehnfache an Ressourcen aufgewandt. Das ganze Feld dazwischen ist doch aber das interessante im Sinne der Transformation. Das ist da, wo auch Publikumstransfer und Erfahrungsaustausch, um den Begriff aufzugreifen, entstehen.
Ich mach dafür ein Beispiel: In den letzten Jahren habe ich ein einziges Mal so etwas wie Inklusion mit und rund um Theater erlebt. Und das ausgerechnet in Wiesbaden, bei der Wiesbaden Biennale, also leider auch im Rahmen des Ausnahmezustands eines Festivals. Da wurde das Foyer des Theaters in einen realen Rewe-Markt verwandelt, man konnte über eine historisch für die Kutsche von Kaiser Wilhelm gebaute Rampe ein Autokino auf der großen Bühne befahren, in einer anderen Spielstätte des Theaters wurde ein Boxring eingebaut, und umgekehrt sind die künstlerischen Interventionen samt und sonders in den städtischen Raum rausgegangen. Das Theater war inside-out, offen für einen anderen Teil von Menschen. Und die sind auch dagewesen, alle: sowohl die Teile der Bevölkerung, die vorher kaum im Theater gesichtet wurden, als auch die dort üblicherweise anwesenden Zuschauer*innen. Ansonsten erlebe ich im Theater oft den rein verbalisierten Anspruch an genau diesen Austausch. Alle im Theater reden davon, dass sie die bisher nicht zuschauenden Zielgruppen erreichen wollen, aber sie erreichen sie nicht.
FRIEDRICH VON BORRIES: Total konstruiert. Muss ich jetzt erst mal so als Arbeitshypothese in den Raum stellen. Auch als in Wiesbaden Aufgewachsener sage ich: total konstruiert. Ich glaube ja, dass man mit diesen Widersprüchen leben muss, dass das ein Teil der Transformation ist, von der wir hier sprechen, im Gegensatz zu den Vorgängen einer Revolution oder auch einer Reform. Dass man mit der Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem leben muss und auch, dass das Theater, überhaupt jeder Kunstraum, den Anspruch haben kann, soll, muss, sozial wirksam zu werden. Dabei aber eben einfach trotzdem elitär ist, und bleibt. Diesen Widerspruch muss es, glaube ich, einfach aushalten. Man kann versuchen, zwischendurch mal ein Kinderbuch zu schreiben, und man kann versuchen, zwischendurch mal eine Aktion zu machen, mit der man ganz viele Leute erreicht, die normalerweise nicht ins Theater gehen. Aber worin besteht denn dann eigentlich der Erfolg? Wäre es tatsächlich ein Erfolg, wenn die Meistersinger nicht mehr gespielt werden, oder wäre es erfolgreicher, wenn die Leute, die sonst Deutschland sucht den Superstar gucken, jetzt in die Meistersinger gehen? Erzielt es eine langfristige Wirkung, dass ich jetzt einmal mit meinem Auto die Rampe hochfahren durfte und im Theater ja gar nicht Theater gespielt wurde, sondern, wie du sagtest, sich ein Autokino befand? Wie gesagt: Ich glaube, dass man die beschriebenen Widersprüche nicht auflösen kann. Diese Aktionen werden nicht nachhaltig das Besucherprofil des Wiesbadener Staatstheaters geändert haben; die Maifestspiele werden elitär wie immer bleiben. Diese Gleichzeitigkeit bleibt bestehen: Man muss beharrlich daran arbeiten, dass immer mehr Sachen von der Off-Bühne auch mal ins Große Haus kommen, und diesen Mut weiterhin immer wieder aufbringen, auch wenn sich dadurch das Publikum nicht verändert. So viel zur Inklusion der Stadtgesellschaft im Stadttheater. Was ist aber mit der Inklusion von anderen Wesen? Mein nächstes Seminar nenne ich Postanthropozentrisches Design und stelle darin die Frage, wie z. B. das Theater aussehen soll, das für die Tiere da ist. Und für Steine und für Pflanzen. Ich weiß: Das klingt jetzt erst mal absurd. Aber wenn wir das Mensch-Natur-Verhältnis im Zuge der Großen Transformation wirklich überdenken wollen, wenn wir die bürgerlichen Konventionsherkünfte des Theaters wirklich sprengen wollen, dann müssen wir an diese ganze Anthropozentrik unseres Tuns und Denkens und Handelns ran.
SILKE VAN DYK: Als Soziologin würde ich auf die Inklusionsfrage gänzlich anders antworten. Vielleicht bin ich noch zu sehr mit der Ungleichheit zwischen Menschen befasst, um bei den Fragen des Anthropozäns anzukommen. Aber beim Blick auf die empirisch vorhandene und sich in der Pandemie noch massiv verstärkende Ungleichheit sind wir, glaube ich, schon bei einer ziemlich zentralen Frage der Inklusion, nämlich inwiefern klassische Positionen der Inklusion, der Diversität, sich eigentlich für eine Klassenperspektive und für die damit verbundenen Ausschlüsse eignen. Parallel zu den aktuellen Debatten des Rassismus und Sexismus lässt sich eine anhaltende Form von Klassismus konstatieren. Daher würde ich ganz anders fragen als ihr beide: Nicht danach, ob sich neben bildungsbürgerlichen auch Leute aus einem subproletarischen Kontext ins Theater bewegen, sondern danach, wie ihr Zugang zu materiellen und vor allem auch kulturellen Ressourcen grundsätzlich geregelt ist. Es sollte nicht darum gehen, wie wir Arme ins Theater bringen oder Prekäre zu Engagement und Buchlektüre motivieren, sondern wie wir Ausbeutungs-, Diskriminierungs- und Ungleichheitsverhältnisse gemeinsam überwinden – nur so werden Theater- und Kunsträume zu offenen Räumen und nicht zu Räumen, in die die künstlerisch ambitionierten und interessierten Akademiker*innen mit großem Gestus die weniger Privilegierten einladen. Es müssen Räume werden, die wirklich von unterschiedlichen Seiten und Gruppen erschlossen werden können! Soziologisch betrachtet führen viele dieser Zugangsangebote und Aktionen wie in Wiesbaden die nicht klassische Kultur- oder Engagementklientel letztlich vor. Zugespitzt formuliert wird da so ein bisschen ein kleines Treppchen ausgebaut, um sagen zu können: Guck mal, da kannst du jetzt ganz leicht hochgehen und musst auch gar keine Angst haben, und da ist auch ein Geländer und so. Aber die Frage, warum die Person eigentlich normalerweise an der Treppe gar nicht vorbeikommt, tritt in den Hintergrund. Wir müssen stattdessen fragen: Wie können wir Klassenverhältnisse, Ungleichheitsverhältnisse als Inklusionsoder Identitäts- oder Antidiskriminierungskontext thematisieren, ohne dass wir die dahinterstehenden Ausbeutungszusammenhänge de-thematisieren?
FRIEDRICH VON BORRIES: Ich möchte die Frage provokativ wenden und auf das bestehende Theaterpublikum beziehen. Gerade in Wiesbaden wäre es doch maximal inklusiv, wenn man ganz normal die Meistersinger gespielt hätte, aber pro Karte die 1.000 Euro genommen hätte, die sie nun mal kosten, statt sie mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren – das Große Haus wäre natürlich trotzdem voll gewesen, denn es gibt genug reiche Wiesbadener*innen –, und sich dann überlegen würde, welche Kultur man mit den gesparten Geldern bzw. den neu vereinnahmten Geldern finanzieren kann. Die ehrliche Frage lautet doch: Wer spricht in diesem Land eigentlich wann und aus welchem Grund von einer Inklusionsperspektive?!
SILKE VAN DYK: Genau. Und: Was wird öffentlich gefördert?
FRIEDRICH VON BORRIES: Ja. Was würde dann öffentlich gefördert? Für mich klingt Inklusion sonst nur nach der Legitimationskrise einer bürgerlichen Kultur. Eine Krise, die vielleicht dazu führt, neue Formate zu finden, um neue Zielgruppen zu öffnen, die aber nicht kommen, anstatt einfach zu sagen: Lasst uns in Ehre sterben; lasst die Oper das werden, was die chinesische Oper in China ist; da gehen Touristen hin, da zahlt man viel Geld, und das gibt es irgendwie an ein, zwei Orten in China; das reicht. Warum muss jede Großstadt in Deutschland eine Oper haben, mit einem klassischen Opernprogramm, zu dem ein Publikum mit einer Altersstruktur von 60+ und einer Einkommensstruktur von 60.000+ hingeht, höchstens ergänzt um ein paar Jugendliche mit bildungsbürgerlichem Hintergrund oder mit Aufstiegsphantasmen, die denken, dass sie über kulturelles Kapital zustande kommen. Warum denkt man die Sache nicht so? Aber das traut sich keiner! Das Gleiche gilt für die Museen, die zwar ebenfalls Bildungsprogramme machen und sich zu öffnen versuchen, im Grunde aber auf Tonnen von Sachen sitzen, die keiner mehr sehen will, die auch völlig irrelevant geworden sind. Zumindest braucht man diese Sachen nicht in jeder zweiten Stadt. Wenn ich griechische Antike sehen will, geh ich doch nicht ins städtische Museum, wo ein paar Vasen und Scherben rumstehen, sondern fahre nach Athen, das reicht mir ein Mal im Leben, ich brauche das nicht ein Mal in der Woche. Lasst uns doch mit dem Geld, mit dem Raum, mit den Werten was anderes machen.
JONAS ZIPF: Diese Provokation trifft. Sie markiert genau den Punkt, warum ich das Theater vor einigen Jahren verlassen habe und eine breitere Verantwortung gesucht habe. Heute bin ich nicht mehr Teil einer Künstlerischen Theaterleitung, sondern Kulturverantwortlicher einer Stadt. Und zwar einer Stadt, die keine Oper hat, auch kein wirklich großes hochkulturelles Behältnis – einer Stadt, die für sich ziemlich dezidiert entschieden hat, dass 40 Prozent des kommunalen Kulturetats in kulturelle Bildung fließt. Denn letztlich wird die Forderung, die du aufmachst seit der sogenannten Neuen Kulturpolitik der 1970er-Jahre, seit Konzepten wie Hilmar Hoffmanns „Kultur für alle“ diskutiert. Im Kulturinfarkt steht diese Forderung vor zehn Jahren eins zu eins genauso drin. In den Jahrzehnten dazwischen wurde die kulturelle Bildung, die Kunst- und Theaterpädagogik, Programme der Education, des Outreach etc. additiv aufgebaut. Jetzt haben wir hier in Jena 40 Prozent Mittel für kulturelle Bildung und erreichen mit diesen Mitteln im Großen und Ganzen trotz fortgesetzter Anstrengungen an allen möglichen Ecken und Enden trotzdem wieder mehr Spitze als Breite. Teilweise ist die kulturelle Bildung dann eine verkappte Elitenförderung. Das Plus an Geld beispielsweise in einer Musikschule geht eben nicht nur in die aufsuchende Arbeit, in Schulkooperationen in Problemvierteln, sondern an die Professorentöchter, die Klavier lernen und Wettbewerbe gewinnen – beispielsweise in einer Volkshochschule nicht nur in Sprachkurse zur Integration von Geflüchteten, sondern auch in Kochkurse für Oberstudienräte. Und leider zahlen die Leute für beide Angebote dieselbe demokratisch vom Stadtrat legitimierte Gebühr. Unter dem Strich lautet die kulturpolitische Aufgabe im Sinne der Inklusion doch aber immer: Wie können wir die Bedürfnisse der gesamten Stadtbevölkerung in einer gerechten Art und Weise abbilden? Von daher trifft die Provokation ins Ziel: Alle Bedürfnisse und Angebote sind legitim, es stellt sich aber die Frage der Zugänge – da gehört die Preispolitik zentral dazu – und der Quantität.
Von daher möchte ich in einer Schlusskurve den Appell von Friedrich mit der Postwachstums- und Degrowth-Thematik verbinden und euch beide fragen, was ihr den Theatermacher*innen empfehlt. Transformation heißt Verwandlung: Das Neue entsteht nicht, ohne etwas Altes zu lassen, sonst würde es weiteres Wachstum bedeuten. Davon können Theatermacher*innen ein leidvolles Lied singen. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Inklusion gehen nicht einfach zusätzlich, oben drauf, oder an der Peripherie eines fortbestehenden Kernbetriebs. Diese überragenden Themen lassen sich nicht einfach im Rahmen einer zusätzlichen Arbeitsgruppe oder Klausurtagung weiter vor sich herschieben. Wie schaffen die Theatermacher*innen diesen fundamentalen Switch ihres Mindsets? Was empfehlt ihr ihnen?
SILKE VAN DYK: Wir diskutieren tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen. Eine Empfehlung an den Kulturbetrieb geht eben weiterhin vom bestehenden Kulturbetrieb aus und nicht von der Klassenperspektive, die ich aufgemacht habe. Solche Empfehlungen führen zwangsläufig zu symbolischen Angeboten an „die da unten“: Dann sind „wir da oben“ bereit, „die“ an unserer bürgerlichen Kultur zu beteiligen und machen manchmal unser Theater zu einem Rewe-Markt oder so, damit wir beweisen können, dass unser Angebot auch gelingen kann. Dabei bleibt aber die eigentlich substanzielle Frage an bürgerliche Kultur nach Qualitätsmaßstäben und auch nach Angebotsquantitäten trotzdem genauso bestehen: Warum werden Boulevardtheater oder Musicals nicht subventioniert, die Oper aber schon? Oder umgekehrt: Kann man diese Bereiche – die Meistersinger, das MKG – ohne eine radikal andere Klassenpolitik inkludieren? Ohne dass die Zugänge einfach nur regressive, symbolische Handreichungen sind, die letztlich sogar die zugleich weiter bestehenden Klassenverhältnisse noch verfestigen?!
JONAS ZIPF: Danke für die Spiegelung. Lässt sich diese systemische Betriebsblindheit auch auf die anderen beiden Transformationen der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung übertragen? Ist es auch da so, dass wir Kultur- und Theaterschaffenden im Grunde wie der beleidigte Thomas Gottschalk dasitzen und uns wundern, dass wir immer noch das samstäglich wärmende Lagerfeuer der Wetten-Dass-Sendung ausstrahlen, aber immer weniger Menschen kommen? Dass es eben nicht reicht, die Saalwette und den Wettkönig zu reformieren, sondern sich die ganze Senderstruktur transformieren muss? Im Kontext der Nachhaltigkeit gibt es ja erste Gedanken in die radikale Richtung, die Friedrich vorhin in den Raum gestellt hat: Frank Raddatz, Bruno Latour oder Thomas Oberender fordern ein neues Theater des Anthropozäns, ein Theater, das sich die Natur zurückerobert. Im Kontext der Digitalisierung sprechen wir nicht nur über neue Theater-Digitalformate, die in diesem Jahr beispielsweise schon einen substanziellen Teil des Berliner Theatertreffens ausmachen, sondern über eine Neu-Formatierung der Arbeitsweise hinter den Theaterkulissen: So hat Ulf Schmidt bei der Dramaturgischen Gesellschaft schon vor zehn Jahren eine kollektive Arbeit im Writer’s Room gefordert; seit Jahr und Tag zeigen sich Betriebsdirektoren immer unzufriedener mit den Marktmonopolisten der Theatersoftware Theasoft oder Opas. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Dennoch scheint es, als seien die Theater und Kulturbetriebe seit Jahren kaum vorangekommen, als träten sie auf der Stelle. Wie kommen wir in die Transformation? Was muss sich ändern?
FRIEDRICH VON BORRIES: Ich mache einen utopischen Vorschlag. Jedes Theater sollte endlich seine Schizophrenie anerkennen und sich klonen und sagen: Wir doppeln uns und halbieren uns, aus einem Theater werden zwei, die sich die Räume und andere Ressourcen teilen. Das eine Haus macht ein Theater, wie wir es kennen, also die behutsame Überführung von deutschem Sprechtheater in zeitgenössisches Diskurstheater für Akademiker*innen. Die andere Hälfte probiert für fünf Jahre etwas gänzlich anderes aus. Was dieses gänzlich Andere ist, wissen wir alle und wissen wir alle nicht. Denn es ist ja gänzlich anders. Der eine mag Rewe-Supermärkte einrichten, der andere mag Theater für Haustiere machen, der Dritte mag Projekte mit migrantischen Jugendlichen machen, der Vierte mag Klassiker der türkischen Theaterkultur aufführen. What ever, I don’t know. Und dann setzt man sich nach fünf Jahren zusammen und redet mal. Und denkt und diskutiert. Weil die Transformation nur aus Erfahrung kommen wird. Sie wird nicht aus Analysen, nicht aus Beschreibungen kommen. Auch die Transformation des Theaters wird in der Transformation passieren, als Prozess, in dem man sich Freiräume schafft, ausprobiert und danach gemeinsam darüber diskutiert, und nicht im Sinne eines Vorschlags oder einer Beschreibung.
JONAS ZIPF: Damit kommen wir zu unserem Ausgangspunkt zurück: Corona als Brennglas. Eigentlich bietet uns Corona genau die Experimental- und Reagenzglas-Situation, von der du gerade sprichst. Allerdings müssen wir wahrscheinlich jetzt schon im Konjunktiv Zwei – leider nicht im Futur Zwei – sprechen: Corona hätte uns diese Situation geboten. Wenn wir etwa auf die Digitalisierungsebene im Theater schauen, dann hat das nur sehr bedingt stattgefunden: Die meiste Aktivität war geprägt von Aktionismus, davon, irgendwie präsent zu bleiben für sein Publikum, auch von beruflicher Verzweiflung, kulturpolitischer Angst, selten aber vom gründlichen Versuch, die eigene Struktur anzufassen, die eigenen Produktionsweisen zu verändern und zu adaptieren. Eigentlich bot Corona dazu die ideale Krisensituation, gerade im Hinblick auf die staatlichen Kulturträger: Wirtschaftlich abgesichert durch Kurzarbeit, zumindest was die Festangestellten anbelangt, im Bereich der Orchester sogar mit einer Lohnfortzahlung von gewerkschaftlich durchgesetzten 100 Prozent. Während Freischaffende gleichzeitig lange darum kämpfen mussten und müssen, nicht automatisch aus der KSK raus und in Hartz IV zu fallen. Und trotzdem war diese Zeit von ganz viel Mehrbetrieb und Weiterbetriebsamkeit geprägt, vom alten Muster des „Immer noch mehr vom Selben“. Da ist noch wenig Bewusstsein für Transformation by Design. Das führt, wenn es so weitergeht, eher zu Transformation by Desaster. So zumindest unser Eindruck als Herausgeber*innen des Arbeitsbuchs. Konjunktiv Zwei: Man hätte diese Chance sehr früh definieren müssen, zu Beginn des ersten Lockdowns im März des vergangenen Jahres, diese Phase nutzen und den Theaterbetrieb neu erfinden können. So ist das aber nun mal mit der Zeitdiagnostik: Hinterher sind wir immer klüger. Das vorliegende Arbeitsbuch stellt jedenfalls den Versuch dar, diese Chance noch mal aufzugreifen und dennoch zu nutzen. Vielleicht liegt ja auch ausgangs der Pandemie noch ein Rest dieser Chance in der Luft. Immerhin befinden wir uns auch weiterhin in einer intensiven Phase des aktivistischen Protests, auch innerhalb der Theater, und stehen vor einigen bedeutsamen politischen Umwälzungen, nicht nur finanzpolitischer Natur, sondern gesamtpolitisch und gesamtgesellschaftlich.
SILKE VAN DYK: Da verläuft tatsächlich die eindeutige Trennlinie: Zwischen Transformation by Design und by Desaster. Ich glaube ja, eine ganz fatale Situation entstand gleich zu Beginn der Pandemie. Ich kann das anhand der sozial- und kulturwissenschaftlichen Textproduktion beschreiben. Nicht wenige Autor*innen sind sofort davon ausgegangen, dass die Pandemie durch eine Transformation by Desaster den Einstieg in eine neue Welt ebnen könnte. Ich weiß nicht, wie viele Texte ich aus dem Nachhaltigkeits-, Postwachstums-, Degrowth-Spektrum gelesen habe, die a) den radikalen Kategorienfehler gemacht haben, die akute Bedrohung durch die Pandemie mit dem langsamen Klimawandel gleichzusetzen, der noch dazu räumlich und personell externalisiert, nämlich genau dort zuerst seine negativen und desaströsen Folgen zeigt, wo die Menschen am wenigsten zu diesem Wandel beitragen – und b) auf die Idee verfallen sind, die auch vor Corona schon anliegenden Transformationsprozesse so stark mit einem Hoffnungsdiskurs zu verknüpfen, dass das Wünschbare, nämlich der Übergang in eine Postwachstumsgesellschaft, plötzlich als wahrscheinlicher imaginiert wurde. Immer wieder war in unterschiedlichen Varianten zu lesen, dass jetzt ja alle auf Flug- und Urlaubsreisen verzichtet haben und damit bestimmt ganz viele erkennen werden, dass sie das gar nicht brauchen. Jetzt, ein Jahr später, sehen wir: Genau das ist nicht eingetreten, weil nämlich ziemlich viele Menschen ziemlich viel vermisst haben. Es ist ein fundamentales Problem, wenn Zeitdiagnosen das Wünschenswerte zum Wahrscheinlichen ausrufen und dabei die Macht- und Kräfteverhältnisse einfach ausblenden, die dem entgegenstehen. Das ist auch extrem ahistorisch: Wir wissen aus Extremsituationen in der Vergangenheit, zum Beispiel aus Kriegen oder anlässlich großer Naturkatastrophen, dass plötzlich ganz viel geht, was vorher undenkbar war. Nur ist es damit dann auch schnell wieder vorbei, das sind radikale Ausnahmesituationen, die eben nicht organisch und automatisch in Transformation by Design münden. Das muss ich leider nüchtern feststellen. Und es ist im Moment erstaunlich leise in der Debatte. Ich lese nicht mehr so viele Texte von denjenigen, die mir vor einem Jahr erzählt haben, was jetzt alles besser werden kann, warum dieses und jenes nun vielleicht eintritt oder doch nicht eintritt. Diese Schwäche der sozial- und kulturwissenschaftlichen Zeitdiagnose gab es auch nach Occupy, als man sich im Nachgang immer mal gewünscht hätte, von den so vielen euphorischen Stimmen in Wissenschaft und Zivilgesellschaft auch mal was darüber zu lesen, warum so vieles nicht geklappt hat und welche Verheißungen nicht eingetreten sind. Das im Blick zu behalten, heißt natürlich nicht, dass wir nicht nach emanzipatorischen Ansatzpunkten in der Krise suchen sollten, dass wir nicht nach historischen Beispielen schauen und nicht auch im Kultursektor die Frage nach der Transformation stellen sollten: Wie kann eine Situation by Desaster etwas anstoßen, das darüber hinausweist, das Räume öffnet? Wenn wir noch mal an die Pendelbewegungen von Polanyi denken: Führt uns die Pandemie vielleicht doch schneller als gedacht in ein post-neoliberales Zeitalter? Was wird die Rolle des Staates nach der Pandemie sein? Werden Privatisierungen im Gesundheitswesen oder die Ausbeutung von Pflegekräften in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so geräuschlos vonstattengehen? Wie können wir aus der Ausnahmesituation der Pandemie lernen und dazu kommen, die Transformation selbst in die Hand zu nehmen?