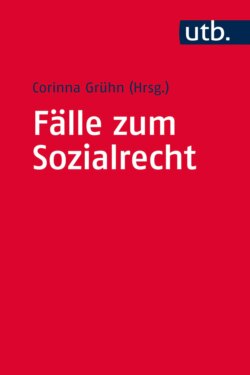Читать книгу Fälle zum Sozialrecht - Группа авторов - Страница 8
Оглавление[10][11]Prof. Dr. Ingo Palsherm
Fall 1: Ein Medikament für Eveline
Themenbereich: Gesetzliche Krankenversicherung, SGB V
Sie arbeiten als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge in der allgemeinen Sozialberatung eines großen Trägers der freien Wohlfahrtspflege. In Ihre Beratungsstunde kommt Eveline Darmstadt (E) und schildert folgenden Sachverhalt:
Vor einiger Zeit sei bei ihr eine Brustkrebserkrankung festgestellt worden. Der Tumor sei operativ entfernt worden, und sie habe eine Chemotherapie erhalten. Ihr gehe es nun schon besser. Sie arbeite seit drei Monaten wieder in Vollzeit in ihrem Job als Verkäuferin. Ihre behandelnde Ärztin wolle eine sog. adjuvante Therapie durchführen, um die Gefahr einer Rückkehr des Krebses (sog. Rezidiv) aufgrund von unerkannten kleinen Metastasen1 zu verhindern. Sie habe ihr dazu ein anthroposophisches Mistelpräparat verordnet. Dieses habe eine das Immunsystem positiv beeinflussende Wirkung (sog. Immunmodulation) durch pharmakologisch wirksame Stoffe. Nachdem ihre gesetzliche Krankenkasse die Kosten des Medikamentes ursprünglich getragen hatte, hat E nun erfolglos einen Antrag auf Kostenübernahme für weitere fünf Jahre gestellt. Die Krankenkasse begründet die Weigerung damit, dass es sich um ein zwar apotheken-, aber nicht verschreibungspflichtiges Präparat handele (sog. OTC-Arzneimittel2). Solche Arzneimittel seien von der Verordnungsfähigkeit zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung prinzipiell ausgeschlossen (s. § 34 Abs. 1 S. 1 SGB V). Außerdem habe der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)3 in seiner Arzneimittel-Richtlinie Mistelpräparate[12] zwar ausnahmsweise als verordnungsfähig anerkannt, wenn sie als Therapiestandard bei bestimmten schwerwiegenden Erkrankungen gälten. Dies betreffe aber nur palliative4 Therapien von malignen Tumoren zur Verbesserung der Lebensqualität und nicht – wie hier – adjuvante Therapien (s. § 34 Abs. 1 S. 2 SGB V i.V.m. § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V i.V.m. Nr. 32 der Anlage I zum Abschnitt F der Arzneimittel-Richtlinie (sog. OTC-Übersicht)).
E ist mit der Ablehnung nicht einverstanden. Denn immerhin habe ihre Ärztin das Arzneimittel verordnet. Außerdem sei es ja wohl kaum demokratisch, wenn anstatt des Gesetzgebers „irgend so ein Gremium aus Ärzten und Krankenkassen“ entscheide, welches Arzneimittel verordnungsfähig sei. Darüber hinaus müsse der Sozialstaat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG schützen. Der Staat verletze dieses Grundrecht, wenn sie in ihrer Situation, die zwar nicht mehr akut lebensbedrohlich, aber nach wie vor sehr einschränkend sei, das Mistelpräparat nicht erhalte. Da das Medikament ihr helfe, habe sie es sich nun auf eigene Kosten besorgt. Dies könne sie sich aber gar nicht leisten.
Um E unterstützen zu können, müssen Sie folgende Frage prüfen (bitte fertigen Sie ein Rechtsgutachten im Gutachtenstil an): Hat E einen Anspruch gegen ihre gesetzliche Krankenversicherung auf Erstattung der privat aufgewendeten Kosten für das verordnete „Mistelpräparat“ und zukünftig auf Leistung zu Lasten der Krankenkasse?
Lösungsskizze
Anspruch auf Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 S. 1 Fall 2 SGB wegen Vorliegen eines unbefriedigten Naturalleistungsanspruchs nach §§ 27 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3, 31 SGB V
I. Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
II. Vorliegen einer Krankheit
1. Regelwidriger körperlicher Zustand
2. [13]Behandlungsbedürftigkeit des Zustands
III. Besondere Voraussetzungen des Leistungsfalls
1. Apothekenpflichtiges Arzneimittel nach § 31 Abs. 1 SGB V
2. Ausgestaltung des Rahmenrechts auf Arzneimittel
a) Herausnahme nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel aus Leistungskatalog nach § 34 Abs. 1 SGB V
b) Ausnahmsweise kein Ausschluss nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel
c) Verfassungsmäßigkeit des Leistungsausschlusses
aa) Demokratische Legitimation des G-BA zum Richtlinienerlass
bb) Verstoß des Leistungsausschlusses gegen Grundrechte
IV. Ergebnis
E könnte einen Anspruch gegen ihre Krankenkasse auf Erstattung der für das „Mistelpräparat“ aufgewendeten Kosten nach § 13 Abs. 3 S. 1 Fall 2 SGB V haben.
Dies setzt voraus, dass die Krankenkasse eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat und daher der Versicherten für die notwendige selbst beschaffte Leistung Kosten entstanden sind (s. § 13 Abs. 3 S. 1 Fall 2 SGB V).
Als erstes müsste die Krankenkasse mithin eine Leistung zu Unrecht abgelehnt haben. Das ist der Fall, wenn E einen Anspruch auf die Leistung als Naturalleistung gehabt hätte. Der Anspruch auf Kostenerstattung verhält sich also akzessorisch5 zum Naturalleistungsanspruch.6 Ein Anspruch auf die Kostenerstattung kann nicht weiter reichen als ein entsprechender Naturalleistungsanspruch.7[14] Ein solcher Anspruch könnte sich hier aus §§ 27 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3, 31 SGB V ergeben. Danach haben Versicherte im Rahmen der Krankenbehandlung einen Anspruch auf Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln, soweit dieser nicht nach § 34 SGB V ausgeschlossen ist. Im Einzelnen müsste E mithin (I.) krankenversichert sein, (II.) an einer Krankheit leiden und (III.) die besonderen Voraussetzungen für die Leistung eines Arzneimittels als Krankenbehandlung müssten erfüllt sein.
I. Krankenversicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V
Zunächst müsste E krankenversichert sein. Im Rahmen der Versicherungspflicht sind unter anderem krankenversichert Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Der Beschäftigte ist damit ein Fall des kraft Gesetzes automatisch Versicherten (sog. „Versicherungspflichtigen“). Beschäftigung ist die nicht selbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis (§ 7 Abs. 1 S. 1 SGB IV). In Abgrenzung zur Selbständigkeit ist die Arbeitsleistung in persönlicher Abhängigkeit entscheidend. Versicherungspflichtiger Arbeitnehmer i.S.d. SGB V ist demnach, wer gegen Entgelt (s. § 14 SGB IV) für einen anderen in dessen Betrieb (= Eingliederung) eine Tätigkeit nach dessen Weisung bezüglich Zeit, Dauer, Ort und Tätigkeit der Arbeit ausübt (§ 7 Abs. 1 S. 2 SGB IV). Hier arbeitet E als Verkäuferin. Typisch für dieses Berufsbild ist, dass sie für den Inhaber eines Geschäftes weisungsgebunden im Hinblick auf Geschäftszeiten, Ladenlokal und Preis der Ware tätig wird, wenn sie etwas in Vertretung des Inhabers an Kunden verkauft. Folglich entspricht E dem Normalfall einer weisungsgebundenen Arbeitnehmerin. Sie ist somit als Beschäftigte versicherungspflichtig, also kraft Gesetzes automatisch versichert nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V.
[15]II. Vorliegen einer Krankheit
Weiterhin müsste E an einer Krankheit leiden. Die Krankheit ist der wichtigste Versicherungsfall in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie ist gegeben, bei (1) einem regelwidrigen körperlichen oder geistigen Zustand, dessen Eintritt (2) Behandlungsbedürftigkeit und/oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.8
1. Regelwidriger körperlicher Zustand
Zunächst müsste bei E also ein regelwidriger körperlicher oder geistiger Zustand vorliegen. Regelwidrig in diesem Sinne ist, was vom Leitbild des gesunden Menschen in seiner ganzen Spannbreite abweicht, d.h. zu fragen ist, ob die normalen und üblichen psychophysischen Körperfunktionen beeinträchtigt sind oder ob eine anatomische Abweichung entstellend wirkt.9 Der bei E diagnostizierte Brustkrebs kennzeichnet sich durch eine bösartige Tumorbildung der Brustdrüse. Die durch eine solche Krebserkrankung hervorgerufenen körperlichen Beschwerden beeinträchtigen die üblichen Körperfunktionen. Es handelt sich somit um eine Abweichung vom Leitbild der Gesundheit. Ferner ist aufgrund der Gefahr der Metastasierung mit der operativen Tumorentfernung ein Zustand von Gesundheit auch noch nicht wieder eingetreten. Folglich liegt bei E immer noch ein regelwidriger körperlicher Zustand vor.
2. Behandlungsbedürftigkeit des Zustands
Dieser Zustand müsste außerdem behandlungsbedürftig sein. Behandlungsbedürftig ist, was ohne ärztliche Behandlung wahrscheinlich nicht mit Aussicht auf Erfolg erkannt, geheilt, gebessert oder vor Verschlimmerung bewahrt werden kann10. Die Erkrankung muss also sowohl behandlungsfähig sein, d.h. eines der Behandlungsziele des § 27 Abs. 1 S. 1 SGB V möglicherweise erreichen, als auch zum Erreichen dieser Ziele wahrscheinlich ärztlichen Handelns bedürfen. Die adjuvante Therapie zielt darauf ab, eine Rückkehr des Krebses zu verhindern. Damit soll der bestehende Zustand nach Operation des Mammakarzinoms11 erhalten werden. Es geht jedenfalls darum,[16] eine Verschlimmerung der Erkrankung zu verhindern, was eines der Behandlungsziele des § 27 Abs. 1 S. 1 SGB V ist. Behandlungsfähigkeit liegt somit vor. Als besonders schwerwiegende Erkrankung bessert sich die Krebserkrankung zudem regelmäßig nicht von allein. Sie erfordert – anders als leichtere Krankheiten wie zum Beispiel ein grippaler Infekt – ein ärztliches Handeln. Folglich ist hier ein behandlungsfähiger, aber auch behandlungsbedürftiger Zustand gegeben.
Somit liegt der Versicherungsfall der Krankheit bei E vor.
III. Besondere Voraussetzungen des Leistungsfalls
Schließlich müssten die besonderen Voraussetzungen des Leistungsfalls gegeben und das konkret begehrte Arzneimittel vom Leistungsumfang der Krankenversicherung erfasst sein. Nach §§ 27 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3, 31 SGB V erfordert dies, dass (1) das Mistelpräparat ein apothekenpflichtiges Arzneimittel ist und (2) die Arzneimittelversorgung sowohl notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern, als auch weder nach § 34 SGB V noch durch Richtlinien nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V ausgeschlossen ist.
1. Apothekenpflichtiges Arzneimittel
Das Mistelpräparat müsste daher zunächst ein apothekenpflichtiges Arzneimittel i.S.d. § 31 Abs. 1 SGB V sein. Unter einem Arzneimittel versteht man solche Stoffe, die die Voraussetzungen des Arzneimittelbegriffs nach § 2 Arzneimittelgesetz erfüllen und damit pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch – gleichsam von „innen“ – auf den Organismus einwirken, um Krankheitszustände zu heilen oder zu bessern bzw. eine medizinische Diagnose zu stellen.12 Das Mistelpräparat soll aufgrund seiner pharmakologisch wirksamen Stoffe das Immunsystem positiv beeinflussen. Ziel ist eine Besserung des Gesundheitszustands. Es wirkt somit von innen auf den Organismus ein und erfüllt damit die Voraussetzungen des Arzneimittelbegriffs. Zudem ist es apothekenpflichtig.13
[17]2. Ausgestaltung des Rahmenrechts auf Arzneimittel
Im SGB V ist der Anspruch auf Krankenbehandlung als Rahmenrecht ausgestaltet.14 Damit ist gemeint, dass beim Vorliegen des Versicherungsfalls der Krankheit zwar prinzipiell ein Anspruch des Versicherten besteht, jedoch die theoretisch denkbare Variationsbreite von „Behandlungen“ noch begrenzt werden muss auf dasjenige, das die Krankenkasse bezahlen soll.15 Normsystematische Anknüpfungspunkte für diese Begrenzung sind einschränkende Tatbestandsmerkmale im Wortlaut des Gesetzes und insbesondere das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 2 Abs. 1 S. 1, § 12 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 27 Abs. 1 S 1, § 70 Abs. 1 S. 2 SGB V (s. „Notwendigkeit“ der Behandlung). Demnach muss jede Form der Krankenbehandlung (also auch die Arzneimitteltherapie) notwendig sein, um eines der Behandlungsziele des § 27 Abs. 1 S. 1 SGB V zu erreichen. Von Notwendigkeit in diesem Sinne kann man sprechen, wenn die Therapie unter Zugrundelegung dieses Leistungszwecks unentbehrlich, unvermeidlich oder unverzichtbar ist.16 Außerdem muss die Behandlung nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot nicht nur notwendig, sondern auch ausreichend und zweckmäßig sein.17 Praktisch betrachtet werden die unbestimmten Rechtsbegriffe der notwendigen, ausreichenden und zweckmäßigen Krankenversorgung durch untergesetzliche Rechtsnormen des G-BA – die Richtlinien nach §§ 92, 135 SGB V – und durch die individuelle Behandlungsentscheidung des Leistungserbringers definiert. Im Ergebnis ist es mithin so, dass das Rahmenrecht auf Behandlung durch die Richtlinien des G-BA verdichtet und erst durch die individuelle Behandlungsentscheidung des Vertragsarztes zu einem echten Anspruch i.S.d. § 38 SGB I konkretisiert wird.
a) Herausnahme nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel
Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind von der Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung aber prinzipiell ausgenommen (§ 34 Abs. 1 S. 1 SGB V).18 Verschreibungspflichtig sind[18] solche Arzneimittel, die bestimmte gesetzlich konkretisierte Stoffe enthalten (§ 48 AMG i.V.m. Arzneimittelverschreibungsverordnung). Das Mistelpräparat enthält solche Stoffe nicht und ist danach nicht verschreibungspflichtig19, was gegen eine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung sprechen könnte.
b) Ausnahmsweise kein Leistungsausschluss
Allerdings könnte hier ein Fall vorliegen, in dem ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel bei einer schwerwiegenden Erkrankung als Therapiestandard gilt und deshalb vom Vertragsarzt ausnahmsweise zu Lasten der Krankenkasse verordnet werden dürfte (§ 34 Abs. 1 S. 2 SGB V). Dazu müsste das Mistelpräparat in einer Richtlinie nach § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 SGB V (sog. Arzneimittel-Richtlinie) als verordnungsfähig eingestuft worden sein. Anlage I der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-RL)20 – sog. OTC-Übersicht – bestimmt unter Nr. 32, dass verordnungsfähig sind „Mistel-Präparate, parenteral, auf Mistellektin normiert, nur in der palliativen Therapie von malignen Tumoren zur Verbesserung der Lebensqualität“. Vorliegend soll das Mistelpräparat allerdings bei einer adjuvanten und nicht bei einer palliativen Therapie eingesetzt werden. Folglich fällt es nicht unter die ausnahmsweise Verordnungsfähigkeit gemäß der Richtlinie.21
[19]c) Verfassungsmäßigkeit des Leistungsausschlusses
Schließlich dürfte der Leistungsausschluss des Mistelpräparates nicht unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten unzulässig sein. Eine Unwirksamkeit des Leistungsausschlusses ist unter zwei Gesichtspunkten denkbar: (aa) Dem G-BA könnte es an einer hinreichend demokratischen Legitimation zum Erlass der Arzneimittel-RL ermangeln und (bb) der Leistungsausschluss könnte das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip verletzen.
aa) Demokratische Legitimation des G-BA
Es fragt sich zunächst, ob die Richtliniengebung des G-BA dem grundgesetzlichen Demokratieprinzip nach Art. 20 Abs. 1 und 2 GG widerspricht. Indem der G-BA mittels der Arzneimittel-RL den Leistungsanspruch von Versicherten definieren kann, setzt er eine abstrakt-generelle Regelung. Dabei könnte es sich um die Ausübung von Staatsgewalt handeln, die sich nach dem Demokratieprinzip prinzipiell immer auf den Volkswillen zurückführen lassen muss (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG). Anders als beim Bundestag, der den prinzipiellen Rechtsanspruch nach § 31 Abs. 1 SGB V erlassen hat, lässt sich beim G-BA eine solche ununterbrochene Legitimationskette weder zum deutschen Volk an sich noch zur Gemeinschaft der Versicherten als der hier einschlägigen Teilmenge des Volkes ziehen. Andererseits hat der Gesetzgeber selbst in § 34 Abs. 1 S. 2 SGB V den G-BA zur Richtlinienschaffung ermächtigt. Folgerichtig fordert die Rechtsprechung[20] im hier einschlägigen Bereich der funktionellen Selbstverwaltung22 aufgrund des Demokratieprinzips auch nicht, dass eine lückenlose personelle Legitimationskette vom Volk vorliegt. Hinreichend ist, dass die Aufgaben und Handlungsbefugnisse der ermächtigten Organe gesetzlich ausreichend vorherbestimmt sind und ihre Wahrnehmung der Aufsicht personell demokratisch legitimierter Amtswalter unterliegt.23
Eine ausreichende vorherige Bestimmung der Aufgaben und Handlungsbefugnisse ist anzunehmen, wenn die vorgeschriebene Handlungsform gesetzlich präzise ausgeformt ist und rechtsstaatlichen Anforderungen genügt. Das erfordert, dass erstens das Verfahren zum Erlass der Richtlinien transparent, zweitens ihre Publizität gesichert und drittens die Reichweite der Bindungswirkung gegenüber den Systembeteiligten gesetzlich festgelegt ist.24 Als erstes setzt Verfahrenstransparenz voraus, dass der Weg zum Erlass der Richtlinie klar ist. Dieses Verfahren der Richtliniengebung ist hier durch Gesetz geregelt. Insbesondere ist vorgesehen, dass vor dem Richtlinienerlass sowohl Sachverständige als auch die Vereinigungen mit wirtschaftlichem Interesse an der Entscheidung (wie pharmazeutische Unternehmer und Apotheker sowie die Vertreter der besonderen Therapierichtungen) eine Stellungnahme abgeben können, die in die Entscheidung einzubeziehen ist (§ 92 Abs. 3a SGB V). Damit besteht über das Verfahren zum Richtlinienerlass Transparenz. Zum zweiten verlangt Publizität, dass eine beschlossene Richtlinie jederzeit einsehbar ist. Hier wird die beschlossene Richtlinie im Bundesanzeiger und im Internet veröffentlicht. Von Publizität kann also ausgegangen werden. Drittens bestimmt § 91 Abs. 6 SGB V, dass die Beschlüsse des G-BA für die Krankenkassen, Versicherten und Leistungserbringer verbindlich sind. Mithin ist für die Arzneimittel-RL die Reichweite der Bindungswirkung im Hinblick auf die maßgeblichen am System Beteiligten durch Gesetz festgelegt. Folglich ist die Befugnis des G-BA zur Regelung gesetzlich präzise und rechtsstaatsgemäß ausgeformt.
Außerdem müsste die Richtliniengebung des G-BA der Aufsicht personell demokratisch legitimierter Amtswalter unterliegen. Die[21] vom G-BA beschlossenen Richtlinien müssen dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt werden. Dieses kann sie innerhalb von zwei Monaten beanstanden (§§ 91 Abs. 8, 94 Abs. 1 SGB V). Der Bundesgesundheitsminister besitzt eine ununterbrochene Legitimation durch das Wahlvolk (s. Art. 64 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 Abs. 1 GG). Infolgedessen liegt hier präventive aufsichtsrechtliche Kontrolle durch einen personell demokratisch legitimierten Amtswalter (Bundesgesundheitsminister) vor.25
Folglich ist der G-BA hinreichend demokratisch legitimiert und seine Richtliniengebung verstößt auch nicht gegen das Demokratieprinzip.
bb) Verstoß des Leistungsausschlusses gegen Grundrechte
Der Leistungsausschluss könnte das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip verletzen.
Eine solche Verletzung läge vor, wenn der Gesetzgeber in unverhältnismäßiger Weise Arzneimittel von der Verordnungsfähigkeit ausgeschlossen und somit dem Bereich der Eigenvorsorge zugewiesen hätte. Dies ist anerkanntermaßen der Fall, wenn Versicherte an einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung bzw. an einer zumindest wertungsmäßig damit vergleichbaren Erkrankung leiden, für die eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht und eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürbar positive Entwicklung des Krankheitsverlaufs besteht (vgl. auch § 2 Abs. 1a SGB V).26 Eine Krankheit ist in diesem Sinne lebensbedrohlich bzw. wertungsmäßig damit vergleichbar, wenn nach den konkreten Umständen des Falls droht, dass sich der negative Krankheitsverlauf innerhalb eines kürzeren, überschaubaren Zeitraums mit großer Wahrscheinlichkeit verwirklicht.27 Vorliegend hat E die Operation und die Chemotherapie erfolgreich absolviert. Sie hat ihre Arbeit wieder in Vollzeit aufgenommen. Metastasen sollen zwar durch die adjuvante Therapie verhindert werden, sind derzeit aber nicht ersichtlich. Somit fehlt es an einer lebensbedrohlichen[22] oder wertungsmäßig damit vergleichbaren Erkrankung i.S.d. oben dargestellten Ausnahmeregelung.28
Folglich hat der Gesetzgeber hier nicht in unverhältnismäßiger Weise das Mistelpräparat vom Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung ausgenommen und dem Bereich der Eigenvorsorge zugewiesen. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip sind mithin nicht verletzt.
IV. Ergebnis
Nach alledem ist das Mistelpräparat in rechtmäßiger Weise vom Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen (§ 34 Abs. 1 SGB V). Die besonderen Voraussetzungen der Leistung des Arzneimittels sind nicht gegeben. E hat damit keinen Anspruch auf Leistung des Mistelpräparats gegen ihre Krankenkasse. Diese hat die Leistung zu Recht abgelehnt, so dass E keinen Anspruch auf Kostenerstattung wegen einer zu Unrecht abgelehnten Leistung nach § 13 Abs. 3 SGB V hat. Auch zukünftig muss die Krankenkasse das ausgeschlossene Arzneimittel somit nicht erbringen.
Literaturhinweise
– BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R, das „Vorbild“ für den Fall
1 Metastasen sind Absiedlungen des Tumors in weiter entferntem Gewebe (sog. Töchtergeschwulste).
2 OTC kommt von „over the counter“, also gleichsam ein „über den Apothekentresen-Arzneimittel“.
3 Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Er besteht aus Vertretern der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen. Seine hohe praktische Bedeutung folgt daraus, dass die Leistungsansprüche im SGB V nur als sog. Rahmenrecht im Gesetz konstruiert sind (vgl. dazu vertiefend Palsherm, Sozialrecht, 2. Aufl. (2015), Rz. 181). Bevor ein versicherter Mensch eine konkrete Leistung erhalten kann, muss dieses Rahmenrecht erst noch durch eine Entscheidung seines be handelnden Vertragsarztes konkretisiert werden, der seinerseits durch verbindliche Richtlinien des G-BA (s. § 91 Abs. 6 SGB V) determiniert ist. Diese Richtlinien über eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten legen den Leistungskatalog der Krankenversicherung fest (§ 92 Abs. 1 S. 1 SGB V). Letztlich entscheidet der G-BA damit, welche Leistungen von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden.
4 Eine palliative Therapie zielt nicht mehr auf die Heilung, sondern nur noch auf die Linderung der Symptome ab.
5 Das Wort „akzessorisch“ ist ein Fachbegriff aus der Rechtssprache dafür, dass ein Recht von einem anderen, übergeordneten Recht abhängig ist.
6 Vgl. Janda, Medizinrecht, 3. Aufl. (2016), S. 79.
7 Das entspricht der ständigen Rechtsprechung des BSG, vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 9. Die gesetzliche Krankenkasse erbringt ihre Leistungen prinzipiell nach dem sog. Naturalleistungsprinzip, d.h. die Krankenbehandlung wird als Sach- und Dienstleistung erbracht. Dabei wird die Krankenkasse aber nicht selbst tätig, sondern bedient sich der sog. Leistungserbringer. Dies sind z.B. die zur Behandlung von gesetzlich Krankenversicherten zugelassenen Vertragsärzte (früher deshalb Kassenärzte genannt). Der große praktische Vorteil des Naturalleistungsprinzips ist es, dass die Versicherten die Leistung erhalten, ohne dafür unmittelbar selbst bezahlen zu müssen. Dies ist bei einem Kostenerstattungsprinzip, wie es beispielsweise kennzeichnend für die private Krankenversicherung ist, anders. Auch wenn in der Gesundheitsökonomie das Naturalleistungsprinzip zuweilen mit dem Argument kritisiert wird, dass die fehlende Kostentransparenz zu unnötiger Leistungsinanspruchnahme durch Versicherte führe, verdient der Naturalleistungsgrundsatz aus sozialen Erwägungen unbedingte Zustimmung. Denn gerade für sozial schwache Menschen wäre zu befürchten, dass eine Verpflichtung zur Vorabbezahlung vom notwendigen Arztbesuch abhalten würde. Freilich bedarf es ersatzweise einer Kostenerstattung, wenn eine Sachleistung zu Unrecht abgelehnt wird und deshalb Kosten für die Selbstbeschaffung entstanden sind.
8 Diese Definition entspricht der ständigen Rechtsprechung des BSG, vgl. zum Beispiel BSG 8.3.2016 – B 1 KR 35/15 R – Rn. 9.
9 Auch diese Definition entspricht der ständigen Besprechung des BSG, vgl. zum Beispiel BSG 8.3.2016 – B 1 KR 35/15 R – Rn. 10.
10 Vgl. ständige Rechtsprechung des BSG, zum Beispiel BSG 3.8.2006 – B 3 KR 1/06 S – juris Rn. 7.
11 Medizinischer Begriff für Brustkrebs.
12 Diese Definition entspricht der ständigen Rechtsprechung des BSG, vgl. BSG 3.7.2012 – B 1 KR 23/11 R – Rn. 12.
13 Hier erübrigt sich eine detaillierte Prüfung der Apothekenpflichtigkeit, da der Sachverhalt dies eindeutig vorgibt. Vgl. zur Apothekenpflicht im Übrigen §§ 43 bis 45 AMG. Im Regelfall sind Arzneimittel i.S.d. § 2 Abs. 1 AMG auch apothekenpflichtig (s. § 43 Abs. 1 S. 1 AMG).
14 Vgl. die ständige Rechtsprechung des BSG, zum Beispiel BSG 17.12.2009 – B 3 KR 13/08 R – Rn. 19.
15 Die Sinnhaftigkeit dieser Begrenzung zeigt folgende Kontrollüberlegung: Muss die Krankenkasse etwa auch den „heilenden Schamanentrunk“ als Arznei bezahlen?
16 Vgl. BSG 26.10.1982 – 3 RK 28/82 – juris Rn. 12.
17 Vgl. dazu vertiefend Janda, Medizinrecht, 3. Aufl. (2016), S. 81 f. und Palsherm, Sozialrecht, 2. Aufl. (2015), Rz. 193 f.
18 Die Regelung ist verfassungsgemäß (vgl. BVerfG 12.12.2012 – 1 BvR 69/09 – Rn. 6 ff.). Auf die Gegenausnahme nach § 34 Abs. 1 S. 5 SGB V – Leistungspflicht für Kinder bis zwölf Jahren bzw. für Jugendliche mit Entwicklungsstörungen – braucht in der Prüfung nicht eingegangen zu werden, da E ersichtlich volljährig ist. Allenfalls kann man auf die Gegenausnahme in einem kurzen Satz hinweisen.
19 Das geht aus dem Sachverhalt eindeutig hervor, so dass sich weitere Ausführungen dazu erübrigen.
20 Die Richtlinie ist erhältlich unter: http://www.g-ba.de.
21 In der diesem Fall zu Grunde liegenden BSG-Entscheidung (BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 14 ff.) wird außerdem problematisiert, ob sich eine Verordnungsfähigkeit ausnahmsweise daraus ergeben könnte, dass es sich bei dem Mistelpräparat um ein anthroposophisches Arzneimittel handele. Denn immerhin sei der therapeutischen Vielfalt Rechnung zu tragen (§ 34 Abs. 1 S. 3 SGB V) und bei schwerwiegenden Erkrankungen könnten für die in der Anlage I der Arzneimittelrichtlinie genannten Indikationsgebiete auch Arzneimittel der Anthroposophie und Homöopathie verordnet werden (§ 12 Abs. 6 Arzneimittel-RL). Dies wird im Ergebnis jedoch überzeugend abgelehnt, weil aufgrund des eindeutigen Wortlauts der Arzneimittel-RL auch insoweit nur ein Einsatz in der palliativen Tumortherapie in Betracht kommt (vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 17). Außerdem prüft das BSG, ob der Ausschluss einer lediglich adjuvanten Tumortherapie durch die Arzneimittel-RL, die den Charakter untergesetzlicher Rechtsnormen hat, mit höherrangigem Gesetzesrecht, nämlich § 34 Abs. 1 S. 2 und 3 SGB V, vereinbar ist (vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 23 ff.). Auch hier legt das BSG überzeugend dar, dass nur solche nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel in die OTC-Liste aufgenommen werden sollen, die als „Therapiestandard“ gelten (s. § 34 Abs. 1 S. 2 SGB V). Für die Beurteilung, was Therapiestandard ist, komme es auch nicht auf die bloße Binnensicht einer Therapierichtung – hier also der Anthroposophie – an (vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 36). Die Behandlung mit dem Mistelpräparat entspreche aber nicht dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse für eine adjuvante Tumortherapie (vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 33 ff.). Sowohl der Gesichtspunkt der Anthroposophie (s. o.) als auch die Prüfung der Vereinbarkeit mit höherrangigem Gesetzesrecht des SGB V dürften in einer Klausur für Studierende der Sozialen Arbeit nicht erwartet werden. Daher wurde auch hier auf eine ausführliche Prüfung verzichtet.
22 Das Grundgesetz anerkennt in Art. 87 Abs. 2 GG die Möglichkeit funktioneller Selbstverwaltung, bei der staatliche Aufgaben nicht im Wege unmittelbarer Staatsverwaltung, sondern eigenverantwortlich durch die Betroffenen – freilich unter staatlicher Rechtsaufsicht – wahrgenommen werden.
23 Vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 43 ff., insb. 44.
24 Vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 45.
25 Vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 47 f.
26 Vgl. dazu grundlegend BVerfG 6.12.2005 – 1 BvR 347/98 – insb. Rn. 63 ff. (sog. Nikolaus-Beschluss).
27 Vgl. BSG 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R – Rn. 59.
28 Hier ist es wichtig, sprachlich ganz präzise zu sein (und zu lesen). Niemand bezweifelt, dass E an einer sehr schweren Krankheit leidet. Vgl. auch die durch das SGB IX gewährte Möglichkeit der Feststellung eines Grades der Behinderung nach einer operativen Entfernung der Brust (Mastektomie). E.s Zustand entspricht aber nicht der extremen Situation einer direkten krankheitsbedingten Lebensgefahr, um den Ausnahmefall eines unmittelbaren verfassungsrechtlichen Leistungsanspruchs zu rechtfertigen.