Interaktionen im Kita-Alltag gestalten
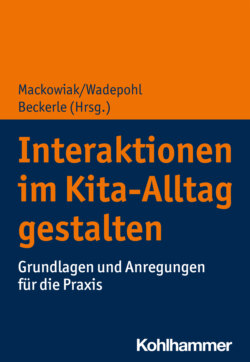
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Группа авторов. Interaktionen im Kita-Alltag gestalten
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
1. Entwicklungsförderliche Fachkraft-Kind-Interaktionen in Kindertageseinrichtungen: Einführung in den Themenschwerpunkt. Katja Mackowiak, Christine Beckerle & Heike Wadepohl
Literatur
2. Gestaltung von Fachkraft-Kind-Beziehungen. Heike Wadepohl & Susanne Böckmann. 2.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
2.2 Zentrale Konzepte. 2.2.1 Ausgangspunkt: Eltern-Kind-Bindung. Bindungstheorie
Bindungsqualitäten
Feinfühliges Interaktionsverhalten der Bezugsperson
2.2.2 Die Fachkraft-Kind-Beziehung
Reflexionsfrage
Facetten der Beziehungsgestaltung in der Kita
Sensitiv-responsives Interaktionsverhalten
Untersuchungen zur Qualität von Fachkraft-Kind-Beziehungen
2.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag
2.3.1 Diagnostische Perspektive
Übung 1 und 2: Beobachtung in der Eingewöhnung
Reflexionsfragen
Übung 3: Identifikation kindlicher Bedürfnisse im Kita-Alltag
Übung 4: Entwicklung der Beziehungsgestaltung
2.3.2 Förderperspektive
Übung 5: Fünf Facetten der Beziehungsgestaltung
Reflexionsfragen
Übung 6: Dyadische Spielsituationen
Weiterführende Literaturtipps
Literatur
3. Unterstützung kindlicher Lernprozesse durch kognitiv anregende Interaktionen im Kita-Alltag. Katja Mackowiak, Matthias Mai, Lisa Keller, Theresa Johannsen, Stefani Linck, Cathleen Bethke. 3.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
3.2 Zentrale Konzepte
3.2.1 Lernunterstützung durch kognitive Aktivierung
3.2.2 Lernunterstützung und Bildungsverständnis
Reflexionsfragen
3.2.3 Studien zur Lernunterstützung in Kitas
3.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag
3.3.1 Diagnostische Perspektive
Reflexionsfragen
Übung 1: Kindliches Spiel beobachten und verstehen
3.3.2 Förderperspektive
Scaffolding
Kasten 3.1: Scaffolding
Sustained shared thinking (SST)
Kasten 3.2: Sustained shared thinking (SST)
Reflexionsfragen
Übung 2: Lernunterstützende Spielbegleitung planen. Übung 3: Scaffolding- und SST-Dialoge zuordnen. Übung 4: Kognitiv anregende Dialoge entwickeln
Literatur
4. Kindliche Interessen im Fokus der Fachkraft-Kind-Interaktion. Michael Lichtblau. 4.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
4.2 Zentrale Konzepte. 4.2.1 Person-Gegenstands-Theorie des Interesses
Reflexionsfrage
Übung 1: Reflexion der Person-Gegenstands-Theorie des Interesses
Übung 2: Fallbeispiele für situationales und individuelles Interesse
4.2.2 Forschungsergebnisse zur Entwicklung und Förderung kindlicher Interessen
Reflexionsfrage
4.2.3 Forschungsergebnisse zum Einfluss von Interessen auf die (Lern-)Entwicklung
Reflexionsfrage
4.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag
4.3.1 Diagnostische Perspektive
Inhaltliche Orientierung kindlicher Interessen
Reflexionsfrage
Übung 3: Kategorien kindlicher Interessen in der Kita und im Übergang zur Schule identifizieren
4.3.2 Förderperspektive
»Catch«- und »Hold«-Komponenten von situationalen Interessen
Kognitiv aktivierende Fachkraft-Kind-Interaktion auf Basis individueller Interessen
Inhaltliche Orientierung kognitiv aktivierender Fachkraft-Kind-Interaktionen
Direkte inhaltliche Orientierung am individuellen Hauptinteresse
Indirekte inhaltliche Orientierung am individuellen Hauptinteresse
Übung 4: Gestaltung einer Fachkraft-Kind-Interaktion mit direkter bzw. indirekter inhaltlicher Orientierung
Weiterführende Literaturtipps
Literatur
5. Adaptive sprachförderliche Interaktionen im Kita-Alltag. Christine Beckerle, Stefani Linck & Kim Sophie Bernecker. 5.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
5.2 Zentrale Konzepte. 5.2.1 Aufgaben und Kompetenzen in der adaptiven alltagsintegrierten Sprachförderung
Reflexionsfragen
5.2.2 Methoden einer sprachförderlichen Interaktionsgestaltung
Kasten 5.1: Adaptives sprachförderliches Handeln
Reflexionsfrage
5.2.3 Rahmenbedingungen einer sprachförderlichen Interaktionsgestaltung
Reflexionsfragen
5.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag. 5.3.1 Sprachförderdiagnostik
Erste Komponente: Beobachtung
Reflexionsfrage
Übung 1: Beobachtung ausgewählter Sprachstrukturen
Zweite Komponente: Elizitation
Reflexionsfrage
Übung 2: Elizitation ausgewählter Sprachstrukturen
Dritte Komponente: Anamnese
Reflexionsfragen
Übung 3: Anamnesegespräch mit den Erziehungsberechtigten
5.3.2 Sprachförderung
Sprachvorbild
Reflexionsfrage
Reflexionsfragen
Reflexionsfrage
Reflexionsfrage
Reflexionsfragen
Reflexionsfragen
Übung 4: Sprachvorbild
Konkrete Sprachförderstrategien
Reflexionsfragen
Reflexionsfrage
Reflexionsfrage
Übung 5: Adaptive Fragen in verschiedenen Situationen
Weiterführende Literaturtipps
Literatur
6. Gemeinsam die Welt erkunden und befragen – Domänenspezifische Interaktionsgestaltung am Beispiel des naturwissenschaftsbezogenen Lernens im Kita-Alltag. Claudia Schomaker & Kathrin Hormann. 6.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
6.2 Zentrale Konzepte. 6.2.1 Ziele: Mit Kindern über Naturphänomene nachdenken
Zur Anbahnung von scientific literacy als Zieldimension
Lern- und entwicklungspsychologische Voraussetzungen von Kindern
6.2.2 Naturwissenschaftsbezogene Bildungsprozesse unterstützen und begleiten
Professionelle Voraussetzungen zur Gestaltung von Interaktionen
6.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag
6.3.1 Der Blick auf die Kinder – die diagnostische Perspektive
Übung 1: Zu den Fragen von Kindern
Übung 2: Zu den Vorstellungen, Ideen und Interessen von Kindern
Mit Konzeptdialogen Vorstellungen von Kindern sichtbar machen
Konzeptdialog zur Stabilität einer Brücke aus Papier
6.3.2 Interaktionen zu naturwissenschaftsbezogenen Bildungsprozessen gestalten
Übung 3: Zur Weiterentwicklung der Denkmodelle von Kindern
Übung 4.1: Reflexion der eigenen Perspektive auf Natur und Technik
Übung 4.2: Reflexion der Perspektive von Kindern auf Natur und Technik
Weiterführende Literaturtipps
Literatur
7. Gesundheitsförderliche Interaktionsgestaltung im Kita-Alltag. Nicole R. Heinze, Julia Feesche, Antje Kula & Ulla Walter. 7.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
7.2 Zentrale Konzepte
7.2.1 Definition von Gesundheit
7.2.2 Definition von Prävention und Gesundheitsförderung
7.2.3 Setting Kita
Kasten 7.1: Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten
7.2.4 Prävention und Gesundheitsförderung in Kitas
7.2.5 Das Thema Ernährung im Kita-Alltag
7.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita Alltag
7.3.1 Diagnostische Perspektive
Reflexionsfragen
Übung 1: Bestandsaufnahme für die Kita hinsichtlich der Förderung gesunder Ernährung (einzeln und als Team)
7.3.2 Förderperspektive
Reflexionsfragen
Reflexionsfragen
Übung 2: Mahlzeiten kultursensibel gestalten
Reflexionsfragen
Übung 3: Ernährungsbezogene Dialoge
Literatur
8. Lernwerkstattarbeit: Interaktionsgestaltung im Rahmen einer Lernwerkstatt. Kathrin Hormann. 8.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
8.2 Zentrale Konzepte. 8.2.1 Lernwerkstatt
8.2.2 Lernwerkstätten in Kitas: Räumliche Gestaltungsweisen
8.2.3 Lernwerkstattarbeit: Interaktionsgestaltung in der Lernwerkstatt
Reflexionsfragen
8.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag. 8.3.1 Die diagnostische Perspektive: Der Blick auf die Perspektive der Kinder
Material 1: Interaktion in der Lernwerkstatt ›Naturwissenschaft/Technik/Forschen‹
Übung 1: Reflexion der Perspektiven von Kindern
8.3.2 Die Förderperspektive: Interaktionsgestaltung in der Lernwerkstatt
Material 2: Fortsetzung der Ausgangssituation: Interaktion in der Lernwerkstatt ›Naturwissenschaft/Technik/Forschen‹
Übung 2: Reflexion der Lernbegleitung in der Lernwerkstatt
8.3.3 Umsetzungshinweise zur Einrichtung einer Lernwerkstatt
Übung 3: Eine Lernwerkstatt als anregende Lernumgebung bereitstellen
Literatur
9. Eine inklusive Perspektive auf responsive Interaktionsgestaltung im Kontext alltagsintegrierter Unterstützung. Antje Rothe. 9.1 Relevanz des Themas und Zielsetzung
Leitfragen
9.2 Zentrale Konzepte. 9.2.1 Responsive Interaktionsgestaltung
Übung 1: Reflexion des Konzeptes responsiver Interaktionsgestaltung
9.2.2 Inklusion
Übung 2: Reflexion des Inklusionsverständnisses von Artiles et al. (2006)
9.2.3 Inklusion – Responsivität – Diagnostischer und förderorientierter Modus
9.3 Möglichkeiten der Umsetzung im Kita-Alltag. 9.3.1 Inklusive Potenziale responsiver Interaktionsgestaltung anhand eines Fallbeispiels
Material 1: Fallbeispiel. Adal2 möchte eine Lego-Figur in ein Lego-Fahrzeug setzen3
Übung 2: Beschreibung und Reflexion des inklusiven Handelns
Analyse
Kasten 9.1: Akzeptanz
Kasten 9.2: Partizipation
Kasten 9.3: Leistung
Kasten 9.4: Das inklusive Potenzial einer responsiven Interaktionsgestaltung
9.3.2 Reflexion der inklusiven Potenziale in der eigenen Praxis responsiver Interaktionsgestaltung
Übung 3: Reflexion der Interaktionsgestaltung in der eigenen Praxis
Weiterführende Literaturtipps
Literatur
Zusatzmaterial
Autorenverzeichnis
Отрывок из книги
Die Gestaltung von Fachkraft-Kind-Interaktionen in Kindertageseinrichtungen (Kitas) hat sich in den letzten Jahren zu einem eigenständigen und zentralen Forschungsfeld in der Frühpädagogik entwickelt. Hierzu haben viele (inter-)nationale Befunde beigetragen, die den Einfluss pädagogischer (Interaktions-)Qualität auf kindliche Entwicklungsmaße eindrücklich belegen. Dieses Thema bildet auch einen Schwerpunkt in unserer Forschung; dabei ist von besonderem Interesse, wie es pädagogischen Fachkräften im Kita-Alltag gelingt, kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse in Interaktionen anzuregen, und wie die professionellen Kompetenzen der Fachkräfte im Hinblick auf eine qualitativ hochwertige Interaktionsgestaltung weiterentwickelt werden können.
In diesem Herausgeberband bringen wir interdisziplinäre Beiträge zur Gestaltung entwicklungsförderlicher Fachkraft-Kind-Interaktionen im Kita-Alltag zusammen. Inhaltlich werden in diesem Band ausgewählte Facetten der Interaktionsgestaltung aus (inklusions-)pädagogischer, (entwicklungs-)psychologischer und domänenspezifischer Perspektive vorgestellt, welche die Arbeitsschwerpunkte der beteiligten Kolleg*innen aus drei Abteilungen des Instituts für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover sowie des Instituts für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule Hannover bilden.
.....
Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Beziehungen für die Entwicklung und das Lernen von Kindern sollen die hier vorgestellten Übungen und Reflexionsfragen insbesondere (angehende) frühpädagogische Fachkräfte dazu einladen, sich ihrer Kompetenzen in diesem Bereich bewusst zu werden und diese – insbesondere im Hinblick auf das flexible und individuell abgestimmte Wechselspiel der unterschiedlichen Facetten – im komplexen, pädagogischen Alltag umzusetzen.
Becker-Stoll, F. & Textor, M. R. (2007) (Hrsg.). Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Zentrum von Bildung und Erziehung. Berlin: Cornelsen.
.....