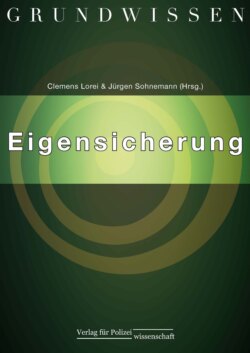Читать книгу Grundwissen Eigensicherung - Группа авторов - Страница 8
ОглавлениеStress
Christian Pundt
Kriminologe M. A., Diplomverwaltungswirt (FH), Polizeiakademie Niedersachsen
Die Fragestellungen, die in diesem Kapitel bearbeitet werden, sind:
1. Was ist Stress? Wie kann man das Phänomen Stress definieren?
2. Was bedeutet Stress für Polizeibeamte?
3. Welcher Stress ist für Polizeibeamte zu erwarten? Wie kann man darauf konkret reagieren?
Einführung
Der Polizeidienst ist geprägt durch eine Vielzahl von Einwirkungen und Belastungen, die etymologisch dem Begriff Stress zuzuordnen sind. Stressoren wie Wechselschichtdienst, eine relativ starre Hierarchie und eine hohe individuelle Anforderung an die Flexibilität des Einzelnen seien hier freilich ebenso genannt, wie starke persönliche Belastungen. Als persönliche Belastungen werden u. a. das Anwenden und Erleben von Gewalt, die Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle sowie die Betreuung von Opfern und Angehörigen angesehen.1 Allgemeine Stressoren, die zusätzlich zum Einsatzgeschehen auf Polizeibeamte einwirken, sind aufgrund der Thematik des Fachbuches aus dieser Betrachtung auszuschließen und werden in einem weiteren Fachbuch „Grundwissen Stress“ ausführlich erläutert.2 Ein wichtiger Aspekt dabei ist jedoch, dass alle Stressoren, seien sie privater oder dienstlicher Natur, auf das Arbeitsverhalten, die Konzentration und damit auf die Einsatzbewältigung Einfluss haben können.3
Abbildung 1
In der Psychologie werden die auftretenden Stressoren jedoch differenzierter eingeteilt. Unterschieden wird grundsätzlich in physische, psychische und soziale Stressoren (Abbildung 1).
Grundsätzlich sind jedoch nicht alle Einflussfaktoren negativ zu bewerten sondern können je nach individueller Sichtweise auch als Schutzfaktoren die Arbeit des Einzelnen erleichtern. Zu nennen sind eine gute Teamarbeit, ein gutes Arbeitsklima sowie ein gutes soziales Umfeld.
Der Einsatz- und Streifendienst, aber auch Ermittlungstätigkeiten außerhalb der Dienststelle, orientieren sich zum Großteil an der Bewältigung und Bearbeitung polizeilicher Standardlagen. Bei der Aufnahme polizeirelevanter Sachverhalte können die eingesetzten Beamten meist nur reagieren, anstatt selbst zu agieren. In jeder Standardlage entsteht somit immer ein „blinder Fleck“, der nicht vorausgesagt werden kann. Mit zunehmender Berufserfahrung entstehen bei der Aufnahme von Standardlagen Handlungsroutinen, die positiv wie negativ bewertbar sind. Die Auswertungen dieser „polizeilichen Standardlagen“ (Ruhestörung, innerfamiliäre Streitigkeiten und Gewalt) zeigen deutlich, dass gerade bei diesen scheinbaren Routineeinsätzen Polizeibeamte angegriffen und mit extrem aggressivem Verhalten konfrontiert werden.4 Dabei müssen sie trotzdem handlungsfähig und professionell bleiben. Betrachtet man die Stressbelastung, ist besonders hervorzuheben, dass sich Einsatzsituationen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde ändern und der Stresslevel von absoluter Ruhe auf ein Höchstmaß ansteigen kann. Es ist gerade im Polizeialltag umso wichtiger, die Einsatzsituation und den auftretenden Stress entsprechend bewerten zu können, um handlungsfähig zu bleiben. Deshalb sollte jede/r Polizeibeamte/-in wissen, was für ihn/sie persönlich Stress bedeutet, wie er/sie sich innerpsychisch zeigt und welche Reaktionen für den Einzelnen zu erwarten sind.
Beispiel
Verden
19.07.2009
Messereinsatz gegen Polizeibeamten
Durch den Rettungsdienst wurde der Polizei in Verden/Osterholz ein polizeirelevanter Sachverhalt gemeldet, bei dem eine verletzte Person vor einer Gaststätte stehen sollte. Die Verletzungen seien eventuell durch ein Messer zugefügt worden. Als die beiden Polizeibeamten vor Ort eintrafen, standen zwei Personen vor einem Kaffee. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um Vater und Sohn. Der jüngere von beiden wirkte aufgrund seiner Kleidung (Schlafanzughose, Shirt und barfuß mit Blut an der Körperseite) wie ein Opfer. Der Polizeibeamte (30) erkannte aufgrund seiner Bewertung der Situation keinerlei Gefahrenmomente und ging auf die beiden Personen zu. Ohne eine Ansprache durch einen der beiden Beamten an die Personen „wirbelte“ der Täter (19) plötzlich herum und stach dem Polizeibeamten mit einem Messer in den Hals. Der Polizeibeamte sah den Angriff nicht voraus und war völlig überrascht. Der Kollege sprach den Täter mit gezogener Waffe zu Boden und hielt die Lage statisch, bis der Rettungswagen eintraf. Sein Kollege berichtet später, dass der Angriff wie ein ausgeholter Tennisschlag aussah. Erst bei der Verletzung habe der Polizeibeamte gemerkt, dass etwas im Argen ist. Er konnte nicht mehr funken und sich auch nicht mehr auf den Beinen halten. Die Gefahrensituation sei für ihn nicht erkennbar gewesen. Eigene Anmerkung: Mittlerweile ist Herr Biernath glücklicherweise wieder im Dienst.
Quelle: Auszüge aus einem Interview mit dem lebensgefährlich verletzten Kollegen Mirko Biernath, welches im Rahmen einer Bachelorarbeit (2010) geführt und mir durch den Kollegen Biernath freundlicherweise für weitere Projekte in der Polizeiwissenschaft zur Verfügung gestellt wurde.
Stress
Das Wort Stress hat seinen Ursprung aus dem lateinischen strictus, was so viel wie straff bedeutet. Im englischsprachigen Raum wird das Wort Stress mit Anspannung oder Druck übersetzt.
Die Schwierigkeit des Terminus Stress ist die unterschiedliche Möglichkeit der Interpretation. Das Wort Stress wird häufig als Synonym für Belastung, Krankheit und dem Burnout Syndrom verwendet. Es ist ein universeller Begriff, der in der Alltagssprache unspezifisch verwendet wird und eine Vielzahl von körperlichen und seelischen Zuständen in einem Wort zusammenfasst. In der konkreten Situation sollte also hinterfragt werden, was genau als Stress angesehen und bewertet wird.
In der Literatur (u. a. Krampl, (2007); Nitsch (1981); Sapolsky (1998)) werden neben den unterschiedlichen Stressoren („Psychisch, Physisch und Soziale Stressoren“) vier Kategorien von Stress unterschieden. Die erste Kategorie beinhaltet den „normalen“ Alltagsstress, der alle üblichen Belastungen (Arbeit, Freizeit, Verkehr etc.) zusammenfasst. Die zweite Kategorie ist der kumulative Stress. Hierunter werden zusammen auftretende Stressoren aus dem Alltagsstress als erhöhte Belastung bewertet. Eine weitere, die dritte Kategorie, ist der chronische bzw. Dauerstress. Hierbei kommt es zu starken Belastungen über einen andauernden Zeitraum. Als vierte und gravierendste Stresskategorie wird der Terminus „Traumatischer Stress“ verwendet. Als traumatische Stresssituationen werden die Belastungen definiert, die das Grundvertrauen bzw. eigene Grundannahmen erschüttern oder bedrohen können. Zu dieser Stresskategorie werden grundsätzlich u. a. massive Angriffe, Schusswaffengebräuche und Katastrophen gezählt, die jedoch nicht immer eine traumatische Belastung zur Folge haben müssen. Hier können Bewältigungsstrategien, Einstellungen, Erfahrungen und auch entsprechende Trainings traumatische Folgen verhindern.
Allgemein beschreibt der Begriff Stress eine körperliche und psychische Reaktion auf einen Umweltreiz.5 Stress erfordert also die Reaktion eines Organismus (Mensch) auf einen Stimulus (Reiz). Die Einflüsse auf eine Person können so groß sein, dass die Fähigkeit zur Resilienz stark beansprucht wird oder der Einfluss die Grenze der Belastbarkeit/Widerstandsfähigkeit übersteigt. Wird die Grenze überschritten, kann der erlebte Stress negative gesundheitliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Nichts desto trotz ist Stress und eine Stressreaktion die Grundvoraussetzung, damit sich ein Körper und die Psyche an veränderte Gegebenheiten anpassen und reagieren kann. Die Ambivalenz zwischen positiven und negativen Eigenschaften, die dem Begriff Stress zugeordnet werden, beschrieb der Forscher Hans Selye mit den Begriffen Eustress und Distress (auch: Dystress).
Eustress und Disstress (Dystress)
Eustress (Lateinisch Eu = gut) gilt dabei als positive Form des erlebten Stresses. Bei einer Herausforderung wird dabei mit den üblichen „Stresshormonen“ ein Erregungszustand im Körper aufgebaut, der für die Bewältigung einer individuellen Aufgabe erforderlich ist. Diese Form des Stresses wird als Motivator und grundsätzlich leistungsstimulierend angesehen. Die Folge ist, dass bei der Bewältigung der Aufgabe, zu den üblichen Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin, auch Glückshormone (Endorphine) ausgeschüttet werden.
Man bezeichnet den Einfluss oder Reiz dann als Disstress (aus dem lateinischen „Dis“ = Schlecht; im englischsprachigem Raum: Distress), oder auch Dystress (aus dem griechischen „Dys“ = Schlecht), wenn er als negativ und belastend wahrgenommen wird. Die Häufigkeit und die Dauer des erlebten Reizes ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung des Stressniveaus. Je häufiger und länger ein Reizzustand anhält, umso eher bestehen die Gefahr einer Belastung und die Wahrnehmung als negativen Stress. Um mit dem Phänomen Stress im Einsatzfall besser umgehen zu können, ist es notwendig, Einzelheiten über theoretische Grundlagen bzw. Modelle zu kennen. Nachfolgend stelle ich die für die polizeiliche Einsatztätigkeit bedeutendsten Stressmodelle dar. Zum einen ist es das Allgemeine Adaptionssyndrom von Selye. Zum anderen sind es das „Fight or Flight“ Modell von Walter B. Cannon und das „Transaktionale Stressmodell“ von Richard S. Lazarus.
Stressmodelle
Die folgend dargestellten Stressmodelle können entweder der Physiologie oder Psychologie zugeordnet werden. Während Cannon und Selye ihre Modelle anhand der physiologischen Veränderungen erläutern, orientieren sich die Modelle von Holmes & Rahe und Lazarus an der Psychologie. Je nach Zielsetzung können die unterschiedlichen Modelle für allgemeine Erklärungen zum Thema Stress genutzt werden.
Das Allgemeine Adaptionssyndrom (General Adaptation Syndrom, GAS)
Einer der ersten Forscher, der sich mit den Auswirkungen von andauerndem Stress beschäftigt hat, war der kanadische Endokrinologe6 Hans Selye (*1907 in Wien, +1982 in Montreal). Er definierte 1936 den Begriff Stress und begründete die Lehre vom Allgemeinen Adaptionssyndrom, auch Generalisiertes Adaptionssyndrom genannt. (Schwarzer, 1993, S.12 ff.)
Obwohl eine Begriffsbestimmung des Phänomens Stress bis heute schwierig erscheint, hat Selye den Begriff aus seiner Sicht frühzeitig definiert.
Definition Stress nach Selye:
„Stress kann als die unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art von Anforderung verstanden werden“.
(Selye, 1956, 1981)
Abbildung 2
Hans Selye beschrieb und untersuchte die körperlichen Auswirkungen von Stress. Insbesondere ging er auf die grundsätzlich hormonellen Reaktionen des Körpers auf akute und chronische Belastungen ein, wobei er sich auf die stark belastenden bzw. chronischen Stressoren spezialisierte. Das Individuum mit seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten wird in Selyes Theorie nicht mit in die Bewertung einbezogen. Er beschränkt sich in seinen Ausführungen rein auf die hormonellen Reaktionen des Körpers. Die kognitive transaktionale Stresstheorie von Lazarus geht über die Beschreibung von rein körperlichen Vorgängen hinaus und findet einen eher ganzheitlichen Ansatz.
Das Allgemeine Adaptionssyndrom nach Selye ist wie in Abbildung 2 in drei Phasen eingeteilt:
1. Alarmphase
2. Widerstandsphase
3. Erschöpfungsstadium
In den einzelnen Stufen kommt es zu jeweils aufeinander bezogenen Reaktionen, die in Abbildung 3 zusammengefasst dargestellt sind.
Stress
Stress kann nach Selye (1981) „als die unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art von Anforderung verstanden werden.“
Im Allgemeinen Adaptionssyndrom findet die körperliche Reaktion immer in drei Phasen statt:
1. Alarmphase
2. Widerstandsphase
3. Erschöpfungsstadium
Abbildung 3
In der Abbildung 4 ist übersichtlich verdeutlicht, welche körperlichen Reaktionen im Allgemeinen bei Stress auftreten können. Kommt es zu einer Alarmreaktion, wird durch den Hypothalamus und das limbische System die Hormonausschüttung angeregt. Der Körper reagiert daraufhin mit der Ausschüttung der sogenannten Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Im Anschluss daran ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Durch die Leber wird Blutzucker kurzfristig zur Verfügung gestellt. Der Blutdruck und die Herz-Frequenz werden gesteigert und die Bronchien erweitern sich. Der Verdauungstrakt verringert seine Tätigkeit und die Augen werden auf eine erhöhte Weitsicht eingestellt. Der Körper befindet sich in höchster Alarmbereitschaft, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. In einer Stresssituation kann die Ausschüttung von Adrenalin den 10-fachen Wert der normalen Ruheausschüttung übersteigen. Bei chronischem Stress ist durch den andauernden Erregungszustand die Gefahr erhöht, gesundheitliche Schädigungen zu erleiden, da keine Erholungsphasen zwischen dem auftretenden Stress liegen (Siehe Abbildung 3, Stufe III.).
Walter B. Cannon (Fight or Flight) (*1871- +1945)
Der Physiologe Walter B. Cannon (USA) beobachtete die Reaktionen von Menschen und Tieren bei Bedrohung. Er veröffentlichte 1915 seine Abhandlung zu den Notfallreaktionen von Menschen und Tieren, ohne jedoch den Begriff Stress explizit zu erwähnen. In seiner Abhandlung beschrieb er die Vorgänge im Körper beim Auftreten von Bedrohungen (Stress). In Notfällen ist der Mensch anhand seiner körperlichen Reaktionen in der Lage, entweder der Bedrohung aktiv entgegen zu treten (anzugreifen), oder sich zurückzuziehen (fliehen).
Walter B. Cannon: Fight or Flight So beschrieb Cannon die Abfolge von Ereignissen im Körper, die den Menschen oder das Tier in der Folge befähigt, entweder anzugreifen (verteidigen) oder zu flüchten (in Sicherheit bringen).
Abbildung 4
Die kognitiv-transaktionale Stresstheorie nach dem amerikanischem Psychologen Richard S. Lazarus (*1922 - †2002)
Die kognitiv-transaktionale Stresstheorie kann für die Beschreibung und Erklärung von belastenden Einsatzlagen der Polizei als wichtigste Theorie bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den Theorien von Selye oder Cannon wird ein eher ganzheitlicher Ansatz für die Erklärung von Stress gebraucht.
Das „Transaktionale Stressmodell“
Der Begriff der Transaktion beschränkt sich nicht auf den Reiz, der auf eine Person trifft. Transaktion spiegelt „…die Verbindung zwischen einer sich verändernden Situation und einer denkenden, fühlenden und handelnden Person…“ wieder. (Schwarzer, 1993, S.14)
Es findet nach dieser Theorie grundsätzlich eine individuelle Bewertung des Umweltreizes als positive oder negative Anforderung (Reiz, Stress) statt. Was für den einen negativer Stress und damit eine massive Belastung darstellt, hat für den anderen eventuell noch keine Bedeutung in psychologischer Hinsicht erlangt. Die individuelle Bewertung ist also entscheidend für das Ergebnis, ob ein Reiz, der auf eine Person einwirkt, auch als negativer Stress wahrgenommen wird oder nicht. Es findet somit immer eine Interaktion zwischen Individuum und der aufgetretenen Situation statt. Der Stress ist demnach subjektiv und individuell und die Bewertung dieser Wahrnehmung kann somit auch bewusst verändert und beeinflusst werden.
Lazarus hat die kognitive Bewertung der Anforderungen (Reize, Einsatzsituationen) in zwei Phasen unterschieden.
Für die erste Einschätzung zur Ernsthaftigkeit einer Anforderung verwendet er den Begriff primary appraisal (primäre Bewertung). Die Phase beginnt seiner Ansicht nach mit folgenden Fragestellungen: Was passiert gerade? Ist es gut, schädlich oder unwichtig für mich? Führt die Beantwortung der Frage zu der Einschätzung, dass die Anforderung schädlich sein kann, werden die potentiellen Auswirkungen des Stressors bewertet.7
Wird daraufhin eine Handlung als erforderlich angesehen, werden in der secondary appraisal (sekundären Bewertung) persönliche und soziale Ressourcen inklusive der eigenen Handlungsmöglichkeiten für die Bewältigung des Stressors mit einbezogen. Mit den individuellen Möglichkeiten wird dann versucht, die Situation zu bewältigen. Während der gesamten Einsatzphase kommt es zu einer immer fortwährenden Neubewertung der Situation, die sich durch notwendige Änderungen des Verhaltens und der Strategie bei der Bewältigung des Stressors zeigt. (Zimbardo, 1999, S. 376 ff.)
Lazarus & Launier (1981) differenzieren des Weiteren zwischen der psychischen Bedrohung und der Herausforderung. Ebenso entwickelten Lazarus & Folkmann (1987) die Möglichkeit, dass eine Situation auch als Nutzen, Vorteil oder Gewinn bewertet werden kann. Aufgrund der vorher beschriebenen kognitiven Bewertungsprozesse wird eine Situation oder ein Ereignis entweder als irrelevant, günstig bzw. positiv oder als stressend aufgefasst und eingestuft. Hierbei spielen die individuellen Möglichkeiten, vorhandene Strategien zur Stressbewältigung sowie Einstellungen und Überzeugungen der Person eine zentrale Rolle.
„Aus psychologischer Sicht setzt Stress die Feststellung voraus, dass die Transaktion ein Risiko (Bedrohung), Schädigung/Verlust oder eine Gelegenheit beinhaltet, die Probleme zu überwinden und sich weiter zu entwickeln (Herausforderung), indem mehr als die normalen Fähigkeiten aktiviert werden. Wenn eine Anforderung die Fähigkeiten übersteigt, fühlt sich das Individuum sozusagen überwältigt (Trauma) und besiegt. Der Schweregrad hängt dabei davon ab, was auf dem Spiel stand (Wertungsdisposition). Die Folge könnten Erschöpfung, Zusammenbruch, Regression oder Dekompensation sein (um einige der Begriffe der klinischen Psychologie zu gebrauchen).“
(Lazarus/Launier, 1981, S. 226)
Akuter und chronischer Stress
Die allgemeine Stressforschung unterscheidet nicht nur in positiven oder negativen Stress, sondern auch zwischen akutem und chronischem Stress. Die Dauer des erlebten Umweltreizes (Stressors) hat eine grundlegende Bedeutung für die individuelle Wahrnehmung und Bewertung.
Die kognitive Bewertung einer Stresssituation ist für die Deutung und späteren Bewältigung einer Einsatzsituation von zentraler Bedeutung. Kommt es zu einer falschen Deutung, kann das gerade bei Polizeibeamten im Einsatz zu fatalen Folgen führen.
Stress (Akut)
Der akute Stress ist grundsätzlich ein vorübergehender physischer und psychischer Erregungszustand. Die körperliche Anpassung an einen Reiz ist normal und eine der wichtigsten Bedingungen, um sich veränderten Situationen optimal anpassen zu können. Abbildung 6 verdeutlicht die auftretenden Stressphasen.
Akuter Stress:
Der Erregungszustand steigt stark an und kann nach der Bewältigung (Angriff oder Flucht) und eine Erholungsphase wieder seinen Ruhezustand erreichen.
Abbildung 5
Abbildung 6
Beispielsachverhalt
Phase 1 (Vorphase): Zwei Polizeibeamte werden zu einer Ruhestörung gerufen. Beide Beamte haben bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Erkenntnisse, außer dass es sich um eine polizeiliche Standardlage handelt, die routiniert abgearbeitet werden soll.
Phase 2 (Alarmphase): Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses kommt ihnen eine männliche Person entgegen und greift die beiden Beamten plötzlich mit einem Messer an.8 Beide Polizeibeamten versuchen sich möglichst schnell aus der Gefahrenzone zu begeben und setzen das Einsatzmittel Pfefferspray ein. Durch die einsetzende Wirkung können die beiden Polizeibeamten den Mann nun überwältigen und entwaffnen.
Phase 3 (Widerstandsphase): Die Person wird aufgrund der weiteren Sachverhaltsaufnahme zur Wache verbracht. Die Situation ist beruhigt und die Beamten können eine Pause machen. Sie sprechen über den Einsatz (Nachbereitung) mit ihren Kollegen und gehen nach der Nachtschicht nach Hause.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass der akute Stress einen klaren Anfang und ein absehbares Ende enthält. Im Gegensatz dazu ist der chronische Stress zu sehen.
Chronischer Stress
Problematisch wird es bei einer weiteren Häufung von Stressoren. Häufen sich im Verlauf mehrerer Dienste weitere belastende Einsätze, in denen beispielsweise Gewalt eingesetzt bzw. selbst erfahren wird, kann es zu einer Dauerbelastung kommen. Die inneren und äußeren Ressourcen zur Stressbewältigung werden durch die Betroffenen grundsätzlich niedriger wahrgenommen, als der chronische Erregungszustand. Der Stresslevel kann nicht mehr abgebaut werden und führt im schlimmsten Fall zur Aufhebung der Erholungsphase (Abb. 7). Dieser andauernde Erregungszustand wird von den Betroffenen als äußerst belastend empfunden. Wiederholen sich Einsätze und Schichtabläufe dieser Art und treten zusätzlich außerberufliche Belastungen auf, kann chronischer Stress die Folge sein, der auch gesundheitliche Folgen für die Beamten hat. Der Körper ist aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit nicht mehr in der Lage, auf akut belastende Einsatzlagen entsprechend zu reagieren. Erhöhte Fehlerqouten sind die Folge und führen im schlimmsten Fall zu schwerwiegenden Einsatzentscheidungen für sich selbst und andere.
Chronischer Stress: Durch anhaltenden Stress wird die Erholungsphase aufgehoben und die Stresskurve liegt dauerhaft über der Normalgrenze. Gesundheitliche negative Folgen wie Belastungsstörungen, erhöhte Fehlerqouten im Einsatz und das Burnout Syndrom etc. können entstehen.
Abbildung 7
Traumatischer Stress
Die Stressbelastung, die als tatsächliches, extrem stressreiches äußeres Ereignis definiert wird, kann zu einem Trauma werden, wenn es als „äußerste Bedrohung“ (Huber, 2003, S. 39) gewertet wird. Diese sogenannte Annihilationsdrohung (annihilate, engl.: vernichten, zerstören, ausrotten) führt zu körperlichen Reaktionen, die die erlebende Person kaum mehr bewusst beeinflussen kann. Im schlimmsten Fall kommt es bei den Polizeibeamten zu dem Eindruck, dass „nichts mehr geht und alles aus“ sei. Der Terminus „Traumatischer Stress“ kann in der Polizeiarbeit zum besseren Verständnis auch mit dem Begriff Hochstress definiert werden. Traumatische Erlebnisse können zu akuten Stressbelastungen, Posttraumatischen Störungen und in der Konsequenz auch zum Posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS, postraumatic stress disorder) führen.
Die Themenbereiche, psychische Verletzungen und traumatischer Stress, werden in einem anderen Beitrag des Fachbuches behandelt. Neben psychischen Verletzungen kann der Einfluss von Stress jedoch weitere Folgen für den Polizeibeamten haben. Unterscheiden kann man hier Folgen für die Gesundheit und Leistungsfolgen.
Folgen von Stress
Gesundheitliche Folgen
Indirekt schädliche Folgen
Durch Stress, insbesondere Dauerstress, können direkte gesundheitsschädliche Folgen auftreten. Mit indirekten Folgen kann das Verhalten beschrieben werden, um sich beispielsweise nach einem stressreichen Tag zu entspannen. Übermäßiges Essen, Alkoholkonsum, Tee/-Kaffeekonsum und der Griff zur Zigarette werden in der Literatur als Hauptgründe aufgeführt, die zu indirekten schädlichen Folgen führen können. Der Griff zur Zigarette ist beispielsweise rein subjektiv beruhigend, da Nikotin nachweislich eine anregende Wirkung hat. Koffein und Tein haben eine ähnliche Wirkung und führen zu Stresssymptomen (Schwitzen, innere Unruhe, Zitternde Hände). (Litzke, 2005, S. 45 ff.)
Direkt schädliche Folgen
In einer akuten Stressreaktion kommt es zu einer Erhöhung der Pulsfrequenz und der Blutdruck steigt an. Ist es möglich, dass der Stressphase eine Erholungsphase folgt, kann sich der Blutdruck wieder normalisieren. Bei chronisch auftretendem Stress kann der Körper nicht mehr entspannen. In der Folge erreicht der Blutdruck ein ständig erhöhtes Niveau. Dieser chronische Erregungszustand wird in der Folge zur Hypertonie (Bluthochdruck). Die Hypertonie verursacht in der Folge eine Arteriosklerose (Gefäßverkalkung), die zu einer verschlechterten Durchblutung der Organe führt. Chronischer Stress, Bluthochdruck und die damit einhergehende Gefäßverkalkung steigern das Risiko, in der Folge einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden.
Chronischer Stress kann auch akute Ängste auslösen, die zu Panikattacken führen können. Die Betroffenen haben beispielsweise rein subjektiv das Gefühl, einen Herzinfarkt oder Herzstillstand zu erleiden, obwohl keine medizinische Indikation vorliegt (funktionelle Herzbeschwerden).
Durch die dauernde chronische Stressbelastung kann der Krankheitsverlauf einer Asthma-Erkrankung negativ beeinflusst werden. Die Häufigkeit und Schwere der Anfälle ist dabei von zentraler Bedeutung für die betroffenen Personen. Im Allgemeinen führt andauernder Stress zu einer Störung der Immunkompetenz, während dem akuten Stress eine immunstimulierende Wirkung zugeschrieben wird. Dies kann sich bei den Betroffenen in Krankheitsverläufen von Infektionen zeigen. Erkrankungen haben einen schwereren Verlauf und die Heilung dauert länger. In diesem Zusammenhang wird auch die Meinung vertreten, dass ein geschwächter Körper auch anfälliger für Krebserkrankungen ist. (Litzke, 2005, S. 48 ff.)
Stressbelastungen haben ebenfalls Einfluss auf die Schwere von Allergien und anderen Hautkrankheiten. In der Naturheilkunde wird die Haut als Spiegelbild der Seele bezeichnet. Weitere Folgen von Stress sind chronische Kopfschmerzen, zentralnervöse Störungen (Schlafstörungen, innere Unruhe u. a.) und das Auftreten des sogenannten Burnout Syndroms. Im weiteren Verlauf können affektive Störungen, wie Depressionen, ausgelöst werden.
Burnout Syndrom
Dem Burnout Syndrom kommt in der heutigen Polizeiarbeit eine immer größere Bedeutung zu. Dabei handelt es sich um ein Erschöpfungssyndrom durch chronisch erlebten Stress. Mit einer Rückschau auf die Eingangsbemerkungen zu möglichen Stressoren, die nicht nur im beruflichen sondern auch im privaten Bereich zu finden sind, sei hier anzumerken, dass meist ein Faktorenbündel von Stressoren die Person stark überfordert. Diese Vielzahl von einwirkenden Stressoren kann durch die Personen in einem langwierigen Prozess nicht mehr bewältigt werden. Es entsteht ein Gefühl der Leere und die persönliche Motivation geht verloren. Am Ende dieses Prozesses erkranken Menschen dann am Burnout Syndrom. (Latscha, 2005)
Leistungsfolgen durch Stressbelastungen
Leistungsfolgen sind Reaktionen des Körpers auf Stressbelastungen. Diese können für Polizeibeamte in Stressbelastungen (Beispielhaft: Schlägereien, Festnahmen, die Verfolgung eines Täters nach einer strafbaren Handlung, Personenkontrolle, Fahrzeugkontrolle, Haus- und Familienstreitigkeiten, Ruhestörungen, Häusliche Gewalt) massive negative Folgen haben. Leistungsfolgen sind für das polizeiliche Vorgehen von hoher Bedeutung. Mit individuellen Bewältigungsstrategien und der Nutzung des SOR-Modells (Stress-Organismus-Reaktion) ist es möglich, eigene Reaktionen besser einzuschätzen. Negative Leistungsfolgen werden dadurch grundsätzlich gemindert und im besten Fall verhindert. Leistungsfolgen können in fünf Reaktionsebenen eingeteilt werden, wie sie auch im SOR-Modell dargestellt sind. Im Einzelnen handelt es sich um die kognitive, die emotionale, die vegetative, die muskuläre und die Verhaltensebene.
Leistungsfolgen sind Reaktionen des Körpers auf Stressbelastungen. Sie können Polizeibeamte in Einsatzlagen einschränken und zur Handlungsunfähigkeit führen.
Unter der kognitiven Ebene werden alle Wahrnehmungs- und Denkprozesse zusammengefasst. Die Verhaltensebene (Behaviorale Ebene) beschreibt die konkrete Reaktion auf das Gegenüber. Unterschieden wird dabei zwischen der Kontrolle des Stressors durch aktive Reaktion, dem Tolerieren oder der Resignation. (Litzke, 2005, S. 29) Bei der weiteren Beschreibung der Leistungsfolgen werden nun die negativen Folgen für Einsatzkräfte beschrieben. Kurzfristige und langfristige Bewältigungsstrategien werden anschließend dargestellt.
Kognitive Ebene
Belastende Polizeieinsätze können zu Denkblockaden und Denkstörungen führen, durch die in der Folge die Konzentrationsfähigkeit und die Beobachtungsgabe herabsetzt wird. Als weitere negative Folge ist es möglich, dass Versagensängste ausgelöst werden. Eine mangelnde Beobachtungsgabe und Konzentrationsfähigkeit führt zu Fehlern in der Eigensicherung, die möglicherweise zu schweren Folgen für sich und andere am Einsatz beteiligte Personen führen. Bei schweren Verkehrsunfällen beispielsweise kann das Szenario so unwirklich erscheinen, dass Polizeibeamte aufgrund der Konzentrations- und Denkstörungen den üblichen Straßenverkehr nicht mehr beachten und auf die Straße laufen. Ein weiteres Beispiel ist die Sachverhaltsaufnahme bei einer Großveranstaltung. Die Anwesenheit der Polizei führt zu Gruppenbildungen beim polizeilichen Gegenüber. Das Vorgehen der Polizei wird kritisch betrachtet und kann zu Solidarisierungseffekten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten führen. Die Konzentrations- und Denkstörungen können dazu führen, dass Angriffe aus der Personengruppe zu spät erkannt werden. Weiterhin ist es wahrscheinlich, dass langfristige Denkprozesse nachlassen und die Fehlerhäufigkeit steigt. Dies führt beispielsweise bei komplexen Ereignissen zu Fehlern in der Sachverhalts- bzw. Tatortaufnahme, die im Nachhinein schwierig bis gar nicht aufzuarbeiten sind. Ein eingeschränkter Merkprozess bei hohen Stressbelastungen ist ebenfalls zu beobachten. Das Kurz- und Langzeitgedächtnis lässt nach. Wichtige Lageinformationen können dabei eventuell verloren gehen. (Siehe die Ausführungen zu Stress im Einsatzgeschehen und mögliche Konsequenzen)
Emotionale Ebene
In dieser Ebene werden Leistungsfolgen beschrieben, die Gefühle und das eigene Empfinden beinhalten. Die Folgen von Stress können Gefühlsausbrüche sein, die mit einem erhöhten Aggressionspotential einher gehen. Dies könnte zu Überreaktionen durch Polizeibeamte führen, die sich im Einsatz befinden. Überreaktionen führen zu unrechtmäßigen Maßnahmen mit dem Ergebnis, dass der Polizeibeamte selbst Gegenstand polizeilicher Ermittlungen wird. Eine weitere Folge von Stress ist die Abnahme des Selbstwertgefühls und der Zufriedenheit. Außerdem kann ein Gefühl der Ohnmacht entstehen und der betroffene Einsatzbeamte fühlt sich den Situationen nicht mehr gewachsen.
Vegetativ-hormonelle Ebene
Direkte Folgen in der vegetativ-hormonellen Ebene sind nicht steuerbare Reaktionen des Körpers auf veränderte Umgebungen oder Ereignissen. Dazu zählt das Austrocknen der Mundschleimhaut, Herzklopfen, die stockende Stimme und das Erröten in Stresssituationen. Der trockene Mund oder das Herzklopfen ist für das polizeiliche Gegenüber nicht deutlich erkennbar. Unsicherheit und Stress zeigen sich jedoch mit der „belegten“ Stimme und einer geröteten Gesichtshaut. Dies kann beim Gegenüber das Gefühl der Überlegenheit auslösen und im schlechtesten Fall zu Widerstandshandlungen beziehungsweise Angriffen gegen die eingesetzten Polizeibeamten führen. Vegetativ-hormonelle Veränderungen sind nicht willentlich steuerbar, da der Körper sich immer wieder an neue Veränderungen der Umgehung anpasst. Zu weiteren vegetativen Reaktionen verweise ich auf die Ausführungen in der Abbildung 4, in der die Reaktionen im Körper schematisch dargestellt werden.
Muskuläre Ebene
Bei Stressbelastungen besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche muskuläre Folgen entstehen. Massive Stressoren führen häufig zu unkontrolliertem, deutlich sichtbaren Zittern. Der Körper reagiert mit Anspannung der gesamten Skelettmuskulatur und ist auf Aktion eingestellt. Durch einen länger andauernden Stressreiz ermüdet der Körper schneller. Dies ist insbesondere bei längerfristigen Einsätzen zu beachten. Die Koordination lässt ebenfalls nach und einfache Handgriffe können schwierig werden. Problematisch wird dies bei Einsatzlagen, in denen Einsatzmittel eingesetzt werden müssen. Bei Dunkelheit wird dieser Umstand noch verstärkt, da zusätzlich zu normalen Einsatzmitteln auch die Handhabung der Taschenlampe koordinativ bewältigt werden muss. Unter die muskuläre Ebene wird auch Stottern und eine starre Mimik gefasst.
Verhaltensebene
Bei den Reaktionen in Stresssituationen wird zwischen aktiven und defensiven Verhalten differenziert. Bei aktiven Verhalten in Stresssituationen besteht die Möglichkeit, dass die Gemütsverfassung in Aggressivität und Gereiztheit umschlägt. Das Verhalten zeigt sich nicht nur gegenüber den von der polizeilichen Maßnahme Betroffenen sondern auch im Kollegen- und Familienkreis. Jede Kleinigkeit führt zu Gereiztheit und negativen Reaktionen. Werden die Probleme größer, entsteht ein Teufelskreis. Das Familien- und Berufsleben leidet aufgrund des erlebten Stresses und entwickelt sich eventuell zu einem ernsten Problem im zwischenmenschlichen Bereich. Entgegengesetzt führt passives Verhalten in Bezug auf Stressreize langfristig zu Hilflosigkeit und Selbstzweifel bis zum Realitätsverlust. Das Gefühl von grenzenloser Traurigkeit kann sich einstellen bis zur Entwicklung einer psychischen Störung (Depression). Mit zunehmendem Stresseinfluss vermindert sich das Sprachvermögen. Persönlich Ziele werden aufgegeben und am Arbeitsplatz nehmen Abwesenheitszeiten zu. Weiterhin sind Schlafstörungen die Folge und anstehende Probleme werden nur noch oberflächlich gelöst. Freilich müssen Stressreaktionen nicht zu diesem einschneidenden Ergebnis führen. Im Einsatzgeschehen sind negative Stressreaktionen jedoch kontraproduktiv und sollten vermieden werden.
Stress im Einsatzgeschehen und mögliche Konsequenzen
Problematisch in Einsatzsituationen ist die Kumulation unterschiedlichster Eindrücke (Heubrock, 2001). Die Wahrnehmungen leiden unter den Einwirkungen des Stressors und können nicht mehr verarbeitet werden wie im Normalzustand. Gehen wir auf das Eingangsbeispiel des Kollegen zurück. Die Informationen zum Sachverhalt waren nach seinen Aussagen sehr dürftig. Nun erweitern wir den Informationsgehalt um einen Faktor. Nehmen wir an, es wäre im Vorfeld klar gewesen, dass der Bruder des späteren Täters sich in das Café geflüchtet und der Vater versucht hat, auf den draußen stehenden jüngeren Bruder beruhigend einzuwirken. Die Wahrnehmung einer eventuellen Gefahr wäre vermutlich anders gewesen. Im Ursprungssachverhalt hat der Informationsmangel zu einer (verständlichen) Fehleinschätzung des Polizeibeamten mit einem lebensbedrohlichen Ausmaß geführt.
Ungerer & Ungerer (2008, S. 39 ff.) haben die „Stressentstehung im Augenblick des Divergierens von Lageinformation und Informationskapazität …“ beschrieben. Eine polizeiliche Lage- oder Einsatzbewältigung beginnt mit den Informationen zum Sachverhalt, die der Streifenbesatzung über die Dienststelle mitgeteilt werden. Erst durch diese Informationen und deren Verarbeitung sind Polizeibeamte in der Lage, sich emotional auf den Einsatz bei der Anfahrt vorzubereiten und gegebenenfalls untereinander abzusprechen. Erhalten die Einsatzkräfte in der Einsatzvorphase (Anfahrt) zu viele Informationen, entsteht durch den Informationsüberschuss eine Bedrohung (Hyperstress). Informationen können durch den Stress nur noch begrenzt verarbeitet werden. Die Einsatzbewertung ist aufgrund der fehlenden Inhalte nur noch bedingt möglich. Dies führt im weiteren Einsatzverlauf eventuell zu situativ falschen Entscheidungen, durch die eine Überforderung entsteht.
Im Gegensatz zum Informationsüberschuss führen Informationsdefizite ebenfalls zur Auslösung von Stress. Das Informationsdefizit kann Unsicherheiten verursachen, die sich auch im Einsatzverlauf als Stressbelastung manifestieren. Merkenswert ist also, dass die Differenz zwischen Information und Informationsverarbeitung den Stress im Einsatz fördert (Hypostress).
Konsequenzen
Führt die Informationsflut und die Einsatzentwicklung zu einer Überlastung, sollte eine personelle Unterstützung angefordert werden, um diesem Stressreiz effektiv begegnen zu können. Dies ist auf den ländlicher gelegenen Dienststellen mit geringer Schichtstärke leider nicht immer sofort möglich, so dass an einsatztaktische Maßnahmen gedacht werden sollte. Eventuell ist ein „taktischer Rückzug“ als sinnvoll in die Lagebewertung einzubeziehen, um den Einsatz mit Verstärkung anschließend optimal lösen zu können. Idealerweise stellt sich eine optimale Konstellation zwischen den individuellen Fähigkeiten einer Person und den unterschiedlichen Einsatzbelastungen, die bearbeitet werden müssen, ein. Führt eine Einsatzsituation zu einem Kontakt mit einem unbekannten flüchtenden Täter, entsteht durch die Stressbelastung häufig ein „Jagdtrieb“. Durch die hormonellen Reaktionen ist der Körper auf Aktion eingestellt. Ein weiter Faktor ist der Erfolgsdruck, also die Festnahme eines Täters, der sich automatisch einstellt. Dieser „Erfolgsgedanke“ führt im Einsatzverlauf zu einer erhöhten Risikobereitschaft bei der Verfolgung von Personen oder Fahrzeugen.
Der sogenannte „Jagdtrieb“ sollte in Lagen mit extrem wenigen Informationen vermieden werden. Gerade die direkte Verfolgung von potentiellen Tätern ohne Zusatzinformationen birgt massive Gefahren für die eingesetzten Polizeibeamten. (Pokojewski, B., 2009, S. 21 ff.)9
Beispiel
Auf einem Volksfest kommt es zu Streitigkeiten zwischen Polizeibeamten und einer Gruppe junger Männer. Einer der Männer zieht ein Klappmesser und verletzt einen Polizeibeamten mit diesem durch Glück nur leicht am Hals. Bei der anschließenden Flucht wird der Täter durch einen anderen Polizeibeamten verfolgt. Hinter einer Haus wand tritt eine weitere Person (Mittäter) plötzlich hervor und schlägt dem verfolgenden Polizeibeamten eine volle Bierflasche unvermittelt in das Gesicht. Der Polizeibeamte erlitt tiefe Schnittwunden im Gesicht.
Doch was kann Polizeibeamten bei Stress wirklich helfen und welche kurzfristigen Maßnahmen im Einsatz sind möglich, wenn die optimale Lösung aufgrund personeller Schwierigkeiten oder akuter Lageentwicklung nicht möglich ist?
Verhaltensempfehlungen bei akutem Stress im Einsatz
In Einsatzfällen mit akuten Stressbelastungen ist das Wissen um die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten ein großer persönlicher Vorteil. Die Möglichkeiten der Stressbewältigung mit dem SOR-Modell (Stressoren-Organismus-Reaktionen) werden in Abbildung 8 übersichtlich dargestellt.
Tritt ein Stressor auf, wird dieser aufgrund der vorhandenen Einstellungen, Erfahrungen, Veranlagungen, der persönlichen Verfassung und der individuellen Fähigkeiten eingeschätzt. Je nach Bewertungsergebnis kommt es dann zu unterschiedlichen Reaktionen.
Grundsätzliche Fragen, die sich in Stresssituationen und deren Analyse bewährt haben:
• Welche Ereignisse zählen zu den persönlichen Stressoren?
• Was sind typische Reaktionen in der Belastungssituation?
• Welche Bewältigungsstrategien sind persönlich verfügbar? (ebda., S.10 ff.)
Abbildung 7
Durch diese Fragestellungen ist es möglich, eine akute Einsatzlage und den auftretenden Stress individuell bestimmen zu können. Werden die eigenen Fähigkeiten als ausreichend angesehen, kann der Stressor beseitigt werden. Polizeiliche Einsatzlagen lassen diese Möglichkeit aufgrund der zu treffenden Maßnahmen jedoch nicht immer zu, so dass andere Ansätze gewählt werden müssen. Ein weiterer Ansatz, möglichen Stressoren zu begegnen, besteht in der Veränderung der Stresseinschätzung. Mit einer veränderten Stresseinschätzung ändert sich auch die Wahrnehmung. Die Ereignisse werden durch die veränderte Einschätzung besser verarbeitet und die Handlungskompetenz bleibt erhalten. Die eigenen Stressreaktionen sind durch eine gefestigte Handlungskompetenz kontrollier- und lösbar.
Kurzfristige Stressentlastung bzw. Spontanentspannung
Polizeibeamten ist es in akuten und belastenden Einsatzlagen grundsätzlich nicht möglich, eine Pause einzulegen. Eine Flucht vor dem Stress auslösenden Reiz ist für Polizeibeamte dadurch nicht ohne weiteres möglich. Kurzfristige Erleichterungen führen dazu, dass auftretende Stressreaktionen gemildert und Stressspitzen reduziert werden. (ebda., S. 51) Die Handlungsfähigkeit bleibt erhalten und es entstehen kurze Erholungszeiten, mit denen das Hochschaukeln von Stressempfindungen vermieden wird. (Litzke, 2005, S. 51)
Abreaktion und Progressive Muskelentspannung
Durch Abreaktion können kurzfristig Stresshormone abgebaut werden. Abreaktion ist häufig verbunden mit Wutausbrüchen, die im Einsatzgeschehen kontraproduktive Ergebnisse erzielen. Eine körperliche Betätigung führt in positiver Hinsicht zu einer kurzfristigen Reduzierung der Stresshormone. In der Einsatzsituation ist es also sinnvoll, die Hände in kurzen Abständen anzuspannen, zu lösen und in der Folge wieder anzuspannen. Hilfreich ist auch eine kurzfristige innere Anspannung des ganzen Körpers, da die Möglichkeit entsteht, dass der innere Druck so kanalisiert wird. Diese Technik wird auch der Abreaktion zugeordnet. Die Technik Anspannung/Entspannung usw. hat ihren Ursprung in der progressiven Muskelentspannung und ist eine alternative Entspannungstechnik, die auch außerhalb des Dienstes zu Hause durchgeführt werden kann. Sie muss jedoch erlernt werden, um in konkreten Situationen spontan bewusst entspannen zu können. Die progressive Muskelentspannung hat einen kurzfristigen Effekt, da durch die Anspannungsphasen Stressspitzen abgebaut werden können.
Atemtechnik
Des Weiteren sollen Einsatzkräfte sich auf ihre Atmung konzentrieren: Vor oder im Einsatz wird die Atmung durch den erlebten Stress schnell und flach. Der Organismus arbeitet unökonomisch, da weniger Sauerstoff durch die Lungen in die Blutbahn abgegeben werden kann. Eine falsche Atmung kann im Stress zu Atemnot (Hyperventilation) führen. Die Stimme wird durch die fehlende Kraft automatisch leiser. Somit leidet eventuell ein sehr wichtiger Punkt im Einsatz, die Kommunikation. Als Atemtechniken sollten entweder die Zwerchfell- oder Vollatmung präferiert werden. Da die Brustatmung in der Literatur als Atemtechnik erklärt wird, möchte ich sie der Vollständigkeit halber mit erläutern.
Brustatmung (Schulter-, Flanken- und Rückenatmung)
Bei der Brustatmung weiten sich die mittleren Lungenflügel und Luft strömt ein. Die Brustatmung führt zu einer verkrampften Atmung, durch die ein ineffizienter Luftaustausch entsteht.
Zwerchfellatmung (Bauchatmung)
Eine effizientere Möglichkeit, um kurzfristig die Stresssituation zu entlasten, ist die sogenannte Bauch-Zwerchfellatmung.
Die Zwerchfellatmung, auch Bauchatmung genannt, konzentriert die Atmung bewusst auf den Bauch. Das hochgewölbte Zwerchfell flacht durch die Atmung ab und das untere Drittel der Lungenflügel dehnt sich aus und wird mit Luft gefüllt.
Vollatmung (Bauch-Zwerchfellatmung und Brustatmung)
Durch die Vollatmung findet ein ganzheitlicher Austausch der Luft im Körper statt. Die Vollatmung vereint die Bauch-Zwerchfellatmung mit der Brustatmung. Die Kombination beider Atemtechniken führt zur Dehnung des gesamten Rippenbogens. Durch diese Dehnung wird ein maximaler Luftaustausch erreicht.
• Die Atmung konzentriert sich auf den Bereich des Bauches. Die unteren Rippenbögen wölben sich und das Zwerchfell flacht ab. Luft kann in die unteren Lungenflügel strömen.
• Setzt im weiteren Verlauf des Atemprozesses die Brustatmung ein, weiten sich die mittleren Lungenflügel und die Brust dehnt sich weiter aus. Wird im letzten Drittel der Atmung noch das Schlüsselbein angehoben, strömt noch zusätzlich Luft in die Lungen ein. Somit füllen sich zum Abschluss die Lungenspitzen mit Luft. Ein ganzheitlicher Luftaustausch und eine verbesserte Sauerstoffversorgung sind die Folge.
Gedanken-Stopp
Sollten sich im Verlauf einer belastenden Einsatzlage (Todesermittlung, schwerer Verkehrsunfall etc.) negative und quälende Gedanken einstellen, kann es hilfreich sein, die Gedanken-Stopp Technik einzusetzen. Schränkt negatives Gedankengut die Tätigkeit ein, soll innerlich das Wort „Stopp“ gesagt werden. Ziel ist es, die negativen Gedanken möglichst schnell abzubrechen, damit diese sich nicht festigen können. Kommt es wieder zu belastenden Gedanken, kann mit der „Unsinn-Formel“ (Litzke, 2005, S. 54) Abhilfe geschaffen werden. Dabei sollten Einsatzbeamte ein mehrsilbriges Wort erfinden und direkt im Anschluss an den Gedanken-Stopp mehrmals hintereinander wiederholen. Da das selbst erfundene Wort keine Assoziationen hervorruft, kann somit die Entwicklung neuer negativer Gedanken verhindert werden.
Positive Selbstinstruktion
Hilfreich ist es auch, sich direkt im Einsatzverlauf selber positiv zu motivieren. Die positive Selbstinstruktion („Ich kann das“ oder „Ich bin gut vorbereitet“) kann helfen, auch belastende Ereignisse als Herausforderung zu sehen. Denkt ein Polizeibeamter, dass er den vor ihm liegenden Einsatz nicht bewältigen kann, wird ihm das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht gelingen. Es schleichen sich durch den eigenen Pessimismus Fehler ein, die eine Bewältigung des Einsatzes wesentlich erschweren können. Die Technik der Selbstinstruktion ist im Modell von Lazarus verankert, da sie genau an der sekundären Bewertung ansetzt und das Verhalten zur Stressbewältigung danach ausgerichtet wird.
„Entschleunigung“ der Kommunikation durch bewusste Temporeduzierung
Einsatzlagen sind häufig geprägt durch hektisches Sprechen der Personen am Einsatzort. Diese Hektik überträgt sich auch auf das eigene Einsatzhandeln. Dieser Dynamik kann mit einer bewussten Reduzierung der Sprechgeschwindigkeit entgegengewirkt werden. Die bewusste Reduzierung der Sprechgeschwindigkeit wirkt sich positiv auf die eigene Denkzeit aus und verhindert bzw. reduziert eigene Verhaltensfehler. Möglich ist dies jedoch nur in Einsastzlagen, die es möglich machen, diese Technik anzuwenden.
Teamarbeit
Eine gute Arbeit im Team am Einsatzort ist eine grundlegende Voraussetzung, um Stressbelastungen aufgrund der Informationsfülle von Einsätzen entgegen wirken zu können. In der Teamarbeit besteht die Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und sich kurz aus der direkten Interaktion mit dem polizeilichen Gegenüber zurückzuziehen, um neue Energie zu sammeln. (Wechsel der Positionen im Team). Eine klare Aufgabenteilung im Team kann auch unter widrigen Umständen helfen, den Stresseinfluss zu begrenzen. Problematisch bleibt hier anzumerken, dass aufgrund der veränderten Schichtmodelle klare Teamstrukturen verloren gehen können, die für Einsatzsituationen eine große Bedeutung haben. Die individuelle Planbarkeit eines bedarfsorientierten Schichtmodells ist auf der anderen Seite wieder positiv für die Begrenzung der belastenden Alltagseinflüsse zu bewerten. Somit findet grundsätzlich ein Austausch von Belastungen statt und vermutete Nachteile können eventuell wieder ausgeglichen werden.
Kurzfristige wie langfristige Schutzfaktoren Vor- und Nachbereitung von Einsätzen
Die Vor- und Nachbereitung von Einsätzen ist fester Bestandteil im Leitfaden 371, besser bekannt als das Einsatzmodell. Die Vor- und Nachbereitung ist vergleichbar mit der Planung der eigenen Urlaubsreise. (Urlaubsvorbereitung, Urlaub genießen und die Nachbereitung des Aufenthaltes wie Bilder entwickeln lassen etc.). Die detaillierte Vor- und Nachbereitung würde zu einer Erleichterung und Entlastung in der Einsatzbewältigung führen, auch wenn sich die Lage anders entwickelt. Zum Dienstbeginn und Dienstende wäre es von Vorteil, wenn Polizeibeamte ein festes Ritual entwickeln würden. Somit ist gewährleistet, dass alle Maßnahmen auch bei Stress optimal ablaufen. Die Fahrt zum Einsatzort ist ein guter Zeitraum, in dem man den zu erwartenden Einsatz besprechen kann. Dabei sollten Polizeibeamte auch ihrem „Können“ und der eigenen „Intuition“ vertrauen. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Werden Einsätze gut nachbereitet, sind Polizeibeamte für den nächsten Einsatz gut vorbereitet. Auch das mildert die Einsatzbelastung und stärkt die eigene Wahrnehmung für das eigene Können. Die Vor- und Nachbereitung von Einsätzen kann bereits dem Coping zugeordnet werden.
Coping (englisch to Cope with = bewältigen, überwinden, kämpfen mit)
Der Begriff Coping wurde durch Lazarus (1981) geprägt und bedeutet so viel wie die Bewältigung von Stress.10 Er hat dabei zwischen dem problemorientierten und emotionsorientierten Coping unterschieden. Als dritte Möglichkeit ist auch das bewertungsorientierte Coping in diese Betrachtung einzubeziehen.
Beim problemorientierten Coping zielt das gesamte Verhalten auf die meist zukünftige Lösung eines Problems. Bei Einsätzen beispielsweise versuchen die eingesetzten Beamten, möglichst viele Informationen zu generieren. Somit können sie problemorientierter Sachverhalte betrachten und auch die Eigensicherung veränderten Situation anpassen. Ähnliche Einsätze sind in der Zukunft durch die entwickelten Lösungsmöglichkeiten besser zu bewältigen. Dies wird im Polizeiberuf bei Einsätzen täglich durchgeführt und schult die eigene Wahrnehmung von Gefahrensituationen.
Das emotionsorientierte Coping beinhaltet die Linderung von Belastungssymptomen. Durch Selbstgespräche und Kanalisierungen durch Ablenkungen sollen Lösungsstrategien entwickelt werden. Weiterhin kann man selber Spannungen reduzieren, beispielsweise durch Rauchen, Essen & Trinken oder Sport. Die Verdrängung von Problemen und der Wunschgedanke, dass alles gut werden wird, werden ebenfalls hierunter zusammengefasst. Das problem- und emotionsorientierte Coping kann auch immer zusammen stattfinden und baut nicht aufeinander auf.
Das bewertungsorientierte Coping ist die Konsequenz aus der primären und sekundären Bewertung der Belastung. Durch die ständige Interaktion zwischen der primären und sekundären Bewertung wird im Idealfall die Belastung eher als Herausforderung denn als Belastung angesehen. (Reininger, Gorzka, 2011)
Langfristige Schutzfaktoren Rationalisierung
Belastende Ereignisse (schwere Verkehrsunfälle, Tote, Schwerverletzte) lassen sich mit der nötigen Berufserfahrung „aus einer gewissen „professionellen Distanz“…“ (Krampl, 2007, S. 14) betrachten, um die eigene Anteilnahme und das eigene emotionale Miterleben in Grenzen zu halten. Die Gefahr bei der Rationalisierung besteht in der Verdrängung persönlicher Belastungen, die im Einsatz erlebt worden sind. Die nötige emotionale Distanz von der Verdrängung zu differenzieren, ist für persönlich betroffene Kollegen und Kolleginnen häufig nicht so leicht. Es sollten daher nach Einsatzende weitere Nachbesprechungen und Hilfsangebote wahrgenommen werden. Hierbei sind die polizeilichen Beratungsstellen nicht außer Acht zu lassen. Ihre Wichtigkeit und Kompetenz gewinnt bei den Dienststellen und Polizeibeamten immer mehr Akzeptanz und Bedeutung. Wo Polizeibeamte sich früher eher als „schwach, unzulänglich und nicht belastbar gesehen haben, nehmen heute immer mehr Beamte die Hilfs- und Präventionsangebote in Anspruch. Das Thema der dienstlichen Belastung ist kein Tabu-Thema mehr.
Eigene Kompetenzerwartung und Erfahrung durch Einsatz und Training
Die Bewältigung unterschiedlicher Einsätze und den daraus resultierenden Erfahrungen führt zu einem positiven Selbstbild. Es entwickelt sich ein positives Selbstverständnis und der Eindruck, mit belastenden Situationen gut umgehen zu können. Zusätzlich wächst auch das Vertrauen zu Kollegen und den vorhandenen Einsatzmitteln, wie beispielsweise die Schutzweste, die nicht nur in Nachtschichten getragen werden sollte. Auch ein gutes theoretisches Grundlagenwissen hilft, Kompetenzen schneller zu entwickeln und diese auch nach außen auszustrahlen. Des Weiteren ist vorbereitendes Training in objektiver und subjektiver Hinsicht von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Handlungskompetenz
Kompetenzgewinn durch Training
Schulungen und Fortbildungen bieten die Grundlage und das Fundament für jedes Einsatzhandeln. Es kommt zur Ausbildung von Kompetenzen und Handlungsalternativen, die im Realeinsatz benötigt und nicht erst herausgebildet werden können. Es müssen Automatismen in Form von grundsätzlichen Grundlagentrainings gelehrt werden, um in einer Einsatzsituation bestehen zu können. Dabei ist der sichere Umgang mit Einsatzmitteln und das Bewusstsein der Einsetzbarkeit unter Stress ein wichtiges vorbereitendes Element, um auch Einsätze unter Stress bewältigen zu können. Hier sollten folgende Unterweisungsmethoden aus der Trainingslehre angewendet werden:
• Vom Leichten zum Schweren
• Vom Bekannten zum Unbekannten
• Vom Einfachen zum Komplexen
Dies zeigen auch die mit Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen durchgeführten Untersuchungen zur Bewältigung von polizeilichen Hochstressphasen, die in meiner Dissertation zum Ausdruck kommen werden. Durch intensive realistisch nachgestellte Szenarien unter Hochstress mit im Vorfeld durchgeführten Grundlagentrainings können implizite Lernprozesse angeregt werden, die auch in Extremsituationen noch eine Handlungskompetenz möglich machen.11 Im Idealfall entsteht eine Handlungsroutine bei der Bewältigung von Extremsituationen (zur Bedeutung gedächtnispsychologischer Grundlagen für die polizeiliche Tätigkeit vgl. auch Heubrock, 2010).
Anerkennung von Vorgesetzten/Führungskräfte
Als weiterer Aspekt, der nach den Aussagen von Polizeibeamten präventiv bei Stressbelastungen wirkt, ist der positive Rückhalt von Führungskräften innerhalb der Polizei. Haben die Mitarbeiter das Gefühl, dass die Arbeitsergebnisse anerkannt werden, wächst auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Durch die positive Rückkopplung wird in kritischen Situationen verhindert, dass Beamte eher an die Bewältigung der Einsatzlage als an die Folgen durch die Führungskraft denken. Gerade bei jungen Kollegen, die noch eine geringe Anzahl an Einsätzen und somit auch relativ wenige notwendige Einsatzerfahrungen sammeln konnten, ist dies ein positiver Effekt für die Stressprävention (Gruschinske, 2010).
Das Vorhandensein einer Polizeikultur
Die „Polizeikultur“ wirkt im Rahmen der Prävention von Posttraumatischen Belastungsstörungen als Schutzfaktor in der polizeilichen Arbeit. Durch die „Subkulturentwicklung“ mit eigenen Werten und Normen bilden sich eigenständige soziale Muster, die berufstypisch sind und als Polizeikultur bezeichnet werden können.12 Weitere Schutzfaktoren sind ein Gemeinschaftsgefühl (Identifikationsbezug) und die soziale Unterstützung durch Kollegen. Polizeibeamte werden in der Ausbildung grundsätzlich auf Einsatzsituationen vorbereitet und belastende Ereignisse werden im Allgemeinen als Teil ihres Arbeitsplatzes angesehen. (Schneider, Latscha, 2010, S. 39)
Mentale Vorbereitung
Die mentale Vorbereitung ist bisher in die polizeiliche Tätigkeit wenig integriert. Schmalzl (2008, S. 108 ff.) beschreibt in seiner Untersuchung zur Einsatzkompetenz, dass die mentale Vorstellungskraft einen positiven Effekt auf komplexe Trainingseinheiten bewirkt. Etabliert hat sich die mentale Vorbereitung in der Sportpsychologie. Spitzensportler nutzen das mentale Training als einen Baustein in ihren Trainingsplänen. (Bioni, Achtziger, Gentsch, 2010, S. 16). „In der mentalen Bedingung stellen sich die Versuchspersonen vor, wie sie die Aufgabe meistern, entweder indem sie sich selber bei der Ausführung „zuschauen“ oder indem sie sich unter mentaler Einbeziehung aller beteiligten Sinne vorstellen, wie sie die Aufgabe bewältigen.“(Schmalzl, 2008, S. 110) Die mentalen Übungen sollten jedoch eine Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Eine mentale Vorbereitung ist aufgrund der Ergebnisse der Sportpsychologie auch innerhalb der Ausbildung von Polizeibeamten anzustreben. Einsatzübungen könnten so mit klaren Aufgaben im Rahmen des Selbststudiums integriert werden. Das Verständnis für mentales Training muss jedoch noch etabliert werden. Dazu sollte im Vorfeld das Personal speziell geschult werden, damit die mentale Vorbereitung auch mit dem praktischen Training korrelieren kann. Durch die Einführung des mentalen Trainings in die Ausbildung kommt es vermutlich auch zu einer späteren Übernahme und Akzeptanz innerhalb der Fortbildung von Polizeibeamten.
Fazit
Empfehlungen zum Umgang mit Stress: Stress gehört zum Leben wie Atmen. Ohne Stress können sich Polizeibeamte nicht an veränderte Einsatzbedingungen gewöhnen. Das Bewusstsein über unterschiedliche Belastungen führt zu einem besseren Umgang mit negativem Stress. Eine gute körperliche Verfassung, ein sozial stabiles Umfeld, gute Fachkenntnisse und praktische Fertigkeiten erhöhen die Stressstabilität. Eine gute Vor- und Nachbereitung von Einsätzen erhöht die Widerstandskraft gegen belastende Einflüsse. Es gibt in und nach stressigen Einsatzsituationen Möglichkeiten, kurzfristig und langfristig Stress abzubauen. Nehmen sie Stress und die Eigensicherung auch bei Routinetätigkeiten ernst und reagieren sie auf negative Einflüsse.
Literatur
Behr, R. (2006). Polizeikultur. Routinen - Rituale - Reflexionen. Bausteine zu einer Theorie der Praxis der Polizei. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden
Bioni, D., Achtziger, A., Gentsch, R. (2010). Psychologisch orientiertes Training in der Polizeiarbeit. Mentale Vorbereitung im Einsatztraining durch „Goal Shielding“. In: Polizei & Wissenschaft (04/2010). Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a. M.
Bulling, A. (2010). Psychologische Krisenintervention im Kontext polizeilicher Einsätze. Was hilft während und nach traumatischen Ereignissen, die psychische Gesundheit aufrecht zu erhalten und Traumafolgen abzuschwächen. Bremen: Unveröffentlichte Diplomarbeit.
Cannon, Walter B. (1975). Wut, Hunger, Angst und Schmerz; eine Physiologie der Emotionen / aus d. Engl. übers. von Helmut Junker. Hrsg. von Thure von Uexküll, Erste engl. Ausgabe 1915 Verfasser: Cannon, Walter B., Verleger: München, Berlin, Wien: Urban und Schwarzenberg.
Füllgrabe, U. (2003). Suicide by Cop. Ein Gewaltdelikt gegen Polizeibeamte. In: Kriminalistik, Jg. 57 (4), 225-233.
Gasch, U. (1998). Polizeidienst und psychische Traumen; Eine Pilotstudie über traumatisierende Erlebnisse und deren Bewältigung. Kriminalistik, 12, 819-823.
Gasch, U. (2000). Trauma spezifische Diagnostik von Extremsituationen im Polizeidienst: Polizisten als Opfer von Belastungsstörungen. Berlin: Dissertation.
Gruschinske, M. (2010). Prävention psychischer Folgen von Belastungen im Polizeidienst. Bremen: Unveröffentlichte Diplomarbeit.
Hallenberger, F. & Mueller, S. (2000). Was bedeutet für Polizistinnen und Polizisten „Stress“?, Polizei & Wissenschaft, 1, 58-65. Hermanutz, M. & Buchmann, K. E. (1994). Körperlich und psychische Belastungsreaktionen bei Einsatzkräften während und nach einer Unfallkatastrophe. Die Polizei, 11, 294-302.
Heubrock, D. (2001). Angst, Streß und Panik: Ursachen und Bewältigungsmöglichkeiten. Vortrag an der Nachschubschule des Heeres [jetzt: Logistikschule der Bundeswehr] in Garlstedt am 13. November 2001 (unveröffentlichtes Manuskript).
Heubrock, D. (2010). Gedächtnispsychologische Grundlagen der Zeugenvernehmung — Zum Nutzen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die polizeiliche Vernehmungspraxis. Kriminalistik, 64, 75-81.
Holmes T. H., Rahe R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, 11, S. 213-218
Huber, Michaela (2009). Trauma und die Folgen. 4. Auflage Paderborn. (Trauma und Traumabehandlung,/Michaela Huber, Teil 1).
Klemisch, D., Kepplinger, J. & Muthny, F. A. (2005): Stressfaktoren und Positiva im Polizeiberuf - Selbsteinschätzungen durch Polizeibeamte. In: Polizei & Wissenschaft, 02/2005, Verlag für Polizeiwissenschaft Frankfurt a. M.
Krampl, M. (2003). Ursachen und Auswirkungen von Stress und Belastungsreaktionen bei Einsatzkräften nach belastenden Ereignissen. In: Lorei C. (Hrsg.): Polizei & Psychologie. Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft, 433-444.
Latscha, Knut (2005). Empirische Untersuchung zur Posttraumatischen Belastungsstörung bei bayerischen Polizeivollzugsbeamten/-innen.
Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktion zwischen Person und Umwelt. In: Mitsch J. R: (Hrsg.), Stress (S. 213-259). Bern: Hans Huber.
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, 1, p. 141-169.
Ley, T. (1996). Methodische Überlegungen zur Untersuchung der Verarbeitungsmechanismen traumatischer Ereignisse im Polizeidienst. Dissertation.
Litzke, S. M., Schuh, H. (2007). Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz. 4. vollständig überarbeitete Auflage. Springer Verlag, Heidelberg.
Lorei, C., 2003 (Hrsg.). Polizei & Psychologie. Frankfurt: Verlag für Polizeiwissenschaft.
Lorei, C., Meyer, S. & Wittig, G. (2010). Polizei im Jagdfieber. Eine kognitive Annäherung. In: Polizei & Wissenschaft. §3/2010). Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a. M.
Nitsch, J. R. (1981). Stress – Theorien, Untersuchungen, Maßnahmen, Bern: Huber.
Meichenbaum, D. (1991). Intervention bei Stress. Bern: Verlag Huber.
Pokojewski, B. (2009). Verfolgung zu Fuß: Ein weißer Fleck in der Eigensicherung. In: Polizeitrainer Magazin. (12/2009). Polizeitrainer in Deutschland e. V., Taunusstein.
Puzicha, Klaus J. (2001). Psychologie für Einsatz und Notfall: Internationale truppenpsychologische Erfahrungen mit Auslandseinsätzen, Unglücksfällen, Katastrophen. Bonn. Bernard & Graefe.
Reininger, Claus Michael, Gorzka, Robert (2011). Copingmuster bei Polizistinnen und Polizisten. In: Polizei & Wissenschaft, Heft 1/2011. Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a. M.
Sapolsky, R. M. (1998). Warum Zebras keine Migräne kriegen. Wie Streß den Menschen krank macht. München Serie Piper.
Schmalzl, H. P. (2005). Das Problem des „plötzlichen“ Angriffs auf Polizeibeamte. Polizei & Wissenschaft, 3, 8-18.
Schmalzl, H. P. (2008). Einsatzkompetenz: Entwicklung und Überprüfung eines psychologischen Modells operativer Handlungskompetenz zur Bewältigung kritischer Einsatzsituationen im polizeilichen Streifendienst. Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a. M.
Schneider, D., Latscha, K. (2010). Polizeikultur als Schutzfaktor bei traumatischen Belastungen. In: Polizei & Wissenschaft (04/2010).Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a. M.
Schwarzer (1993). Streß, Angst und Handlunsregulation. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Kohlhammer. Stuttgart
Selye, H. (1981). Geschichte und Grundzüge des Stresskonzeptes. In: Nitsch, J. R. (Hrsg.), Stress (S 163-187). Bern: Hans Huber.
Selye, H. (1983). Stress: Lebensregeln vom Entdecker des Stress-Syndroms. Reinbeck. Rowohlt.
Steinbauer, M. (2001). Stress im Polizeiberuf und die Verarbeitung von belastenden Ereignissen im Dienst. Polizei & Wissenschaft, 4, 46-59.
Teegen, F., Domnick, A. & Heerdegen, M. (1997). Hochbelastende Erfahrungen im Berufsalltag von Polizei und Feuerwehr: Traumaexposition, Belastungsstörungen, Bewältigungsstrategien. Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 4, 583-599.
Teegen, F. (1999). Berufsbedingte Traumatisierung bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. In: Zeitschrift für Politische Psychologie, 4, 437-453.
Teegen, F. (2003). Posttraumatische Belastungsstörungen bei gefährdeten Berufsgruppen. Prävalenz-Prävention-Behandlung. Hans Huber Verlag. Bern.
Ungerer D. & Ungerer J. (2008). Lebensgefährliche Situationen als polizeiliche Herausforderung. Entstehung-Bewältigung-Ausbildung. Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a.M.
Violanti, J. M. & Aron, F. (1995). Police stressors: Variations in perception among police personnel. Journal of Criminal Justice, 23 (3), 287-294.
Wagner, D., Heinrichs, M. & Ehlert, U. (1999). Primäre und sekundäre Posttraumatische Belastungsstörung: Untersuchungsbefunde bei Hochrisikopopulationen und Implikationen für die Prävention. Psychomed, 1, 31 -39.
Wagner, H. (1986). Belastungen im Polizeiberuf. Die Polizei, 77, 80-84.
Schneider, Daniel, Latscha, Knut (2010). Polizeikultur als Schutzfaktor bei traumatischen Ereignissen. In: Polizei & Wissenschaft, Heft 4/2010. Verlag für Polizeiwissenschaft. Frankfurt a. M.
Zimbardo, Philip G., Gerrig, Richard J. (2004) : Psychologie. 16.,aktualisierte Auflage. Pearson Studium, München.
Carpi, John (2010). Stress: It‘s Worse Than You Think. In: Psychology Today http://www.psychologytoday.com/articles/199601/stress-its-worse-you-think.
Klemisch, Dagmar (2006). Psychosoziale Belastungen und Belastungsverarbeitung von Polizeibeamten. URL: http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate3182/diss_klemisch.pdf. (Zuletzt geprüft: 29.11.2010).
Sennekamp, W. & Martin, H. (2001). Extreme dienstliche Belastungssituationen und Unterstützungsbedarf im Polizeidienst. Psychotraumatologie.
1 Mit den Folgen von psychosozialen Belastungen und der Belastungsverarbeitung von Polizeibeamten hat sich unter anderem Dagmar Klemisch (Klemisch, 2006) in Ihrer Dissertation befasst. Weitere Untersuchungen zur Belastung von gefährdeten Berufsgruppen: (Latscha, (2005); Teegen et al., (2003), (1997); Gruschinske, (2010); Hermanutz et. al. (2001); Gasch (1998), (2000))
2 Zu weiteren Allgemeinen Stressoren zählen u. a. Belastungen im Privatleben, verschiedene Rollenerwartungen von Vorgesetzten, nahen Verwandten, der eigene Gemüts- und Gesundheitszustand, hohe Schulden. Zur Vertiefung dieses Themenbereiches sei hier auf das Lehrbuch „Grundwissen Stress“ (herausgegeben von Hallenberger & Lorei, 2012, Verlag für Polizeiwissenschaft) verwiesen.
3 Erschöpfungszustände, der Gesundheits- oder Gemütszustand etc. werden auch als Moderatorvariablen bezeichnet. Es handelt sich hierbei um Einflüsse, die eine Reaktion auf einen Stressor (physiologisch oder psychologisch) beeinflussen. Bei guter körperlicher Verfassung ist ein besserer Umgang mit einem Stressor zu erwarten, als bei Müdigkeit und gesundheitlichen Problemen. Auch eine persönliche Betroffenheit kann den Umgang mit Stressoren erschweren.
4 Vgl.: KFN, Zwischenbericht 1, 2010, S.18 ff.)
5 Die Verbindung von physischen und psychischen Reaktionen bei auftretenden Stressoren wird in der Stressforschung als Personen-Umwelt-Beziehung verstanden und findet seine theoretische Grundlage im Transaktionalen Stressmodell von Lazarus.
6 Als Endokrinologie wird auch die Lehre von den Hormonen als Teilgebiet der inneren Medizin bezeichnet.
7 Als Stressoren werden Reize, Einflüsse, Anforderungen beschrieben, die eine Anpassung des Körpers an die Situation erfordern.
8 Zur weiteren Information über den plötzlichen Angriff auf Polizeibeamte siehe auch Hans Peter Schmalzl (2005).
9 Vgl. Weiterführende Literatur zum Thema „Jagdfieber“: Lorei, Meyer, Wittig (2010)
10 Vgl. auch: Lazarus, (1981); Lazarus & Folkmann, (1987); Reininger, Gorzka, (2011))
11 Füllgrabe (2003) verwendet für die Vorbereitung auf belastende Einsatzsituationen den Terminus „Stressimpfung“. Zur Erweiterung der Stressbewältigungskompetenz siehe auch Schmalzl (2010) und Gasch & Lasogga (2001), die das Stressimpfungstraining (SIT) nach Meichenbaum erläutern.
12 Vgl.: Behr, R. (2006)