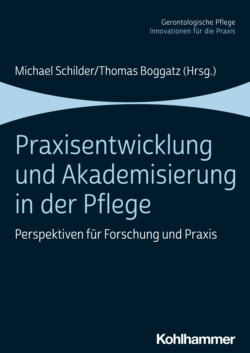Читать книгу Praxisentwicklung und Akademisierung in der Pflege - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Pragmatik und Kritik – ein Ausweg?
ОглавлениеWir haben festgestellt, dass die Verbindung von Theorie und Praxis nicht einfach so geschieht, auch nicht bloß eingefordert oder autoritär erzwungen werden kann. Man muss schon bereit sein, sich mit der Komplexität dieses Verhältnisses ernsthaft auseinanderzusetzen. Der Pragmatismus könnte eine Perspektive darstellen, denn – so hat es bereits Charles Peirce betont – unsere Überzeugungen, Denkschema und Glaubenssysteme sind letztlich Orientierungen für die Praxis, die wir im Alltag leben. Und nichts anderes geschieht auch mit den Pflegetheorien oder Modellen. Wenn sie in ihrer Bedeutung für die Praxis erkannt werden, wir uns mit ihnen auseinandersetzen, sie für unseren Alltag eine Orientierung bieten, dann können sie »praktisch« wirksam werden. Es geht also nicht um ein Eigenleben der Theoriewelt, ein pragmatischer Zugang rückt ihre Konsequenzen für die Praxis in den Vordergrund – ohne Dogmatik! Auch William James betonte vor über 100 Jahren, dass letztlich alle Theorien Approximationen, d. h. Annäherungen sind: »They are only a man-made (sic) language, a conceptual shorthand« (James 1907, S. 147). Dabei ist Wahrheit etwas, was geschieht. Das bedeutet, dass man sich die Umsetzung von Theorien, Ideen und Konzepte als einen Prozess vorstellen muss, in dem ihre Wahrheit letztlich durch bestimmte Ereignisse, und Vorkommnisse erst wirklich wird. Es geht dabei nicht darum um die »reine Lehre« zu streiten, sondern am Ende zu schauen (und zu reflektieren), was vor Ort sinnvoll ist, machbar ist, erreichbar ist. Zwei amerikanische Pflegetheoretikerinnen formulieren dies wie folgt: »As James contends, however, theories and ideas become true (are meaningful) just in so far as they help us to get into satisfactory relation with our experiences and result in more responsive action« (Doane & Varcoe 2005, S. 82). Noch ein Punkt ist sehr wichtig, der oben bereits angedeutet wurde: Entscheidend ist der Prozess, weniger die Suche nach einer bestimmten Doktrin (oder Wahrheit), der nun alle folgen müssen; auch steht der Vergleich der verschiedenen theoretischen Zugänge nicht im Vordergrund. Theoretische Überlegungen sind also nichts anderes als Programme, deren Nutzen und Nützlichkeit ständig auf dem Prüfstein stehen: »Theories thus become instruments, not answers to enigmas, in which we can rest. We don’t lie back upon them, we move forward, and, on occasion, make nature over again by their aid. Pragmatism unstifles all our theories, limbers them up and sets each one at work« (James 1907, S. 145).
Aber ein pragmatischer Zugang muss sich mit einem kritischen Zugang im Hinblick auf die Wirklichkeit verbinden. Und zwar vor allem deswegen, weil eine zu enge Auffassung des Pragmatismus im Kern nur aus unserer Wunscherfüllung besteht (vgl. den terminologischen Unterschieden vor allem: Brandom 2000). Eine umfassendere Perspektive, zu der vor allem Heidegger, Quine und Rorty im 20. Jahrhundert beigetragen haben, stellt den Vorrang des Praktischen selbst ins Zentrum seiner Überlegungen. Und dieser Zugang muss m. E. mit einer Kritikperspektive verbunden werden. Und die fragt nicht affirmativ danach, wie vorgegebene Dinge – es kann auch ein Expertenstandard sein – nun einfach in die Praxis umgesetzt werden können; Kritik geht darüber hinaus (vgl. umfassend Jaeggi & Wesche 2009). Denn entweder in oder außerhalb der bestehenden Verhältnisse muss sich ein Maßstab entwickeln, von dem aus eine gegebene Situation als falsch, mangelhaft, jedenfalls verbesserungsfähig charakterisiert wird. Letztlich ist es das gute Leben, was als Orientierung und Referenzkriterium dienen mag. Im Hinblick auf die Pflege gilt das genauso, denn am Ende geht es darum, den Betroffenen zu einem eigenständigen, autonomen und gelungenen Leben zu verhelfen. Aufgabe der Kritik (auch in der Pflege) ist es dann, aufmerksam zu sein für jene Mechanismen und Pathologien, welche die Betroffenen gerade daran hindern diesem Anspruch gerecht zu werden – auch wenn sie es selbst nicht wissen!
Und hier eine entsprechende Moderation und Qualifizierung zu übernehmen, das ist m. E. die Aufgabe der sog. »change agents«, oben bereits als Facilitators bezeichnet. Das ist vor allem in Großbritannien thematisiert worden, im sog. »Promotion Action on Research Implementation in Health Services/PARIHS)-Modell« Rycroft-Malone 2013, Sanders et al. 2013, Titchen et al. 2013). Dieses Modell geht davon aus, dass für einen erfolgreichen Transfer drei Dinge notwendig sind: Erstens muss eine empirische Basis vorhanden sein bzw. erst geschaffen werden (z. B. zum Schmerzmanagement). Zweitens muss ein Kontext vorhanden sein, der die Umsetzung neuer wissenschaftlicher Befunde unterstützt. Und drittens setzt eine erfolgreiche (und nachhaltige) Implementierung voraus, dass geeignete Facilitators engagiert bei der Sache sind. Und diese Personen sind fachlich qualifiziert, verfügen in der Regel über eine akademische Ausbildung und haben ein gewisses »standing« in der Organisation – das kann z. B. ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim – sein. Es geht am Ende um einen »reflective pracititioner« (Schön 2013).