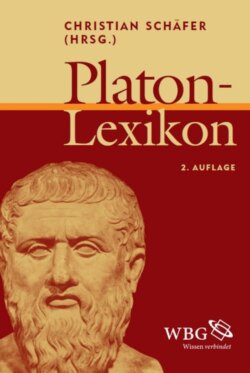Читать книгу Platon-Lexikon - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung des Herausgebers
ОглавлениеPlatoni imputes, non mihi, hanc rerum difficultatem; nulla est autem sine difficultate subtilitas … (Seneca, Ep. 58)
„Ein Buch, das nicht durch sich und für sich selbst spricht, ist schlecht und die beste Vorrede nützt ihm nichts; so könnte denn nach meinem Ermessen allen Büchern, die bestimmt sind, von Anfang bis zum Schluß gelesen zu werden, die Vorrede fehlen. Anders freilich steht es mit einem Wörterbuch.“ – Mit dieser lapidaren Feststellung eröffnet Wilhelm Gemoll sein mittlerweile in Ehren altgedientes Griechisches Wörterbuch. Für ein Wörterbuch zu Platon gilt das Gesagte in besonderer Weise, denn Platon ist ein gesucht unterminologisch schreibender Autor. Von den vielen Kolleginnen und Kollegen der verschiedensten Fachrichtungen, die zur Mitarbeit an diesem Lexikon eingeladen waren, hat daher ein stattliches Kontingent nicht zusagen wollen. Denn wer Platon wirklich schätzt, der ist ganz dem Zusammenhang und der inneren Entwicklung der Dialogtexte und der auch inhaltlich vielsagenden Stimmungen, die sie kreieren, ergeben, der scheut sich, Platon in Begriffe zu zerlegen und ihn sprachlich auf etwas „festzunageln“, und das mit gutem Grund. Diesen guten Grund zu erläutern und gleichzeitig eine sinnvolle Apologie dafür zu liefern, dass hier dennoch und gegen alle Unwahrscheinlichkeiten ein Lexikon zu Platon vorzulegen gewagt wird, bedarf es einer Bevorwortung, die über den Rahmen und die Form einer intellektuellen Biographie des behandelten Autors, einer Sondierung des status quaestionis der Forschung und einige Handhaberegeln ein wenig hinausgreift. Denn ein Autor, der nicht aus sich selbst und für sich selbst spricht, taugt nichts, und auch die beste Einleitung in ein Wörterbuch zu seinen Schriften wird daran nichts ändern. Anders freilich steht es mit Platon.
1. Platons Leben: „Platon aus Athen war der Sohn des Ariston und der Periktione oder Potone, die ihr Geschlecht auf Solon zurückführte. Des Solon Bruder nämlich war Dropides; dessen Sohn war Kritias, dessen Sohn Kallaischros, dessen Sohn Kritias, das Haupt der Dreißig, und Glaukon. Des letzteren Kinder waren Charmides und Periktione, von der Platon stammte aus ihrer Ehe mit Ariston, als sechster von Solon abwärts. Solon aber führte sein Geschlecht auf Neleus und Poseidon zurück. Auch Platons Vater soll sein Geschlecht auf Kodros, des Melanthos Sohn, zurückgeführt haben, die nach Thrasyllos gleichfalls als Nachkommen des Poseidon gelten.“ Mit diesen Worten leitet Diogenes Laertios (3, 1) seine Lebensbeschreibung Platons ein. Dieser wurde also in eine der angesehensten Familien Athens hineingeboren. Seine Eltern gründeten ihre Ahnenreihe einerseits auf Solon, den großen Gesetzgeber der Stadt, und andererseits durch Kodros auf deren halbmythisches Königsgeschlecht (und damit schließlich auf göttlichen Samen). Viele von Platons näheren Verwandten spielten eine führende Rolle in den Leitungsangelegenheiten der Polis, Kritias als Vertreter der „Herrschaft der Dreißig“ (404/03 v. Chr.) wird von Diogenes Laertios eigens erwähnt. Dagegen scheinen weder das Jahr noch der Ort von Platons Geburt noch eindeutig zu ermitteln zu sein: Die konstruktionsfreudigen Testimonien der Alten und ihre modernen Ausdeuter schwanken in ihren Angaben zwischen Athen und Ägina sowie den Jahren zwischen 430/29 und 423 v. Chr. Platons Geburtsname soll gemäß allerdings oft angezweifelter Überlieferung Aristokles, nach seinem Großvater, gewesen sein, den „Spitznamen“ Platôn, „der Breite“, habe er später erhalten, sei es der Breite seines Körperbaus, seines Stils oder seiner Gedanken wegen.
Anders als ihr Autor selbst, tauchen Mitglieder seiner Familie in den Platonischen Dialogen häufig als mitunter titelgebende Protagonisten auf, sein Onkel Charmides etwa, oder sein Halbbruder Antiphon als Erzähler im Parmenides, Kritias im Charmides und Protagoras, seine älteren Brüder Glaukon und Adeimantos im Parmenides und in der Politeia, daneben außerdem Persönlichkeiten des öffentlichen und intellektuellen Lebens Griechenlands: der Komödienschreiber Aristophanes, die Sophisten Protagoras, Thrasymachos und Gorgias, die maßlosen politischen Wunderknaben Phaidros und Alkibiades, Pythagoreer und Eleaten als Repräsentanten bedeutender auswärtiger Philosophenschulen – all das legt Zeugnis ab von Platons familiärer und pädagogischer Beheimatung in den „besten Kreisen“, die vielleicht allerdings auch damals gleichzeitig die verkommensten gewesen sein mochten. Bald jedoch stand Platon im Bann eines anderen Kreises, nämlich dessen um Sokrates, dem Platon um die zehn Jahre lang angehört haben mag. Aus einer versprengten Notiz bei Xenophon (Memorabilia 3, 6,1), der anderweitig kein großer Freund Platons war, ist zu ersehen, dass Sokrates den Platon äußerst geschätzt haben soll. Sokrates ist auch die Hauptfigur fast aller Dialoge Platons, in denen bezeichnenderweise sein eigener Name nur in der von ihm nachverfassten Verteidigungsrede des Sokrates (Apologie 34a) und ganz am Rande in der Erzählung vom Todestag des Sokrates im Phaidon auftaucht. Vielleicht auch das nicht von ungefähr: Der herkömmlichen Doxographie zufolge markiert der Prozess und das Todesurteil gegen Sokrates durch die athenische Bürgerschaft den richtungsändernden Einschnitt in Platons Leben. Mag sein, dass schon der Phaidon diese populäre Sicht der Dinge vorbereitet hat: Am Todestag des Sokrates findet man weder Glaukon noch Adeimantos noch sonst ein Familienmitglied Platons bei seinem alten Lehr- und Lebemeister. Platons eigene rätselhafte Aussage, er selbst sei, so wurde angenommen, damals krank gewesen (Phaidon 59b), mag eine fiebrige Krise zwischen familiärem Loyalitätsdruck und innerer Überzeugung, zwischen politischer Räson und geschuldetem Freundschaftsdienst andeuten, die erst in der Nachfolge eine dann allerdings gänzliche Parteinahme für die Sache und die Person des Sokrates zeitigte. Der Virus des Sokrates hatte indes schon früher Wirkung gezeigt: Traut man unbehelligt von allen Echtheitsfragen mit den antiken Gewährsmännern der autobiographischen Passage von Platons „Siebtem Brief“ (Ep 7, 324b–326b), so hätte Platon gemäß den eingangs geschilderten Vorzügen seines Elternhauses eine politische Karriere ergreifen können und auch wollen, sobald er mit dem dafür nötigen Alter „sein eigener Herr geworden wäre“. Es kam aber ganz anders. Vom politischen Treiben Athens wandte er sich mit Abscheu weg, die ungerechte Hinrichtung des Sokrates besiegelte Platons „Absage an die Welt“ (so Wilamowitz-Moellendorff) und ließ ihn seine Zuflucht in der Philosophie finden, „die allein erkennen lässt, was im Staatswesen wie auch im Leben jedes Einzelnen gerecht ist“. So will es die Rückschau des alten Platon in dem unter seinem Namen überlieferten Rechtfertigungsbrief (Ep 7, 326a) und so wollte es dann auch die Tradition sehen: Erst die Philosophie ließ Platon aus der Krise hervortretend wirklich und im tieferen Sinn „sein eigener Herr werden“, und erst das sollte es dann ermöglichen, dass er später übrigens doch noch zu aktiver Teilnahme an öffentlichen Geschäften zurückfand (was vielleicht ein wenig allzu auffällig an den idealen Werdegang des Philosophenherrschers in der Politeia erinnert).
Letzteres ist mit seiner ersten Sizilienreise bezeugt, die er antrat, als er „ungefähr vierzig Jahre“ zählte (Ep 7, 324a). Zwischen diesem Alter und dem Tod des Sokrates 399 war ein gutes Dutzend Jahre vergangen, Platons „dark years“, und wie die meisten sogenannten dunklen Jahre offenbar von ernster Vorbereitung, tiefer innerer Verarbeitung und äußerer Erarbeitung großer Gedanken geprägt. Er soll in dieser fraglichen Zeit ausgedehnte Reisen unternommen haben, nach Kyrene und Tarent, angeblich auch nach Ägypten, von Kontakten mit den herausragenden Köpfen der Epoche ist in der Überlieferungsfolklore die Rede, außerdem von längeren Aufenthalten in Megara und Unteritalien. (Das alles mag man cum grano salis nehmen, denn die geographischen Angaben scheinen doch stark den philosophischen Interessensthemen von Platons Dialogen angeformt: Kyrene mit Theodoros der Mathematik, Megara mit der dortigen Philosophenschule der Logik, Syrakus der Politik und Ägypten der Weisheit alter Mythen.) Vor allem aber muss Platon während dieser Jahre als Philosoph aufgetreten und als solcher auch bekannt geworden sein (die Philologen weisen seine „Frühdialoge“ dieser Zeitspanne zu), sonst wäre das Folgende nicht so recht erklärlich.
Auf seiner Sizilienreise nämlich wurde er mit Dion, dem Schwager des Tyrannen Dionysius I. von Syrakus, bekannt und fand dort somit Einlass in politisch maßgebliche Kreise; nach anderen Quellen hatte Dionysius selbst Platon als bekannten Philosophen an seinen Hof eingeladen. Dieser mochte berechtigte Hoffnungen gehegt haben, was seine Rolle und Einflussmöglichkeiten betraf: Es gibt historische Zeugnisse davon, dass, anders als im Mutterland, in den griechischen Pflanzstädten (nicht nur) des Westens Philosophen erfolgreich und mit allgemeiner Zustimmung an die Grundfesten der politischen Konstitution Hand anlegen konnten. Platons Einschätzungen führten allerdings schon bald zu einem tiefen Zerwürfnis mit Dionysius, das sich in der Erzählung widerspiegelt, der Tyrann habe den athenischen Philosophen festnehmen und als Sklaven verkaufen lassen, so dass er schließlich von Freunden auf dem Markt von Ägina ausgelöst werden musste – all das würde geradezu symbolisch zu dem passen, was oben über den Zusammenhang von politischer Betätigung und „sein eigener Herr sein“ erzählt wurde.
„Nach seiner Rückkehr nach Athen wählte er zu seiner Wohn- und Lehrstätte die ‚Akademie‘, ein baumreiches Gymnasium vor der Stadt, das seinen Namen von einem Heros namens Hekademos hat“, so wieder Diogenes Laertios (3, 7). In die ungemein erfolgreiche Lehr- und Schreibtätigkeit der anschließenden Zeit hinein ereilte ihn wiederum der Ruf aus Syrakus, wo inzwischen Dion unter Dionysius II. weiter politisch aufgestiegen war. Trotz anfänglicher Bedenken, die bald herbe Bestätigung finden sollten, beschloss Platon, auf sein Glück zu trotzen und schiffte nochmals, ja später noch zu einem dritten Versuch nach Sizilien ein, indem er für die Dauer seiner Abwesenheit die Führung seiner Schule dem Knidier Eudoxos überließ, bezeichnenderweise einem Mathematiker also (zur Zeit von dessen Interimsleitung soll Aristoteles der Akademie als Schüler beigetreten sein). Platon scheiterte abermals und auch mit seiner noch weit bedenklicheren dritten Syrakusreise. Die in ihrer Art so interessante Autobiographie des Briefwerks (Ep 7, 324b; 352a) steht im Dienste der Erklärung von Platons Rolle in den Angelegenheiten von Syrakus, einer Erklärung, der sich die antiken Lebensbeschreibungen anschließen und damit auch deren charakteristisches an spätere Generationen weitergegebenes Bild vorzeichnen. Es ist dies ein Bild, das aus diesem Grund vordringlich den äußeren Lebensverlauf bietet und den politisch aktiven Platon in den Vordergrund stellt. Die inneren Entwicklungen, so sie denn für eine Philosophenbiographie und wohl anders als die äußeren wirklich von Aussagekraft sind, liegen andererseits ziemlich im Dunkeln und es bleibt vielleicht letztlich der Datierung und Deutung der Dialoge überlassen, ob sie Auskunft darüber zu geben imstande sind. Dazu gleich mehr.
Platon soll „im dreizehnten Jahr der Königsherrschaft des Philipp von Makedonien“ gestorben sein, oder nur unwesentlich später (und zwar angeblich an seinem Geburtstag und bei einem Hochzeitsgelage, nach anderen mitten im Schreiben). „Bestattet wurde er in der Akademie, wo er die meiste Zeit mit philosophischer Arbeit zubrachte. Daher wurde seine Schulrichtung auch die akademische genannt, wie denn auch die gesamte Bevölkerung dieses (athenischen) Bezirks ihm das Grabgeleit gab“ (Diogenes Laertios 3, 40–41). Die Akademie selbst hatte – wenn auch mit tiefgreifenden doktrinalen Umschwüngen und Richtungswechseln – nach Platons Tod noch Jahrhunderte Bestand, ja die „Platonische Schule“ in Athen wurde erst 529 n. Chr. vom Oströmischen Kaiser Justinian geschlossen. Bis dahin wurde dort Jahr für Jahr Platons Gedenktag kultisch begangen. Spätestens seit Poseidonios im frühen ersten Jahrhundert v. Chr. sprechen die Doxographen vom theios Platôn, dem „göttlichen Platon“, oder, wie Cicero, vom divus auctor Plato.
2. Platons Schriften: Was aber lässt Platon als Autor so „göttlich“ erscheinen? Eine antike Anekdote erzählt, man habe nach Platons Tod unter seinen Notizen eine Anzahl verschiedener Variationen der Anfangspassage der Politeia aufgefunden. Das mutet eigentümlich an, denn nichts philosophisch Tiefschürfendes scheint diesem Beginn innezuwohnen, und die Version, auf die Platon schließlich die Wahl fallen ließ, lautet: „(Sokrates:) Gestern stieg ich mit Glaukon, dem Sohn des Ariston, zum Piräus hinab, um die Göttin anzubeten und weil ich mir zugleich anschauen wollte, auf welche Weise man denn dort das Fest feiern würde, weil es da nämlich gerade zum ersten Mal gefeiert wurde, und der Festzug der Einheimischen schien mir auch sehr schön zu sein, gewiss jedoch scheint der, den die Thraker veranstalten, nicht weniger glanzvoll – nachdem wir also gebetet und uns umgeschaut hatten, gingen wir wieder zur Stadt hinauf“ (327a). Platon hat mit Bedacht größten Wert auf die äußere Gestalt seiner philosophischen Schriften gelegt, und diese von den Doxographen keineswegs zufällig weitergegebene Episode spiegelt das wider: Der Anfangssatz der Politeia ist eine Vorwegnahme der gesamten inneren Dialogbewegung von AUF- und ABSTIEG in der Rahmenerzählung. Er deutet den Auf- und Abstieg im Höhlengleichnis vorausweisend an, die Symbolgehalte von Unterweltsabstieg (durch die Thrakische Göttin, die eine Unterweltsgottheit war), wie sie etwa im Höhlengleichnis (514a–518b) und am Ende der Schrift in der Unterweltserzählung des Er (614a–621b) auftauchen, und der Stadt als politischer Menschengemeinschaft auf der sichtbaren Höhe der Landmarke, die es erst zu ersteigen gilt, und als Höhepunkt der langsam ansteigenden Gesprächsentwicklung des Dialogs, greifen hier auf der einleitenden Handlungsebene ineinander mit den Momenten, an denen man erkennt, dass Sokrates von Platon dargestellt wird wie einer, der – ähnlich dem Philosophen des Höhlengleichnisses wiederum – aus der lichten Höhe hinabsteigt, um eine Zeitlang unten zu verweilen und andere, die dort leben und ihre Freude am Betrachten von Fackelspielen haben (328ab), über das wahre Licht der Erkenntnis des Höheren zu belehren und dorthin mitzuziehen. Dass Platon ein Meister der sprachlichen und literarischen Darstellung war, erfordert jedoch für keinen seiner Leser wirklich einen Beleg mehr. Wer Platon liest, gerät unweigerlich in den Bann seiner Sprachgewalt, seiner Bilder, seines wohlgesetzten nüchternen Pathos und seiner nicht immer nur feinen Ironie. Kein Wunder also auch, dass die alte Überlieferung, Platon habe vor seiner Hinwendung zur Philosophie Tragödien verfasst, gerne geglaubt wurde.
Warum aber Dialoge, hat auch einen bestimmten Grund: Viele Philosophen nach Platon haben ebenfalls „more socratico“ ihre Philosophie in kunstvollen Dialogen gestaltet, doch keiner hat die Höhe des Platonischen Anfangs je erreicht. Die Antwort darauf mag u.a. darin zu finden sein, dass sie alle Dialoge schrieben, weil sie schreiben wollten, Platon dagegen, weil er es offenbar eigentlich nicht wollte. Die Dialogform war für Platon, so darf man annehmen, der Ausweg aus einem Dilemma, das sich peinlich und fast unausweichbar mit seiner SCHRIFTKRITIK ergibt. An berühmter Stelle führt der Autor des Phaidros, eingebettet in einen ägyptischen MYTHOS, eine Rüge des geschriebenen Worts vor, die es fraglich erscheinen lässt, warum er sich denn als Philosoph dann überhaupt der Schrift bedient habe (Phaidros 274c–275e). Deren Erfindung nämlich habe gedächtniszersetzend gewirkt, sie verleite dazu, Unverstandenes „schwarz auf weiß nach Hause zu tragen“ und sich damit im Besitz dessen zu wähnen, was da geschrieben wurde, ohne dass man es begriffen, geistig aufgenommen habe, ohne dass es „in die Seele geschrieben“ sei, also durch das Verstehen verständnisbringend in den Verstand gewandert. Zum Vergleich: Die literarische Figur Professor Kien etwa in Elias Canettis Roman „Die Blendung“ bedient sich der Methode, alles, was ihn ärgert, in ein kleines Notizbuch niederzuschreiben, weil er diese störenden Banalitäten damit aus dem Kopf aufs Papier verbannt und den Gedanken daran endlich loshabe. Platon will genau das verhindern: Den philosophischen Gedanken einfach loshaben zu können (hineinspielen mag da auch die ideale Auffassung von der philosophischen mania, dass man bestenfalls ohnehin nicht den Gedanken hat, sondern der Gedanke einen selbst). Das Geschriebene treibe sich ja dann übrigens auch ununterschieden bei denen herum, die es verstehen, und bei denen, die es nicht, noch nicht oder nicht richtig verstehen, und so kann der in Schrift gefasste LOGOS sich auch nicht mehr aussuchen, bei wem er seine Heimstatt nehme, der Gewinn für die aber, die ihn bei sich führten, sei gering, enttäuschend und oftmals auch täuschend: Dünkten sie sich doch allein schon durch den Besitz des Geschriebenen und dadurch, dass sie es lesen können, als weise. Rechenschaft ablegen aber (der griechische Ausdruck dafür, logon didonai, heißt schließlich auch soviel wie „den Sinn hergeben oder wiedergeben“) können weder sie selbst noch das Geschriebene als in Buchstaben gegossener Logos. Alles, was geschrieben steht, „ähnelt darin ziemlich der Malerei: Denn auch die stellt das, was sie hervorbringt, hin als sei Leben in ihm, doch wenn man das Gemalte dann etwas fragt, dann schweigt es ganz ehrwürdig still. Und genauso ist das mit den Schriften. Du könntest vermeinen, sie sprächen, als verstünden sie etwas von dem, was sie da von sich geben, fragst du sie aber wissbegierig näher aus, was sie denn da bitteschön sagen, so bieten sie dir doch immer nur ein und dasselbe“ (Phaidros 275d). Somit kommt es auch, dass wenn das Geschriebene dann „beleidigt wird oder ungerechterweise beschimpft, es immer der Hilfe seines Autors bedarf, da es selbst weder imstande ist, sich zu schützen, noch sich zu helfen“ (Phaidros 276e).
Dieses Letztere zeigt Platon im Theaitetos anhand des berühmten Satzes des Protagoras vom Menschen als „Maß aller Dinge“: Der Satz, bloß und erläuterungslos wie er eben geschrieben dasteht, kann nicht Rede und Antwort stehen, er ist eine dingfest gemachte Weltaussage und in dieser kondensierten Formfixierung, die nichts über den Sinn herausrückt, gleicht der Satz eher einer Geheimlehre, so dass man sich staunend fragen muss, ob vielleicht Protagoras nicht gar „überweise war, und die Sache zwar uns nur durch vielen Nebel dunkel angedeutet, seinen Schülern aber insgeheim das Eigentliche gesagt hat?“ (Theaitetos 152c). Wie ein MYTHOS (das Wort fällt dort) ist der Satz des Protagoras in einem schlechten Sinne ‚gläubig‘ und aus dem Vertrauen auf die Autorität des Verfassers heraus anzunehmen oder eben nicht. Befragen allerdings kann man ihn kaum. Den verstorbenen Verfasser nicht mehr und den Satz auch nicht, und damit muss man sich offenbar abfinden. Sokrates unternimmt es daher, den Spruch des Philosophen „wie ein Waisenkind“ zu bemuttern und sich um ihn zu kümmern, ihn zu verstehen zu suchen, zu beschützen und wie ein Vormund für ihn zu sprechen. Es ist eine Demontage des Protagoras, die damit erfolgt (Theaitetos 165e–168d), und die gezielte Bösartigkeit des Sokrates verfehlt ihre Wirkung auf die Zuhörer im Dialog keineswegs. Aus ihren Reaktionen lässt sich unschwer erraten, wie unangenehm es ihnen ist, dass Sokrates aus dem feierlichen Spruch des zu Lebzeiten gefeierten Sophisten – den einige der anwesenden Gesprächsteilnehmer persönlich gekannt und geschätzt haben – ein auf gütige fremde Hilfe angewiesenes und unverständlich brabbelndes Waisenkind gemacht hat, das Mitgefühl und wohlmeinende Nachsicht weit nötiger hat als die geistige Auseinandersetzung auf gleicher Augenhöhe. Was Platons Kritik am geschriebenen Wort meint, wird dadurch ebenso klar wie durch die etlichen Passagen etwa im Politikos und in den Nomoi, die nachvollziehbar davon sprechen, dass man nicht dem Buchstaben der Gesetze folgen soll, sondern ihrem Geist, denn, so möchte man fast ergänzen, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig.
Platon fand indes offenbar Wege, sich der Schrift zu bedienen, ohne der Statik des Buchstabens, der Verfügbarkeit durch den Leser und der Gefahr des wohlfeilen Gedankenverkaufs zu verfallen. Einer dieser Wege, und vielleicht der entscheidende, war die Dialogform, die er seinen philosophischen Werken gab. Die Lehrschrift des Anaxagoras konnte jeder Beliebige auf dem Marktplatz von Athen für eine Drachme in seinen Besitz bringen (so Apologie 26de). Wahrheit lässt sich aber nach Platon nicht besitzen und auch nicht wie Eigentum verkaufen, das ist schließlich die ständige Auseinandersetzung mit den Sophisten im Platonischen Werk, die sich dort als kostspielige Weisheitslehrer gerieren, als würden sie eine Fertigkeit veräußern und in Aussicht stellen, und wenn sie sich geäußert hätten, dann sei man mit der Weisheit eben fertig – oder wohl eher am Ende, würde Platons Sokrates mahnen. Sich hingegen der Gedanken Platons derart zu versichern, dass man sie sich aneignen kann, bedarf es weit größeren Aufwands, nämlich einer intensiven Aneignungsarbeit, die nicht allein darin besteht, das zu lesen, was der Autor schreibt, und es hinlänglich verstanden zu haben. Sondern vielmehr darin, das Entscheidende im Gesagten und Ungesagten aufzuspüren und in sich wirken und fortdenken zu lassen. Das ermöglicht der Platonische Dialog, in dessen singulärer Verarbeitungsform sich um der Besonderheit der SCHRIFTKRITIK willen auch bestimmte identifizierende Eigentümlichkeiten niederschlagen: Nichts scheint sich hier in feste Begriffe oder auch nur Thesen fassen zu lassen, selbst vermeintlich „typisch Platonische“ Schlagworte wie IDEE sind in den Dialogen bewusst unterminologisch gebraucht, mal haben sie einen spezifischen Sinn, mal einen anderen und oft genug nur einen ganz allgemeinen oder umgangssprachlichen. Es bleibt stets dem Leser überlassen, aus der Gesprächssituation heraus die passende Bedeutung zu wählen, und manchmal ist bei aufmerksamem Nachlesen die Wahl bloß einer der denkbaren Varianten ganz unmöglich. Wer sich je vorgenommen hat, griffig aus den Dialogtexten zu zitieren und welthaltige Einzelsätze herauszubrechen, deren Aussagen für sich stehen und sozusagen Platons ganze Philosophie emblematisieren sollen, Sätze, die es zulassen, „sich einen Reim auf das Ganze machen zu können“, der merkt schnell, wie geschickt sich der Text solchen Ansinnen entzieht. Das Schicksal des Spruchs des Protagoras soll eben gerade vermieden werden. Selbst vermeintlich Altbekanntes, wie der angebliche Ausspruch des Sokrates „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, lässt sich nicht dingfest machen, es sei denn, man zitierte wenigstens eine halbe Druckseite und lieferte dabei gleichzeitig noch das weitere Umfeld der Gedankenentwicklung mit. Platon mag u.a. deshalb nicht aus Zufall der erste antike Philosoph sein, dessen Werke uns offenbar in ihrer Gesamtheit erhalten sind: Die aller seiner Vorgänger sind nur noch in Bruchstücken überliefert, gerade weil sich ihre Hauptgedanken in der Auffassung der Doxographen augenscheinlich isolieren und in einer Art „Best of “-Sammlungen zusammenfassen ließen, die sich in späterer Zeit als handbuchartige Nachschlagewerke großer Beliebtheit erfreuten. Was tradiert wurde, war dann schließlich nur noch der Inhalt dieser Kompendien, nicht mehr die Gesamtinhalte der Originalschriften.
Dafür identifiziert man Platon gerne mit großartigen und detailreich referierten Bildern, wie etwa dem schon angesprochenen Höhlengleichnis, mit farbenfrohen und teilweise verstörenden Mythen, Metaphern und Allegorien, die alle ihrerseits dazu angetan sind, nichts Fixiertes zu sein, sondern ein phantasievolles Weiterspinnen des verbildlichten Gedankens anzuregen. Platon beschwört in seinen Dialogen kunstvoll Situationen und Gesprächsstimmungen herauf, die meist deutlich vermitteln, worum es geht, ohne dass es jemals eindeutig ausformuliert herausbenannt würde, und die das Denken immer wieder zu filigraner Verzweigung in Bereiche locken, die nie expressis verbis zur Sprache kommen. Diese Situationen und der Ton des Gesprächs bedingen nicht selten das Gesagte in entscheidender Weise: Wer bei der Lektüre des Phaidon etwa nicht begreift, worauf die Gesprächsentwicklung insgesamt abzielt, wird auch nicht erkennen können, warum einige der Argumente für die Unsterblichkeit der Seele nur angeführt werden, um sie bewusst scheitern zu lassen, und welche. Es sind eben zunächst gar nicht Platons Argumente, sondern die seiner Dialogfiguren, und nicht selten ist deren Verhalten ausschlaggebender als ihre Argumente, auch dafür bietet der Phaidon mit der Sokratesfigur des Dialogs ein Beispiel, von der ja Phaidon in der Rückschau ein ums andere Mal sagt, die Person habe ihn überzeugt, nicht einmal jedoch, die Argumente hätten es. Genauso gilt das für das Problem der Bewertung anderer Figuren: Die Mitunterredner des Sokrates im Phaidon und auch der Adressat des Rahmendialogs sind Pythagoreer (oder Schüler von solchen), und damit selbst Philosophen, die im Grundsatz die Auffassung von der wesensgemäßen TRENNUNG von Leib und SEELE vertreten und auch die von deren Weiterleben nach dem Tod. Über Auffassungen lässt sich streiten, nicht aber über Auffassungsgrundlagen, und somit führen die Dialogfiguren nicht selten ein ad hominem-Argument ein, was keine Entmündigung des Lesers darstellt, sondern die Argumentationsgrundlagen klärt, die das Gespräch erfordert. Bei Platon findet sich nirgends ein Satz wie: „Im Folgenden gehe ich davon aus, dass der Leser die Meinung oder Überzeugung teilt, dass …“. Das alles wird „undogmatischer“ über Dialogkonstellationen eingeführt, die sicherstellen sollen, dass sich der Gedanke in dieser schriftlichen Fixierung eben nicht frei verfügbar bei jedem herumtreibt, ob er ihn aufgrund seiner Überzeugungsfundamente und Aufnahmebereitschaft verstehen kann oder nicht: Er richtet sich in der Gesprächssituation ganz eindeutig an solche Menschen, die eine bestimmte Grundlage mitbringen und darauf aufbauend den Gedankengang zumeist vernünftig weiterzuführen imstande sind. Gottesbeweise lassen sich nur ad hominem führen, bemerkt dann Leibniz sehr viel später und spricht damit eine ganz ähnliche Einsicht aus, dass der Nullpunkt der Argumentation utopisch ist. Der Platonische Dialog geht tatsächlich genau davon aus: Statt im Wortsinn „utopisch“ überall und somit nirgendwo stattzufinden, hat er immer seinen „Sitz im Leben“, eine konkrete, möglichst alltägliche Situation, von der her er seinen Ausgang nimmt, und die ihn weiterhin trägt und beeinflusst. Die zahlreichen APORIEN oder „Sackgassen“, in die viele der Dialoge hineinführen, sind nicht zuletzt ein Reflex der ad hominem-Struktur, denn der erfolglose Abbruch des Gesprächs erweist sich oft genug als (mitunter recht späte) Folge der Unmöglichkeit einer Verständigung über letzte (oder eben erste) inhaltliche Grundlagen. Auch die Aporien werfen den Leser damit zurück auf die Frage nach diesen Grundlagen und führen zu einer anderen Form des Durchdenkens und Weiterdenkens als sie der geschriebene und im nachlesbaren Ergebnis gescheiterte Dialog geboten hat. Das Entscheidende ist dann gerade das nicht Geschriebene, das nicht schwarz auf weiß Verfügbare oder Fassbare, was letztlich jedem selbst obliegt.
Die Dialoge Platons wären somit als „Lehrschriften“ offenbar unzulänglich kategorisiert, sie sind weniger und doch gleichzeitig mehr. Von den (leider nicht erhaltenen) Dialogen, die Aristoteles geschrieben hat, wissen wir etwa, dass der Autor selbst in ihnen ganz massiv aufgetreten sein soll, dass die Dialoge als ein weitgehend unmissverständliches Sprachrohr seiner eigenen Grundthesen gelesen werden konnten und sollten, ähnlich wie später die Ciceros, die des Augustinus oder des Erasmus. Wie gesagt, bei Platon ist das nicht so. Seine Dialoge gleichen manchmal eher Schachspielen, die Persönlichkeiten sind wie Figuren des Spiels, jede mit ihrer möglichst selbstständigen Charakteristik, ihren Stärken und Schwächen und der Strategie, die sich daraus ergibt (so ähnlich legt es Platons Text aus Politeia 487b–c auch nahe). Platon setzt sie in den Dialogen wie Spielsteine ein, doch er hält sich an die Regel, sie im Rahmen der Spielentwicklung möglichst vollauf sie selbst sein zu lassen. So weiß man aus erhaltenen Fragmenten der Schriften von Polos, einem der Hauptunterredner des Gorgias, dass das, was Platon ihn vortragen lässt, im Wortlaut recht nahe an dem ist, was er als historische Person selbst geäußert hat. Das hat bedeutende Konsequenzen: Weil wir beispielsweise von Phaidon aus Elis wissen, dass er eine Philosophie betonter, man würde heute sagen: „Leibfeindlichkeit“ und „Lustabkehr“ vertrat und lehrte, lässt sich der straffe Leib-Seele-DUALISMUS des Dialogs Phaidon, der den historischen Phaidon zum fiktiven Erzähler hat und die Leib-Seele-Spaltung in einer im restlichen Dialogwerk nie wieder in dieser Pointierung geäußerten Weise ausspricht, vielleicht höchstens als „Platonisch“ in Anführungsstrichen mit starker Phaidonischer Färbung verbuchen. Der antike Leser zu Platons Zeiten wusste um die Ansichten des historischen Phaidon und also auch darum, dass die Sicht der Dinge im Dialog der Grundansicht des Phaidon über dieselben Dinge gleichförmig oder zumindest (vielleicht verdächtig) ähnlich erschien. Das ist weit mehr als bloße Rhetorik oder ein vernebelnder Kunstgriff, und eine ernstzunehmende Schwierigkeit tut sich hier auf: Die Interpretation und Analyse eines Gedankens oder Arguments unter rationalen Wahrheitskriterien bleibt immer eine der Hauptaufgaben philosophischen Denkens. Doch was Platon betrifft, scheint diese Hauptaufgabe nicht alles zu sein, und selbst wenn sie gelöst wäre, würde der Dialog mit dieser Lösung nur neue Aufgaben stellen. Der Interpret ist somit oft genug erst dann am Ziel, wenn ihn die Lösung seiner Hauptaufgabe zur Aufgabe zu zwingen scheint.
Nicht viel anders steht es mit der Aufmerksamkeit, die der Leser den unscheinbaren Nuancen der Formulierungen entgegenzubringen hat, die einem in den Übersetzungen so leicht unter der Hand verschwinden. So lässt sich die Entgegnung des jungen Sokrates auf die Ausführungen des großen Parmenides in Parmenides 131c: phainetai hutô ge, eben nicht einfachhin und wie oft leichtfertig übersetzt als Zustimmung deuten im Sinne von: „offenbar ja“ oder „ja, so scheint es“, so dass man als Leser beruhigt mit der Lektüre weiterfahren könnte. Vielmehr schränkt die unscheinbare enklitische Partikel ge das Gesagte ein und relativiert es in unnachahmlicher Weise, so dass man eher übersetzen müsste: „naja, so (wie du es jetzt sagst) will es ja nun allerdings auf einmal tatsächlich so scheinen“. Der Sinn ist, den Leser aufmerksam werden und ihn aufhorchen zu lassen, ihm klar zu machen oder ihn darauf hinzustoßen, dass vielleicht doch nur mit Vorbehalt zugestimmt werden sollte, und dass es am tunlichsten wäre, das bisher Gesagte noch einmal nachzublättern, über das dort Geschriebene hinaus zu bedenken und zu prüfen, sich nicht überstürzt auf eine Position einschwören zu lassen, ein paar Textseiten zurückzuschlagen und aufs Neue durchzulesen, wo denn Argumentations- oder Voraussetzungsschwächen liegen könnten, wo sich typische kleine Fehler mit enormer Fernwirkung eingenistet haben könnten. Der lebendige Dialog, in den Platon somit mit seinen Lesern tritt, ergibt sich zum guten Teil eben daraus, dass fast jede seiner Aussagen gleichzeitig ernstgenommen und ernsthaft überprüft werden will, dass der Leser an ihnen Anstoß nehmen und eigene Position beziehen soll, und doch steckt die Kunst Platons darin, dass man stets wissen zu dürfen glaubt, worin und womit es ihm ernst ist, worum es ihm eigentlich geht, obwohl und manchmal gerade weil er es nicht ausspricht, obwohl und gerade weil er zum offenen Umgang mit dem Geschriebenen herausfordert und mit dem Ernst spielt. In der alten griechischen Philosophie hat Platon deswegen vor allem zwei einander entgegengesetzte Deutungstraditionen gehabt: Einmal die der von ihm selbst gegründeten Akademie, die mit der Zeit als „Neue Akademie“ zu einer skeptischen Schule wurde, da, wie es noch Cicero scheint (Academica 2, 46), ja auch Platon nie einen eigenen Standpunkt vorgebracht, sondern nur die Standpunkte anderer gegeneinander gestellt habe, ohne dabei auf Wahrheitsanspruch zu pochen; und dann diejenige Richtung, die historisch als „Platonismus“ bezeichnet wird, und die aus Platons Schriften eine eigene platonische Philosophie herausarbeitet, fast wäre man versucht zu sagen: ein „System“. Es ist diese „dogmatische“ Schule, durch die Platon ein Nachleben zuteil wurde, wie es keinem anderen Philosophen jemals beschieden war (das vorliegende Lexikon wird darauf Bezug nehmen). – Für Platons „Spiel im Ernst“ spricht auch das, was Sokrates in Theaitetos 148d–151d erklärt: Er sei wie eine Hebamme, die bei der Geburt von Gedanken hilft, obwohl er es der Beurteilung anderer überlasse, ob die Geburten dann überlebensfähig sind; jeder der Gesprächsteilnehmer solle also prüfen, ob die Gedanken, die das Gespräch unter Leitung des Sokrates hervorgebracht hat, auch der Prüfung standhalten oder nicht vielmehr Fehlgeburten oder nur halbausgetragene Frühgeburten sind, die den Anforderungen des Lebens nicht widerstehen können, oder ob sie nicht vielleicht sogar (denn auch das gehöre zur Fertigkeit von Hebammen) von Sokrates vorzeitig abgetrieben wurden, ob es nicht Scheinschwangerschaften und die Kinder statt wahre Gedanken nur Dummheiten waren usw. Wachsam also solle man gegenüber der Kunst des Dialogführens sein, so wie der keineswegs immer sympathische Sokrates sie betreibe, denn solche Gesprächsführung erfordere Aufmerksamkeit und das Ansehen der Person, und offenbar lässt sich der eine von der Kunst des Sokrates zur Wahrheit verhelfen, der andere zu „Mondkälbereien“ (wie Schleiermacher so nett übersetzt), der eine erweise sich da als aufnahmebereit zum Guten, der andere aber nicht.
Die Wahl der Person und dessen, was er sie auf welche Weise sagen lässt, entspricht also zum guten Teil Platons caveat an den Leser, nicht zu glauben, man könne etwas wie „Platons reine Lehre“ tel quel und mit dem Dialog in der Tasche schwarz auf weiß nach Hause tragen. Man kann dieses Verschwinden Platons in und hinter den eigenen Dialogtexten vielleicht im Anschluss an einige neuere Deutungen am ehesten mit der Auflösung der Zentralperspektive in der Malerei vergleichen. Das perspektivische Malen platziert die Gegenstände in Ordnung auf das „Sehfenster“ des Künstlers hin, auf das alles zu konvergieren scheint: Was in Blickrichtung rechts des Malers steht, wird rechts gemalt, was weiter hinten, kleiner oder verschwunden hinter Objekten im Vordergrund, die deutlich größer und schärfer wiedergegeben werden usw. Wer das Bild richtig sehen will, der muss auf dem Punkt stehen, auf dem der Maler während der Arbeit gestanden hat. Realistisch, würde man nach modernen Maßstäben wohl sagen, doch entspricht das nicht Platons Absichten, denn hier wird eine Perspektive, ein Standpunkt auf die Dinge festlegend aufgezwungen. In der Politeia (596de) beschreibt Platons Sokrates einen solchen Realisten: Es ist ein Mensch, der mit einem Spiegel durch die Welt läuft und ein Künstler zu sein behauptet, da er doch alles natürlich, will sagen mit einem Höchstmaß an Realismus, abbilden könne. Platons Vorstellung von der Darstellungskunst sieht offenbar anders aus: Das Wesen der Sache gilt es erst zu begreifen, dann darzustellen; das „Wesen von etwas“ sei der eigentliche Naturbegriff, der „naturalistische“ nur der abgeleitete. Und so ist der Dialog kein unmittelbarer Reflex dessen, was sich dem Autor darstellt, gewissermaßen wie aus der Zentralfensterperspektive auf die Welt, sondern eher eine Reflexionsleistung, in der das Wesentliche der Situation oder eben der Dialogteilnehmer mit ihren Thesen und Gegenthesen herausgearbeitet wird, und somit das Eigentliche oder Wesentliche daran, und bestenfalls an der Welt. Ein jedes soll, so legt es der Darstellungsversuch Platons nahe, seine Selbständigkeit im Dialog behaupten, ohne von der Interpretation auf den Standpunkt des Autors hin allein schon deswegen abzuhängen, dass er der Autor ist, und in den Hintergrund zu rücken, verstellt zu werden oder eine Position „links“ oder „rechts“ nur dadurch zugewiesen zu bekommen, wie sich der Standpunkt zum Betrachter ergibt, auch wenn sich Platon freilich einige Bösartigkeiten in der Darstellung dadurch nicht verbieten lässt. Allerdings zeigt die in der Politeia vorgetragene Ansicht über die rechte Art der Darstellung auch, dass eine Wesensschau vorausgegangen sein muss, dass mithin das, wozu die schriftliche Fassung von PHILOSOPHIE allein nie dienen kann, erreicht sein muss, bevor die Schrift zur Sprache kommen darf. Schreiben also sollte man als hilfreiche Abstiegsbewegung, wenn man keine Zweifel mehr haben muss, dass man das Wesen selbst aufweisen kann und somit gerade nicht mehr eine eigene Erkenntnis, sondern die Dinge „wie sie sind“, will sagen: wie sie wesentlich sind. Im Ausgleich dazu, dass die Dialogtechnik Platons den „Nullpunkt“ der Argumentation als im schlechten Sinne utopisch aufgibt, holt dieselbe Technik damit das philosophische Anliegen des angesprochenen utopischen „Nullpunkts“ der Argumentation auf ganz andere Weise wieder ein: Ihre Auflösung der auf den Standpunkt des Autors hin konvergierten Zentralperspektive eröffnet der Darstellung der Gedanken und dem Zugriff des Lesers auf sie in gewisser und den Ausstattungen der Vernunftfähigkeit angemessener Weise den berühmten „Blick von Nirgendwo“ auf die Wirklichkeit, der nun wieder eine der epistemischen Vorzugsutopien von Philosophen allgemein ist.
Vielleicht darf man vermuten, es ginge Platon also noch nicht einmal darum, „richtig verstanden“ zu werden, was sonst das Lieblingstrauma von Autoren und Rednern ist. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass es ihm offenbar auch nicht darum geht, dass wenn man, was er schreibt, nur richtig verstünde, man auch die Wahrheit richtig sehen würde (wie das auffällig oft zum Beispiel bei Kant-Experten der Fall zu sein scheint, die gerne behaupten, wenn man Kant nur recht verstehen würde, dann würde man auch verstehen, dass er recht hat). Vielmehr geht es im Dialog darum, durch den Dialog zu einem Verständnis der Wahrheit zu kommen, ob man Platon selbst dabei versteht oder missversteht ist nebensächlich. „Kümmert euch nicht so sehr um den Sokrates, sondern weit mehr um die Wahrheit, und wenn es euch scheint, ich sagte etwas Richtiges, dann stimmt mir zu, wenn aber nicht, dann gebt mir nur möglichst Kontra, damit ich nicht im Eifer des Gefechts mich und euch zugleich betrüge“, sagt Platons Sokrates bezeichnenderweise in Phaidon 91c.
Gleich im Anschluss an seine Schriftkritik im Phaidros lässt Platon seinen Sokrates aber auch erzählen, wie man, wenn überhaupt, philosophisch schreiben könne und solle. Er tut es, was wunder, in einem Bild: Die Leute hätten den spielerischen Brauch, bevor es Jahr für Jahr an die Aussaat auf den Feldern ginge, kleine sog. Adonisgärtchen anzulegen, indem sie Proben aus dem Saatgut in eine Art Blumenkästen pflanzten, betrachteten, wie die Saat in kurzer Zeit aufginge, und sich daran freuten, es wohl auch für ein gutes Omen nähmen. Erst dann gingen die Bauern an die ernsthafte Arbeit und säten auf den Äckern, wo die Saat dann nach Monaten erntereif stehe. Die Schrift, so Sokrates, sei wie dieses Spiel mit den kleinen Gärten: Man könne mit ihr wohl im Kleinen und spielerisch erproben, was man im Ernst und lebensentscheidend eigentlich betreiben solle. Das Ausschlaggebende aber sei, was man sich in die Seele schreiben und was sich nicht in Buchstaben fixieren lasse. Ein Spiel von der Art versucht anscheinend der Platonische Dialog. Er zeigt, wie eine Auseinandersetzung um philosophische Themen aussieht, ohne jedoch für sich in Anspruch zu nehmen, das Eigentliche in der ihm angemessenen Tiefe preiszugeben oder schriftlich auch nur preisgeben zu können – und schon gar nicht, es aufdrängen zu wollen. Er zeigt in langer Ausarbeitung Richtungen auf und tippt erwägenswerte Gedanken an, aber er führt sie nicht aus und zu Ende, er gibt keine Patentantwort, mit der man zufrieden sein und die man einmal gelesen und verstanden beruhigt zwischen Buchdeckeln begraben könnte. Beruhigung ist das Gegenteil von Platons philosophischer Pädagogik. Der Dialog ähnelt einem Raubtierkinderspiel, das teilweise auch wie Ernst aussieht, aber doch immer dort abbricht, wo es ernst wird, gleichzeitig jedoch auf den Ernst vorbereitet, denn beim Jagen und Kämpfen werden die ausgewachsenen Raubtiere nichts anderes tun als die Kleinen im Spiel, nur eben im Ernst und es wird dabei ums Leben gehen. Das Raubtierkinderspiel ist daher ein Spiel, aber eben nicht nur ein Spiel, und Ähnliches gilt für die geschriebene Philosophie Platons. Was das Spiel lehrt, dann umzusetzen, ist Philosophie, der Dialog selbst ist ein philosophisches Spiel, aber eben nicht nur. Der Leser der Dialoge muss sich also damit zufrieden geben, dass er hier für die Platonische Philosophie trainiert wird und sozusagen das Rüstzeug zum Selberdenken vermittelt bekommt. Das Spielerische im Ton und in der Gangart der Dialoge ist also alles andere als zufällig, alles entspricht hier der Überzeugung, dass paideia, Bildung, und paidia, kindliches Spiel, sich gegenseitig bedingen, ohne dass man sie durcheinanderwerfen und für dasselbe halten solle (Theaitetos 151b–c).
Diese Schriftlichkeitskritik Platons hat verschiedene Deutungsversuche hervorgerufen. So wird häufig davon ausgegangen, seine Dialoge seien im Sinne der literarischen Gattung des logos protreptikos aufzufassen, wie eine „Werbeschrift“, die über die Themen, nicht aber über die Antworten Platonischer Philosophie anstoßhalber Auskunft geben und somit auch Interessenten an die Akademie ziehen sollte. Es kann wohl schlecht bestritten werden, dass Platons Schriften vielleicht auch diesen Zweck verfolgten. Und wirklich wird ja im Platonischen Dialogwerk ein paar Mal darauf angespielt, dass andere Philosophen es tatsächlich so machten, dass sie das Wesentliche für sich behielten und es nur ihren Schülern sagten (so wieder über Protagoras in Theaitetos 252c) – doch ist hier scheinbar eine ganze Menge Ironie im Spiel und die innere Gegnerschaft Platons zu den in solchen Zusammenhängen genannten Philosophen ist notorisch. Darüber, ob es eine innerakademische Lehre der Art gegeben habe, dass sie als „Fortsetzung oder Schlußstein der schriftlichen Mittheilungen“ Platons betrachtet werden dürfe, tobt der Streit nicht erst, seitdem Karl Friedrich Hermann im 19. Jahrhundert diese Frage stellte.
Der angelsächsische Philosoph R.M. Hare emblematisiert eine andere Interpretationsrichtung, die als Reaktion auf die verwirrende Textlage bei Platon den „literarischen“ Mythenerzähler und Moralisten („Laton“) von einem spürbar „philosophischeren“ Erkenntnistheoretiker und glänzenden Logiker („Paton“) methodisch zu trennen versucht, um die Gedanken des einen mit Genuss zur Kenntnis zu nehmen, die des anderen mit seriösen Denkmitteln zu durchdringen. Eine abgeschwächte Variante dieser Deutungsrichtung, die in ihrer aggressivsten Spielart in Platons Schriften den Beleg sehen will, wie schlechte Philosophie gute Literatur ergeben kann, legt den Finger auf die spürbare Entwicklung seines Denkens zwischen den heute als „früh“ und als „spät“ anerkannten Dialogen und versucht daraus ihre Schlüsse zu ziehen, wobei zumeist das Spätere als philosophisch hochwertiger oder „interessanter“, jedenfalls als reifer veranschlagt und dann deshalb v.a. von dorther der Standpunkt auf Platons Philosophie als Ganze erklommen wird. Ihr gegenüber steht, wie könnte es anders sein, ein Interpretationsbekenntnis, das in allen Dialogen eine fertige Philosophie im Hintergrund erkennt, die erst graduell und in vorsichtig pädagogisch aufbauender Gewöhnung des Lesepublikums expliziter hervortritt. Dieser Entwicklung hin zum Expliziteren entspräche dann der außerordentliche Implikationsreichtum auch der bereits „frühesten“ Schriften, deren gezielte Aporien, Abbruchstellen und lose Enden ohne den fertig durchdachten Gedanken so nicht komponiert hätten werden können. Da die heute gängige, wenn auch keineswegs unumstrittene Periodisierung der Dialoge Platons in drei oder vier chronologische Gruppen auch in zahlreichen Lemmata dieses Lexikons eine Rolle spielt, sei sie hier kurz zur Orientierung angedeutet. Zu den „frühen“ Dialogen zählt man gerne Apologie, Charmides, Kriton, Euthyphron, Hippias Minor, sodann Alkibiades, Hippias Maior und Theages (die bei einigen jedoch als pseudo-platonisch gelten), Ion, Laches, Lysis und Menexenos; zu den Werken der sich daran anschließenden „Übergangszeit“ werden Euthydem, Gorgias, Menon und Protagoras gerechnet; als „mittlere“ Dialoge bezeichnet man zumeist Kratylos, Phaidon, Symposion (das „Gastmahl“), Politeia (der „Staat“), Phaidros, Parmenides und Theaitetos; während Timaios, Kritias, Sophistes, Politikos, Philebos und Nomoi (die „Gesetze“) als „spät“ angesehen werden.
Bekannt geworden unter dem Namen „Tübinger Schule“ ist der Interpretationsvorschlag, bei Platon eine UNGESCHRIEBENE LEHRE anzunehmen, die seine systematische Philosophie hinter den Dialogtexten bilde und den eigentlichen, aber nicht nach außen verbreiteten Lehrinhalt der akademischen Schule darstelle. Diese „esoterische“ Platoninterpretation hat zahlreiche Befürworter gefunden und vor allem die Diskussion darüber, ob und in welchem Ausmaß die „innere Lehre“ der Platonschule noch zu rekonstruieren sei, scheidet seit Jahrzehnten die Geister. (Der „Ungeschriebenen Lehre“ ist daher als einem der ganz wenigen Ausdrücke, die nicht selbst bei Platon vorkommen, ein eigenes Lemma dieses Lexikons gewidmet.) Je nachdem, ob man davon ausgeht, dass Platon das Wesentliche seiner Philosophie bloß nicht gesagt hat oder schlicht nicht sagen konnte, ob es also an ihm lag oder an der Sache selbst, sehen andere in den Dialogen die Grenze der Sprachlichkeit im Vordergrund: Nicht exakte Darlegung, sondern das Erzeugen einer Grundhaltung, die sich daraus ergibt, dass man sich auf Platons Denken einlässt, sei der Sinn Platonischen Schreibens. Es handle sich nicht um Wahrheiten extensiver Tendenz, die nach Verbreitung schreien, sondern um solche intensiver Art, die nicht nur nicht schriftlich, sondern gar nicht sprachlich gefasst werden können. Höchstens erzeugt. Dieser Deutungsrichtung kommt eine Passage aus dem Siebten Brief zu Hilfe (Ep 7, 341a–d), die hier den fast schon poetischen Abschluss dieses Überblicks zum Platonischen Schreiben bilden soll: „Das zumindest kann ich wahrlich über alle verkünden, die darüber schon geschrieben haben und noch schreiben werden und die zu kennen behaupten, worum ich mir Mühe mache, ob sie es nun von mir gehört oder von anderen oder selbst herausgefunden haben wollen: Die können nach meiner Auffassung von der Sache nichts verstehen. Es gibt ja auch von mir darüber keine Schrift und kann auch niemals eine geben; denn es lässt sich keineswegs in Worte fassen wie andere Lerngegenstände, sondern aus häufiger gemeinsamer Bemühung um die Sache selbst und aus dem gemeinsamen Leben entsteht es plötzlich – wie ein Feuer, das von einem übergesprungenen Funken entfacht wurde – in der Seele und nährt sich dann schon aus sich heraus weiter“.
3. Das Lexikon zu Platon: Ein Lexikon zu Platon darf daher nicht unbefangen angegangen werden. Die Probleme, die sich aus Platons Haltung zur Schrift und der Dialogform seiner Werke für die Erstellung eines Lexikons ergeben, liegen auf der Hand, und wer zu diesem Lexikon greift, soll wissen, was es gemessen an den traditionell hohen Erwartungen an ein Lexikon leisten kann und was nicht. Es darf also zufürderst nicht einfachhin davon ausgegangen werden, dass es immer „Platon selbst“ ist, der da spricht, die Dialogsituation und Gesprächsdynamik, schließlich auch die Eigenständigkeit der Dialogcharaktere stünden so einer platten Annahme entgegen. Wo immer man „Platon sagt“ oder „Platon schreibt“ liest, ist das letztlich eine abkürzende Redeweise, vergleichbar den pyrrhonischen phonai, in welchen die Kurzformel elliptisch für die umständlichere und in ihrer Ausführlichkeit eigentlich adäquatere Formulierung steht. Der Ton des Platonischen Gesprächs ist oft genug bewusst umgangssprachlich gehalten, Fachterminologie wird dabei zumeist vermieden, er ist in einer kunstvoll konstruierten Dialogsituation bewusst adressatenspezifisch formuliert, der fingierte „Sitz im Leben“ alles Gesagten unterstreicht das Unspezifische und Kolloquiale der Wortwahl, und wo einmal spezifisch Fassbares auftaucht und Wissenschaftssprache bemüht wird, verbleibt das fast ausnahmslos in einer eigenartigen Ambivalenz gegenüber der Normalsprache und spielt gewollt mit Mehrdeutigkeiten im Hintergrund. Wer spricht, in welcher Situation, aufgrund welcher Gesprächsentwicklung oder Kontexteinbindung und generell im Hinblick auf was, markiert das Gesagte auch inhaltlich und beeinflusst mitunter entscheidend die Art und Weise, wie es zu lesen (und weiterzudenken?) ist. Schließlich bleibt der Platonische Dialog aus den oben angegebenen Gründen auch weitgehend zitatresistent, er sperrt sich gegen griffige Fassungsversuche und erfordert, lange Paraphrasen und die Fährnisse der Deutung auf sich zu nehmen, wenn man denn überhaupt etwas „textnah“ wiedergeben will.
Auch die so häufig gewählte Vorgehensweise philosophischer Platondeutung, die im sorgfältig durchdachten Dialogverlauf als Versatzstücke eingebauten Einzelargumente der Platonischen Dialoge herauszubrechen und auf Stichhaltigkeit zu überprüfen als stünden sie als Argumente für sich selbst, erweist sich für ein Platon-Lexikon als problematisch, so interessant und geistig stimulierend solche Auseinandersetzungen über eigentlich kontextverwiesene Einzelthemen auch unbestreitbar sind. Denn gerade dass Platon in den Dialogen Argumente einstreut, um sie dann bewusst zum Scheitern zu bringen, lässt es als äußerst fragwürdig erscheinen, hier von „Platonischen“ Argumenten und Gedankenentwicklungen zu reden, und was Platon da schreibt, ist in vielen Fällen offenbar nichts, was ein Lexikon zu Platon als Wort für Wort genuin „Platonisch“ verbuchen dürfte. Man muss sich also darauf beschränken, sich auf den Dialogzusammenhang und den Gesamtzusammenhang Platonischen Denkens, sofern er für uns aus dem Werk spricht, einzulassen und zu berufen, um somit bestenfalls „Platonische Themen“ zu isolieren, die sich dann jeweils in Lemmata eines Lexikons fassen lassen.
Die Voraussetzungen, ein Begriffslexikon zu Texten dieser Art zu erstellen, sind also denkbar schlecht. Der Weg, der sich bei all diesen Widerständen und angedeuteten Problemen als gangbar erwies und letztendlich zur Zusammenstellung des vorliegenden Lexikons führte, war folgender: Den Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Fachrichtungen wurden zumeist je nach ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Schwerpunktsetzung solche Lemmata angetragen, die miteinander in innerem Zusammenhang stehen, damit sie diese nicht isoliert, sondern als Gesamt und sachlich untereinander in Verbindung stehend behandeln können, damit sie oder er die Verweiszusammenhänge selbst herstellen und wo nötig quantitative Verschiebungen von einem Stichwort zum anderen bei gleichbleibender Gesamtseitenzahl aller ihrer oder seiner Artikel selbst in der Hand habe. Solche Lemmatagruppen mit gemeinsamem Autor sind etwa: DÄMON – JENSEITS – UNSTERBLICHKEIT oder DEMIURG – MATERIE – RAUM – ZEIT. Thematische Überschneidungen, etwa zwischen den Stichwortartikeln DIHÄRESE und DIALEKTIK oder NACHAHMUNG und DICHTUNG, waren dabei mitunter unvermeidlich, sollen aber auch zur Kompaktheit des Lexikons beitragen. Gemäß den Vorgaben des Verlags sollten die Lexikoneinträge die zentralen Termini erläutern und analysieren, exegetische Streitpunkte benennen, sie im historischen Kontext verankern und ausführliche Textverweise bieten. Außerdem war es gerade im Hinblick auf die Probleme der Platonischen Dialogform das Ziel, jedem Stichwort-Artikel genug Raum für eine adäquate Darstellung einzuräumen, ohne dass die Platznot allzu grobe Verkürzungen oder grausam schmerzliche Vereinfachungen der Begriffsverwendung oder des Forschungsstands aufzwingen würde. Daher wurde der Überlegung der Vorzug gegeben, besser einige Lemmata einzusparen, um den anderen, dann allerdings wenigeren, mehr Umfang geben zu können und somit eine tiefere und angemessenere Bearbeitung zu ermöglichen. So wurde dabei auch in Kauf genommen, dass interessante und bisweilen pittoreske Lemmata zugunsten philosophisch bedeutsamerer ausgespart werden mussten: „Ironie“, „Atlantis“, „Tod“ oder „Geschichte“ etwa, während man sich für andere ausgebliebene, wie „Herrschen/Herrschaft“, auf POLIS und ANFANG (als politische archê) verweisen lassen muss. Dadurch ergab sich in einigen seltenen Fällen, dass bestimmten Lemmata, die andere subsumieren, breiterer Raum zugestanden wurde, also z.B. IDENTITÄT, worunter die schwierige Frage der megista genê verhandelt wird. Da sich das Lexikon neben Platon selbst vor allem auf die nach-Platonische philosophische Tradition konzentriert, ist auch auf die Hereinnahme einiger „vorplatonischer“ Begriffe, die durchaus bei Platon auftauchen, jedoch keine ausschlaggebende Rolle mehr spielen, verzichtet worden, so etwa auf „Element“ und ähnliche „physikalische“ Termini; das Nötige dazu ist unter RAUM, DEMIURG oder sachverwandten Lemmata zu finden. Durch die relative Länge der Artikel und die auch für ein philosophisches Wörterbuch untypische Bandbreite in den Schreibstilen sowie in den Herangehens- und Bearbeitungsweisen durch die Autoren – angefangen mit der Einbindung von Primärtexten und Sekundärliteratur bis hin zur inneren Abschnittsfolge und -aufteilung – mag der vorliegende Band daher streckenweise vielleicht eher einem „Companion“ gleichen als einem Lexikon. Hoffentlich nicht zum Nachteil des Ganzen und, wenn das nicht zu viel zu wünschen ist, in mancher Hinsicht vielleicht sogar zum Vorteil.
Angesichts der Eigenarten und des Status des Geschriebenen bei Platon wurde auch das ursprüngliche Vorhaben der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, das Lexikon als ein Begriffswörterbuch zu Platon und dem Neuplatonismus in einem zu publizieren, nach Absprache mit dem damaligen Verlagslektor Dr. Bruno Kern und dank seines fachlich versierten Entgegenkommens als zu groß angelegt und innerlich zu heterogen verworfen. Dennoch sollte aus demselben Grund die platonische Tradition nicht vernachlässigt, sondern als entscheidender Bestandteil unseres heutigen Platonbildes mitverrechnet werden. So erhielt mit wohlerwogener Absicht (nahezu) jeder Stichwortartikel zum Abschluss einen summarischen „Ausblick“ auf die Tradition nach Platon, wobei innerhalb der von typischer Platznot diktierten Rahmenvorgabe, vordringlich und wenn möglich ausschließlich die wichtigsten Vertreter des paganen griechischen Platonismus zu behandeln, auch hier wieder die quantitative Gewichtung und Auswahl der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor überlassen blieb. Sinn dieses Ausblicks am Ende jedes Stichwortartikels ist es, die bei Platon aus den angedeuteten Gründen so unterminologische Verwendung der Begriffe in ihrer traditionellen Weiterentwicklung darzustellen. Damit sollte es ermöglicht werden, die Erstarrung der Platonischen Termini in der Überlieferung seiner Nachfolger nachzuvollziehen, die keineswegs mehr more platonico schrieben, sondern Lehrschriften und Auslegungswerke verfassten, Meditationen, Kommentare oder Ähnliches, also die Platonische Art zu schreiben aufgaben. Das brachte eine Gerinnung der platonischen Sprache zur Fachterminologie mit sich, die so bei Platon eben gerade nicht zu finden war, aber auf die Folgezeit mächtige Wirkung hatte, weswegen man mehrheitlich davon sprechen kann, dass die herkömmlichen Auffassungen von Platonischer Philosophie eigentlich platonischer Philosophie entsprechen, angefangen von allgemeinen Vorstellungen (etwa über den anthropologischen Dualismus) bis eben zur philosophischen Terminologie, die für gewöhnlich als platonische in der Deutung Platons als „typisch“ Anwendung findet. Aus demselben Grund übrigens wurden einige Begriffe, die bei Platon nicht oder so nicht auftauchen, in dieses Lexikon mitaufgenommen: Ungeschriebene Lehre etwa, Religion, Dualismus und Dritter Mensch. Getragen wird diese Vorgehensweise zum guten Teil von der Erfahrung, dass man den unterminologischen Platon von seiner stark terminologisch geprägten und manchmal geradezu kanonisch gebundenen Überlieferung durch den Platonismus kaum mehr losketten kann, und dass es umgekehrt die beste Annäherung an den Platonischen Text sein könnte, sich der Tradition, durch die er auf uns gekommen ist, aus aktiver Aneignung und intensiver Beschäftigung bewusst zu werden. Das trägt dann auch der Tatsache Rechnung, dass die Aufgabe, Platon zu lesen, zum guten Teil darin besteht, den Standpunkt des heutigen Lesers mitzuverrechnen, einen Standpunkt, der seinerseits aus einer jahrhundertelangen Tradition des Platonlesens hervorgegangen ist und von dem nach menschlichem Ermessen offenbar kein rechter Weg mehr zurück zum status innocentiae führt – falls es den in der Lektüre Platonischer Werke jemals gegeben haben sollte. Denn was weiter oben über die Eigenheiten und Eigentümlichkeiten Platons als Autor schriftenkritischer Schriften gesagt wurde, legt unmissverständlich nahe, dass es bei ihm mit einem solchen „unschuldigen Lesen“ so seine Bewandtnis hat. Ob es möglich ist, noch jemals Platon per se zu lesen, ist denn doch sehr fraglich. Das macht die philologische Aufgabe, von einem Verständnis quoad nos aus immer wieder den Weg über den Platonismus zu den Quellen zu gehen, nicht müßig, sondern umso interessanter.
In den genannten Punkten unterscheidet sich das vorliegende Lexikon deutlich von seinen Vorgängerwerken, auf die es in vielen Hinsichten allerdings auch dankbar aufbaut und auf die es Bezug nimmt. Sie waren ihm in vielen Einzelfragen auch ein Vorbild in der Einfachheit der Handhabung. Dass diese zwar angestrebt war, jedoch leider nicht selbsterklärend ist, hängt mit einigen Besonderheiten zusammen, die im Folgenden noch kurz erwähnt werden sollen.
4. Zur Handhabung des Lexikons: Den verschiedenen Verfasserinnen und Autoren der Lemmata wurde für ihre Arbeit an den Stichwort-Artikeln möglichst großer Freiraum gewährt, so dass jeder ihre jeweils eigene persönliche oder fachspezifische Herangehensweise und Kompetenz als Fachgrößen des bestellten Gebiets widerspiegelt. Dafür wurden auch gewisse Inkongruenzen etwa in der Binnengliederung der Stichworttexte und im Umgang mit der Sekundärliteratur hingenommen. Die Verfassernamen finden sich am Ende jedes Artikels und noch einmal in vollständiger Auflistung am Ende des Lexikons. Auf ungebräuchliche Abkürzungen wurde im Sinne eines breiteren Lesepublikums genauso verzichtet wie auf griechischen Text. Werktitel Platons werden nach dem vorangestellten Abkürzungs-Schlüssel mit Angabe der Standardzählung gemäß der Stephanus-Paginierung zitiert, alle weiteren antiken Werke sind mit vollem Titel angeführt, die Standardausgaben verzeichnet die Bibliographie unter „Primärliteratur“. Moderne Sekundärliteratur wird in Anlehnung an die angelsächsische Konvention mit Autorennamen und folgender [eckig eingeklammerter] Jahreszahl des Werks sowie daran anschließender Seitenzahlangabe angeführt. Wo in den Texten wörtlich zitierte Platon-Stellen aus den gängigen deutschen Übersetzungen von Schleiermacher, der Apelt- oder der Heitsch/Müller-Ausgabe verwendet wurden, ist die alte Rechtschreibung belassen worden, für selbst übersetzte Zitate wurde die neue Rechtschreibung zugrunde gelegt. Griechische Wörter und Phrasen werden stets translitteriert, wobei nach üblich gewordenem deutschen Standard ν = y; η = ê; ω = ô; γγ, γξ = ng, nx; oν = u; usw. Verweise zwischen den Lemmata sind jeweils durch verkleinerte Versalschreibung des Wortes, auf das verwiesen wird, kenntlich gemacht.
Gerade das Bestreben, die Handhabung des Lexikons einfach und gebrauchsfertig zu halten, machte die Arbeit an der Erstellung und Formatierung des Lexikons besonders zeitraubend und schwierig. Um den (gewünschten) Eigenheiten und verschiedenen Bearbeitungsansätzen möglichst vieler Einzelartikel gerecht zu werden und dabei dennoch eine gewisse Konstanz der Formatierung zu erreichen, musste manchmal wie bei der Geschichte von dem Vater und dem Sohn der Esel mit den Füßen an einem Ast aufgehängt über der Schulter den steinigen Weg entlang getragen werden. Ich möchte daher abschließend nicht versäumen, dem Verlag meinen Dank dafür auszusprechen, dass ich in Person von Dr. Bruno Kern und seinem Nachfolger im Lektorat Philosophie, Dr. Bernd Villhauer, stets wohlgesonnene Ansprechmöglichkeit fand und mir vieles ausnahmshalber zugestanden und anderes erlassen wurde, was beides die Arbeit an diesem Lexikon vereinfachte und erträglicher machte. Die DFG hat die Finanzierung der Stelle einer Studentischen Hilfskraft für das Lexikonvorhaben ermöglicht, in Herrn cand. phil. Christopher Franke habe ich dank dieser Großzügigkeit einen fleißigen und kompetenten Mitarbeiter bei der Erstellung der jetzigen Gestalt des Buches gefunden. Frau stud. theol. Veronika Bogner und Frau stud. theol. Iris Rechtsteiner sei für die Mühe in Korrektur und Formatierung der Texte gedankt, Frau Eleni Gaitanu für ihre Arbeit an den Indices. Für die Korrekturen und Ergänzungen in der zweiten Auflage hat Frau stud. phil. Elisabeth Handel unschätzbare Hilfe geleistet.
Alles in allem jedoch gilt auch für dieses Buch, was Goethe (über ein ganz anderes Vorhaben) auf seiner Italienischen Reise geschrieben hat: „So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das möglichste getan hat“.