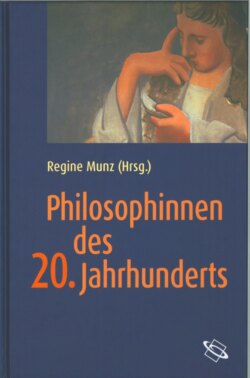Читать книгу Philosophinnen des 20. Jahrhunderts - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EDITH STEIN Kontingenz im Spannungsfeld von Ontologie und Phänomenologie
ОглавлениеVon HANNA-BARBARA GERL-FALKOVITZ
1. Vita
Herkunft und frühe Jahre
Die Spur des Besonderen hebt früh an.1 Schon der Mutter war die Geburt des elften Kindes am jüdischen Versöhnungsfest (Yom Kippur), damals 12. Oktober 1891, auszeichnend. Breslau, Geburtsort Edith Steins, besaß eine starke jüdische Gemeinde.2 Beide Eltern entstammten kinderreichen Familien aus dem schlesischen Kleinbürgertum, die allerdings um die Jahrhundertwende durch Studium und wachsenden Wohlstand mittelständisch wurden.
Das Mädchen wächst vaterlos auf; es ist eindreiviertel Jahre alt, als Siegfried Stein (1843 – 1893), Holz- und Kohlenhändler in Breslau, plötzlich stirbt. So übernimmt die Mutter Auguste (1849 – 1936), geb. Courant, das Geschäft. Das Bild dieser starken Frau, die ungelernt mit erstaunlichem Erfolg in die Arbeit einsprang, hat Stein später bei der Konzeption der weiblichen Arbeitswelt und vor allem bei der Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geleitet, ebenso bei den Thesen zur leiblichen und geistigen Mutterschaft. Auguste Stein besaß als tragenden Grund eine verhaltene, selbstverständliche Frömmigkeit; dennoch wuchsen die Geschwister Stein bereits, wie ihre gesamte Generation, in ein liberal-preußisches Kulturbürgertum hinein. Steins Autobiographie Aus dem Leben einer jüdischen Familie (1933) zeichnet nur noch wenige religiöse Gebräuche nach, die vorwiegend auf Festtage beschränkt blieben.3 Sichtbar wird stattdessen die unaufhaltsame Assimilation an die liberale deutsche Kultur, das unbefangene Abwerfen der religiösen Resttradition.
Ethische Entschiedenheit, Bedürfnislosigkeit und Selbstdisziplin sind als grundlegendes familiäres Erbe anzusehen. Von der „klugen Edith“, die den Kindergarten verweigert, über ihre erstklassigen schulischen Leistungen und das Abitur 1911 als Prima der Klasse, schließlich bis zur glänzenden Studienzeit und Promotion 1916 geht ein geradliniger, kaum gehemmter Weg. Hervorstechend ist eine rasch und gründlich aufnehmende Intelligenz, allerdings neben zeitweiliger Verschlossenheit. Stein wird in der Autobiographie die Gefährdung dieser jugendlichen Phase, die sogar eine gewisse Lebensmüdigkeit einschließt, mit Freimut ansprechen. Schon die Gymnasiastin wendet sich andererseits aktiv den Idealen der Frauenbewegung zu, während sie sich der Religion vollständig entfremdet. Das leichte Abstreifen des Betens im Alter von 14 Jahren ist bezeichnend, weil sich daran das Gesetz ihrer ganzen Generation ausdrückt: statt einer unverstandenen Tradition anzuhängen lieber aufrichtig in einem keineswegs unangenehmen Vakuum zu stehen.
Der erste Eros: Philosophie
Das – erstmals dieser Frauengeneration mögliche – Studium führt Stein zu inneren Durchbrüchen. Sie belegt in Breslau im Sommer 1911 Germanistik, Psychologie und Philosophie – Letztere der kritischen Studentin etwas zu flach. Als sie auf Edmund Husserls Logische Untersuchungen (1900 / 1901) stößt, bieten sie ihr den lang gesuchten intellektuellen Anreiz: eine „Klärungsarbeit“ und einen voraussetzungslosen, streng kontrollierten Beginn der Reflexion. Beim Wechsel nach Göttingen im April 1913 zu Husserl kommen ihre Intellektualität, ihr Streben nach Selbststand, ihre Durchsetzungskraft rasch zu Wort. Stein hat schon in diesen Anfangsjahren etwas erstaunlich Zielgerichtetes und Willensbetontes bei großer rezeptiver Kraft. So führt sie sofort das Sitzungsprotokoll der Göttinger Philosophischen Gesellschaft4.
In Göttingen 1913 / 1914 tauchen lebenslange Freunde am Horizont ihrer phänomenologischen Studien auf: Adolf und Anne Reinach, Roman Ingarden, Alexandre Koyré, Hans Lipps, Winthrop Bell, Jean Hering, Fritz Kaufmann, Hedwig Conrad-Martius. Max Schelers philosophische Schätzung des Religiösen klingt für die Agnostikerin neu, aber nicht unlogisch: „Sie führte mich noch nicht zum Glauben. Aber sie erschloß mir einen Bereich von ‘Phänomenen’, an denen ich nun nicht mehr blind vorbeigehen konnte. […] Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen, und die Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir.“5
Zu tiefer Erschütterung führt die Konfrontation mit dem Ersten Weltkrieg. Die überzeugte Patriotin unterbricht 1915 Studium und Dissertation zugunsten eines Lazarett-Einsatzes in Mährisch-Weiskirchen. Das erfahrene Leiden drängt die Frage nach Sinn im Vergeblichen auf. Nicht ohne Krisen nervlicher und intellektueller Erschöpfung wird die Doktorarbeit zum Thema Einfühlung6 beendet; Husserl, mittlerweile von Göttingen nach Freiburg berufen, benotet sie im August 1916 „summa cum laude“. Stein befindet sich jedoch bei allem steil aufstrebenden Weg in einer unklaren Lage: Husserl erwägt grundsätzlich keine Habilitation von Frauen; ein nicht-philosophischer „Brotberuf“ ist ihr undenkbar. Immerhin: Husserl stellt die ebenso fähige wie zäh-fleißige Doktorin in Freiburg als Privatassistentin an, um Vorlesungen und unfertige stenographierte Entwürfe zu transkribieren, Lücken anzumerken und zur Weiterverarbeitung vorzulegen. Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie II und III wären unzweifelhaft ohne Stein nicht erschienen. Ferner bereitete sie seine Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins für den Druck vor; noch ungedruckt liegt im Husserl-Archiv Löwen die Systematische Raumkonstitution nach von ihr ausgewählten Manuskripten Husserls vor 1916. Zeitgleich verfasst Stein einige Aufsätze im Auftrag des „Meisters“.7
In diesen angespannten Jahren entstehen aber auch eigene Konzeptionen: eine Einführung in die Philosophie von 1917 – 1918 (Erstdruck 1991), Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geisteswissenschaften (Erstdruck 1922) und Eine Untersuchung über den Staat (Erstdruck 1925), beide im renommierten Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung.
Allerdings wird Stein diese zehrende Aktivität wegen der mangelnden Zuarbeit Husserls schon im April 1918 entmutigt aufkündigen.
Krise und Wahrheit
In ihr Leben bricht etwas nicht Vorhergesehenes ein – doch geht diesem Neuen eine Zeit besonderen Leidens von 1917 bis 1921 voraus. Insgesamt vier (!) Habilitationsversuche zwischen 1918 und 1932 scheiterten. Hinzu kommen zwei zerbrochene Beziehungen. Die erste galt in scheuer Form dem polnischen Kommilitonen Ingarden; der Höhepunkt der Neigung fällt ins Jahr 1917. 1920 / 1921 wiederholt sich das Grundmuster, Liebe ohne Gegenliebe, in Bezug auf Lipps. Stein reflektiert dies indirekt als ein „Erlebnis, das meine Kräfte überstieg, meine geistige Lebenskraft völlig aufgezehrt und mich aller Aktivität beraubt hat“8.
Die quälende Suche nach Sinn führt zu einer Annäherung an das Christentum: „Das hat mich von dem Leben befreit, das mich niedergeworfen hatte und hat mir zugleich die Kraft gegeben, das Leben aufs neue und dankbar wieder aufzunehmen. Von einer ‘Wiedergeburt’ kann ich also in einem tiefsten Sinne sprechen.“9
Nach mehreren Jahren des gewissenhaften Einlesens in die christliche Literatur mündet die Suche im Juni 1921 in dem Willen zur Konversion. Stein entschließt sich in Bergzabern bei Conrad-Martius anhand der Vida von Teresa von Ávila dazu, Christin, Katholikin, Karmelitin zu werden. Der „Blitz“ dieser einen Nacht muss jedoch vor dem Hintergrund einer mehrjährigen „Wüste“ und eines großen Leides gesehen werden. Die Wucht der neuen Anziehung ist erheblich: Stein lässt sich am 1. Januar 1922 in Bergzabern taufen und am 2. Februar 1922 in Speyer firmen – an zwei Festtagen, an denen die katholische Liturgie jüdische Rituale mitfeiert: die „Beschneidung des Herrn“ und die „Reinigung Mariens im Tempel“. Doch trennt sich Stein damit von ihrer Kindheits-Kultur, wie ihr auf bedrückende Weise klar wird am tiefen Schmerz und bleibenden Unverständnis ihrer Mutter und der Familie.
Wendung zum Endgültigen
Steins Leben unter dem „neuen Gesetz“ verläuft in zunächst unauffälligen Bahnen: Von 1923 – 1931 arbeitet sie als Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Pädagogischen Seminar und Lyzeum St. Magdalena der Dominikanerinnen in Speyer.10 Der Jesuit Erich Przywara rät ihr zu Übersetzungen von (1923 – 1925) John Henry Newman und (1925 – 1929) Thomas von Aquin, um gedanklich in den Horizont christlicher Philosophie einzudringen.11
Neben der (Über-)Last der Schularbeit häufen sich die Einladungen zu Vorträgen, vornehmlich zur Frauenfrage.12 Geistliche Heimat wird ihr ab 1928 die Erzabtei Beuron unter Abt Raphael Walzer. 1932 beruft sie das Deutsche Institut für wissenschaftliche Pädagogik als Dozentin nach Münster. Durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ im April 1933 dort untragbar geworden, verwirklicht Stein im Oktober 1933 den Wunsch, in Köln in den Karmel einzutreten, und erbittet den Namen Teresia Benedicta a Cruce.
Ein umfangreiches Werk, 1931 ursprünglich als Habilitationsschrift Potenz und Akt betitelt, wird mit der Zunahme der Problematik Endliches und ewiges Sein genannt (1935 – 1937) und erhält den auf Heidegger bezogenen Untertitel Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. „Die wiedergeborene Philosophie des Mittelalters und die neugeborene Philosophie des 20. Jahrhunderts – können sie sich in einem Strombett der philosophia perennis zusammenfinden?“13 1941 / 1942 verfasst Stein Wege der Gotteserkenntnis14 und die Kreuzeswissenschaft15. Inspiriert von dem spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz (1542 – 1591) zeichnet Stein die paradoxe Beziehung von Tod und Leben, Kreuz und Auferstehung nach, was im Nachhinein durchsichtig wird auf ihre eigene Lebensentscheidung.
Steins Lebensende entzieht sich fast ganz ins Dunkel. An Silvester 1938 wechselt sie nach der „Kristallnacht“ in das niederländische Kölner Filialkloster Echt. 1942 versucht sie, für ihre als Laienhelferin tätige Schwester Rosa und sich selbst im Schweizer Karmel von Le Pâquier Aufnahme zu finden. Am 26. Juli 1942 lassen die niederländischen Bischöfe ein Hirtenwort gegen die Judenverfolgung verlesen. Unmittelbar darauf werden die katholischen Juden, vor allem Ordensangehörige, verhaftet; auch Edith und Rosa Stein werden am 2. August 1942 abgeholt und über die Sammellager Amersfort und Westerbork mit etwa 15 anderen Ordensleuten und einer Gruppe von Gefährtinnen16 „nach Osten“ transportiert – dann verlieren sich die Spuren vermutlich in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau am 9. August 1942.
Die Tochter Israels
Der Seligsprechung Steins als Martyrerin am 1. Mai 1987 ging die Kontroverse voraus: Starb sie als Christin oder nicht vielmehr als Jüdin? Es gehört zur historischen Redlichkeit zu sagen, dass Stein als Jüdin umgebracht wurde, aber es gehört ebenso zur historischen Redlichkeit anzuerkennen, dass sie dieses Schicksal bewusst als Christin trug. Gerade in den Kölner Jahren ab 1933 betonte sie mehrfach die besondere Auszeichnung ihrer jüdischen Abstammung im Sinne einer Berufung zum Kreuz. Den Rassenterror der Nationalsozialisten kommentierte sie hellsichtig, er richte sich gegen die menschliche Natur Christi. Kraft dieser menschlichen Natur wusste sie sich „blutsverwandt“: „Sie glauben nicht, was es für mich bedeutet, Tochter des auserwählten Volkes zu sein, nicht nur geistig, sondern auch blutsmäßig zu Christus zu gehören.“17 Bekanntlich ersuchte sie bereits im April 1933 den Papst um eine Enzyklika gegen den Nationalsozialismus und empfand deren Ausbleiben mit Schmerz. Steins zerstörtes Leben geht letztlich, gemäß ihrem Testament18, in eine kaum auszuleuchtende Stellvertretung für das alte und neue Israel über.
Am 11. Oktober 1998 wurde sie in Rom heilig gesprochen und ein Jahr später zur Mitpatronin Europas neben Birgida von Schweden und Caterina von Siena ernannt. Eine Gesamtausgabe ihrer autobiographischen, pädagogischen, philosophischen und geistlichen Werke in 25 Bänden (Freiburg: Herder) von 2000 – 2006 ist im Erscheinen begriffen.
2. Denkerin der Kontingenz?
Es mag Kenner des Werkes von Edith Stein verblüffen, der Phänomenologin und Husserl-Schülerin unter dem Gesichtspunkt der Kontingenz zu begegnen. Zutreffend wird ihr philosophisches Hauptwerk Endliches und ewiges Sein (EES)19 vornehmlich unter ontologischen Kategorien gelesen20, verdankt es doch seinen Theorieansatz ausdrücklich Aristoteles, dem die ersten Kapitel im Blick auf Potenz und Akt gewidmet sind.21 Verstärkt wird die aristotelische Ontologie durch Steins Hinzuziehung des Thomas von Aquin, dessen erkenntnistheoretisch bedeutendstes Werk Quaestiones disputatae de veritate sie ab 1925 übersetzt hatte22. Ausdrücklich wird als Ziel von EES formuliert die Mitarbeit an der „philosophia perennis“, also am zeitübergreifenden philosophischen Erkennen, das kontingente Daten zunächst auszuschließen oder in eine nur zweitrangige Fragestellung abzudrängen scheint. Dem entspricht der Reduktionscharakter des phänomenologischen Vorgehens, das gerade kontingente Momente in die „epoché“, die methodische Einklammerung, setzt. Auch ist die Methode Steins, ihrer phänomenologischen Herkunft gemäß, entschieden unhistorisch. Ihre Reflexion von Thomas und Husserl meint Rückgang auf die Wahrheitsfrage oder die „Urgeschichte“ des Denkens. Die Suche nach übergeschichtlicher Wahrheit bringt den Versuch daher von Anfang an in Gegensatz zum damaligen historischen, aber auch zum heutigen sprachtheoretischen Ansatz: Stein verzichtet fast durchgängig auf geschichtliche Reflexionen (hierin eine erkennbare Schülerin Husserls).
Andererseits ist der ontologische, aristotelisch-thomistische Ansatz durch Steins phänomenologisches Denken auch „gebrochen“. Husserl selbst hatte in seiner erkenntnistheoretischen, das Subjekt akzentuierenden Fragestellung überrascht konstatiert, „daß meine Phänomenologie die einzige Philosophie ist, die auch zur Scholastik Beziehungen hat“23. So kann nachdenklich stimmen, dass Stein in ihrem Hauptwerk argumentativ von Aristoteles und Thomas zu Husserl, letztlich aber zu Augustinus wechselt, so dass nicht einfach von einem Weiterschreiben scholastischer oder transzendental-phänomenologischer Ansätze auszugehen ist. Gerade die Nähe zu Augustinus lässt ein „Existenzdenken“ dienlicher werden als ursprünglich vorgesehen. So wird sie die thomasische Seinslehre an der augustinischen Personlehre orientieren und den Sinn des Seins aus der Anthropologie unter den Vorzeichen des 20. Jahrhunderts, der Frage nach dem menschlichen Dasein, entwickeln – was ihr zu Beginn der Arbeit auch zielhaft vorschwebte. Damit gerät Stein absichtlich in die herausfordernde Nähe zu Heideggers Vordenken. Heidegger hatte in Sein und Zeit (1927) die unvereinbar scheinenden Gegensätze von nicht-ichlichem Seinsbegriff und ich-bezogener Phänomenologie durch die Analyse des Daseins zu überbrücken versucht. Stein dagegen akzentuiert die Überbrückung durch eine Theorie des Personalen, indem sie die Bedeutung von Zeitlichkeit für das menschliche Dasein erweitert und über die Todesgrenze sowie über die Existentialien Angst, Sorge etc. hinaus den Sinn des Daseins extrapoliert (ohne bereits theologisch zu werden). Dabei entwickelt sie neue Existentialien wie Intentionalität auf Leben in Fülle, Vertrauen, Liebe, Einfühlung in den anderen. Der Sinn des Daseins liegt demzufolge nicht einfachhin im Dasein selbst, sondern in zeit- und ich-transzendierender Erfüllung des Daseins.
Vorrangig arbeitet Stein ab 1928 bis 1932 an einer Theorie des Frauseins, die neben der phänomenologischen Wesensfrage Überlegungen zu geschichtlichen, mithin kontingenten Faktoren des Frauenbildes einschließt.24 Noch vor diesen Theorien liegt eine „terra incognita“ der Stein-Forschung: Die Studien Anfang der 20er-Jahre zu einer Phänomenologie des Psychologischen und des Sozialen, die den intersubjektiven Charakter von Welt zeigen, sind erstaunlicherweise kaum untersucht.25 Der Platzbeschränkung wegen sollen diese Studien hier jedoch nicht einbezogen werden. Jedenfalls ist der Materialbestand offenbar vielschichtiger, als auf den ersten Blick zu vermuten, und lädt zu einem Überprüfen der latenten Kontingenz in dieser angezielten philosophia perennis ein.
3. Dominanz der Seinsfrage
In EES führt Stein bedeutsamerweise nicht nur eine Auseinandersetzung mit den Zeitgenossen Husserl, Conrad-Martius, Przywara und Martin Heidegger, sondern gelangt außerdem zu einer gewissen Abhebung von Aristoteles und Thomas von Aquin – was letztlich zu einer immanenten Erarbeitung von Kontingenz führte.
Einleitend skizziert Edith Stein die griechische Ausgangsfrage nach dem Sein als dem „Herrschenden“. Diese Frage werde vom mittelalterlichen Denken übernommen und erweitert: Unter Sein werde Natürliches wie Übernatürliches zur philosophischen und theologischen Darstellung gebracht. Stein fasst dabei christliches, jüdisches und moslemisches Denken unter derselben Gattung ontologischer Theologie zusammen. Der Bruch mit der Seinsfrage geschehe in Schärfe erst durch die Neuzeit, welche anstelle des Seins das Erkennen thematisiere und ihm die Gottesfrage logisch unterordne: Die cartesische Selbstvergewisserung des Denkens bedarf der Offenbarung nicht (mehr).
Stein begreift die zeitgenössische Phänomenologie in Ablösung des Cartesianismus und Kantianismus als epochalen Neubeginn. Er schließe die beiden unabhängigen, ja gegenläufigen Fragestellungen nach dem Sein wie nach dem Erkennen erstmals wieder zusammen, und zwar nicht auf den ausgeschrittenen Wegen, sondern in originärer methodischer Reflexion. Die Skizze ihrer Zeitgenossen stellt zugleich Steins eigene Quellen und Denkhilfen vor: „Sie brachten den verachteten alten Namen Ontologie (Seinslehre) wieder zu Ehren. Sie kam zuerst als Wesensphilosophie (die Phänomenologie Husserls und Schelers); dann stellte sich ihr die Existenzphilosophie Heideggers zur Seite und Hedwig Conrad-Martius’ Seinslehre als deren Gegenpol“ (6 f.). Stein selbst versucht, die „neugeborene Philosophie des 20. Jahrhunderts“ und die Philosophie des Mittelalters so weit wie möglich aufeinander zu „übersetzen“, was freilich nicht mit Harmoniestreben verwechselt werden darf. Steins Denken müht sich um „Sachgehorsam“, was ihr ein wanderndes Vergleichen zwischen verschiedenen Denkern nahe legt und keine „geschlossene“, auf einen einzigen Entwurf eingeschworene philosophische Systematik.
Wie weit ist aber der reflexive Blick auf Kontingenz in der Befragung des Seins eingeschlossen? Stein selbst neigt dazu, Philosophie nach dem Vorbild Husserls als „strenge Wissenschaft“26 zu bestimmen, als „Niederschlag alles dessen, was der Menschengeist zur Erforschung der Wahrheit getan hat, in Gebilden, die sich von dem forschenden Geist abgelöst haben und die nun ein eigenes Dasein führen“ (16). Diese Verselbstständigung muss sich ihrerseits wiederum systematisch auf das Sein zurückführen und daran prüfen lassen. „Das wahre Sein ist es, worauf alle Wissenschaft abzielt. Es liegt aller Wissenschaft voraus, nicht nur der menschlichen Wissenschaft als einer Veranstaltung zur Gewinnung von richtigem Wissen und damit zugleich von wahren Sätzen und als des greifbaren Niederschlages aller dahin zielenden Bemühungen, sondern selbst noch der Wissenschaft als Idee“ (17). „Unter der Wissenschaft als Idee, die aller menschlichen Wissenschaft zu Grunde liegt, ist also der reine (gleichsam noch körperlose) Ausdruck aller Sachverhalte zu verstehen, in denen sich das Seiende gemäß seiner eigenen Ordnung auseinanderlegt“ (18). Keineswegs glaubt Stein damit an eine je abzuschließende Systematik dieser Ordnung. Vielmehr betont sie umgekehrt das Endlose der Wissenschaft, sofern „die wirkliche Welt in ihrer Fülle für eine zergliedernde Erkenntnis unausschöpfbar ist“ (18).
Diese „wirkliche Welt“ ist der Bereich der Kontingenz, die bei Stein zwar nicht begrifflich, aber der Sache nach aufscheint. Denn umfassend lässt sich das Ich nur analysieren im Spannungsfeld der Momente Sein und Nichtsein, Zeitlichkeit und Endlichkeit.
4. Das kontingente Ich
Steins Unterscheidung der Seinsweisen setzt ein bei den aristotelischen Begriffen Potenz und Akt, transformiert durch Thomas von Aquin in seiner philosophisch argumentierenden Jugendschrift De ente et essentia27. Stein verlässt jedoch nach kurzer Darstellung jene Stufenfolge des Seienden und wählt denselben anthropologischen Einsatz wie Heidegger: das Ich als den ausgezeichneten Zugang zum Sein. Denn der unbezweifelbar gewisse Ansatz des Philosophierens, das Welt erschließen will, kann eben nicht mit Welt beginnen, sondern nur mit dem „Träger“ dieser Reflexion selbst, dem eigenen Ich, dem „unentrinnbar Nahe[n]“ (35) – wie bei Augustinus, Descartes und Husserl zentral entfaltet. Bei dieser Rückwendung des Geistes auf sich selbst taucht die dreifache Frage auf: „Was ist das Sein, dessen ich inne bin? Was ist das Ich, das seines Seins inne ist? Was ist die geistige Regung, in der ich bin und mir meiner und ihrer bewußt bin?“ (36). Erst vom selbst-bewussten Ich her erschließt sich Neues: das Nicht-Ichliche.
Was die erste Frage betrifft, so zeigt das eigene Innesein unmittelbar ein Doppelgesicht: Das Ich steht nicht in sich, sondern scheint zwischen Sein und Nichtsein zu strömen – es erfährt sich nur im Gegenwartspunkt zwischen Vergehen und Kommen als wirklich. An diesem „Jetzt“ stößt der Geist in sich selbst auf die Scheidung von Nichtsein und Sein. Dieser prekäre Zwischen-Stand des Ich ist ein erstes Kennzeichen seines kontingenten Seins: Es ist nicht ein aus sich begründetes, sondern von unbekannten Faktoren bzw. vom Rückfall ins Nichts bedrohtes Vorhandensein.
Mit dem Doppelgesicht menschlichen Daseins zwischen Sein und Nichts kommt das Rätselhafte der Zeit ins denkerische Spiel: zeitliches Strömen als zweites Moment der Kontingenz. Stein hat analog zu Heidegger die Zeit als dasjenige gefasst, was das Dasein durchgängig bestimmt. Dabei geht es – Conrad-Martius folgend – nicht um die übliche unphilosophische Vorstellung von Zeit als räumlichen „Behälter“ für Vergangenheit und Zukunft (39). Zeit ist Träger oder Medium einer Urbewegung ins Sein hinein, gegen das Nichts; oder: in das Selbst hinein, aus dem Nichts heraus. Zeitliches Sein ist Werden, das freilich nie zu einem voll in sich ruhenden Sein wird. „Dieses Sein bedarf der Zeit“ (39) – mit der Besonderheit, dass nur seine „kontinuierlich immer neu aufleuchtende punktuelle Aktualität“ erscheint (40). Doch enthüllt sich gerade der kontingente Gegenwartspunkt als Mangel – ist das Ich darin doch nicht alles, was es war und sein wird. Das kontingente Ich existiert in prozessualem Strömen.
Eben deshalb aber entlässt es aus sich zwingend die „Idee des reinen Seins, das nichts von Nichtsein in sich hat“ (36 f.). Das Ich kann von seinem an den Augenblick gebundenen „schwachen“ Sein, hängend über dem Abgrund des Nichts, auf ein volles, glückhaftes Sein weiterschließen. Offenbar kann eine Steigerung gedacht werden, worin alles Können in der Tat verwirklicht, wo jedes Jetzt alles zugleich ist, wo die „Gebrochenheit und Gespaltenheit des geschöpflichen Seins“ (40 f.) vollkommene Gegenwart eines Seins, jeder Augenblick mit seinem Wesen eins und ganz aktualisierte Potenz ist. Dies hat umso mehr reflexive Bedeutung, als im Sein keineswegs nur eine unversöhnliche Alternative erscheint: hier Fülle, dort Mangel an Sein. Vielmehr kann das doppelgesichtige Ich, gemischt aus Sein und Nichtsein, sich selbst erst vom ursprünglich vollen Sein her deuten und seine eigentümliche Leere erfassen. Ebenso meint „Potenz des Ich“ im strengen Sinne „Möglichkeit zu sein“ (41): offen für anderes, das ihm Wirklichkeit verleiht. Dieses Andere muss geklärt werden in einer genauen Abgrenzung vom Werden.
Denn damit das kontingente Ich auf eine erfüllte, zeitfreie Gegenwart weiterschließen kann, ist der Modus des zeitlichen Werdens zu reflektieren. Dabei trifft Stein auf ein verflochtenes Verhältnis: Werden kann nur das Sein, anders gesagt: Werden ist seinem Sinne nach Übergang zum Sein (44). Im Werden und entsprechenden Vergehen erscheint ein Übersteigen des „Jetzt“, ein Verweis über den Augenblick hinaus. Wenigstens annähernd wird dieser Gedanke auch durch Erfahrung bestätigt: Der Mensch weiß von einer ihm nicht zugänglichen Seinsfülle in den Augenblicken, wo Höhe und Übermaß das Leben durchpulsen. Diese Höhe ist eingeschränkt eben durch den kontingenten Augenblick, in dem sie aufblüht und schwindet. Ein wandellos-gegenwärtiges Sein kann jedoch, e contrario, gedanklich erschlossen werden. Mehr noch: In der Erfahrung leuchtet es zwar bruchstückhaft, aber in subjektiver Gewissheit auf.
Doch lässt sich das kontingente Ich noch weiter erhellen im Blick auf jenes zeitfrei wirkende, zeitlich nicht festzuhaltende Erlebnis. Ein solches Widerfahrnis ist ja unterschiedlich stark; seine wechselnde Intensität beruht also auf einem im Innersten offenen oder verschlossenen Ich. Es gibt offenbar ein Recipiens im Ich, das dem kontingenten Ich selbst unbekannt, sogar unzugänglich ist – entweder aufnahmebereit oder abweisend. Stein bezeichnet diesen Ich-Grund in der Nachfolge Husserls als transzendent, nämlich das kontingente Ich übersteigend. Ebenso geht das, was rezipiert wird, über das Ich hinaus; es transzendiert die bloße Ichlichkeit, jedenfalls das Bewusstsein vom Ich.
Im Unterschied zum transzendenten Ich-Grund und zum kontingenten Ich kennt Stein auch ein reines Ich, dem in den wechselnden, wiederum kontingenten Vorkommnissen des Lebens zwar immer Neues zugespielt wird, das aber als konstanter Träger dieses Spiels fungiert (47). Die kontingenten Erlebnisgehalte füllen dieses Ich nicht mechanisch-quantitativ auf; es erweist sich vielmehr als lebendig-qualitativ Tragendes, welches seine Inhalte auswählt: Es geht selbsttätig von einem Gehalt zum anderen, „aus einem Erlebnis ins andere, und so ist sein Leben ein fließendes Leben“ (48). Trotz aller kontingenten Augenblicke bleibt es unzerstückelt, denn das Ich behält das, was es erlebt, „noch eine Weile im Griff“ und „ebenso streckt es sich schon dem Kommenden entgegen und greift danach“ (48). Doch gerade hier kommt das reine Ich an der Frage nicht vorbei, woraus die Gegenwart, in der ihm sein kontingentes Leben bewusst wird, beständig hochquillt. Anders gefragt: Hat auch dieses reine Ich einen Anfang seines Seins? „Kam es aus dem Nichts? Geht es in das Nichts? Kann sich in jedem Augenblick unter ihm der Abgrund des Nichts öffnen?“ (51). So erscheint das reine Ich, obwohl seiend im ausgezeichneten Sinn, trotz allem bedingt, weil es nicht aus sich selbst lebendig erhalten kann, was es zum Leben nötig hat: „sein Leben bedarf der Gehalte, ohne Gehalte ist es leer und nichts“ (51). Das Ich hängt vielmehr ab von einer „jenseitigen Tiefe“ (52), wobei „jenseitig“ hier nicht religiös, sondern phänomenologisch als „bewußtseinstranszendent“ oder erlebnisbezogen zu verstehen ist: Welt selbst ist transzendent zum Ich.
Als philosophische Folgerung bleibt festzuhalten: Menschliches Dasein ist nicht aus sich selbst, ist weder selbstherrlich noch selbstverständlich. Es besitzt sich niemals, ist immer empfangenes Sein. Der eigene transzendente Ich-Grund bleibt entzogen; das reine Ich als sich durchhaltende Größe bleibt leer ohne Erlebnisgehalte; das kontingente Ich des Jetzt ist der Möglichkeit des Nichtseins und der Zeit ausgeliefert. In dieser Kennzeichnung liegt die konstitutionelle Tragik des Menschen, der sich aus der Kontingenz, die den Abgrund des Nichts bzw. des Nicht-Selbstständigen nur schwach verdeckt, lösen möchte. „Das stimmt aber offenbar nicht zu den festgestellten merkwürdigen Eigentümlichkeiten dieses Seins: zu der Rätselhaftigkeit seines Woher und Wohin, den unausfüllbaren Lücken in der ihm zugehörigen Vergangenheit, der Unmöglichkeit, das, was zu diesem Sein gehört (die Gehalte), aus eigener Macht ins Sein zu rufen und darin zu erhalten“ (52). Stein zitiert wörtlich Heidegger, das Dasein sei geworfen, ohne die Möglichkeit, seiner Geworfenheit zu entrinnen (52).
Die Grundfrage muss daher lauten: „Woher aber kommt dieses empfangene Sein?“ (53). Philosophisch ist eine doppelte Antwort möglich. Entweder: Das Ich empfängt sein Leben aus den erwähnten „jenseitigen Welten“, die im Erlebnis aus einem das Ich transzendierenden Bereich der Wirklichkeit andrängen. Oder: Menschliches Sein empfängt sich von einem reinen, selbstherrlichen und selbstverständlichen Sein. Beide Antworten schließen sich nicht aus. Allerdings setzt jedes Empfangen ein Geben voraus, so dass letztlich nur das reine Sein fähig wäre, Leben zu geben, auch wenn es Leben über die das Ich transzendierenden und im Übrigen kontingenten Erlebnisse vermittelt.
An das Thema des Woher wendet Stein die Mühe einer tieferen Ausführung, um darin Zustimmung und Widerspruch zu Heidegger zu begründen. Der gedankliche Ausgang ist identisch: Das Sein „schrickt zurück vor dem Nichts und verlangt nicht nur nach endloser Fortsetzung seines Seins, sondern nach dem Vollbesitz des Seins“ (54). Mithin verlangt der Mensch – anders als bei Heidegger – von selbst nach Fülle, bleibt weder gedanklich noch lebenspraktisch in der Nähe des Nichts, die der leibliche Tod manifest macht. Mühelos umspannt das Denken vielmehr die Idee eines solchen höchsten Seins, dem gegenüber das menschliche Sein als Minderung erscheint. Dabei ist die Idee höchster Fülle keineswegs nur eine abstraktphilosophische Spekulation, sondern wird für jedes Ich zum individuellen Maß seines eigenen Seins (55). Wenn es daher nach Heidegger die Angst ist, die den Menschen „vor das Nichts bringt“, so ist es nach Stein ebenso die Gewissheit dieses höchst entfalteten Seins, die den Menschen in seiner gefährdeten Kontingenz schirmend „vor das Sein bringt“. Wenn auf der einen Seite das Nichts unleugbar das menschliche Dasein bedroht, so antwortet dem auf der anderen Seite ebenso unleugbar die Seinssicherheit, die jeder Mensch inmitten allen Wechsels erfährt.
„Ich stoße also in meinem Sein auf ein anderes, das nicht meines ist, sondern Halt und Grund meines in sich haltlosen und grundlosen Seins“ (57). Wichtig bleibt die Unterscheidung: Der Weg des Glaubens kann diese Grundlage im ewigen Sein Gottes erkennen. Der Weg der philosophischen Erkenntnis formuliert spröder, wenn auch nicht minder konsequent: Kontingentes Sein bedarf als Gegenüber und Ursprung eines Seins aus sich selbst, das zugleich Eines und notwendig es selbst ist. Ebenso bedarf die Zeitlichkeit – schon der Erkennbarkeit wegen – einer Ewigkeit, eines Haltes (58); anders: Kontingenz bedarf der nicht-kontingenten Vorgabe. Und dieses Bedürfen ist keineswegs nur Wunsch, Projektion, sondern wird aufgrund realer Erfahrung dem Denken zugänglich. Dies gilt für Stein auch dann, wenn die Seinssicherheit, gedanklich bis ins Letzte verfolgt, nur noch ein subjektives „Spüren“ erzeugt, das sich dunkel und kaum noch reflektiert vollzieht. Stein verweist auf Augustinus, der den unverhofften Halt und Grund eigener Kontingenz in seinem innersten Kern als etwas Unbegreifliches, als den Unbegreiflichen kennzeichnet. Das dunkle Spüren umkreist dabei sowohl den „unentrinnbar Nahen“ als auch den „Unfaßlichen“ (58). Philosophie rückt jenen Grund durch ihre Begrifflichkeit notwendig in theoretische und apersonale Ferne. Der Weg des Glaubens, der sich hier für Stein zweifellos in der Problemstellung mit dem Weg des philosophischen Erkennens trifft, weiß dagegen in dem entzogenen Grund den Gott der persönlichen Nähe (58).
Was mit der Unterscheidung von Potenz und Akt begann, wurde zu einem großen Spannungsfeld geweitet: zur Unterscheidung von kontingentem und notwendigem Sein und von Zeitlichkeit und Zeitfreiheit des Ich.
5. Kontingenz und Endlichkeit
Stein führt weiter eine wichtige Unterscheidung zwischen Zeitlichkeit und Endlichkeit ein, wodurch sich auch Kontingenz weiter profiliert. Endliches wird bestimmt als das, „was sein Sein nicht besitzt, sondern der Zeit bedarf, um zum Sein zu gelangen“; ferner ist es ein „sachlich Begrenztes“, dessen Sinn ist: „etwas und nicht alles sein“. Ewiges als Gegenbegriff besagt umgekehrt: „Herr des Seins“, „Herr der Zeit“, „alles sein“ (60). Endliches und Zeitliches decken sich aber nicht einfachhin. Um ihr eigentümliches Verhältnis zu klären, trennt Stein zwischen Wesenheit und zeitlichem Sein, illustriert an der schlichten Erfahrung des Unterschieds von „meiner Freude“ zur „Freude als solcher“: Die erste entsteht und vergeht, die zweite besteht überhaupt. Unmittelbar leuchtet ein: „wo und wann immer Freude erlebt wird, da ist die Wesenheit Freude verwirklicht“ (62). Andererseits: Erlebte Freude gibt es, aber Freude überhaupt „gibt es“ so nicht. Daher gerät Stein in die seit Platon bestehende Notwendigkeit, Wesenheiten (Ideen) als gedankliche Struktur fordern zu müssen, ohne sie letztlich als wirklich vorzustellen. Wesenheit ist vielmehr Bedingung der Möglichkeit des Freuens, also transzendental im kantischen Sinne; wirkliche Welt ist ohne Wesenheiten gedanklich nicht zu strukturieren.
Solche Feinarbeit ist wichtig, weil sich dadurch das Maß an Sein im kontingenten Ich genauer bestimmen lässt. Das kontingente Ich weist als drittes Merkmal Endlichkeit auf (meine Freude vergeht, Freude überhaupt bleibt). Endliches hat aber durchaus einen Zug zur Voll-Endung, ist nicht einfachhin eingeschränkt und unvollkommen. Es kennt eine Art „Höhe“, wo seine Wirklichkeit in die volle Wirksamkeit „ausbricht“, so etwa wenn die stumme Saite beginnt zu tönen: Das Sein „geht aus sich heraus, und das ist zugleich seine ‘Offenbarung’“ (89). So verbindet sich Endliches über die ihm gemäße Welt des Werdens und Vergehens mit seinem vollen Wesen und bildet in ihr eine ursprüngliche Wesenheit nach. Sosehr man also zwischen dem bloß wesenhaften (in sich kraftlosen und unwirklichen) Sein und dem wirklichen Sein unterscheiden muss, so sehr stellt doch das lebendige, endliche Sosein eines Dinges die Brücke zwischen beiden dar. Auf das kontingente, endliche Ich hin gesprochen bedeutet dies: Auch das Ich zielt im zeitlichen Strömen auf eine Vollendung ab, die sein eigenes Wesen zur vollen Darstellung bringt. (Welche Wesenheit damit verwirklicht wird, kann hier offen bleiben.) Weniger spröde formuliert: Das kontingente Ich konstituiert sich nicht in einer Folge gleichgültig sich ablösender Augenblicke oder Jetztpunkte der Zeit, sondern seine Endlichkeit realisiert ein Wachstum (oder eine Verminderung) des wesentlichen bzw. verwirklichten Ich, zuzeiten auch beglückend als „Vollendung“ erfahren.
Als Frucht dieser beharrlichen Zergliederungen reift die Folgerung: Von rein philosophischem Boden aus lässt sich über Zwischenstufen auf ein letztgültiges Sein schließen. Die Verbindung von zeitlichem, endlich-wirklichem und wesenhaftem Sein rührt an ein zeitloses, in sich gegründetes, schöpferisches Sein selbst. Für das Ich gilt analog: Phänomenologisch lässt sich vom kontingenten Ich, das jetzt-gebunden, unselbstständig lebt, über ein reines Ich, das eine gewisse Konstanz im Zeitfluss aufweist, auf ein vollendet realisiertes Ich mit tragendem Ich-Grund weiterschließen.
Dieser Ich-Grund könnte theologisch Gott genannt werden. Philosophische Rede kreist ihn nur distanziert-begrifflich ein, keineswegs gelangt sie zu einer „erfüllenden Anschauung“. Ontologisch formuliert: „Es ist das ewige Sein selbst, das in sich selbst die ewigen Formen gestaltet – nicht in einem zeitlichen Geschehen –, nach denen es in der Zeit und mit der Zeit die Welt schafft“ (103). Freilich wird die gewonnene Einsicht nicht eigentlich lebendig: „Ein Wesen, das nichts anderes ist als Sein, können wir nicht fassen. Wir rühren gerade noch daran, weil unser Geist über alles Endliche hinauszielt – und durch das Endliche selbst dahingeführt wird, darüber hinauszuzielen – auf etwas, was alles Endliche in sich begreift, ohne sich darin zu erschöpfen. […] Es entzieht sich seiner Anschauung“ (106). So mündet der Aufstieg des bloßen Denkens in jene Paradoxie, die dem Ich eigentümlich ist, in das „Ausgespanntsein zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit“ (106).
Erkenntnis und Sprache sind im Übrigen als vorläufig enthüllt. Zwar gründen beide selbst im Sein, können ihre Ableitung aber nicht bis in diesen Ursprung zurückverfolgen: Das gesuchte Sein lässt sich philosophisch nicht herbeizwingen. So bleibt als Ergebnis: Das erkennende Ich muss sich mit „Übereinstimmung – Nichtübereinstimmung“ von Menschenwort und ewigem Wort bescheiden (108). Im kontingenten Ich wirkt das Streben nach vollendetem Sinn seiner selbst, zugleich bleibt die tatsächliche Unmöglichkeit, solchen Sinn vor der Zeit zu entschleiern. Leben vollzieht sich in nicht zu lösender Spannung: „Was wir vom ‘Sinn der Dinge’ erfassen, was ‘in unseren Verstand eingeht’, das verhält sich zu jenem Sinnganzen wie einzelne, verlorene Töne, die mir der Wind von einer in weiter Ferne erklingenden Symphonie zuträgt“ (110).
Offen bleibt, ob nicht zur Überwindung dieser formalen Schlussfolgerung ein ganz anderer Akt als die Reflexion vonnöten ist. Muss das Gebiet der Philosophie nicht – von ihr selbst her – verlassen werden? Aber darf sie sich diesem Ansinnen nicht auch – von ihr selbst her – verweigern? Jedenfalls wäre die Stelle, wo sich Philosophie selbst verlässt, genau und nicht ungefähr zu beschreiben. Stein formuliert nochmals, was sie anfänglich zur Grenzziehung zwischen Philosophie und Theologie ausgesprochen hatte: „Rein philosophisch zum Verständnis […] des ersten Seienden zu gelangen, ist nicht möglich, weil uns keine erfüllende Anschauung des ersten Seienden zu Gebote steht. Die theologischen Überlegungen können zu keiner rein philosophischen Lösung der philosophischen Schwierigkeit führen, d. h. zu keiner unausweichlich zwingenden ‘Einsicht’, aber sie eröffnen den Ausblick auf die Möglichkeit einer Lösung jenseits der philosophischen Grenzpfähle, die dem entspricht, was noch philosophisch zu erfassen ist, wie andererseits die philosophische Seinserforschung den Sinn der Glaubenswahrheiten aufschließt“ (116).
6. Kontingenz der Dinge im Spannungsfeld von Form und Stoff, Zeit und Raum
Um Gemeinsamkeit und Unterschied zwischen klassischer Ontologie und phänomenologischer Ich-Analyse zu vertiefen, folgt Stein im vierten Kapitel von EES kritisch der aristotelischen Kategorienlehre. Auch dabei entwickelt sie latent ein Denken der Kontingenz, diesmal zunächst des dinglichen Gegenstandes, und zwar vor dem Hintergrund durchgängigen Werdens.
Entscheidend scheint ihr die Fassung der ersten Kategorie: „ousía“ („Wesen“) ist bei Aristoteles „das Seiende, dem das Sein in einem ausgezeichneten Sinne zukommt“ (128). Ohne die ins Einzelne gehenden Überlegungen mitzuvollziehen, sei die Schlussfolgerung zu der berühmten aristotelischen Wesensdefinition („das, was war, ist“ – griech.: „to ti en einai“) hervorgehoben: Wesen ist „das, was dem Ding von innen her – nicht unter äußeren Einflüssen eigen ist – und unter wechselnden Einflüssen bleibt. […] Das Ding ‘ist’, was es ‘war’, weil sein Wesen dem Zeitfluß enthoben ist“ (134). Zugleich hebt Stein ausführlich ihre Aristoteles-Deutung von derjenigen Heideggers ab, die er in Kant und das Problem der Metaphysik 1929 vorgelegt hatte. Während Heidegger an derselben Stelle „ein spontanes und selbstverständliches Verstehen des Seins aus der Zeit“ sieht, nimmt Stein umgekehrt „das Verständnis des Seins als Grundlage für das Verstehen der Zeit“ an (134). Entscheidend ist, dass sie bereits im aristotelischen „das ist, was war“ ein Durchhalten des Seins durch die Zeit sieht und wie Thomas damit das Wesen grundsätzlich als nicht der Zeit unterworfen fasst.
Jedoch besitze der wirkliche, leibhaftige Gegenstand einen „viel verwickelteren und tiefgründigeren Aufbau“ (153) als bei Aristoteles und verlange eine anders gedachte Beziehung von Stoff und Form. Man muss nach Stein im Gegenstand mehrere Schichten und einen „Grund“ annehmen, der sich durch verschiedene „Äußerungen“ mitteile. „Und so ist auch das lebendige Verhalten keine ‘bloße Oberfläche’, sondern in der Tiefe des Wesens verwurzelt“ (154). Form als Entfaltung offenbart das Innere nach außen. So gehört zur Wirklichkeit, die sich auswirken will, Zeit. „Das Wirkliche besitzt sein Wesen und entfaltet es in einem zeitlichen Geschehen“ (158).
Mit diesen Darlegungen ist ein Widerspruch zu Aristoteles’ Fassung von Form und Wesen eingetragen: Aristoteles kennt kein Werden, mithin keine Zeit zur Verwirklichung des Wesens. Bei ihm wird das Zusammengesetzte, das Ding, nur aus Stoff und Form; beide Komponenten sind zeitlos gedacht, treffen sozusagen von Ewigkeit her aufeinander und sind gleichermaßen ursprünglich getrennt: als reiner Stoff oder reine Form (162). Stein sieht im Fehlen des Zeitproblems auch den mangelnden Schöpfungsgedanken, da Aristoteles die Welt als ewig voraussetzt. „Der Sinn des Urstoffes ist danach Empfangsbereitschaft für alle Formen der Dinge, die Möglichkeit, alles zu werden. Er erschöpft sich darin, Vorstufe des Wirklichen (dynamis, Potenz) zu sein“ (177). Darin liege aber eine logische Unstimmigkeit: Es gebe kein mögliches Sein ohne tragendes „Etwas“. Denn Wirkliches sei in jedem Fall Grundlage, Ziel und Träger des Möglichen. Bei Aristoteles ist aber der Urstoff vor dem Wirklichen schon möglich und sozusagen selbsttragend.
Stein schlägt ihrerseits vor, den aristotelischen Gedanken der Ewigkeit von reinem Stoff und reiner Form aufzugeben und umgekehrt Stoff und Form zusammen mit dem Werden zu fassen, also die Frage der Zeit und der Verwirklichung im Raum miteinzubeziehen. Damit wird der Schöpfungsgedanke philosophisch in die Argumentation eingebracht (219); Stoff und Form sind immer schon einem geschichtlichen Prozess zugeordnet; es gibt sie nicht abstrakt.
Daraus ergibt sich ein reizvoller Ansatz, der anders als die Antike Schöpfung grundsätzlich als zeitliches Werden begreift; so „wirkt sich die Form in der stofflichen Fülle als ihrem miterschaffenen und restlos gefügigen Gestaltungsmittel aus“ (220). Anders gewendet: Stoff wird nicht ungestalt-ewig vorgefunden, sondern ist immer schon in raumgreifender Form zeitlich manifest. Umgekehrt ist Wesensform „nicht denkbar ohne durch sie gestaltete stoffliche Fülle“. Knapp: „Alles Seiende ist Fülle in einer Form“ (261).
Stein sucht eine weitere Herausforderung durchzuführen, die die zufällige, also kontingente Form vieler Gegenstände betrifft: das Denken des Formlosen. Nicht überall, ja selten ist Form zu ihrer höchsten Möglichkeit entbunden. Gibt es einen „gefallenen Zustand“ der Dinge, der die Beziehung von Form und Stoff verstörend berührt hat? Dabei geht es nicht darum, einen solchen Fall zu „beweisen“. Die Beobachtung drängt sich aber auf, dass statt der komplementären Beziehung von Fülle und Form und statt einer sich wahrhaft ausformenden Kraft eher Zufall bis zum Zerfall herrscht. „Der aus lebendigen Formen heraus geborene und gestaltete Stoff wird zur puren Masse, wenn er aus der Wesenseinheit mit den ihn gestaltenden Formen heraus- und dem Raum anheimfällt“ (221). Letztlich ist diese Auflösung nicht zu Ende gebracht, ließe sich aber weiterdenken bis zur „nicht mehr gestaltbaren Masse“, die keine Natur, keine raumdingliche Welt mehr erlaubt. Jedenfalls ist mit Händen zu greifen, dass der Stoff der Form entgleiten, ihr nicht mehr wesensmäßig geeint sein kann (221). Dies hat mit der Raumverhaftung der Schöpfung zu tun: Im Raum drückt sich eine Art Abgrund aus, in den die Dinge stoffmäßig auswuchern können. (Diese Konzeption räumlicher Abgründigkeit verdankt sich Conrad-Martius’ Überlegungen.) Denn die Dinge bleiben hinter der ursprünglich denkbaren Welt zurück, zeigen sich im Zustand eines „Falls“, da sie jede ganz reine Gestaltung hemmen. Stein thematisiert damit die Kontingenz des Vorfindlichen, dessen Ausformung zufälligen Faktoren unterworfen bleibt.
Dennoch lässt sich nach ihr alles Endliche nach wie vor auf seine Voll-Endung und die zielgerichtete Beziehung zur (Wesens-)Form hin lesen. Stein verwendet zur Erläuterung solcher Teleologie – auch des Kontingenten – eine theologische Überlegung: Der göttliche Logos wirft als Urbild sein Licht in das Geschaffene. Daran gemessen bleibt das Endliche allerdings zweifach hinter seinem Urbild zurück: Einmal durch den Charakter des Abbildes – wo unendliche Fülle in Gott sich zeigt, beharrt das Ding in der Endlichkeit; wo der vollkommene Wesensbesitz in Gott aufscheint, gibt es beim Ding nur gestaffelten Anteil am Sein. Dinge sind also Spiegel. Das Höchstmaß des Abbildes wird zweitens dadurch gemindert, dass die Dinge entarten können. Dinge sind also „zerbrochene[] Spiegel“ (226). Ihr Zwiespalt verunklart sie für das Erkennen. Stein spricht vom Widerstand allen Stoffs auch in der Arbeit (226), welcher Widerstand sich der grundsätzlich gehemmten Erkenntnis mitteilt.
Trotz aller kontingenten Unschärfe im Dinglichen bleibt darin aber ein „sehnsüchtiger“ Zug bewegend sichtbar: „Die tatsächliche Wasbestimmtheit der Dinge weist über sich selbst hinaus auf das, was sie sein sollten und könnten, auf ihr Urbild, das Maß und Richtschnur für sie bedeutet. […] Der göttliche Logos, durch den und nach dem alles geschaffen ist, bietet sich uns als das urbildliche Seiende, das alle endlichen Urbilder in sich befaßt. Sie werden dadurch für uns nicht begreiflicher, aber der Grund ihrer Unbegreiflichkeit leuchtet auf: sie sind von dem Schleier des Geheimnisses umhüllt, der alles Göttliche vor uns verbirgt und doch in gewissen Umrißlinien andeutet. Und dieser Schleier fällt nun auch auf die innere Wesensbestimmtheit der Dinge, die zunächst als etwas so Klares und Nüchternes erscheint und ja tatsächlich das eigentlich ‘Begreifliche’ für uns ist“ (227f.).
So wird Entscheidendes als Frucht der mühsamen Analyse sichtbar: Das Wesen stofflich-kontingenter Dinge geht keineswegs in sich selbst auf, weder räumlich noch zeitlich; es öffnet vielmehr tief berührende Verbindungen zu einer anderen Welt: „Es gehört zum Wesen alles Endlichen, Sinnbild zu sein, und zum Wesen alles Stofflichen und Räumlichen, Gleichnis von Geistigem zu sein. Und das ist sein geheimer Sinn und sein verborgenes Inneres. Eben das, was es zum Gleichnis des Geistigen macht, macht es zum Sinnbild des Ewigen. […] So trägt jedes Ding mit seinem Wesen sein Geheimnis in sich und weist gerade dadurch über sich selbst hinaus“ (228 f.).
7. Ewiges Sein als Horizont von kontingentem Sein
In ausführlichen Untersuchungen des fünften Kapitels, die hier nicht nachzuzeichnen sind, werden sechs klassische Aussagen über das Seiende als solches, die so genannten Transzendentalien, geprüft: Es ist Seiendes, Sache, Eines, Etwas, Gutes, Wahres. Dabei öffnet sich ein „Restproblem“: Das Seiende ist nicht selbst wahr, gut und eines; um ihm dies zuzusprechen, muss das Wahre, das Gute, das Eine am Horizont der Bestimmung auftauchen. Freilich ergibt sich daraus die bekannte Schwierigkeit: Das Urbild der Transzendentalien ist dem Erkennen nicht zugänglich, und dennoch muss das Erkennen auch der endlichen Dinge implizit davon wissen, wenn es erkennen will.
Geheimnisvoll scheint das ewige Sein durch diese kontingente Welt auf, vom Verstand mühsam nachgezeichnet, aber von der Seele ebenso sicher wie unbenennbar ergriffen: „Die ‘Klarheit’ aber ist wie ein Lichtglanz, der über das Seiende ausgegossen ist und seinen göttlichen Ursprung verrät. Es scheint, dass mit diesem Wort der eigentliche Zauber des Schönen ausgesprochen ist: das, was in so eigentümlicher Weise die Seele ergreift und was der natürliche Mensch meint, wenn er etwas ‘schön’ nennt. Wie wir ‘ursprünglich verstehen’, was Wahrheit ist, wenn wir erkennen, und was Gutheit ist, wenn unser Streben Erfüllung findet, so verstehen wir, was Schönheit ist, wenn jener ‘Glanz’ uns an die Seele rührt“ (300). Eine solche Erfahrung, die sich für den Verstand nicht dingfest machen lässt, begegnet sowohl in der sinnlichen Welt als auch, noch bezwingender, in der geistigen „Schönheit der Menschenseele, deren ‘Wandel oder Tun nach der geistigen Klarheit der Vernunft im rechten Maß geordnet ist’“ (300).
Vor der Sicherheit dieser analogen Übertragung versagt tatsächlich der sich Schritt für Schritt weitertastende Verstand, das rechenhafte Vorwärtsgehen. Statt zu schließen, muss der Verstand enden und – soweit vom denkenden Subjekt übernommen – die Direktive an die Theologie weitergeben: „Schon der Versuch, die Einfachheit des göttlichen Seins mit der Vielheit der Ideen in Einklang zu bringen, trägt den Stempel der vom Glauben beschwingten Vernunft, die – von Offenbarungsworten angetrieben – Geheimnisse zu fassen sucht, an denen die menschlichen Begriffe zerbrechen“ (287).
Zugrunde liegt nicht Unklarheit, sondern Überklarheit in Gott. „Wenn er für uns unbestimmbar und unmessbar ist, weil seine Unendlichkeit alle unsere Maße und Bestimmungen übersteigt, so ist es doch sein eigenes Maß, in und für sich selbst ‘ausgemessen’ und bestimmt, in und mit sich selbst in vollem Einklang, in und für sich selbst ganz durchleuchtet: das Licht selbst, ‘in dem kein Schatten von Finsternis ist’“ (301).
So bibel-theologisch hier auch argumentiert wird, so bleibt doch zu betonen, dass Stein die Konzeption eines notwendigen Seins als Extrapolation aus dem kontingenten Sein für zwingend hält – woran ließe sich sonst Kontingenz erkenntnistheoretisch festmachen, wenn nicht an ihrem Gegensatz? Die phänomenologische Analyse der verschiedenen Schichten des Ich hat anthropologisch gleichfalls aufgezeigt, dass das ausschließlich kontingent gedachte Ich nur unter Ausblendung anderer Schichten der ichlichen Kontinuität zustande käme, mithin gar keinen „Stand“ für die Reflexion gewinnen könnte. So ist die theologische Fassung desselben Gedankens zwar philosophisch nicht notwendig, erhellt aber nach Steins Intention nochmals die Grundproblematik: Kontingenz ist nur als komplementärer Begriff zu Notwendigkeit, Zeitfreiheit, Vollendung sinnvoll.
8. Die Wende von Thomas zu Augustinus: von der Ontologie zur Personlehre
Wie fruchtbar die theologische Wendung jedenfalls für die – nicht glaubensgebundene – phänomenologische Ich-Analyse werden kann, sei an einer letzten Reflexion deutlich gemacht. Damit rückt auch der Charakter der mehrfach geübten Extrapolation vom kontingenten auf ein notwendiges Sein in ein deutlicheres argumentatives Licht.
Im sechsten Kapitel von EES greift Stein unmittelbar auf den Sinn des Seins, also auf die Anfangsfrage zurück, die sie mit Heidegger gemeinsam hat. „Das Sein ist eines, und alles, was ist, hat daran teil. Sein voller Sinn entspricht der Fülle alles Seienden. Wir meinen diese ganze Fülle, wenn wir vom Sein sprechen“ (308 f.).
Wieso aber viele Seiende und zugleich ein einheitliches Sein?
Stein betont, dass das griechische Denken die Einheit des Seins und die offenbare Vielheit des Seienden zur Deckung zu bringen suchte, etwa bei den Eleaten, welche nur die Einheit des wahren Seins als wirklich erachteten und das Seiende in seiner Vielfalt darüber verloren (309). So ist das Problem neu aufzufächern. Wie können Teile an einem Ganzen teilhaben? „Ganzes“ sind z. B. die Natur, die Geisteswelt, die Urbilder (Wesenheiten) alles Geschaffenen und letztlich das eine Urbild, welches das göttliche Sein ist (310 f.). Eine solche Aufzählung ist jedoch falsch angesetzt, da sie nebeneinander ordnet, was tiefer betrachtet kausal vernetzt und selbst nur ein Ganzes ist. „In diesem letzten und letztbegründeten Einen ist alle Fülle des Seins beschlossen. […] Jedes endliche Mittelglied muß schließlich auf diesen anfangs- und endlosen Urgrund führen: das erste Sein“ (311).
So erweist sich, dass das Ganze nicht in gleichgültige „Teile“ auseinander zu legen ist. Und es stellt sich nicht so sehr eine Stufenfolge, die addiert werden könnte, sondern eine rätselvolle Asymmetrie her: Das Ganze bedingt seine Teile, ist aber nicht aus seinen Teilen zusammengesetzt. Wie hat dann das endliche am ewigen Sein Anteil? Stein referiert zur Lösung die Auffassung des Thomas von einer doppelten Möglichkeit der Analogie. Die erste Analogie meint eine einfache Beziehung zwischen zwei Gliedern: 2 als das Doppelte von 1. Die zweite Analogie meint eine übertragene Beziehung: 2: 1 = 6: 3 = 100: 50. In der Rede von Gott ist nur diese zweite Analogie erlaubt. Sie schließt endlichen Abstand und unmittelbaren Vergleich zwischen Gott und dem Geschöpf aus und erlaubt mittelbar ein übertragbares Verhältnis: Das Verhältnis endlichen Teil-Seins ist analog zum Selbstverhältnis des ewigen Seins (als eines differenzierten Ganzen).
Mit dieser Unterscheidung ist zweierlei gewonnen: Gott ist nicht auf das Geschöpf eingeebnet; philosophisch gesprochen: Endliches Sein erlaubt keine einfache Extrapolation auf ewiges Sein. Zweitens ist es dennoch erlaubt, ja anders nicht möglich, den gemeinsamen Begriff Sein auf unterschiedliche Größen anzuwenden. Abgewehrt sind Pantheismus auf der einen Seite, völlige Sprachlosigkeit und Erkenntnisskepsis auf der anderen Seite.
Eben hier ist die Stelle einer bedeutsamen Wende: Stein wechselt von Thomas zu Augustinus. Das heißt, dass nicht mehr nach Urteilen über Gott gesucht wird, sondern nach seinen eigenen Selbstaussagen in der Schrift, die das zergliedernde Begreifen sprengen. So wirkt der Absatz über den „Namen Gottes“ als Ausbruch aus dem bisher Entwickelten. Mit Augustinus sieht Stein in der Deutung von Exodus 3,14: „Ich bin, der ich bin“, das Sein nunmehr vollkommen personal ausgesprochen. Person ist grundsätzlich definiert durch Vernunft und Freiheit (317) – beides sichtbar an Gott in der auf ihn verweisenden Vernünftigkeit der Welt und der ihm innewohnenden Freiheit der ersten Ursache, die ihrerseits nicht von einer noch weiter vorgelagerten Ursache abhängen kann.
Auffächernd scheidet Stein das menschliche vom göttlichen Ich. Die gemeinsame Definition lautet: Ich meint das eigene Innesein und zugleich das Unterschiedensein von jedem anderen. Kürzer benannt ist es die Einheit von Selbstsein und Andersheit (gegenüber anderem Selbst); bildhaft zeigt es sich als in sich geschlossenes Ich, das für sich da ist, und aufquellendes, das sich nach außen abgrenzend zeigt (318). Gemäß dieser Definition ist das endliche Ich bis auf seinen Grund ebenso bedürftig wie nichtig, denn es ist leer an sich selbst, weil es äußerer und innerer Welten als Gehalt bedarf; auch kommt sein Leben aus dem Dunkel und geht ins Dunkel, ist für die Erinnerung lückenhaft und wird nur von Augenblick zu Augenblick erhalten (319). So ist sein Abstand zum göttlichen Ich unendlich. Der Gottesname „Ich bin“ meint ja „ewig-lebendige Gegenwart, ohne Anfang und Ende, ohne Lücken und ohne Dunkelheit. Dieses Ichleben hat alle Fülle in sich und aus sich selbst […]. Das ‘Ich bin’ heißt: Ich lebe, Ich weiß, Ich will, Ich liebe […] Das göttliche Ich ist kein leeres, sondern das in sich selbst alle Fülle bergende, umschließende und beherrschende“ (319). Sein ist hier persönlich geformt, ist Person, also nicht Neutrum und Gegenstand, sondern Ich und Selbstbewusstsein. Stein kommentiert, dass „es sich selbst geistig umfaßt oder für sich selbst durchsichtig ist“ (320). Neben und über anderen Bestimmungen, die alle außerordentlich für dieses Ich gelten, stehen Personalität und Selbstbesitz, die Gegensatzlosigkeit, Form und Fülle zugleich umfassen, als die dem Denken gerade noch berührbare Kontur des Personalen in seinem Urbild. Davon ist zugleich das Kontingente gegenbildlich ausgeschlossen.
Sachgemäß taucht hier das große Geheimnis der Schöpfung auf: die alte Frage, wie Gott überhaupt ein anderes, als er selbst ist, habe hervorrufen können, zumal in der Weise des Kontingenten, dem die obigen Bestimmungen durchaus fehlen. Stein versucht, nun wieder in den Bahnen des Thomas, die Teilung des Seins als Anteil am einen Sein zu erläutern. Wenn dies schon nicht restlos aufzuhellen ist, so darf doch „Teilung“ nicht quantitativ verstanden werden, sondern meint qualitatives Scheiden. Alles dazu Sagbare darf jedoch den Gegensatz von Ewigem und Endlichem, von Notwendigem und Kontingentem nicht zudecken. Nicht wenige Bilder dieser Teilung leiten irre, auch das Verhältnis des Künstlers zu seinem Kunstwerk; am ehesten trifft noch zu das Urbild im Verhältnis zum Spiegelbild oder das ungebrochene Licht im Verhältnis zum gebrochenen Farbstrahl. Jedenfalls steht neben dem Ewigen kein zweites Ewiges, sosehr der Verstand dabei auch weiterhin mit Rätselfragen zu tun hat (321).
Ein letzter schwieriger Gedanke: Verhält sich der Schöpfer zur Schöpfung wie Gott zu sich selbst? Auch hier gerät die Reflexion an eine Grenze, die sich nur mit Bildern, uneigentlich, erhellen lässt. Denn wie ist das göttliche Leben in sich lebendig? Der Sohn ist durchaus ein „vollkommenes Bild“ des väterlichen Ursprungs, was genauer heißt: Dasselbe Wesen und Sein ist nicht später geschaffen, sondern gleich ursprünglich gezeugt. Zugang zu dieser Formulierung bietet ein Verhalten des Geistes, das der Selbstbeobachtung entnommen ist: Auch die Selbsterkenntnis weiß von sich selbst im unmittelbaren Innesein des eigenen Ich (322). Doch fehlt erfahrungsgemäß die völlig umfassende Erkenntnis, das Selbst-Bewusstsein trägt einen unbekannten Rest mit sich – eben jenen entzogenen Ich-Grund, von dem die Rede war. Dennoch lässt sich von der Selbstbeobachtung geistigen Lebens schließen auf Gottes Wissen um sich selbst. Sein Wissen und Sich-Betrachten meint nicht leibliche Zeugung eines quantitativ zweiten, sondern unmittelbare Zeugung seiner selbst als Gegenüber. „So ist die Erzeugung eines vollkommenen ‘Ebenbildes’ Gottes nicht die Hervorbringung eines neuen Seins außer dem göttlichen und eines zweiten göttlichen Wesens, sondern die innere, geistige Umfassung des einen Seins“ (322).
Die Frage ist damit aber nicht behoben, weshalb überhaupt eine zweite Person erscheint – ist doch damit die Einheit des göttlichen Seins fraglich. Zu diesem Problem gibt es einen doppelten Zugang wiederum über die Selbsterfahrung. Der erste Zugang greift auf die Erfahrung von Ich und Du zurück, die sich als Eigenes und Fremdes gegenüberstehen und doch ein Gemeinsames haben: das beiderseitige Ich. Ihre Trennung ist unterfangen von der Einheit des „Wir“. Dieses Wir umschließt das Einssein einer Mehrheit von Personen: Einheit und Vielheit stören sich hier nicht, zwingen das Ich weder zum Aufbrechen noch zum Festhalten seiner Geschlossenheit. Bei aller Unterschiedenheit gibt es auch in Gott „eine vollkommene Einheit des Wir, wie sie von keiner Gemeinschaft endlicher Personen erreicht werden kann. Und doch in dieser Einheit die Geschiedenheit des Ich und Du, ohne die kein Wir möglich ist“ (323). Genesis 1, 28: „Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde“, erscheint als solcher Hinweis auf das geheimnisvolle Wir Gottes.
Tiefer noch formt sich die genannte Einheit als Einheit der Liebe – in ihr sind wechselseitige Spannung und Bedürftigkeit der beiden Gegenüber in äußerster Weise ausgeprägt. Liebe ist sowohl Selbstliebe als auch Selbsthingabe. Da dies ebenso für den anderen gilt, bewirkt die wechselseitige Liebe ein hoch differenziertes Einssein. Sie kann im Endlichen geahnt, nicht in ihrer höchstmöglichen Spannung vollendet werden. Stein vermutet, dass die Liebe zwischen dem Geschöpf und Gott deswegen unvollkommen bleibt, weil das Geschöpf die restlose Selbsthingabe Gottes nicht beantworten kann. Doch erschließt sich denkend die makellose Urform: „Gottes inneres Leben ist die völlig freie, von allem Geschaffenen unabhängige, wandellose ewige Wechselliebe der göttlichen Personen. Was sie einander schenken, ist das eine, ewige, unendliche Wesen und Sein, das eine jede vollkommen umfasst und alle zusammen. […] das Geben und Empfangen gehört zum göttlichen Sein selbst“ (324).
Als zweiten knappen Zugang zu diesem unerhörten Spannungsfeld versucht Stein Gottes Leben als „Hervorgang“ aus dem eigenen Inneren darzustellen. Gottes Leben verdankt sich nicht einem anderen, sondern ist „ewige Bewegung in sich selbst, ein ewiges Sich-selbst-schöpfen aus der Tiefe des eigenen unendlichen Seins als schenkende Hingabe des ewigen Ich an ein ewiges Du und ein entsprechendes ewiges Sichempfangen und Sichwiederschenken“ (325).
Immer noch muss aber das Verhältnis von Gott und Welt als zweier getrennter Größen dem Denken nachvollziehbar werden. Stein schlägt vor: „Die innergöttlichen Hervorgänge lassen das Sein noch ungeteilt, aber die Teilung ist in ihnen schon vorgebildet“ (53). Der Logos, der Sohn also, nimmt die Mitte zwischen Schöpfer und Schöpfung ein: Erstens schafft er den Zusammenhang von Sinn in der Welt (den Schöpfungsplan); zweitens ist er Grund des Geschaffenen in seinen schöpferischen Ur-Bildern. So gilt ein doppeltes Verhältnis Gottes zur Welt: Seine Einheit umfasst Vielheit; seine Einheit begründet Vielheit. Das doppelte Antlitz des Logos zeigt die gegenwärtige, haltende Einheit (Bild des Vaters) und die Ursächlichkeit für alles vielfältig Geschaffene. Insofern bildet der Logos das Bindeglied zwischen Ewigkeit und Zeit. Schöpfung ist daher tatsächlich unpantheistisch von ihrem Ursprung geschieden. Zu ihrer Ordnung gehören Zeit und Grenze: Zeit als innere Endlichkeit, Grenze als äußere Bestimmung im Raum. Zur sachlichen Grenze gehört ferner wesentlich die Scheidung von Form und Inhalt. Denn Form ist äußere Umgrenzungslinie und inneres Gefüge, das die aufbauenden Teile ordnet (327). Sein in der Zeit bedarf der Ausfaltung seiner Möglichkeiten zur Wirklichkeit – es folgt einem Werdegang. Schon kraft dieser Kennzeichen ist seine Sonderung vom göttlichen Ursprung noch einmal evident. Schöpfung ist durchaus zeitlich, in ihrem Anfang wie in ihrem Werden, und doch ist sie „von Ewigkeit her vorhergesehen“ (326). Alle Momente der Kontingenz, wie sie immer wieder kontrastierend zum Ewigen aufscheinen, sind daher vom Ewigen her denkbar, und zwar als positive Andersheit.
So lässt sich wiederum die Person nicht allein vom Sein, aber auch nicht allein vom Erkennen aufbauen, sondern wesentlich vom Werden aus Begegnung. Diese denkerische Erfahrung stellt das Dritte vor, das über Thomas’ Seinsdenken, über Husserls Ichdenken zu Augustinus’ Denken aus der Relation führt: zu Hingabe und Hinnahme. Stein nimmt nicht wie Heidegger die Verzweiflung des Menschen als grundlegenden anthropologischen Befund an, sondern der gesamte Befund umfasst sowohl Angst als Geborgenheit, sowohl Ausgeliefertsein als Selbststand, sowohl Irrtum als Wahrheitsvermögen, sowohl Nichtverstehen als Rationalität. Erst von diesem Gesamtbestand aus, der keineswegs nur glaubensmäßig, sondern durch Erfahrung und Reflexion gestützt ist, sucht sie denkend auf Gott weiterzuschließen. So betont Stein kraftvoll überzeugt, Gott sei der Vernunft zugänglich, allerdings innerhalb einer methodischen Grenze. Verstärkte Aufmerksamkeit sei sogar darauf zu richten, dass selbst das Personale, das sich im Aufstieg vom Seienden zu Gott immer klarer konturiert, der ratio offenstehe; dass die Freiheit des Personalen unter der verstandesmäßigen Behandlung nicht schwinde, sondern erst recht sichtbar werde. Vernunft werde von der Gnade nicht entmächtigt. Wahrheit müsse sich vor dem Verstand ausweisen können – auch religiöse Wahrheit.
Doch bleibt die Frage, ob nicht zwischen Schöpfung und Gott, genauerhin zwischen Mensch und Gott, bereits anfänglich ein Abgrund erscheinen müsse, der dem Verstand in seinem Vorgehen unüberwindlich sei. Wo bliebe in dem durchrationalisierten theologischen Entwurf die Erfahrung von der „Inkommensurabilität“, ja „Absurdität“ Gottes, wie Kierkegaard formuliert?
Jedoch: Stein führt gerade kraft ihrer philosophischen Schulung das Experiment der Vernunft so sorgfältig durch, dass auch die Grenze der gedanklichen Bewegung mit Genauigkeit aufscheint. Die Grenze ist sozusagen der Denkfähigkeit selbst eingeschrieben und sinnvolle Herausforderung. „Über die Grenze hinaus“ wird kein Beweis vorgelegt: Stein vollzieht vielmehr jenen „Aufstieg“, der den Absoluten in seinem gesonderten, mit nichts vergleichbaren Sein, den durch alle Ähnlichkeit hindurch Unähnlichen denkbar werden lässt. Die Bewegung wird sogar zeigen, dass die Andersheit Gottes tatsächlich nur „berührt“, nicht gesehen und nicht gewusst werden kann. Doch wird solche Andersheit, sobald sie ins Spiel kommt, die Gegenstände der normalen Erfahrung umgekehrt in eine Bewegung setzen, die der Verstand zu strukturieren sucht. Auf der Grundlage göttlicher Andersheit wird gerade auch die Andersheit des Menschen denkbar: als eine Andersheit des Kontingenten, das sich in der Gerichtetheit (Intentionalität) auf sein komplementäres Anderes profiliert. Solche Erkenntnis zielt auf Begegnung, nicht nur mit Gott, sondern ebenso mit der Welt der Dinge wie mit der Welt, die das Ich selbst ist.
So wird Stein in der Logik der Ontologie aufsteigen bis zur Logik des Personalen, worin der Mensch wie die höchste Person, Gott selbst, einbegriffen sind. Von der Logik der Person aus wird aber die Ontologie noch einmal in ihrem methodisch beschränkten Charakter erkenntlich. Denn es liegt in der Logik des Erkennens von Welt, auf das Selbsterkennen zu verweisen und von dort auf den personalen, transzendenten Ich-Grund weiterzudenken, und es liegt in der Logik des Ich-Grundes, das Erkennen zu einem Anerkennen herauszufordern. Reflexe, distanzierte Logik wird existentielle Logik. Dass das anfänglich ontologische System dadurch in sich selbst aufbricht, dass der Begriff „Person“ letztlich mehr Erklärungsgehalt aufweist als der Begriff „Sein“, weil kontingente Person und absolute Person sich dem Erkennen erstrangig eröffnen, macht die Qualität der Darstellung aus.
Auswahlbibliographie
Beckmann, B., Phänomenologie des religiösen Erlebnisses bei A. Reinach und Edith Stein, Würzburg 2003.
Beckmann, B. u. Gerl-Falkovitz, H.-B. (Hrsg.), Edith Stein, Würzburg 2003.
ESGA: 25 Bände 2000 – 2006 (Freiburg: Herder).
Fetz, R. L. u. a. (Hrsg.), Studien zur Philosophie von Edith Stein, Freiburg–München 1993.
Gerl, H.-B., Unerbittliches Licht. Philosophie, Mystik, Leben: Edith Stein, Mainz 1999.
Wulf, C. M., Freiheit und Grenze, Vallendar 2002.