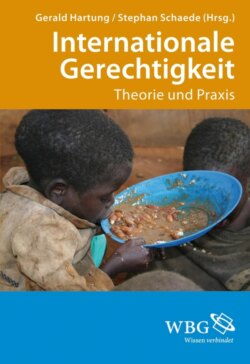Читать книгу Internationale Gerechtigkeit - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sinn für Ungerechtigkeit und das (gebrochene) Versprechen der Gerechtigkeit in der globalen Krise der Ökonomie
ОглавлениеKritisches zum Vertrauen in transnationale Gerechtigkeit im Anschluss an Jeffrey D. Sachs und Margaret U. Walker
BURKHARD LIEBSCH
La justice doit garder la conscience aiguë et lucide de sa propre faiblesse: tout en combattant ses ennemis, il faut qu’elle se combatte elle-même […].
Vladimir Jankélévitch1
Inhalt
1 Im Lichte der Ungerechtigkeit: zur Glaubwürdigkeit von Theorien der Gerechtigkeit im transnationalen Horizont
2 Vertrauen in der politischen Gegenwart: Jeffrey D. Sachs
3 Exkurs zum Vertrauen
4 Verletztes Vertrauen: Margaret U. Walker
5 Versprechen und Vertrauen in Zukunft
6 Resümee
I. Im Lichte der Ungerechtigkeit: zur Glaubwürdigkeit von Theorien der Gerechtigkeit im transnationalen Horizont
Aus der Geschichte politischer Lebensformen lässt sich das Verlangen nach Gerechtigkeit nicht wegdenken. Insofern ist es nichts Neues. Platon und Aristoteles stellen es so dar, als ob die Menschen diesem Verlangen schon immer Rechnung hätten tragen müssen, sobald sie sich unerbittlichen Zwängen schieren Überlebens zu entziehen vermochten, um womöglich gut zu leben. Und bis heute wird oft der Eindruck erweckt, als bewege sich das Gerechtigkeitsdenken nach wie vor (grundsätzlich unverändert) auf der Spur dieser Vorgabe.2
Doch erzwingen Prozesse der Globalisierung wie sie sich u. a. aus einem weitgehend deregulierten und gewaltträchtigen Wirtschaften, aus internationalen ökonomischen Transfers, zunehmender Migration und grenzüberschreitender Kommunikation ergeben, Transformationen der Gerechtigkeit, auf die das Gerechtigkeitsdenken denkbar schlecht vorbereitet war. Die Gerechtigkeit begegnet uns bei Platon und Aristoteles ursprünglich als auf abgegrenzte politische Lebensformen zugeschnitten. Fremden, die diesen Lebensformen nicht zugehörten, konnte sie nicht zustehen.3 Heute sehen wir uns dagegen mit der Ausformung einer neuartigen Gerechtigkeit in statu nascendi konfrontiert, die gewissermaßen vor unseren Augen zu entstehen beginnt, insofern sie ausdrücklich alle Menschen einbeziehen soll, ob sie anderen fremd sind oder nicht.
Möglicherweise ist es freilich irreführend, diese Einbeziehung als eine bloße Ausweitung der Gerechtigkeit zu verstehen. Denn es ist durchaus fraglich, ob eine im globalen Horizont differenzierte Gerechtigkeit überhaupt noch aus einem einheitlichen Begriff entspringen kann oder ob die Idee der Gerechtigkeit nicht eine irreversible Pluralisierung erfahren wird, die geradewegs in ihre regelrechte Zersplitterung münden könnte. Und wird in den gegenwärtig verschärften Prozessen der Globalisierung die Gerechtigkeit überhaupt nachträglich „globalisiert“, oder verhält es sich genau umgekehrt, nämlich so, dass diese Prozesse nunmehr dazu führen, dass eine im Grunde schon immer im Verlangen nach Gerechtigkeit angelegte Globalität nachzuvollziehen sein wird? Wird die Gerechtigkeit einer sekundären Globalisierung unterworfen, durch die sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt oder transformiert werden könnte, oder vollzieht die Globalisierung eine in sich bereits auf Globalität angelegte Gerechtigkeit nur nach? Letzteres liegt nahe, wenn es denn stimmt, dass jedem Menschen – und zwar nicht als uns politisch Zugehörigem, sondern gerade als Fremdem – ein unbedingter Gerechtigkeitsanspruch zusteht, wie uns Levinas und Derrida in Anlehnung an jüdisches Erbe unermüdlich eingeschärft haben, das der griechischen Herkunft eines auf bestimmte Lebensformen beschränkten Gerechtigkeitsdenkens widerstreitet.4
Für beide Philosophen stellt sich dieser Anspruch freilich nicht als zwingend beweisbar dar; vielmehr sehen sie ihn einer anfechtbaren Bezeugung überantwortet, deren politisch überzeugende Wirklichkeit außerordentlich fragwürdig erscheint. Darüber hinaus kann keine Rede davon sein, das Denken dieses unbedingten Gerechtigkeitsanspruchs sei darauf vorbereitet, ihn transnational oder gar global zu denken. Wenn auch im globalen Horizont einer neuartigen Gerechtigkeit in statu nascendi alle Menschen „eingeschlossen“ bzw. niemand von ihm ausgeschlossen sein soll (selbst radikale Feinde nicht), so ist doch unbestritten, dass wir es hier keinesfalls mit einer unmittelbaren Gerechtigkeit von Angesicht zu Angesicht zu tun haben (wie sie Levinas immer wieder vorschwebte). Vielmehr geht es um hochkomplexe, von niemandem mehr in Gänze übersehbare Prozesse institutioneller Vermittlung und Sicherstellung der Gerechtigkeit(en).5Zwar kann ein außerordentlicher Gerechtigkeitsanspruch, der von einem einzigen Anderen und von jedem in seiner Anderheit ausgeht, diese Prozesse möglicherweise durchqueren. Und inter- oder transnationale politische Ordnungsgefüge heben ihn weder einfach auf noch lassen sie ihn gewissermaßen unter sich. Aber darin liegt zugleich die Gefahr einer anarchischen Destabilisierung, wenn eine nach bewährtem Schema Gleiches ungleich und Ungleiches gleich behandelnde, sei es distributive, sei es kompensatorische Gerechtigkeit von der nach singularer Gerechtigkeit verlangenden Anderheit jedes Anderen unterwandert und so geradezu „verrückt“ werden kann (wovon sich Levinas und Derrida überzeugt zeigen).6 Demnach läge die Globalisierung ursprünglich gewissermaßen im Gerechtigkeitsverlangen beschlossen; sie wäre eine zwingende Implikation der Gerechtigkeitsforderung selbst, insofern uns jeder Andere als ein Verlangen nach Gerechtigkeit begegnet. Ganz fremd ist dieser Gedanke auch dem „griechischen“ Gerechtigkeitsdenken nicht. Selbst bei Platon, der die Gerechtigkeit als den Sinn politischen Zusammenlebens denkt, steht zu lesen, dass man auch dem Feind Gerechtigkeit schulde (Politeia 335 d, e).7 Zu beweisen ist das freilich nicht, nur zu bezeugen.8
Im Übrigen bleibt unklar, nach welcher Gerechtigkeit der Andere verlangt.9 Der Begriff erschien schon Platon und Aristoteles als notorisch vieldeutig. Und die inzwischen unübersehbare empirische Erforschung der Gerechtigkeit bzw. des Verlangens nach ihr zeichnet ein eher noch verwirrenderes Bild. Während sie sich in ihren v. a. von Piaget und Kohlberg geprägten Anfängen an normativen Vorgaben der philosophischen Tradition orientierte, um zu untersuchen, auf welchen ontogenetischen Wegen der Einzelne sich ein philosophisch bereits ausformuliertes Gerechtigkeitsverständnis von Kant bis Rawls erschließt10 , weist sie heute, ausgehend von einer primären Sensibilität für Ungerechtigkeit auf außerordentlich disparate Artikulationsformen von Gerechtigkeitsansprüchen hin, die der wahrgenommenen Ungerechtigkeit mehr oder weniger abzuhelfen versprechen, manchmal aber auch in die Irre führen.11 Was sich subjektiv als Ungerechtigkeit darstellt und mit moralischer Empörung einhergeht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen u. U. als bloße Selbstgerechtigkeit oder als Ausdruck eigenen Unglücks, das streng genommen kein Gerechtigkeitsproblem darstellt.12 Offenkundig stellt das, was man Sinn für Ungerechtigkeit genannt hat, keine Berufungsinstanz dar.13 Schon auf der Ebene der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit, die das Verlangen nach Gerechtigkeit allererst auf den Plan ruft, ist Irrtum möglich. Es kann sich also herausstellen, dass es sich gar nicht um eine Frage der Gerechtigkeit handelt. Weiterhin kann das artikulierte Gerechtigkeitsverlangen in seiner Selbstgerechtigkeit die Idee der Gerechtigkeit geradezu konterkarieren. Und aus dem erfahrenen Mangel an Gerechtigkeit ist nicht direkt zu entnehmen, wie eine Gerechtigkeit positiv zu denken wäre, die diesen Mangel zu beseitigen verspräche.14
Das Empfinden von Ungerechtigkeit muss also über sich selbst aufgeklärt werden und bedarf der Rechtfertigung.15 Das gilt umso mehr, wenn wir vor der Frage stehen, wie es in eine Pluralität verschiedener Gerechtigkeitsbegriffe zu übersetzen ist. So unterscheiden wir Leistungs-, Bedürfnis- oder Bedarfsgerechtigkeit, Besitzstandsgerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit, Chancen- und Teilhabegerechtigkeit; und all das wird noch mit Blick auf überlebte und künftige Generationen bedacht, die gegen uns gerechte Ansprüche haben sollen, obgleich es sich um Ungeborene handelt. Auf diese Weise erfährt die Idee der Gerechtigkeit eine geradezu maßlose Ausweitung, die synchron und diachron – idealiter – alle (tote, lebende und noch ungeborene) Menschen einschließt. Dabei geraten freilich verschiedene Konzeptionen der Gerechtigkeit miteinander in Widerstreit.
Wenn wir es nicht mit fein säuberlich voneinander getrennten „Sphären“ der Gerechtigkeit (M. Walzer), sondern realistischerweise mit einer Vielzahl einander überlagernder sozialer, politischer und transnationaler Ordnungen zu tun haben, die uns nicht gleichsam von sich aus lehren, welche Konzeption der Gerechtigkeit jeweils auf sie passt, so ist Widerstreit vorprogrammiert. Das aber hat zur Folge, dass eine Form der Gerechtigkeit zu realisieren bereits bedeuten kann, eine andere zu verraten. Die Gerechtigkeit, die wir jedem Anderem unbedingt schulden, wenn es nach Levinas und Derrida geht, bleibt scheinbar unvermeidlich auf der Strecke, wenn die singulare Anderheit eines jeden nivelliert wird in einer alle Anderen gleich-machenden bzw. gleich behandelnden Gerechtigkeit, die bereits auf staatlicher Ebene, erst recht aber im globalen Horizont transnationaler Formen von Gerechtigkeit nur noch mit einer Vielzahl von Menschen rechnen kann und sie auf diese Weise gleichsam ethisch ihr Gesicht verlieren lässt.
Doch wird gerade das als (seit langem verlangter) „kosmopolitischer“ Fortschritt verkauft. Endlich sollen Nähe oder Ferne, Zugehörigkeit und Mitgliedschaft in einer geteilten politischen Lebensform keinen moralischen Unterschied mehr machen. Endlich soll auch der Fernste unbedingt derselben Gerechtigkeit teilhaftig werden wie der Nächste, d. h. aber: als Gleicher. Lässt sich dagegen eine Form der Gleichheit denken, die nicht um den Preis einer ethischen Gesichtslosigkeit erkauft werden müsste, in der das Antlitz jedes Anderen verschwindet im Grau-in-Grau einer indifferenten Gleichheit? Oder bedürfen wir unabdingbar eben dieser Gleichheit, um die global ausgeweitete Gerechtigkeit vor maßloser Überforderung durch eine angeblich „unbedingt“ jedem Anderen zustehende Gerechtigkeit zu bewahren? Vorläufig ist keine befriedigende Antwort auf diese eindringlichen Fragen in Sicht; aber dass sie uns nicht loslassen zeigt immerhin, wie sich das Verlangen nach einer – vielleicht un-möglichen – Gerechtigkeit im besten Sinne selbst im Wege steht, indem es sich schierer Selbst-Gerechtigkeit widersetzt, die auf dem Weg zu einer universalen Gerechtigkeit gerade diejenige Ungerechtigkeit vergessen könnte, welche der Gerechtigkeit selbst innewohnt, wenn sie niemals zugleich allen und jedem Anderen als Anderem gerecht zu werden versprechen kann.16
Davon lässt indessen eine inzwischen regelrecht „industriell“ (T. Pogge) produktive Gerechtigkeitsdiskussion nur wenig ahnen. Immer raffiniertere Theorien werden lanciert, so dass ein Beschäftigungsprogramm für Gerechtigkeitstheoretiker auf Jahrzehnte hinaus, wenn nicht auf unabsehbare Zeit gesichert scheint, ohne dass die Aussicht besteht, man werde herausfinden, wie es möglich ist, im globalen Horizont gerecht zu sein (und nicht nur subtil von der Gerechtigkeit zu reden). Häufig hat es den Anschein, als suche man vor allem nach einem zwingenden Beweis dafür, dass wir im globalen Horizont anderen überhaupt Gerechtigkeit (und nicht bloß mehr oder weniger herablassende Großzügigkeit) schulden.17 Darüber hinaus wird nicht selten auch bezweifelt, ob die üblicherweise als Gerechtigkeitsfragen aufgeworfenen Probleme der weltweiten Armut überhaupt eine moralische Herausforderung oder primär eine politische Aufgabe (im Sinne unabdingbarer Nothilfe etwa, die kaum beanspruchen kann, gerecht zu erfolgen) darstellen. So werden auch Grundbegriffe wie Moral und Politik zweifelhaft oder geraten ins Wanken im Zuge einer Globalisierung, die, weit entfernt, nur einen weiteren Umfang der Anwendung bisheriger Konzepte zu erfordern, deren radikale Revision nach sich ziehen könnte.
Das gilt nun auch für die Quelle des Verlangens nach Gerechtigkeit selbst: für den Sinn für Ungerechtigkeit, ohne den wir nicht einmal wahrnehmen würden, wo und in welcher Hinsicht es an Gerechtigkeit fehlt, und zwar womöglich so, dass unbedingt und ultimativ die Forderung nach Abhilfe zu stellen ist. Im Sinn für Ungerechtigkeit muss das zuerst zu erschließen sein, sonst hat das Verlangen nach Gerechtigkeit überhaupt keinen Ansatzpunkt. Sinn für Ungerechtigkeit bringt also die Probleme der Gerechtigkeit originär zum Vorschein und führt dem Verlangen nach Gerechtigkeit wie auch deren theoretischer Artikulation überhaupt erst die Gegenstände zu. Letztere kann und muss sich allerdings sekundär ev. auch gegen einen Sinn für Ungerechtigkeit richten, der sich im (wie auch immer i. E. motivierten) Beklagen von Mängeln erschöpft und nicht zeigt, wie sie abzustellen wären. Dennoch ist dieser Sinn nicht als bloße Vorstufe der Gerechtigkeit zu verstehen; er bleibt im Gerechtigkeitsdenken selbst virulent, etwa wenn deutlich wird, dass eine Gerechtigkeit auf Kosten einer anderen geht, so dass Ungerechtigkeit in der Gerechtigkeit selbst zum Vorschein kommt (wie es im skizzierten Missverhältnis von Gleichheit und singularer Gerechtigkeit deutlich wird).18
Nur ein entsprechend präzisierter, gerade nicht auf bloßen Zorn oder Empörung reduzierter Sinn für Ungerechtigkeit wird deshalb einer globalisierten Gerechtigkeit bzw. einer im Zeichen der Gerechtigkeit neu zu denkenden Globalisierung zugute kommen können, die mit einer schweren Glaubwürdigkeitshypothek belastet scheint. Handelt es sich bei dem Versuch, die Gerechtigkeit nunmehr in globaler oder wenigstens in inter- und transnationaler Hinsicht zu formulieren, nicht immer auch darum, sie als möglich, als einlösbar und insofern realistisch zu beschreiben? Arbeitet man so gesehen nicht an einem Versprechen wirklicher Gerechtigkeit, die all denen zugute kommen soll, die bislang vielfach nicht einmal ihre elementarsten Ansprüche und Rechte artikulieren können, so dass dies andere für sie advokatorisch versuchen müssen?19 Gibt aber nicht gerade dies, aufgrund massivster wirklicher Ungerechtigkeit, zu einer Verachtung der Rede von Gerechtigkeit Anlass, die man nicht als bloßen Defätismus abtun kann? Muss sich demzufolge nicht jedes Versprechen künftig doch einzulösender Gerechtigkeit an der wirklichen Ungerechtigkeit messen lassen und in Rechnung stellen, inwieweit es überhaupt etwas gegen die wirkliche Ungerechtigkeit auszurichten versprechen kann?
Wer Gerechtigkeit im Prozess der Globalisierung zu artikulieren unternimmt, kann Glaubwürdigkeit im Sinne dieses Versprechens nur sehr schwer für sich in Anspruch nehmen. Wo Gerechtigkeit global bedacht wird (und zwar so, dass die Theorie der Gerechtigkeit in Aussicht stellt, ihrerseits praktisch bedeutsam zu werden), nimmt man vielfach ohne Rücksicht darauf ungefragt Vertrauen in die Gerechtigkeit in Anspruch, das aber vielerorts ganz und gar abhanden gekommen ist. Jede Theorie, die dessen ungeachtet erneut übermäßige Gerechtigkeitsansprüche legitimiert und als einlösbar darstellt, steht deshalb im Verdacht mangelnder Glaubwürdigkeit. In praktischer Hinsicht sieht sich jede Gerechtigkeitstheorie, die nicht nur Theorie bleiben will, mit einem eminenten Mangel an Vertrauen in die Gerechtigkeit und in jegliche Rhetorik der Gerechtigkeit konfrontiert, die nicht in dem (an sich ehrenwerten) Versuch, die Gerechtigkeit im transnationalen Horizont neu zu denken, zugleich einem wachen Sinn für fortbestehende Ungerechtigkeit zur Sprache verhilft. Je mehr man also theoretisch von Gerechtigkeit in globaler Perspektive spricht, ohne zugleich dies zu tun, desto weniger glaubwürdig wird die Theorie erscheinen; und je weniger diese beschönigt, inwiefern sie wirkliche Ungerechtigkeit nicht „aufzuheben“ versprechen kann, desto überzeugender wird sie wirken.20 Ich nehme das zum Anlass, das Verlangen nach Gerechtigkeit im globalen bzw. transnationalen Horizont im Lichte der skizzierten Vertrauens- und Glaubwürdigkeitshypothek verständlich zu machen.
II. Vertrauen in der politischen Gegenwart: Jeffrey D. Sachs
Schon vor einem Vierteljahrhundert stellte ein soziologischer Beobachter fest, das Vertrauen sei zu einem allgegenwärtigen Thema aufgerückt.21 Tatsächlich reflektiert die Diskussionslage in den Sozial- und Kulturwissenschaften besonders seit dem Erscheinen von Luhmanns einflussreicher Monografie über das Vertrauen als „Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität“ (1973) ein nachhaltiges Interesse an diesem Begriff. Längst befassen sich auch Historiker umfassend mit dem Thema; Soziologen meinen in ihm „die Grundlage des sozialen Zusammenhalts“ entdeckt zu haben; und selbst hart gesottene Ökonomen sind sich inzwischen darüber klar geworden, wie sehr auch weltweit funktionierende Märkte auf generalisiertes Vertrauen angewiesen sind. Unter Berufung auf Adam Smith betont man, effektives Wirtschaften erfordere im ökonomischen Wettbewerb und Kampf auch vertrauensvolle Zusammenarbeit.22
Inzwischen sind wir freilich auch Zeugen regelrechter rhetorischer Orgien des Vertrauens und seiner geradezu beschwörenden Inanspruchnahme – unter dem desaströsen Eindruck exzessiver Finanzspekulationen, die den Verdacht wecken, fortgesetzter Missbrauch kollektiven Vertrauens gehöre geradezu zu ihrem System. Ob dieses System nur in eine vorübergehende Krise oder bereits ins finale Stadium seines Zusammenbruchs geraten ist, wird sich zeigen. Schon jetzt aber wirkt die im Rekurs auf Adam Smith behauptete produktive Komplementarität von ökonomischem Kampf und Vertrauen wie eine dringend revisionsbedürftige Naivität. Pauschal lässt sie sich jedenfalls nicht aufrechterhalten, wenn ökonomisches Handeln so geschieht, dass es nicht nur das in ihm vielfach funktionale Vertrauen aufs Spiel setzt, sondern auch das in die derzeit weltweit dominante, kapitalistische Art des Wirtschaftens selbst gesetzte Vertrauen zu zerstören droht. Möglicherweise liegt freilich gerade darin ein nicht mehr für möglich gehaltenes Potenzial der Befreiung von einer Herrschaft des Ökonomischen, die vielfach asoziale Züge angenommen hat.
Der Ökonom Jeffrey Sachs, an dessen Buch The End of Poverty ich hier anknüpfe, macht in diesem Sinne auf massive Gründe für weltweit gestörtes, wenn nicht zerstörtes Vertrauen aufmerksam. Dabei geht es ihm weniger um Vertrauen als funktionales Element weltweiten ökonomischen Handelns, sondern um Vertrauen, das man unter Berufung auf das Erbe der Aufklärung in das ökonomische Handeln selbst gesetzt hat. Dieses Vertrauen habe sich auf das „Versprechen“ gestützt, effektives Wirtschaften werde zur Respektierung unveräußerlicher Rechte, menschlicher Freiheit und zu allgemeinem Wohlstand bzw. kollektivem pursuit of happiness beitragen (EP, S. 363). Aber gerade diejenigen Wirtschaftssysteme (allen voran dasjenige der USA), die dieses Erbe angetreten haben, hätten es verraten. Deshalb vertraue man vor allem in denjenigen Staaten, die im Prozess der Globalisierung immer weiter zurückzufallen scheinen, kaum mehr einer kapitalistischen Rhetorik ökonomischer Freiheit und Prosperität, die immer wieder die Einlösung jenes Versprechens in Aussicht gestellt hat.23
Wer je ein solches Versprechen gegeben haben soll, ob es sich wirklich um ein Versprechen gehandelt hat, für das, als gebrochenes, nun sogar ganze ökonomische Systeme haftbar zu machen wären, deren Reputation im Lichte der Aufklärung rückhaltlos auf dem Spiel stehen soll, kann hier dahin gestellt bleiben. Wenn Sachs programmatisch fordert, im Sinne der Abschaffung schlimmster Armut nun endlich zu handeln, weil man es versprochen habe24 und nur dadurch Glaubwürdigkeit zurückgewinnen könne, so kann er sich ungeachtet dieser ungeklärten Fragen immerhin auf einige sehr konkrete, quasi als Versprechen zu verstehende Verbindlichkeiten berufen, die die Staaten des Westens explizit eingegangen sind. So z. B., als sie die Programmatik Health for All by the Year 2000 unterschrieben, der Gewährleistung universalen Zugangs zu elementarer schulischer Bildung (ebenfalls um die Jahrtausendwende) beipflichteten und eine Steigerung ihrer Entwicklungshilfe auf 0,7 % des BSP zusagten (ein Wert, der tatsächlich auf etwa ein Drittel seitdem gefallen ist; EP, S. 213).
Die Folge überwiegenden Versagens angesichts dieser selbst gesetzten Ziele und verbindlichen Zusagen ist nicht nur ein weit verbreiteter Zynismus (EP, S. 266) auf Seiten derer, denen das Versprochene hätte zugute kommen sollen, sondern auch radikaler Zweifel am zentralsten Anspruch ökonomischen Denkens überhaupt, wenigstens den elementarsten menschlichen Grundbedürfnissen angemessen Rechnung zu tragen. Haben sich nicht speziell die kapitalistischen Systeme des Westens als „incapable of responding to the needs of others“ erwiesen (EP, S. 360, 348)? Haben die Versprechungen, die man auf vielen teuren internationalen Konferenzen gemacht hat, nicht jegliche Glaubwürdigkeit dieser Systeme (d. h. das Vertrauen Anderer in sie) und ihres zentralsten Anspruchs ruiniert?
Wie dem auch sei: jeder Versuch, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen, wird zwei Voraussetzungen erfüllen müssen: „the rich countries will need to move beyond the platitudes of helping the poor, and follow through on their repeated promises to deliver more help“ (EP, S. 216, 266). Wenn sich Versprechen dagegen weiterhin in leeren Versprechungen erschöpfen, die kein konsequentes Handeln erwarten lassen, zieht das auf internationaler Ebene eine zynische Verachtung jeglicher „verbindlichen“ Rhetorik nach sich, die ihre Glaubwürdigkeit umso mehr beschwören muss, wie sie in Frage steht. Hier handelt es sich aber nicht allein um die prekäre Vertrauenswürdigkeit eines rhetorischen moralischen Sprachgebrauchs, sondern auch um die Frage, ob er überhaupt noch Bezug nimmt bzw. Antwort gibt auf das Verlangen danach, äußerster ökonomischer Not entgegenzuwirken.
Sind jene Versprechungen nur rhetorischer Ausdruck der moralischen Defensive, in die die reichen Staaten der Welt angesichts der Tatsache geraten sind, dass fast zweieinhalb Milliarden Menschen unter Armut bzw. unter extremer Armut leiden (EP, S. 18 f.)? Oder sind sie als ernst zu nehmende Antworten auf die Stimme der Armen zu verstehen? Sachs bezweifelt letzteres offenbar. Sonst müsste er nicht eigens fordern, diese Stimme zu artikulieren und ihr Geltung zu verschaffen (EP, S. 365). Der von ihm diagnostizierte Vertrauensverlust betrifft im internationalen Maßstab nicht nur die geringe Glaubwürdigkeit der praktischen Verbindlichkeit zahlloser Versprechen; er betrifft mehr noch den Verlust des Vertrauens in die Möglichkeit, sich wenigstens mit elementarsten Forderungen an Andere wenden und bei ihnen Gehör finden zu können.
Wo das nicht gelingt, kann auch kein Versprechen als Antwort auf die anhaltende Erfahrung der Verletzung grundlegender Rechte als glaubwürdig erscheinen bzw. Vertrauen erwecken. Das fragliche Vertrauen betrifft hier die Responsivität des Versprechens, d. h. seines Antwortcharakters mit Bezug auf vorgängige kollektive Erfahrungen, die nach dem Versprechen verlangen, für die Abschaffung der schlimmsten Armut ultimativ zu sorgen. Erst wenn das Versprechen in diesem responsiven Sinne als glaubwürdig erscheint, wird man auf seine Gültigkeit ernsthaft setzen und auf die Verbindlichkeit des Versprochenen vertrauen. Zuerst setzt das Vertrauen auf die Responsivität des Versprechens, dann erst auf dessen Gültigkeit und auf die Verbindlichkeit des gegebenen Wortes. Mehr noch als an der zweifelhaften Glaubwürdigkeit zahlloser Versprechen, die man im Zeichen des Erbes der Aufklärung seitens der reichen Staaten des Westens gegeben hat, lässt der von Sachs hervorgehobene, nicht unberechtigte Zynismus an dieser Responsivität zweifeln.
Aber wo hat sie überhaupt ihren Ort? Wer oder was soll für diese Responsivität einstehen? Können wirklich politisch-ökonomische Systeme in dem, was sie angeblich „versprechen“, als mehr oder weniger „responsiv“ verstanden werden? Am Schluss seines Buches The End of Poverty schlägt Sachs eine Antwort im Sinne des methodologischen Individualismus vor: Solche Systeme und ihre Versprechen beruhen letztlich auf den Individuen, die den ökonomischen und moralischen Sinn dieser Systeme als für sich verbindlich erachten. Es geht also um „commitments of individuals“ so wie um „mere accumulations of individual actions“ (EP, S. 367). So gesehen hätten wir auf die Ebene individuellen Selbstseins zurückzugehen, wenn wir den inneren, weitgehend ungeklärten Zusammenhang von Responsivität, Vertrauen und jenem Versprechen der Gerechtigkeit verstehen wollen.25
Wenn man Versprechen keinen Glauben mehr schenkt, die einst mit der Geschichte des Westens verknüpft waren, so bedeutet das letztlich, dass man Anderen nicht mehr vertraut, die für diese Versprechen einstehen müssten. Und wenn Sachs in weltweiter Perspektive Erinnerung an diese Versprechen anmahnt, so appelliert er an Andere, diese Versprechen als für sich verbindlich zu betrachten und sich in diesem Sinne für diejenigen, die unter schlimmster Armut leiden, als glaubwürdig zu erweisen. Das heißt, Sachs baut darauf, dass diese Glaubwürdigkeit letztlich auf individuellem Selbstsein beruht, dem man im Sinne des Versprechens zu vertrauen hätte.26 Ich nehme das zum Anlass, in einem Exkurs zuerst auf das von Sachs nicht weiter befragte Vertrauen einzugehen (3.), den ich im zweiten Schritt mit Margaret U. Walker auf das Verständnis politisch ruinierten Vertrauens (4.) und auf die Frage seiner Wiedergewinnung im Sinne der Versprechen beziehe, an die Sachs mit Nachdruck erinnert hat (5.).
III. Exkurs zum Vertrauen
Der verbreitete rhetorische Missbrauch herbei geredeten Vertrauens als einer Art moralischen Kompensation für politisch-ökonomisches Versagen kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich wirkliches Vertrauen, das sich auf die Erfahrung praktischer Verbindlichkeit Anderer stützt, sehr weitgehend jedem direkten Zugriff entzieht. Zwar kann man Anderen ausdrücklich Vertrauen schenken; und sie können sich in einem konkreten Fall als vertrauenswürdig erweisen. Doch solange man mehr oder weniger im Vertrauen auf Andere lebt, fällt es als solches gar nicht auf. Kommt es dagegen eigens zur Sprache, so gerät es sofort ins Zwielicht von Zweifeln, Verdacht oder Verrat. Man verlangt Vertrauen gerade in Fällen, in denen es nicht mehr als schlicht gegeben vorauszusetzen ist. Ungetrübtes bzw. ungestörtes Vertrauen bedarf überhaupt keiner Thematisierung und gestattet vielleicht nicht einmal, dass es zur Sprache kommt. Deshalb sagt die amerikanische Philosophin Annette Baier nicht zu unrecht: „Die meisten von uns erkennen eine gegebene Form des Vertrauens am leichtesten, nachdem sie plötzlich zerstört oder zumindest erheblich verletzt worden ist. Wir bewohnen ein Klima des Vertrauens, so wie wir in der Atmosphäre leben; wir nehmen es wahr wie die Luft, nämlich erst dann, wenn es knapp wird oder verschmutzt ist.“27
Auch nachträglich noch kann es schwer sein, zu entscheiden, ob wir zuvor Anderen vertraut haben oder ob wir uns nur auf etwas verlassen haben. Als verlässlich erweist sich im Sinne einer als normal zu erwartenden Regelmäßigkeit vieles – vom Auf- und Untergang der Sonne oder des Mondes und dem Rhythmus der Jahreszeiten bis hin zum regelmäßig mehr oder weniger eingehaltenen täglichen Fahrplan öffentlicher Verkehrsmittel –, ohne dass wir darauf vertrauen würden. Um diese Art normaler Verlässlichkeit vom Vertrauen im engeren Sinne zu unterscheiden, spricht Luhmann im ersten Fall von Zuversicht; andere verwenden die Begriffe reliability und confidence im Gegensatz zu trust.28 Als Bestandsstück eines normalisierten lebensweltlichen Wissensvorrats, der sich auf Erwartungssicherheit stützt, hat Alfred Schütz das von ihm sog. Et-cetera-Prinzip beschrieben und anhand verlässlicher Gewohnheiten plausibel gemacht. Die Selbstverständlichkeit, mit der man sich auf An- und Eingewöhntes verlässt, kaschiert allerdings vielfach, ob man sich nur auf etwas oder (auch) auf jemanden verlässt, dem man vertraut.29 Auch diese Unterscheidung selbst wird erst dann „relevant“, wie Schütz sagen würde, wenn die Verlässlichkeit als Verlässlichkeit in Frage steht, so dass zweifelhaft wird, worauf sie sich eigentlich gründet.30 Phänomenologen, die an Schütz anknüpfen, sprechen in diesem Zusammenhang von einer fungierenden, impliziten Verlässlichkeit, die uns im Vertrauen auf sie handeln lässt. So wird sprachlich kontaminiert, was in einer Krise des Vertrauens nachträglich deutlich auseinander tritt: die Frage, worauf wir uns verlassen und wem wir vertrauen können. Der unterschiedliche Sinn beider Fragen bleibt auch dann bestehen, wenn man dem Befund Rechnung trägt, dass das Sichverlassenkönnen auf etwas vielfach gerade vom Vertrauen in Andere getragen wird und dass letzteres sich umgekehrt in praktischer Verlässlichkeit bewährt.31
Während Autoren wie Luhmann davon ausgehen, soziale Verlässlichkeit funktionaler Zusammenhänge habe ein im Grunde vormodernes, heute weitgehend ins Private abgedrängtes Vertrauen längst ersetzt, halten andere (wie etwa Annette Baier) nach wie vor, oft gestützt auf ontogenetische Überlegungen, daran fest, auf Vertrauen in Andere beruhe nach wie vor jegliche Verlässlichkeit (auch wenn letztere nicht auf Phänomene des Vertrauens zu reduzieren ist). Das Vertrauen müsse als die wichtigste „verbindliche“ Infrastruktur des Sozialen gelten. Es bezeuge und begründe die Erfahrung, in einer gemeinsamen sozialen Welt zu leben. „Sozial“ sei diese Welt demnach nur insoweit, wie man mit Anderen vertrauensvolle Beziehungen etablieren und aufrechterhalten könne.32
Aber wann je hat man „volles“ Vertrauen oder (alternativ) gar keines mehr? Vertraut man je Anderen im Ganzen und in jeder Hinsicht – uneingeschränkt, vorbehaltlos, bedingungslos, absolut? Oder reicht das Vertrauen im Einzelfall nur jeweils in dieser oder jener Hinsicht so und so (begrenzt) weit? Gilt es Anderen tatsächlich selbst? Und was bedeutet das überhaupt: ihnen selbst zu vertrauen – statt sich auf sie in der einen oder anderen Hinsicht zu verlassen? Auch für diese spezielleren Fragen gilt, dass sie erst nachträglich zum Vorschein kommen. Die Affirmation vollen Vertrauens wird gegen Zweifel an ihm gesetzt. Nachdem sie zur Geltung gekommen sind, lässt sich nur behaupten, dass man zuvor keinerlei Grund zu ihnen hatte bzw. dass sie nicht einmal als mögliche Zweifel überhaupt bewusst geworden sind. Paradox: solange man im Vertrauen lebt, weiß man es nicht. Sobald man nach Vertrauen fragt, kann es nicht mehr ungestört gegeben sein und zieht sich als solches in die Vergangenheit zurück, der gegenüber jede Frage nach ihm bereits zu spät kommt. Eigentümlich gegenwärtig scheint nur das „geschenkte“ Vertrauen zu sein.33 Doch stiftet es eigentlich nur den Beginn (oder die Wiederaufnahme) einer vertrauensvollen Beziehung, die gleichfalls nur im Nachhinein auf das Vertrauen hin befragt werden kann, das sie trägt bzw. getragen hat.
Auch in diesem Falle zeigt sich: es ist allemal das zweifelhafte, verletzte oder zerstörte Vertrauen, was uns von ihm reden lässt. Ich gehe daher im Folgenden auf eine Analyse des Vertrauens näher ein, die genau hier ihren Ausgangspunkt hat: in den damages to trust (Walker). Diese Analyse scheint mir besonders deswegen bemerkenswert, weil sie im Gegensatz zu risiko- und sicherheitstheoretischen Ansätzen, die sich eher im Bereich prekärer Verlässlichkeit bewegen34 , erstens deutlich den Zusammenhang von Vertrauen in Andere und Verletzbarkeit durch dieses Vertrauen herstellt; zweitens bringt sie das Vertrauen differenziell zur Sprache, nicht bloß als entweder „volles“ oder zerstörtes; drittens untersucht sie Verfahren der Wiederherstellung von Vertrauen, das wie aus dem Nichts neue Vertrauenswürdigkeit originär stiftet und so in seiner grundlegenden sozialen Bedeutung erkennbar wird – ohne dem Vertrauen aber die Bedeutung eines unanfechtbaren Fundaments des Sozialen zuzuschreiben; und viertens schließlich eröffnet Walkers Ansatz die Möglichkeit, das bei Sachs aufgeworfene Problem des Vertrauens in seiner weit über persönliche, zwischenmenschliche Verhältnisse hinaus reichenden Brisanz zu erkennen. Speziell darauf werde ich mit Bezug auf das Verlangen nach Gerechtigkeit näher eingehen.
Diesem Verlangen eine begründete transnationale Perspektive eröffnen zu wollen bedeutet, dass man explizit oder implizit eine entsprechende Vertrauenswürdigkeit derer in Anspruch nimmt, die sich einer erst im Entstehen begriffenen welt-weiten Gerechtigkeit verpflichtet wissen und deren wacher Sinn für Ungerechtigkeit jenseits der jeweils eigenen politischen Lebensformen dieses Verlangen inspiriert. Für sich selbst aber kann man, wie einschlägige Analysen zeigen, überhaupt keine Vertrauenswürdigkeit in Anspruch nehmen; erst recht nicht, wenn das fragliche Vertrauen durch wiederholten Bruch eines Versprechens (wie des Versprechens der Gerechtigkeit) erschüttert worden ist. Worauf kann sich dann aber überhaupt die Glaubwürdigkeit einer in „westlicher“ Perspektive gedachten transnationalen Gerechtigkeit stützen?
IV. Verletztes Vertrauen: Margaret U. Walker
Statt das Vertrauen generell hochzuschätzen oder zynisch zu verwerfen35 , präferiert Walker einen negativistischen Zugang: Sie setzt mit Erfahrungen verletzten Vertrauens ein, um nach Möglichkeiten der Rehabilitierung zu fragen. Dabei werden minimale nächste Anknüpfungspunkte solcher Möglichkeiten ebenso sichtbar wie ferne Fluchtpunkte eines versöhnten Vertrauens, dessen Wirklichkeitsferne die Philosophin nicht beschönigt. Es geht ihr nicht (wie Sachs) darum, etwa eine fortschrittliche Geschichte zu hypostasieren36 , die ungeachtet aller Versprechen, die bislang verraten wurden, weiterhin unser Vertrauen verdiente. Vielmehr stellt sie sich dezidiert der Erfahrung vielfachen Verrats an diesen Versprechen und der Konsequenz, dass man auf eine künftig fortschrittliche Geschichte nicht im Geringsten mehr bauen möchte. Auch Sachs weiß, dass die Versprechen der Aufklärung, deren Einlösung er mit Blick auf die seiner Meinung nach längst mögliche Abschaffung wenigstens schlimmster Armut verlangt, nur noch im Vertrauen auf diejenigen überzeugen können, die sich ihnen verpflichtet wissen. Insofern ist er weit entfernt davon, zu glauben, ein „capitalism with a human face“ (EP, S. 357) werde wie von selbst für das Notwendige sorgen. Jedoch streift er nur die Überlegung, ob dieses Vertrauen – das diejenigen für sich in Anspruch nehmen, die Gerechtigkeit zu üben versprechen – auch diejenigen wird überzeugen können, denen es im Sinne der projektierten Abschaffung der Armut eigentlich zugute kommen soll. Wenn er von den reichen Staaten, speziell von den USA verlangt, endlich ihren Verpflichtungen nachzukommen („to live up to their longstanding commitment“; EP, S. 284) und sich an ihre gebrochenen Versprechen zu erinnern (EP, S. 363 f.), so muss er doch auf die Glaubwürdigkeit erneuerter Versprechen setzen – aber in den Augen derer, die erst wieder von ihr zu überzeugen wären, sofern sie nicht der Tragödie eines millionenfachen „voiceless dying“ ohnehin zum Opfer fallen (vgl. EP, Kap. 10).
Nur allzu leicht degeneriert auch das heiligste Versprechen doch wieder nur zur leeren Versprechung, wenn es sich nicht dem weitgehenden Ruin des Vertrauens auf Seiten derer stellt, denen es als verbindlich erscheinen soll. So gesehen antwortet das Buch von Margaret U. Walker genau auf dieses Kernproblem von Sachs und allen, die sein politisches Anliegen teilen. Denn sie stellt die Aufgabe der Wiederherstellung von Vertrauen ins Zentrum ihrer Konzeption, die in negativistischer Perspektive auf die nachhaltige Störung oder Zerstörung des Vertrauens Antwort geben muss, wenn es im Geringsten als glaubwürdig gelten soll. Ich werde diese Konzeption im Folgenden nur im Hinblick auf die von Sachs aufgeworfenen Probleme wiederherzustellenden Vertrauens in inter- bzw. transnationaler Perspektive zur Sprache bringen.
Was das Verhältnis zwischen der sog. Ersten und der Dritten Welt, den nach wie vor reichsten und den ärmsten Staaten der Welt angeht, so stehen wir heute vor einer weit zurückreichenden Geschichte erschütterten oder zerstörten Vertrauens, die sich aus einer Jahrhunderte überspannenden Erfahrung einschneidendster Ungerechtigkeit erklärt (MR, S. 192). Bis heute hat sie eine extreme Ungleichheit der Lebensverhältnisse mit massiver Benachteiligung der Ärmsten zur Folge, die, wie Sachs zeigt, nicht unter Verweis auf schiere Unfähigkeit, effektiv zu wirtschaften, oder auf korrupte politische Verhältnisse wegzuerklären ist. Zwar macht Sachs immer wieder glauben, man müsse nur die Startbedingungen für eine gesunde ökonomische Entwicklung (notfalls von außen) garantieren, damit diese wie von selbst allgemeinen Fortschritt zu menschlichen Lebensverhältnissen hervorbringen kann. Und er wehrt sich ausdrücklich dagegen, weiterhin anhaltender Ausbeutung der ärmsten Staaten durch die reichsten alle Schuld an der Armut fast eines Viertels der Menschheit zuzuschreiben. Gleichwohl erklärt er: „little surpasses the western world in the cruelty and depredations that it has long imposed on Africa” (EP, S. 188).
Was immer man über den eigenen Anteil speziell afrikanischer Staaten an ihrer vielfach ökonomisch desolaten Lage sagen mag, den Anteil „historischer Schuld“ des Westens an ihrer derzeitigen Verarmung kann man nicht in Abrede stellen. Doch ist die Geschichte dieser Verarmung37 derart verwickelt, dass man sich immer aus ihr herausreden kann. Allzu viele Menschen sind involviert; viele, ganz unterschiedliche Ursachen reichen allzu weit, bis in die Geschichte des europäischen Kolonialismus zurück, an der nun nichts mehr zu ändern ist; der angerichtete Schaden erweist sich vielfach als irreparabel. Darüber hinaus lässt sich die reklamierte Verantwortlichkeit des Westens für Wiedergutmachung kaum präzisieren. So oder ähnlich lauten Abwehrargumente, mit denen man sich pauschal auf die Position einer moralischen Indifferenz zurückzuziehen versucht. Durch dieses „thicket of excuses“ versucht Sachs einen Weg für praktische Handlungsperspektiven zu bahnen, wohl wissend, dass die Gründe für weitgehend verlorenes Vertrauen in den Westen nicht auf singuläre Ereignisse zurückzuführen sind, sondern in einer langen, destruktiven Geschichte liegen, die es in der Tat als abwegig erscheinen lässt, einen „morally acceptable status quo ante“ (Walker) wiederherstellen zu wollen.38
Was Walker „moral repair“ nennt, ist in diesem Falle streng genommen unmöglich. In den kollektiven Gedächtnissen der Armen bleibt gewiss eine weit zurückreichende Gewalt-Geschichte noch lange lebendig, die von (bis heute anhaltend) unterlassener Hilfeleistung (wie zuletzt angesichts der AIDS-Epidemie oder in Darfur und Ruanda und Umgebung) über rassische Diskriminierung und Ausbeutung (wie in Südafrika) bis hin zu genozidalen Praktiken (wie sie sich gegen die Hereros oder die Bewohner des Kongo richteten) alles beinhaltet, was Menschen einander antun können. Die weitaus meisten Opfer dieser Gewalt-Geschichte haben sie nicht überlebt oder werden sie nicht überleben. Ihnen gegenüber gibt es gar nichts wieder gut zu machen.39 Nur denjenigen, die der Fortsetzung dieser Geschichte in der Gegenwart zusätzlich zum Opfer zu fallen drohen, kann man noch gerecht zu werden versuchen.
Es kann dabei nicht darum gehen, sich oder Andere mit dieser Geschichte nachträglich aussöhnen oder sie in eine auf den Spuren Hegels versöhnte Zukunft überführen zu wollen. Ganz im Gegenteil gehört die ungeschminkte Anerkennung all der Erfahrungen, die keiner Aussöhnung oder Versöhnung mehr offen stehen, unbedingt zu den Voraussetzungen jeder wahrhaftigen Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Nur eine solche Anerkennung, die realisiert, wie diese Geschichte im Gedächtnis der Armen lebendig bleiben wird (und ihnen jegliches Vertrauen zu rauben droht40 ), erfüllt das Erfordernis, auf der Basis der Wahrheit des Gewesenen einer besseren Zukunft zuzuarbeiten. Wird diese Herausforderung nicht realisiert, steht jedes erneuerte Versprechen einer weniger gewaltsamen Zukunft im Verdacht unannehmbarer geschichtlicher Ignoranz. Angesichts einer schonungslos als „irreparabel“ anerkannten Geschichte kann ein solches Versprechen dennoch als glaubwürdig erscheinen, insofern es die eingestandene Unmöglichkeit, den Opfern dieser Geschichte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, in den unbedingten Vorsatz ummünzt, wenigstens ihren Nachkommen die Wiederholung der gleichen Ungerechtigkeit ersparen zu wollen.
Ein derart in die Zukunft hinein gleichsam verschobener Gerechtigkeitsanspruch gleicht keine vorherige Ungerechtigkeit aus, kompensiert nichts und entschädigt niemanden für irgendetwas. Aber ihn zu affirmieren bedeutet, auch die in keiner Weise wieder gut zu machende Ungerechtigkeit grundsätzlich der Vergleichgültigung zu entreißen. Für die Zukunft zieht das den unbedingten Willen nach sich, sich wenigstens der Gewalt solcher Ungerechtigkeit und ihrer Naturalisierung zu einem gleichgültigen „Lauf der Dinge“ zu widersetzen, gegen den man scheinbar nichts ausrichten kann. Die Nicht-Indifferenz angesichts nicht wieder gut zu machender Gewalt kann sich, soll sie glaubwürdig sein, allerdings nicht in einem bloßen Vorsatz erschöpfen, sondern muss in konkretisierbare Handlungsanweisungen münden, wie sie Sachs und andere entwerfen.
Tragen solche Anweisungen zu einem „repairing the moral fabric of the world” (MR, S. 210) bei, wie mit Walker anzunehmen wäre? Lässt nicht die Metapher der Reparatur allzu sehr an eine Wiederherstellung denken, obgleich sich die Anerkennung der vorausgegangenen Ungerechtigkeit nicht mehr an unversöhnte Opfer, sondern fast nur noch an Überlebende richten kann?41 So gesehen wäre es angemessener, von einer originären Neustiftung einer moralischen Verbundenheit zu sprechen, die sich zu allererst im erneuerten Vertrauen in deren Verbindlichkeit manifestieren müsste. Freilich muss sich die Verbundenheit praktisch erweisen durch eine effektiv verbindliche Sorge für die jetzt und künftig Lebenden. Andernfalls kommt sie womöglich über eine in „weltweiter“ Perspektive rhetorisch beschworene Gerechtigkeit und Verantwortung für alle Menschen im Allgemeinen (aber für niemanden im Besonderen) nicht hinaus und schlägt dann unversehens in Misanthropie, Zynismus und Verachtung jeglichen Vertrauens um, das man in zahllose Versprechen künftig einzulösender Gerechtigkeit gesetzt hat.
Wenn sich eine solche originäre Neustiftung moralischer Verbundenheit nicht in deren Beschwörung erschöpfen soll, so muss sie sich als Antwort auf ein vorgängiges Verlangen verstehen lassen, erlittener Ungerechtigkeit Rechnung zu tragen (aber nicht: „irreparable“ Ungerechtigkeit auszugleichen). Und als eine solche Antwort muss sie einen Sinn für diejenige Ungerechtigkeit aktivieren, die tatsächlich erlitten worden ist. Maßgeblich ist zunächst allemal die Erfahrung derer, die unter der fraglichen Ungerechtigkeit zu leiden hatten – nicht etwa ein vorfabrizierter Maßstab der Gerechtigkeit, der ohne weiteres dazu herhalten könnte, eben diese Erfahrung zu bevormunden.42 Worauf es auch im Verständnis Walkers vorrangig ankommt, ist, dass wenigstens die Tatsache der erlittenen Ungerechtigkeit als eine schwerwiegende Verletzung Anderer anerkannt wird – auch wenn nicht ohne weiteres klar ist, ob sie und in welcher Art und Weise sie normative Ansprüche nach sich ziehen kann.
Die Anerkennung muss stets damit beginnen, dass man diese Verletzung überhaupt zur Sprache kommen lässt; und zwar in einem sie bezeugenden Hören auf das, was die Opfer zu sagen haben. „Being willing to hear victims is already validating” (MR, S. 19). Das bloße Hin- und Zuhören gibt ihnen keineswegs pauschal Recht, wohl aber anerkennt es die Tatsache der erfahrenen Verletzung, ohne deren erste Würdigung kein Versuch überzeugen kann, ihr Rechnung zu tragen. Mit Recht insistiert Walker auf dem moralischen Sinn des Hin- und Zuhörens. Wer sich ihm verschließt, verschärft die Erfahrung der Ungerechtigkeit, die insofern keineswegs bloß der Vergangenheit angehört. Der in der Ungerechtigkeit erfahrene Bruch in der sozialen Welt (oder ihr Zerbrechen) setzt sich, wenn die Erfahrung nicht Gehör findet und bezeugt wird, in Gegenwart und Zukunft hinein fort (MR, S. 18, 20, 57).
Der beklagten Ungerechtigkeit Gehör zu schenken, bedeutet umgekehrt, eine zu rehabilitierende moralische Verbundenheit zu bezeugen und in Szene zu setzen. Unabhängig von der Frage, ob man der Ungerechtigkeit „gerecht werden“ und entsprechende normative Erwartungen verantwortlich auf sie gründen kann, ist die Bezeugung der moralischen Verbundenheit für Walker in erster Linie eine Angelegenheit der Responsivität des Hörens auf die Anderen, die Ungerechtigkeit erlitten haben. Jedes Vertrauen, das man aufgrund artikulierter Ungerechtigkeit in solche Erwartungen setzt, ruht auf dem vorgängigen Vertrauen in die Responsivität Anderer, die der Ungerechtigkeit allererst zur Artikulation und insofern zur Geltung verhelfen können. In dem Maße, wie man sich zu diesem Vertrauen durchringt, akzeptiert man es allerdings auch, durch mangelnde Responsivität verletzt zu werden (MR, S. 76). Und genau das ist es, was man all jenen ernsthaft – zusätzlich zu ihrer fortbestehenden Armut – zumutet, die man auf dem von Sachs skizzierten Weg davon überzeugen möchte, dass es Sinn hat, wieder den Versprechen der Aufklärung (bzw. denen, die sie zu erneuern behaupten) Glauben zu schenken.
Emphatisch befindet Walker: „Any morality (including the streamlined normative ethical systems that philosophers elaborate) must be embedded in the responses of human beings” (MR, S. 23). In die Verantwortung und normativ zu formulierende Gerechtigkeit vertrauen wir erst sekundär – auf der Basis primärer Responsivität derer, die zuerst einmal hören müssen auf Ansprüche Anderer, denen zu entnehmen ist, was nach Verantwortung und Gerechtigkeit verlangt. Wenn letzteres geltungskritisch geklärt ist, sind wir weiterhin auf „trust in responsiveness“ im Sinne eines etablierten normativen Verständnisses von Verantwortung und Gerechtigkeit angewiesen. Diese sekundäre Responsivität bezieht sich nach Walker auf das, was „shared understandings“ von Verantwortung und Gerechtigkeit erfordern. „We need to trust ourselves and each other to be responsive to moral standards that are presumably shared. It is this trust that grounds our normative expectations of each other, our expectations that we and others will do what we ought to do because of our presumed responsiveness to shared and authoritative standards” (MR, S. 44, 66, 191).
Während sich die fragliche Responsivität im ersten Fall in der Beachtung und Würdigung originärer Artikulation der Ansprüche Anderer zeigt, ohne ihnen dabei bereits ein normatives Recht einzuräumen, bezieht sie sich im zweiten Fall auf bereits normativ gesicherte Ansprüche und deren Beachtung. In beiden, deutlich zu unterscheidenden Fällen soll gelten: „we see those capable of responsiveness as responsible” (MR, S. 70). Wem zuzutrauen ist, auf das Verlangen, bei Anderen Gehör zu finden, Antwort zu geben, der kann genau dafür auch verantwortlich gemacht werden.43 Und wer zur „responsiven“ Beachtung normativer Ansprüche (bzw. Anrechte) Anderer in der Lage ist, wird dafür als verantwortlich betrachtet.
Jede Moral setzt im Verständnis Walkers eine gelebte Responsivität voraus und erfordert Vertrauen in sie. Mit anderen Worten: Würden wir kein Vertrauen in die primäre Responsivität haben, die zur Beachtung und Würdigung fremder Ansprüche veranlasst, so würden wir auch kaum Grund zu der Annahme haben, dass diese Ansprüche Eingang finden in eine normative Moral. Und würden wir kein Vertrauen in die sekundäre Responsivität derer haben, die sich um die angemessene und sensible Berücksichtigung und Wahrung der als Anrechte normativ gefassten Ansprüche haben, so würden wir uns auf die praktische Verbindlichkeit einer normativen Moral kaum verlassen wollen.44
Was Walker nun als moralische Reparation (moral repair) bezeichnet, was aber besser als originäre Neustiftung moralischer Verbundenheit zu verstehen wäre, bezieht sich in dieser Perspektive also keineswegs etwa nur darauf, an die Geltung moralischer Normen wieder zu erinnern und deren Beachtung einzufordern. Zwar können Versuche der Wiedergutmachung diesen Sinn haben. Aber die von Sachs mit Recht betonte kollektive Erfahrung absoluter Hoffnungslosigkeit im Zeichen vielfach extremster Armut bedeutet, dass die Armen und die Reichen in den Augen ersterer überhaupt keine Geltung unangefochtener moralischer Normen mehr verbindet. Vielmehr erscheint jegliche derartige Geltung durch nachhaltige ökonomische Gewalt und bloße Lippenbekenntnisse zu den Versprechen der Aufklärung als grundsätzlich derart desavouiert, dass in moralische Sprache seitens der Armen ohne weiteres überhaupt kein Vertrauen mehr zu setzen ist. Das muss man jedenfalls vermuten.
In einer solchen Lage ist nicht allein mit der Berufung auf geltende, aber chronisch verletzte Normen weiterzukommen, wenn die Moral ihrerseits in dem skizzierten mehrfachen Sinn auf Vertrauen angewiesen ist. Vielmehr geht es um Wiedergewinnung des Vertrauens auf der Basis jener primären Responsivität, die sich in der Beachtung und Würdigung der originären Artikulation fremder Ansprüche bewähren und bewahrheiten muss. Nur wenn diese Responsivität glaubhaft gelebt wird, wird man auch auf die Einlösung der viel weiter gehenden Erwartung hoffen dürfen, dass artikulierte und gewürdigte Ansprüche erneut Eingang finden in Normen, die Ansprüche als Anrechte affirmieren. Erst wenn das erreicht ist, kann Vertrauen in die sekundäre Responsivität Platz greifen, die sich an normativ gefassten Ansprüchen orientiert.
V. Versprechen und Vertrauen in Zukunft
Wer wie Sachs den Westen an die Aufklärung als Erbschaft des Versprechens erinnert, nach und nach wenigstens die ärgste Not und die eklatanteste Ungerechtigkeit nicht nur innerhalb der eigenen Staaten, sondern weltweit abzuwenden, muss wissen, dass streng genommen „der Westen“ überhaupt nichts verspricht oder versprechen kann. Man verspricht sich etwas von ihm – oder verachtet ihn als Quelle moralischer Hypokrisie; oder aber man baut auf die Identifikation der dort Lebenden mit dem Sinn jener Erbschaft, so dass eigentlich sie als Träger jenes Versprechens zu betrachten wären. Das tut offenbar auch Sachs, wenn er darauf insistiert, diese Erbschaft sei nur durch das praktische Leben ungezählter Einzelner verbindlich einzulösen. Insofern setzt sein Versuch, die Abschaffung wenigstens schlimmster Armut zu einem für die nächsten eineinhalb Jahrzehnte vordringlichen Ziel der reichen Staaten zu machen, eine theoretische Vorstellung davon voraus, wie man dem Selbst des Einzelnen überhaupt vertrauen kann.
Dafür, dass Andere anderswo auf die Menschen des Westens setzen, kann Sachs keinerlei Vertrauen in Anspruch nehmen. Er kann das Vertrauen nur vor dem Hintergrund einer weit zurück reichenden, komplexen Geschichte des Westens ins Spiel bringen, die uns vor allem eines lehrt: wie sie eine abgründige, vielfach zynische und weitgehend als berechtigt erscheinende Verachtung westlicher Fortschrittsversprechen hervorgebracht hat. Auch hier bestätigt sich, was die soziologische Erforschung des Versprechens betont hat: dass das Vertrauen nur im Lichte seiner Verletzung oder Zerstörung zur Sprache kommt.
Sachs kann gewissermaßen nur dafür werben bzw. darum bitten, dass man jene Versprechen wieder Ernst nimmt – aller empirischen Evidenz zum Trotz, die massiv dagegen spricht. In internationaler Perspektive, zwischen Armen und Reichen, ist das Vertrauen keine „Ressource“, kein Vorrat, aus dem man sich ohne weiteres bedienen könnte. Im Gegenteil erscheint es erschöpft und wird jeden Tag durch die Fortdauer tödlicher Ungerechtigkeit, die ultimativ aufzuheben wäre, bloßgestellt. Der Forderung, sie bedingungslos und sofort abzustellen, kommt man nicht nach (und kann man vielleicht nicht einmal nachkommen).
Insofern erscheint auch die moralische Responsivität zweifelhaft, mit der jegliches Vertrauen in Andere steht und fällt, wenn wir Walker folgen (MR, S. 66, 166). Auf dem von Sachs beschriebenen Weg wird man bestenfalls im Laufe von vielen Jahren dafür sorgen können, dass diese Responsivität als sensibles Achten auf fremde Ansprüche (und die Schwierigkeiten ihrer originären Artikulation) sowie als sensible Beachtung der normativen Anrechte Anderer mehr und mehr zur Geltung kommt und zur Neustiftung moralischer Verbundenheit insofern beiträgt – wohl wissend, dass denen, die ohnehin jegliches Vertrauen verloren haben, weiteres Warten auf die Einlösung des Versprochenen schlechterdings nicht zuzumuten ist. Deshalb wird der von Sachs unter Berufung auf die Aufklärung beschworene „fortschrittliche“ Weg unvermeidlich neue Verletzungen des Vertrauens nach sich ziehen, die die Glaubwürdigkeit jener Versprechen wiederum erschüttern müssen.45
Für diesen Fall stellt Walker eine düstere Konsequenz in Aussicht: eine Welt, in der alle Menschen durch elementare Gerechtigkeitsansprüche einander verbunden wären, ist so nicht aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Wenn ein „reweaving a moral fabric for the future” (MR, S. 29, 229) nicht gelingt, verkümmert nicht nur das Vertrauen in den Westen. Am Ende wird man nicht einmal mehr von ihm enttäuscht sein, da man den von ihm geweckten bzw. erneuerten Erwartungen ohnehin keinen Glauben mehr schenkt.46 Die von Sachs in Erinnerung gerufenen Versprechen entschärfen diese bedrohliche Aussicht nicht; im Gegenteil beschwören sie das endgültige Zerreißen einer gemeinsamen moralischen Kultur herauf für den Fall, dass man nicht einmal ihrem minimalistischen Anspruch nachkommt, wenigstens die schlimmste Armut unbedingt und schnellstens abwenden zu wollen.47 In dieser Erfahrung schlägt auch ein Terror Wurzeln, gegen den gewiss kein klassischer Krieg zu führen ist, sondern vor allem unnachsichtige Auseinandersetzung mit der Unglaubwürdigkeit der eigenen politischen Kultur hilft.48
Man sieht, dass uns das Vertrauen weder einfach als Ressource zur Verfügung steht noch ohne weiteres eine sichere Grundlage menschlichen Zusammenhalts darstellt. Wer es in Anspruch nimmt und verrät, riskiert, extreme Gewalt auf sich zu ziehen. Diese Gefahr wird nicht geringer, sondern um so größer, je mehr man erneut Vertrauen in bereits vielfach gebrochene Versprechen der Gerechtigkeit weckt, von deren erhoffter Einlösung die Tragfähigkeit der „menschlichen“ Kultur einer gemeinsamen Welt abhängen sollte.
VI. Resümee
Welche Rolle kann, soll oder muss nun der Sinn für Ungerechtigkeit in einer solchen Welt spielen? Diese verdient, wenn überhaupt, ihr so oft schon missbrauchtes und rhetorisch abgenutztes Prädikat „menschlich“ in der hier dargelegten Perspektive durch eine Kultur moralischer Sensibilität, die die Anderen widerfahrende Ungerechtigkeit nicht indifferent hinnimmt, sondern als politische Gestaltungsaufgabe begreift. Wenn dabei der „Sinn“ dieser Welt mit auf dem Spiel steht und strittig erscheint, so geht es nicht primär um einen teleologischen Sinn, wie man ihn einem Zweck oder Ziel der Gattungsgeschichte zugeschrieben hat; vielmehr geht es zuerst um einen „pathologischen“ Sinn in der Sensibilität, die sich für die von Anderen erlittene Ungerechtigkeit aufgeschlossen erweist. Im besten Falle kann Sinn für Ungerechtigkeit einer erst im Entstehen begriffenen transnationalen Gerechtigkeit in statu nascendi als „leidenschaftliche“ Antriebsquelle und zugleich als selbst-kritisches Potenzial dienen, das sie vor fataler Selbstgerechtigkeit bewahrt. Nur ein wacher, außerordentlicher Sinn für Ungerechtigkeit weiß um die Unmöglichkeit, jedem (oder auch nur einem Anderen absolut) gerecht zu werden, und widersetzt sich einer leichtfertig gleich machenden Gerechtigkeit, die das als unvermeidliche Misslichkeit einfach in Kauf nimmt.
D. h. nicht, dass er es nahe legen muss, den Anspruch als von vornherein überzogen zu desavouieren, eine transnationale Gerechtigkeit oder eine Pluralität von einander ergänzenden oder auch in Widerstreit tretenden Ausformungen der Gerechtigkeit zu entwerfen. Er wird nur darauf bestehen müssen, dass es sich allemal um eine Gerechtigkeit (bzw. um Gerechtigkeiten) in fortbestehender Ungerechtigkeit wird handeln können und dass die Ungerechtigkeit in der Gerechtigkeit selbst heimisch ist. Ohne das Wissen darum schlägt Gerechtigkeit unweigerlich in Selbst-Gerechtigkeit, in die schlimmste Karikatur der Gerechtigkeit um.
Doch sollte ein außerordentlicher, in keiner Ordnung der Gerechtigkeit je aufzuhebender Sinn für Ungerechtigkeit nicht dem möglichen Aufbau gerechter Institutionen im Wege stehen, sondern, im Gegenteil, deren „Leben“ inspirieren, das sich niemals in einem regelmäßigen Funktionieren erschöpfen kann, wenn es sich um Gerechtigkeit handelt. Denn die Gerechtigkeit selbst, auf die jeder Andere Anspruch hat, ist eine außerordentliche Forderung, ein radikales Verlangen, das womöglich niemals gestattet, zu befinden, jetzt bin ich, sind wir… diesem oder jenem absolut gerecht geworden. Zwar kann man das Funktionieren transnationaler Institutionen konzipieren und beschreiben, ohne dass Einzelne namentlich Erwähnung finden müssen. Doch werden es immer nur Einzelne sein, die faktisch Gerechtigkeit üben können. Ohne deren Sinn für Ungerechtigkeit ist jede Institution gleichsam auf moralischen Sand gebaut und würde in einer geschäftsmäßigen moralischen Normalisierung verkümmern.
Das aber bedeutet: für die wirklich praktizierte Gerechtigkeit kommt es auf das Selbst derer an, denen sie anvertraut ist. Sie müssen das Vertrauen in die Gerechtigkeit letztlich rechtfertigen, das heute jede neuartige Konzeption einer transnationalen Gerechtigkeit (vielfach unbedacht) für sich in Anspruch nimmt, wenn sie jene überzeugen möchte, die die Gerechtigkeit bislang nur als notorisch gebrochenes Versprechen kennen gelernt haben. Und sie sind es, die Probleme der Gerechtigkeit als solche wahrnehmen, artikulieren und danach verlangen müssen, dass man etwas gegen sie tut. In der Wahrnehmung Einzelner entzünden sich bzw. stellen sich originär Gerechtigkeitsfragen als solche, die erst im zweiten Schritt geltungskritisch zu prüfen sind.
D. h. die Sensibilität eines außerordentlichen Sinns für Ungerechtigkeit löst keineswegs von sich aus das Problem, wie etwa Ansprüche Anderer in Anrechte zu übersetzen sind. Umgekehrt darf aber auch eine normativistische Theorie die Anknüpfung an Sinn für Ungerechtigkeit nicht gering schätzen; andernfalls verliert sie den Erfahrungsboden unter den Füßen und das Verlangen nach Gerechtigkeit selbst, wie es aus der erfahrenen Ungerechtigkeit entsteht, aus den Augen. So wird schließlich die Gerechtigkeit mitsamt dem theoretischen Reden von ihr zum Selbstläufer. In diesem Falle wäre es nur noch von akademischem Interesse, wann man endlich die beste Theorie ermittelt hätte. Doch solange eine Theorie (transnationaler) Gerechtigkeit ihrerseits praktisch werden soll, kann sie sich nicht gleichgültig verhalten zu der Zeit, die unterdessen vergeht, während man auf sie hinarbeitet.
Nicht nur die Probleme humanitärer Hilfe (die kaum Gerechtigkeitsansprüchen genügen kann) sind absolut dringlich. Auch die Gerechtigkeit duldet im Grunde keinen Aufschub, schon gar keine Verzögerung, die Andere das Leben kostet. Jede aufgeschobene Zeit, die man sich nimmt, um einer transnationalen Gerechtigkeit zuzuarbeiten, wird neue Ungerechtigkeit heraufbeschwören. Auch hier ist ohne einen wachen Sinn für Ungerechtigkeit schlechterdings nicht auszukommen; es sei denn, ein so genanntes politisches Realitätsprinzip macht es sich einfach damit, eklatante Ungerechtigkeiten als schlicht unvermeidlich einzustufen. Allerdings hat das mit Gerechtigkeit gar nichts mehr zu tun.
Wenn man dagegen einen unbedingten, jedem Anderem zustehenden Gerechtigkeitsanspruch nicht einfach politisch vergleichgültigt, verbietet sich jegliche Mediatisierung irgend eines Menschen zum Zweck einer in Zukunft fortgeschrittenen Gerechtigkeit. Es mag sein, dass in diesem Anspruch eine Hyperbolik liegt, die unmöglich zu realisieren ist. Das besagt aber nicht, dass dieser Anspruch gewaltsam zu verwerfen wäre, sondern nur, dass (fortbestehende) Ungerechtigkeit das Medium der Gerechtigkeit (Adorno) ist, die wir dennoch zu üben versprechen müssen. Ohne dieses „Versprechen“ würde die notorisch überforderte oder auch mit „real-politischen“ Gründen einfach preisgegebene Gerechtigkeit letztlich in eine Art Naturgeschichte zurücksinken. Dagegen ist effektiver Widerstand nur aufzubieten mit einem außerordentlichen Sinn für Ungerechtigkeit, der die Gerechtigkeit trotz ihrer Schwächen, trotz ihres Versagens vorantreibt, ohne ihr im Geringsten zu gestatten, die Ungerechtigkeit zu vergessen oder zu beschönigen, die in ihr selbst liegt. Im Sinn für diese, der Gerechtigkeit selbst immanente Pathologie liegt wohl das einzige Palliativ gegen ihre Pervertierung zur Selbstgerechtigkeit.
So gesehen kommt Sinn für Ungerechtigkeit nicht bloß wie auf einer „Einbahnstraße“ als Zugang zur Gerechtigkeit in Betracht; vielmehr muss letztere sich ständig der Ungerechtigkeit versichern, die sie nicht aufzuheben versprechen kann, um nicht in Selbstgerechtigkeit zu erstarren. Die Gerechtigkeit selbst bedarf des Sinns für Ungerechtigkeit. Sie muss sich dieses „Sinns“ immer neu versichern, um sich nicht selbst zu verraten.
Umgekehrt bedarf aber auch ein wacher, außerordentlicher Sinn für Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit, denn er liegt nicht ohne weiteres in differenzierter Form vor und kann insofern nicht als anthropologische Gegebenheit eingestuft werden. Vielmehr schärft sich der Sinn für Ungerechtigkeit im gleichen Maße, wie er einer epigenetisch erarbeiteten, kognitiv immer weiter differenzierten Gerechtigkeit sich zu widersetzen gezwungen ist. Indem er sich an dieser gleichsam reibt, muss er sich seinerseits von jeglichem naiven Moralismus lösen, der in schlichter Empörung oder im Zorn über „schreiende Ungerechtigkeit“ bereits eine zureichende Grundlage für ein annehmbares und zu rechtfertigendes Verlangen nach Gerechtigkeit gefunden zu haben meint. Nur unter dieser Voraussetzung kann Sinn für Ungerechtigkeit seinerseits versprechen, die ihm hier zugeschrieben Funktion in der inneren Sinnkonstitution der Gerechtigkeit selber zu übernehmen, statt bloß als psychologische Vorstufe einer normativen Theorie in Betracht zu kommen.
Die Gerechtigkeit liegt nach dem hier entwickelten Verständnis mit sich selbst im Streit – nicht zuletzt auch im Widerstreit ihrer unterschiedlichen Deutungen und Anwendungen, der in neuen Entwürfen einer transnationalen, überkomplexen Gerechtigkeit sich gewiss noch verschärft bemerkbar machen wird. Nur wenn das bewusst bleibt, wird zu vermeiden sein, dass ein äußerst fragwürdiger Optimismus eine Apologie der Gerechtigkeit betreibt, der die allerschlichteste implizite Geschichtsphilosophie49 zu beerben sich anschickt, der zufolge wir den kosmopolitischen Fortschritt einer universalen Gerechtigkeit auf ganzer Breite zu erwarten haben. Wie ausgelöscht wäre dann die Erfahrung der Ungerechtigkeit, an der sich jede Theorie, die etwa deren Überwindung in Aussicht stellt, messen lassen muss: die Erfahrung, dass sie transnational vor allem als notorisch gebrochenes Versprechen erscheint, das keinerlei Vertrauen (wenn nicht gar Verachtung) verdient.
Bibliographie
A. BAIER, Trust, Tanner Lectures on Human Values, Princeton, 6. – 8. 3. 1991.
DIES., Vertrauen und seine Grenzen, in: M. HARTMANN, C. OFFE (Hg.), Vertrauen, Frankfurt am Main 2001, S. 37 – 84.
L. BOLTANSKI, Distant Suffering, Cambridge 1999.
J. DERRIDA, Marx’ Gespenster, Frankfurt am Main 1995.
J. DUNN, Trust and Political Agency, in: D. GAMBETTA (Hg.), Trust. Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford 1988, S. 73 – 93.
O. HÖFFE, Einführung, in: DERS. (Hg.), Der Mensch – ein politisches Tier?, Stuttgart 1992, S. 5 – 13.
F. HUTCHESON, Erläuterungen zum moralischen Sinn, Stuttgart 1984.
V. JANKÉLÉVITCH, B. BERLOWITZ, Quelque part dans l’inachevé, Paris 1978.
I. KAPLOW, C. LIENKAMP (Hg.), Sinn für Ungerechtigkeit. Ethische Argumentationen im globalen Kontext, Baden-Baden 2005.
L. KOHLBERG, Essays on Moral Development, Vol. 1, The Philosophy of Moral Development. Moral Stages and The Idea of Justice, San Francisco 1981.
H. KUCH, S. K. HERRMANN (Hg.), Philosophien sprachlicher Gewalt, (i. V.).
O. LAGERSPETZ, Vertrauen als geistiges Phänomen, in: M. HARTMANN, C. OFFE (Hg.), Vertrauen, Frankfurt 2007, S. 85 – 133.
E. LEVINAS, Verletzlichkeit und Frieden, Berlin 2007.
B. LIEBSCH, Kritische Kulturphilosophie als restaurierte Geschichtsphilosophie? Anmerkungen zur aktuellen kultur- und geschichtsphilosophischen Diskussion mit Blick auf Kant und Derrida, in: Kantstudien 98 (2007), Heft 2, S. 183 – 217.
DERS., Menschliche Sensibilität. Inspiration und Überforderung, Weilerswist 2008.
N. LUHMANN, Vertrauen, Stuttgart 31989.
L. MONTADA, Gerechtigkeitsforschung, empirische, in: S. GOSEPATH, W. HINSCH, B. RÖSSLER (Hg.), Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie, Bd. 1, Berlin 2008, S. 411 – 416.
J. RAWLS, Gerechtigkeit als Fairneß, Freiburg i. Br./ München 1977. DERS., Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1979.
DERS., Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978 - 1989, Frankfurt am Main 1992.
P. RICŒUR, Zeit und Erzählung I, München 1988. DERS., Das Selbst als ein Anderer, München 1996.
J. D. SACHS, The End of Poverty. Economic Possibilities for Our Time, New York 2006.
M. SCHMITT, Sensibilität für Ungerechtigkeit, in: Psychologische Rundschau 60. 1. 2009, S. 8 – 22.
A. SCHÜTZ, T. LUCKMANN, Strukturen der Lebenswelt, Bd. 1, Frankfurt am Main 1979.
A. SEN, The Standard of Living, The Tanner Lectures on Human Values, Cambridge, 11. / 12. 3. 1985.
J. SHKLAR, Über Ungerechtigkeit, Frankfurt am Main 1997.
W. STEGMAIER, Philosophie der Orientierung, Berlin 2008.
U. STEINVORTH, Globalisierung – Arm und Reich, in: F. J. WETZ (HG.), Kolleg Praktische Philosophie, Bd. 4, Recht auf Rechte, Stuttgart 2008, S. 170 – 206.
M. U. WALKER, Moral Repair. Reconstructing Moral Relations after Wrongdoing, Cambridge 2006.