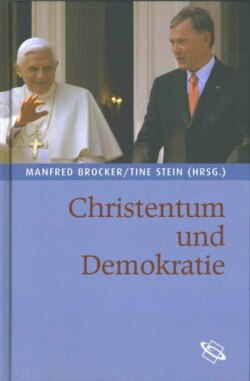Читать книгу Christentum und Demokratie - Группа авторов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMANFRED BROCKER/TINE STEIN
Einleitung
Das Thema des vorliegenden Bandes, „Christentum und Demokratie“, bedarf in dieser Zeit keiner ausführlichen Begründung. Spätestens seit dem Ende des Irakkriegs und dem weitgehend erfolglos gebliebenen Versuch der US-Regierung, das Land am Tigris zu demokratisieren, stellt sich in der politisch interessierten Öffentlichkeit die Frage nach den soziokulturellen und insbesondere religiösen Voraussetzungen funktionsfähiger und stabiler Demokratien. Auch die vergleichende Demokratieforschung hat das Thema inzwischen für sich entdeckt. Während sie ihre Untersuchungen zuvor primär auf die sozioökonomischen und sozialen Bedingungen gelungener Demokratisierungsprozesse konzentriert hatte, wie wirtschaftliches Entwicklungsniveau, soziale Machtverteilung, Bildung, Sozialkapital oder ethnische Homogenität, erscheint ihr heute als gewiss, dass die religiöse Kultur und Struktur eines Landes eine weitere wichtige Erklärungsvariable bildet (vgl. etwa Clague/Gleason/Knack 1997).
Das war nicht immer so. Lange Zeit schenkte die Politikwissenschaft diesem Zusammenhang kaum größere Aufmerksamkeit, nicht zuletzt deshalb, weil sich bei vielen Vertretern des Fachs – wie der Sozialwissenschaften insgesamt – eine allgemeine Säkularisierungs- und Modernisierungsthese durchgesetzt hatte, der zufolge die Religionen in der sozialen Welt zunehmend an Bedeutung verlieren und durch andere, innerweltliche Impulse und Motive des Handelns ersetzt werden würden. Mittlerweile ist von einer „Rückkehr der Religionen“ die Rede (Riesebrodt 2000) – wobei es sich weniger um eine „Rückkehr“ der Religion auf die weltpolitische Bühne als vielmehr auf die Agenda der Politikwissenschaft handelt, die das Thema trotz seiner in vielerlei Hinsicht offenkundigen Bedeutung insgesamt allzu sehr vernachlässigt hat.
Der Konnex von Religion und Demokratie jedenfalls springt unmittelbar ins Auge, wenn man die Weltkarte betrachtet: Alle alten Demokratien – also die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Australien, die Schweiz u. a. – wurden in Gesellschaften mit christlicher Kulturprägung begründet. Nicht-christlich geprägte Staaten dagegen sind bis heute zumeist keine Demokratien, wie der Blick beispielsweise auf den afrikanischen Kontinent oder die arabische Welt deutlich macht.
Auch statistisch lässt sich ein solcher Zusammenhang nachweisen. Die Organisation „Freedom House“ sammelt jährlich die Daten von mehr als 190 Staaten und stuft sie auf dieser Basis als „demokratisch“ oder „nichtdemokratisch“ bzw. als „frei“ oder „unfrei“ ein. So gut wie alle, nämlich rund 90 % der am Anfang des dritten Jahrtausends existierenden „freien“ Staaten sind durch ihre Geschichte christlich geprägt (www.freedomhouse.org; vgl. Schmidt 2000, 448). Für die islamische Welt sieht das Verhältnis genau umgekehrt aus: Von den 47 „islamischen Staaten“ (solche mit mehrheitlich moslemischer Bevölkerung) sind mehr als 90 % nicht „frei“; 77 % müssen sogar als Diktaturen bezeichnet werden (vgl. Merkel 2003, 68).
Andere Daten zeigen ebenfalls die Korrelation zwischen Christentum und Demokratie, die sich mit Manfred G. Schmidt auf eine einfache Formel bringen lässt: „Je höher der Anteil der christlichen Religionen, desto tendenziell höher der Demokratisierungsgrad“ (Schmidt 2000, 444 f.). Der Unterschied zwischen Demokratie und Nicht-Demokratie variiert erkennbar mit dem Anteil von Protestanten und Katholiken an der Bevölkerung. Fällt er unter einen bestimmten Wert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Gesellschaft keine demokratische Ordnung wird entwickeln und erhalten können.
Zwar kann daraus kein „Unvereinbarkeitstheorem“, keine „Kulturalismus-Hypothese“ (Merkel 2003, 64) abgeleitet werden, der zufolge allein das Christentum Normen und Werte bereithält, die die Errichtung demokratischer Ordnungen ermöglichen. Immerhin gibt es einige (wenige) Demokratien in nicht-christlich geprägten Ländern – beispielsweise im jüdischen Israel, im überwiegend hinduistischen Indien, dem von Schintoismus und Buddhismus geprägten Japan, dem mehrheitlich konfuzianischen Südkorea, dem buddhistisch geprägten Thailand. Und auch in der islamischen Welt finden sich neben den vielen Diktaturen einige freiheitliche Staaten. Mali etwa erreicht bei „Freedom House“ hohe Demokratiewerte (vgl. Hanke 2001). Dennoch legen die Zahlen nahe, dass offenbar vor allem das Christentum einen guten Nährboden für die Etablierung freiheitlich-demokratischer Verfassungsordnungen abgibt.
Nicht zuletzt die Transformationsprozesse der letzten drei Jahrzehnte scheinen dafür zu sprechen. Beginnend mit Griechenland, Spanien und Portugal leiteten im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts insgesamt 87 Staaten demokratische Reformen ein, d. h. sie etablierten zumindest das allgemeine, freie und gleiche Wahlrecht, das als Minimalkriterium für eine demokratische Ordnung gilt. Nur sieben dieser Länder hatten eine mosle mische Bevölkerungsmehrheit (Merkel 2003, 67 f.). Dagegen wurden so gut wie alle christlich geprägten Staaten von dieser „dritten“ und „vierten“ „Demokratisierungswelle“ (vgl. Huntington 1991; Schmidt 2000, 463 ff.) erfasst und gaben sich seither demokratische Verfassungen.
Welche politiktheoretisch und ideengeschichtlich fundierten Gründe lassen sich für diesen empirischen Befund anführen? Darum soll es in diesem Band gehen. Woran liegt es, dass sich freiheitliche Demokratien vor allem in den Gesellschaften entwickeln konnten, die vom (westlichen) Christentum geprägt sind? Welche historischen Faktoren trugen hier zur Entwicklung demokratischer Verfassungsordnungen bei? Welche Rolle spielten dabei christliche Werte, Normen und Leitvorstellungen – im Verfassungsverständnis, für die Begründung von Grund- und Menschenrechten, für die Vorstellung von Gewaltenteilung, Ämterordnung und einer politischen Macht, deren Herrschaftsanspruch prinzipiell begrenzt ist?
Diese Fragen sind – von Ausnahmen abgesehen – in der zeitgenössischen ideengeschichtlichen und politiktheoretischen Forschung der Politikwissenschaft bislang eher vernachlässigt worden. Verkürzt gesagt lokalisiert man noch immer die Wurzeln der Demokratie in der Bürgerversammlung der polis Athen, die der Rechtsbindung des politischen Handelns in der Römischen Republik und die Verallgemeinerung individueller Rechte zu Menschenrechten in der Amerikanischen und Französischen Revolution. Als die wesentliche geistige Impulsgeberin wird die Aufklärung angesehen, die mit dem berühmten Aufbruch aus selbstverschuldeter Unmündigkeit nur allzu oft als eine Emanzipation aus religiöser Heteronomie verstanden wird. Aber die ideellen und institutionellen Quellen des demokratischen Verfassungsstaates fließen reicher und sind vielschichtiger. Ob und inwieweit sie auch aus religiösem Grund entspringen, soll im vorliegenden Band ermittelt werden: Wie ist der Beitrag „Jerusalems“ gegenüber dem „Athens“ und „Roms“ zu gewichten? Welche geistig-ideellen Anstöße sind von den biblischen Religionen für unser Menschenbild und unser Weltverhältnis ausgegangen? Hätten sich die radikalen Postulate der Freiheit und Gleichheit, die Vorrangstellung des Individuums in der politischen Ordnung, entfalten können ohne die biblisch begründete Lehre von der Gottebenbildlichkeit jedes Menschen als Geschöpf Gottes? Und inwiefern waren die christliche Tradition und ihre institutionellen Vergemeinschaftungsstrukturen für die Entwicklung des Gedankens der Volkssouveränität und der zur gleichen Zeit auftretenden Idee der Bindung der Souveränität an eine Verfassung von Bedeutung? Das sind einige der Fragen, die im vorliegenden Band erörtert werden, wobei die bezogenen Positionen durchaus kontrovers sind.
Denn die beteiligten Autoren sehen den Zusammenhang zwischen Christentum und Demokratie in institutioneller, politischer und rechtlicher Hinsicht unterschiedlich. Einige erkennen eine starke und grundlegende Beziehung zwischen konstitutioneller Demokratie und Christentum (vgl. Maier), bzw. bestimmter seiner gedanklichen Elemente, wie dem der Gottebenbildlichkeit und seiner Bedeutung für die Idee einer unantastbaren Würde (vgl. Kobusch; Stein) oder von Spielarten wie dem neuenglischen („basisdemokratisch“ orientierten) Puritanismus und seiner Rolle im amerikanischen Gründungsprozess (vgl. Hoye). Andere Autoren erkennen einen nur indirekten und vermittelten Zusammenhang, indem sie mehr auf Strukturanalogien des Denkens verweisen, weniger aber die Tradierung materieller Gehalte im Vordergrund sehen (vgl. Preuß). Wieder andere heben neben der Anerkennung der geistigen und institutionellen Impulse, die vom Christentum für die Herausbildung der politischen Ordnung des demokratischen Verfassungsstaates ausgegangen sind, zugleich die unhintergehbare Bedeutung des griechischen Denkens und seiner „Entdeckung der Politik“ (H. Ottmann) hervor. Zudem wird die Auffassung vertreten, dass sich die konstitutionelle Demokratie erst gegen das Christentum entwickelt habe: durch die konfliktreiche Emanzipation der politischen Ordnung von kirchlicher Vormundschaft und ihre „Verweltlichung“ im Sinne einer institutionellen Autonomisierung (vgl. Roth); durch die Erkämpfung der positiven und negativen Religions- bzw. Glaubensfreiheit angesichts eines dem Christentum eigenen Wahrheitsanspruchs, der einflussreiche christliche Denker dazu führte, den Grundwert der Toleranz zu relativieren bzw. ganz abzulehnen (vgl. Forst). Darüber hinaus gab es im Christentum bzw. einiger seiner konfessionellen Ausprägungen lange Zeit eine starke Opposition, ja eine offene Ablehnung der Gedanken von Menschenrechten und liberaler Demokratie, die teilweise (in einzelnen Fragen jedenfalls) bis in die Gegenwart anhält (vgl. Uertz; Vögele; Ballestrem).
Bei aller Differenz geht aber keiner der in diesem Band versammelten Autoren davon aus, dass das Christentum keinen Einfluss auf das moderne politische Denken und die Entwicklung der konstitutionellen Demokratie hatte. Der vor kurzem verstorbene Kölner Politikwissenschaftler Ulrich Matz, einer der besten Kenner der Materie und einer der wenigen, der sich schon früh mit den hier gestellten Fragen intensiv auseinandergesetzt hat, betonte in seinen Arbeiten, dass zwar auch eine Vielzahl von anderen, eigenständigen Faktoren wirksam gewesen seien, wie das jüdische Denken,1 die antike griechische und römische Kultur, germanische und römische Rechtstraditionen, nicht zuletzt auch Elemente des mittelalterlichen Islam, deren jeweiliger Einfluss nur schwer zu bestimmen sein dürfte (Matz 1987, 29 f.). Doch riet er darum nicht von der Auseinandersetzung mit dem vor liegenden Themenbereich ab. Im Gegenteil. Man solle sich nur, so Matz, stärker auf jene Aspekte konzentrieren, bei denen der dominante Einfluss des Christentums – in positiver wie negativer Hinsicht – keinen begründeten Zweifeln unterliegt und gut gegen konkurrierende Traditionsstränge abgegrenzt werden kann. In diesem Sinne verfahren die Beiträge des vorliegenden Bandes.
Dabei sollen hier aber nicht nur ideengeschichtliche Untersuchungen angestellt werden, sondern darüber hinaus auch der aktuellen Bedeutung der christlichen Religion für den demokratischen Verfassungsstaat nachgegangen werden. Diese Frage hat einen normativen und einen empirischen Aspekt. Welche normative Bedeutung könnte ein Geltungsanspruch der Religion unter den Bedingungen der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates überhaupt haben? Können etwa religiös konnotierte Ansichten über Leben und Tod und über die Begründung der menschlichen Würde für das Recht von Belang sein (vgl. Kobusch; Stein; Roellecke)? Und empirisch betrachtet: Wenn Alexis de Tocqueville mit seiner Beobachtung Recht hat, dass die Religiosität der Bürger für das Wohlfunktionieren der Demokratie ein entscheidender Faktor ist, was bedeutet es dann, wenn sich die religiösen Bindungen in der Gegenwart in Westeuropa lockern oder ganz auflösen?
Für die Europäische Union wird jedenfalls kontrovers diskutiert, welcher Stellenwert der christlichen Herkunftsgeschichte für die europäische Wertegemeinschaft und die politische Union zukommen kann. Diese Frage ist angesichts der gegenwärtigen Debatten um einen religiösen Bezug in der Europäischen Verfassung, die angestrebte Vollmitgliedschaft der Türkei und die Integration moslemischer Minderheiten in den europäischen Gesellschaften von besonderer Brisanz (vgl. dazu die Diskussion zwischen Amirpur, Fücks, Isensee, Maier und Kallscheuer).
Auch in globaler Hinsicht stellt sich heute die Frage nach der Religion erneut. Das Christentum ist seit jeher in besonderer Weise eine Religion, die die nationalen Grenzen und Identitäten übersteigt und sich an alle Menschen richtet. Auch die Menschenrechte sind nur als universelle Rechte begründbar, nicht als Rechte des „westlichen“ Menschen. Gibt es zwischen dem christlichen Missionarismus und dem politischen – mitunter auch militärischen – Bemühen, Menschenrechten und Demokratie universell zur Geltung zu verhelfen, eine Parallele (vgl. Brocker)? Zeigt sich historisch eine Verbindung zwischen der Herausbildung und Entwicklung des modernen Völkerrechts und dem christlichen Denken? Aufmerksamkeit verdient in dieser Hinsicht die innere Spannung zwischen der Partikularität einzelner politischer Gemeinschaften und der Idee einer universalen und globa len Gemeinschaft aller Menschen, die sich im Horizont des mittelalterlichen religiösen Universalismus wie auch im Horizont der Universalität der Völkergemeinschaft einstellt (vgl. Preuß).
Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen auf eine Tagung zurück, zu der die Herausgeber im Januar 2005 auf Schloss Eichholz eingeladen hatten, gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Heinrich-BöllStiftung, welche die Konferenz und die Drucklegung des vorliegenden Bandes großzügig unterstützt haben. Beiden Stiftungen sei hierfür herzlich gedankt. Besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren, die trotz zahlreicher anderer Verpflichtungen die Mühen der Bearbeitung und schriftlichen Ausformulierung ihrer Referate und Diskussionsbeiträge auf sich genommen haben. Alle Beteiligten sehen sich in der Hoffnung vereint, dass ihre Überlegungen und kritischen Reflexionen Anlass zu weiterer Auseinandersetzung mit einem zu Unrecht vernachlässigten Thema geben mögen.
Literatur
Clague, Christopher/Gleason, Suzanne/Knack, Stephen: Determinants of Lasting Democracy in Poor Countries. Center for Institutional Reform and the Informal Sector, Working Paper No. 209, University of Maryland at College Park, September 1997.
Hanke, Stefanie: Systemwechsel in Mali. Hamburg 2001.
Huber, Wolfgang: Die jüdisch-christliche Tradition. In: Hans Joas/Klaus Wiegandt (Hg.), Die kulturellen Werte Europas, Frankfurt am Main 22005, S. 69–92.
Huntington, Samuel P.: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Okla. 1991.
Matz, Ulrich: Zum Einfluß des Christentums auf das politische Denken der Neuzeit. In: Günther Rüther (Hg.), Geschichte der Christlich-Demokratischen und Christlich-Sozialen Bewegungen in Deutschland. Bonn 1987, 27–56.
Merkel, Wolfgang: Religion, Fundamentalismus und Demokratie. In: Wolfgang Schluchter (Hg.), Fundamentalismus, Terrorismus, Krieg. Weilerswist 2003, 61-86.
Putnam, Robert: Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, N. J. 1993.
Riesebrodt, Martin: Die Rückkehr der Religionen. Fundamentalismus und der „Kampf der Kulturen“. München 2000.
Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien. Opladen 32000.
1 Dass auch das jüdische Israel zu den wenigen Demokratien außerhalb des christlichen Kulturkreises zählt, überrascht jene nicht, die eine enge Beziehung von Religion bzw. Christentum und Demokratie sehen, gilt die jüdische Religion doch gewissermaßen als die ältere Schwester des Christentums. Die gegenwärtig häufig zu hörende Wendung von der „jüdisch-christlichen Tradition“ zeugt von der engen Verbindung (vgl. Huber 2005, 70 ff.).