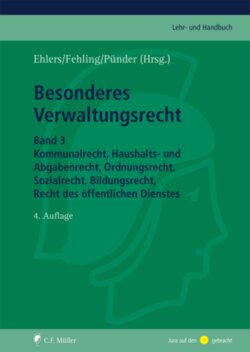Читать книгу Besonderes Verwaltungsrecht - Группа авторов - Страница 82
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Bürgerentscheid und Bürgerbegehren
Оглавление174
Der Bürgerentscheid und das Bürgerbegehren[539] sind als Mitentscheidungsformen den Bürgern vorbehalten. Beiden Instrumenten kommt dabei eindeutig ein plebiszitärer Charakter zu[540]. Ein Bürgerentscheid findet dann statt, wenn eine landesrechtlich festgelegte Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderats so beschließt oder aufgrund eines Bürgerbegehrens[541]. Ein Bürgerentscheid hat die Bedeutung, dass über wichtige Gemeindeangelegenheiten von den Bürgern in geheimer Abstimmung an Stelle der gewählten Gemeindevertretung direkt entschieden wird. Eine entsprechende Entscheidung per Bürgerentscheid hat folglich die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses[542]. Bürgerbegehren und -entscheid treten damit als direkt-demokratische Instrumente in Konkurrenz zu den „normalen“ repräsentativen Entscheidungsprozessen[543]. Das hierüber den Bürgern eröffnete Gestaltungspotential fördert Identifikations- und Zufriedenheitseffekte mit der Verwaltung, schwächt aber die Wirkmächtigkeit der gewählten Volksvertreter. Es dient der Durchsetzung singulärer individueller Interessen eines Teils der Ortsbevölkerung und unterliegt nicht dem in der Volksvertretung obwaltenden Ausgleich von Interessen über die Zeit und das Gemeindegebiet. Bei der Normierung plebiszitärer Elemente kommt dem Gesetzgeber ein Einschätzungsspielraum zu. Problematisch sind faktische Doppelzuständigkeiten[544].
175
An ein Bürgerbegehren werden bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Es muss zunächst eine bürgerbegehrensfähige Selbstverwaltungsangelegenheit vorliegen, die entweder positiv bestimmt oder anhand eines Negativkatalogs abgrenzt wird. Des Weiteren findet ein Bürgerbegehren nur statt, wenn der Antrag von einer bestimmten Bürgeranzahl unterschrieben wurde (Quorum), was meist von der Gemeindegröße abhängt und je nachdem bei ca. 3–10 % der Bürger liegt (in Sachsen 15 %[545]). Ferner muss das Bürgerbegehren schriftlich eingereicht werden mit einer genau formulierten Frage, Begründung und Kostendeckungsvorschlag; schließlich sind bestimmte Fristanforderungen zu beachten. Nicht bürgerbegehrensfähig sind solche Angelegenheiten, die bereits innerhalb der letzten 1–3 Jahre Gegenstand eines Bürgerentscheids waren. Darüber hinaus muss unterschieden werden zwischen initiierenden Bürgerbegehren und kassierenden, d.h. gegen einen ergangenen Ratsbeschluss gerichtete Bürgerbegehren, wobei erstere nicht fristgebunden sind[546].
176
Bevor als Rechtsfolge des Bürgerbegehrens der Bürgerentscheid stattfindet, sehen die Kommunalordnungen die Feststellung der Zulässigkeit vor, für die entweder der Gemeinderat[547] oder die Kommunalaufsicht zuständig ist[548]. Gegen die Ablehnung des Bürgerentscheids kann mit den Mitteln des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes vorgegangen werden[549]. Besonders umkämpft ist die Phase vor dem (erfolgreichen) Bürgerentscheid, in der von Seiten des Gemeinderats, aber auch des Bürgermeisters als Hauptverwaltungsorgan versucht werden kann, dergestalt vollendete Tatsachen zu schaffen, dass der Bürgerentscheid obsolet wird. Manche Gemeindeordnungen sehen deshalb eine Sperrwirkung des zulässigen Bürgerbegehrens vor[550].
177
Auch im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren stellt sich das Problem der Teilnahme von Unionsbürgern. Diesbezüglich gibt es keine Vorgaben der schon erwähnten Richtlinie 90/80/EG und es lässt sich auch keine diesbezügliche Aussage aus Art. 22 AEUV entnehmen, so dass auf bundesverfassungsrechtliche Maßstäbe zurückgegriffen werden muss. Nach Art. 20 Abs. 2 GG geht die Staatsgewalt vom Volk aus und wird durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Berücksichtigt man diese Differenzierung zwischen Wahlen und Abstimmungen, so kann man unter den Begriff der Wahlen in Art. 28 Abs. 1 S. 3 GG nicht ohne Weiteres Abstimmungen fassen. Dieses Ergebnis lässt sich mit dem Zusammenhang zwischen Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG und Art. 28 Abs. 1 S. 3 GG erhärten. Dies hat zur Folge, dass Unionsbürger zwar ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene haben; der Wortlaut des Art. 28 Abs. 1 S. 3 GG allein aber keine Auslegung erlaubt, die ein Abstimmungsrecht für Unionsbürger ergibt. Unter dem Gesichtspunkt der Systemgerechtigkeit erscheint jedoch eine Erweiterung auf entsprechende plebiszitäre Verfahren, die grundsätzlich dieselben Fragen betreffen, die auch von den unter Beteiligung der EU-Ausländer gewählten Vertretungen entschieden werden, als grundsätzlich zulässig[551].