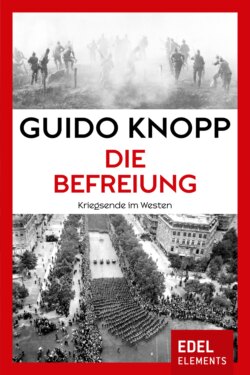Читать книгу Die Befreiung - Guido Knopp - Страница 6
Der längste Tag
ОглавлениеDienstag, 6. Juni 1944. Die Morgendämmerung tauchte die weite Heckenlandschaft der Normandie in ein düsteres Licht. Graue Wolken hingen tief. An der Küste peitschte der starke Wind das grünliche Wasser des Kanals zu meterhohen Wellen auf. Seit mehreren Stunden schon standen die deutschen Soldaten in ihren Bunkerstellungen in erhöhter Alarmbereitschaft. Ungewöhnlich heftig waren in dieser Nacht die alliierten Bombenangriffe auf die Befestigungsanlagen des Atlantikwalls gewesen. Seit Mitternacht gab es sehr widersprüchliche Meldungen über die Landung von feindlichen Fallschirmjägern. Es lag etwas in der Luft. Ob wohl die lang erwartete Invasion bevorstand? Immer wieder schauten die deutschen Posten auf die See hinaus. Gegen 5.30 Uhr hatte das lange Warten dann ein Ende. Die gewaltigste Armada der Weltgeschichte tauchte aus dem Dunst auf. Die deutschen Soldaten trauten ihren Augen nicht: Vor lauter Schiffen war kein Wasser mehr zu sehen – so etwas konnte es doch gar nicht geben. »Der Horizont war schwarz vor Schiffen«, erinnert sich Heinz Bongart, der die Invasion am Strand von St. Laurent erlebte.
Kurz darauf blitzte es aus der Riesenflotte auf und ein wahrer Feuerorkan ergoss sich auf die Strandlinie. Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer begannen, die deutschen Stellungen sturmreif zu schießen. Tonnenschwere Granaten rissen gewaltige Krater in die normannische Erde, zermalmten Stacheldrahtverhaue, Bunkerstellungen und Laufgräben. Die Erde bebte und es war unvorstellbar, dass irgendjemand in diesem Geschosshagel würde überleben können.
Hinter den Kriegsschiffen zeichneten sich die Silhouetten mächtiger Transporter ab, in ihnen zehntausende kampfbereiter Soldaten. Die Armada war von hektischer Betriebsamkeit ergriffen. Sturmboote wurden von riesigen Kränen zu Wasser gelassen, Patrouillenboote flitzten zwischen den großen Landungsschiffen hin und her und in waghalsigen Manövern kletterten voll gepackte Soldaten von Fallreeps in ihre Landungsboote. Die erste Welle brauste nun mit voller Fahrt auf den Strand zu. Die Invasion hatte begonnen!
Wir mussten die größte Landung unternehmen, die bisher in der Geschichte gegen eine von modernsten Befestigungen starrende Küste durchgeführt worden war, und hinter dieser Küste stand das deutsche Westheer, das seit den finsteren Tagen von 1940 nicht mehr zur Schlacht hatte antreten müssen.
General Dwight D. Eisenhower über die Landung in der Normandie
Doch kaum einer der Soldaten, die zur Befreiung Frankreichs und Europas von der Schreckensherrschaft Hitlers zum Kampf angetreten waren, hatte in diesem Augenblick einen Sinn für den historischen Moment. Dicht gedrängt standen die Soldaten in den Sturmbooten. Die schwere See warf sie hin und her. Klatschnass und durchgefroren, waren die meisten seekrank und hofften, nur bald an Land zu kommen, damit die Höllenfahrt endlich ein Ende nehmen würde.
Immer näher schoben sich die Landungsfahrzeuge an die Küste heran. »Utah« und »Omaha« hießen die Strandabschnitte der Amerikaner im Westen der Seine-Bucht. »Gold«, »Juno« und »Sword«, jene der Briten und Kanadier, zwischen Bayeux und Orne-Mündung. Bald hörten die Männer der ersten Sturmwelle nicht nur den Feuerorkan der Schiffsartillerie, sondern auch das dumpfe Dröhnen von Flugzeugmotoren. Über ihren Köpfen bot sich ein atemberaubendes Schauspiel: Aberhunderte von Flugzeugen überflogen die Landungsflotte und stürzten sich auf die deutschen Stellungen. Schwärme von einmotorigen Jagdbombern und zweimotorigen B-26 »Maraudern« griffen immer wieder die Strandlinie an. Über den Wolken flogen die schweren viermotorigen Bomber und warfen ihre todbringende Fracht ab.
Vielleicht würde es doch eine leichte Landung werden, dachte so mancher. Man hatte die Männer zwar auf einen schweren Kampf vorbereitet, aber nach diesem Bombardement, so ihre Hoffnung, müsste es eigentlich ein Leichtes sein, Hitlers Atlantikwall zu durchbrechen. Als die Männer der 1. und 29. US-Infanteriedivision auf den Landeabschnitt Omaha zuhielten, konnten sie nicht ahnen, dass 329 schwere Bomber ihre Fracht aufgrund der schlechten Sicht hinter den deutschen Stellungen abgeladen hatten. »Die alliierten Flugzeuge haben so viele Bomben abgeworfen, dass man glaubte, ein schwarzer Vorhang rauscht auf die Erde nieder. Aber der ganze Regen schlug im Hinterland ein und wir sind von keiner einzigen Bombe getroffen worden«, erinnert sich Heinz Bongart, der im Widerstandsnest 65 direkt an der Steilküste lag. Noch 1000 Meter bis zur Küste. Die GIs konnten jetzt das in Rauch gehüllte Steilufer erkennen, das sich etwa 50 Meter über den flachen Sandstrand erhob. Kein einziges deutsches Geschütz feuerte, kein Maschinengewehr schoss auf sie. Noch 500 Meter – deutlich waren nun die minenbesetzten Vorstrandhindernisse auszumachen, dahinter lag der breite Sandstrand. Nichts rührte sich. Doch dann, als die kleinen Sturmboote noch 400 Meter entfernt waren, eröffnete die deutsche Artillerie aus allen Rohren das Feuer. Granatwerfer bellten, Pak schoss. Als die Landungsboote endlich den Strand erreicht hatten und ihre Rampen herunterließen, steigerte sich das Feuer noch. Im brusthohen Wasser wateten die mit Munition und Ausrüstung schwer beladenen Männer ohne Deckung langsam an Land und boten dabei ideale Zielscheiben. Maschinengewehrsalven mähten hunderte von GIs nieder. Es war ein Inferno.
Freiheit gibt es nicht umsonst! Jemand musste dafür bezahlen. Und diese Jungs taten es. Für uns. Ich bin ihnen dafür bis heute dankbar. Und ich bin überzeugt, sie hätten es wieder getan, um diese Welt von Hitler zu befreien.
Roy Stevens, US-Soldat
Die Landung in der Normandie, die Operation »Overlord«, hatte die militärischen und politischen Stäbe der Alliierten seit Jahren beschäftigt. Seit Hitler im Juni 1941 die Sowjetunion angegriffen hatte, trug die Rote Armee zunächst die Hauptlast des Krieges. Angesichts der gewaltigen Schlachten in den Weiten Russlands erschien der Wüstenkrieg britischer Truppen in Nordafrika wie ein nebensächliches Geplänkel. Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt waren sich dieser Tatsache vollauf bewusst, gaben freilich nur allmählich die Berührungsängste mit dem kommunistischen Regime in Moskau auf. Vorerst wollte man nur Waffen liefern – zu mehr Unterstützung sah man sich nicht in der Lage. Ende Dezember 1941 sprachen sie in Washington zum ersten Mal das Problem der zweiten Front an, wobei Churchill für eine Landung in Nordwestafrika und anschließend in Europa plädierte, während die Amerikaner für eine Landung in Frankreich stimmten. In den folgenden Jahren verschwand das Thema nicht mehr von der Tagesordnung der Beratungen der Großen Drei. Stalin drängte bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf, dass die Westalliierten endlich eine große Landfront im Westen Europas eröffnen müssten. Eigentlich war es dem Diktator immer darum gegangen, dass sich die kapitalistischen Staaten in einem großen Krieg selbst zerfleischen würden, sodass er als lachender Dritter eine leichte Beute würde einbringen können. Doch nun war alles anders gekommen. Die UdSSR befand sich inmitten eines Kampfes auf Leben und Tod mit dem nationalsozialistischen Deutschland, der weite Landstriche verwüstete und jeden Tag abertausende Sowjetbürger das Leben kostete, während die USA und Großbritannien mehr oder minder abseits standen. Es war zu befürchten, das Russland in diesem Kampf ausblutete und stattdessen der Westen als lachender Dritter aus diesem Krieg hervorgehen würde.
Am 19. August 1942 landete zum ersten Mal ein größerer alliierter Truppenverband im deutschbesetzten Frankreich. 6000 kanadische Soldaten sollten den gut befestigten Hafen Dieppe an der Kanalküste erobern und ihn dann im Lauf des Abends wieder räumen. Mit dieser »gewaltsamen Erkundung« sollten die Möglichkeiten einer großen Landungsoperation ausgelotet werden. Das Unternehmen mit dem Decknamen »Jubilee« wurde jedoch ein völliger Fehlschlag. In dem schweren Feuer der Deutschen erlitten die kanadischen Truppen schwere Verluste. Nur 1700 Mann gelang es, sich wieder einzuschiffen und nach England zurückzukommen. Die Übrigen waren gefallen oder in deutsche Gefangenschaft geraten. Für Churchill stand nach diesem Fiasko fest, dass es nicht möglich sein würde, noch 1942 in Frankreich zu landen, so wie dies Ende Mai von Roosevelt zugesagt worden war. Stattdessen besetzten Briten und Amerikaner am 8. November 1942 Marokko und Algerien und verjagten Rommels Truppen bis zum Mai 1943 aus Nordafrika. Der Krieg im Mittelmeer verzögerte die große Landung in Frankreich, mit der dem Deutschen Reich ein entscheidender Schlag versetzt werden sollte. Im Juli 1943 setzten die Alliierten zunächst nach Sizilien und im September auch auf das italienische Festland über. Die Deutschen waren dadurch gezwungen, etliche Divisionen von der Ostfront abzuziehen. Doch der erstrebte große Schlag, der rasch das Ende des Krieges bringen sollte, war dies nicht, da die Alliierten im Spätherbst 1943 von der Wehrmacht für mehr als ein halbes Jahr in Mittelitalien aufgehalten wurden.
Die größte aller Unternehmungen.
Winston Churchill über die Landung in der Normandie
Auf der Konferenz von Teheran, die Ende November 1943 stattfand, sagten Churchill und Roosevelt Stalin dann endgültig zu, im Mai 1944 in Frankreich zu landen, es zu befreien und anschließend in das Deutsche Reich einzufallen. Der Countdown lief – alle militärischen Aktionen wurden nun auf die Vorbereitung der großen Landung ausgerichtet. Riesige Konvois schafften hunderttausende amerikanischer Soldaten sowie tausende von Panzern und Geschützen nach England. Sie überquerten den Atlantik praktisch unbehelligt. Die »Grauen Wölfe« – die deutschen U-Boote – konnten den gewaltigen Aufmarsch nicht mehr behindern. Die vormaligen Jäger waren seit Mai 1943 selbst zu Gejagten geworden. Der Atlantik war nunmehr wie eine große Autobahn, auf der der Verkehr planmäßig lief. Bald glichen die südlichen Grafschaften Englands einem riesigen Heerlager – übersät von Kasernen, Materialdepots und Munitionslagern.
Den Deutschen waren die Vorbereitungen der Alliierten natürlich nicht entgangen. Es lag schließlich in der militärischen Logik, dass Briten und Amerikaner versuchen würden, die nur schwach verteidigte Flanke Europas anzugreifen, während die Masse der Wehrmacht in Russland gebunden war. Allen voran fürchtete Hitler diese drohende Gefahr aus dem Westen. Bereits am 14. Dezember 1941 hatte er befohlen, dass vom Nordkap bis nach Biarritz ein neuer »Westwall« gebaut werden solle. Norwegen hielt er für stark gefährdet, sodass in den nächsten Jahren insbesondere hier viele schwere Küstenbatterien errichtet wurden. Hitlers Angst war nicht ganz unbegründet. Norwegen war für den deutschen Erzimport besonders wichtig und verbesserte die strategische Position von Luftwaffe und Kriegsmarine in erheblichem Maß. Und Churchill regte 1942 in der Tat an, Truppen nach Norwegen zu schicken und das Land den Deutschen wieder zu entreißen. Der Plan scheiterte freilich am Widerstand Schwedens, ohne dessen Hilfe man die Operation nicht durchführen zu können glaubte. Wenngleich die meisten Befestigungsanlagen zunächst in Norwegen gebaut wurden, galt spätestens nach dem alliierten Raid auf Dieppe mehr und mehr auch Frankreich als gefährdet.
Der harte und verlustreiche Kampf der letzten zweieinhalb Jahre gegen den Bolschewismus hat die Masse unserer militärischen Kräfte und Anstrengungen aufs Äußerste beansprucht. ... Die Gefahr im Osten ist geblieben, aber eine größere im Westen zeichnet sich ab: die angelsächsische Landung! ... Gelingt dem Feind hier ein Einbruch in unsere Verteidigung in breiter Front, so sind die Folgen in kurzer Zeit unabsehbar. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass der Feind spätestens im Frühjahr, vielleicht aber schon früher zum Angriff gegen die Westfront Europas antreten wird.
Adolf Hitler, 3. November 1943
Im August 1942 hatte Hitler angeordnet, dass der neue »Atlantikwall« aus 15 000 Bunkern bestehen sollte. Überall baute die Organisation Todt in den folgenden Jahren mit zwangsverpflichteten einheimischen Arbeitern Bunkeranlagen. Millionen Kubikmeter Beton wurden verbaut. Doch es musste von vornherein ein hoffnungsloses Unterfangen sein, eine 5500 Kilometer lange Küste ausreichend zu sichern. Weder stand hierfür eine ausreichende Zahl an Truppen zur Verfügung, noch war es möglich, genügend Befestigungen zu bauen. Die Frage war somit: Wo würden die Alliierten landen? Wo sollte man die Verteidigungsanstrengungen ballen? Zunächst konzentrierten sich die Deutschen auf den Ausbau der Häfen, die zum vorrangigen Ziel der Invasionstruppen werden mussten. Für einen weiten Vorstoß ins Land benötigten die Angloamerikaner schließlich eine gesicherte Nachschubbasis – und die konnte einzig und allein ein hinreichend großer Hafen bereitstellen. 1943 rückte Frankreich immer stärker in den Mittelpunkt der Invasionserwartungen. Für den Oberbefehlshaber West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, war die gefährdetste Stelle der französischen Küste der Pas de Calais zwischen Boulogne und Dünkirchen. Dort war der Kanal am schmälsten, Landungsboote und Flugzeuge hatten hier den kürzesten Weg zurückzulegen. Außerdem führte vom Pas de Calais aus der schnellste Weg ins Ruhrgebiet – in das industrielle Herz Deutschlands. Auch Feldmarschall Erwin Rommel – im Herbst 1943 übernahm er den Befehl über die Heeresgruppe B, der die Truppen in Nordfrankreich unterstanden – glaubte an eine Landung im Pas de Calais. Schließlich legte auch Hitler den Schwerpunkt der Abwehrbemühungen auf diesen Raum. Im Frühsommer 1944 sollte nämlich aus den dort gelegenen Stellungen das verheerende Feuer der »Vergeltungswaffen« auf London eröffnet werden. Da es gegen die Raketen keine Abwehr zu geben schien, wären die Alliierten, so Hitlers Kalkül, gezwungen, im Pas de Calais zu landen, um die V-Waffen-Stellungen auszuschalten. Genau dort baute man den Atlantikwall also am stärksten aus. Mächtige Küstenbatterien standen hier, die ihre todbringenden Granaten bis nach Südengland feuern konnten. Der Strand war mit Geschützstellungen und Widerstandsnestern gespickt – ein Durchkommen erschien kaum möglich.
Unser Täuschungsplan war clever. Wir wiesen mit dem Finger auf den Pas de Calais, den Ort, wo die Landung am einfachsten gewesen wäre, weil dieser Ort England am nächsten liegt.
Sir Carol Mather, Adjutant Montgomerys
Rommel ließ verminte Vorstrandhindernisse errichten, an denen bei Flut angreifende Landungsboote zerschellen sollten. Entschieden sich die Alliierten hingegen, die Invasion bei Ebbe zu starten, müssten sie einen breiten Sandstrand überwinden, wobei sie wie auf dem Präsentierteller dem Feuer der Deutschen ausgesetzt sein würden.
Die Alliierten erkannten rasch den Verteidigungsschwerpunkt der Wehrmacht. Es erschien ihnen kaum ratsam, an diesem gut gesicherten Küstenabschnitt zu landen, zumal es eben auch andere Gründe gab, die gegen den Pas de Calais als Invasionsort sprachen. Die gesamte Nachschublogistik hätte dann auf den kleinen Häfen Dover und Folkestone gelastet, außerdem waren die Strände Wind und Strömung schutzlos ausgeliefert. Bereits im Juli 1943 einigten sich die alliierten Stabschefs daher auf eine Landung in der Normandie. Die Strände waren hier nur schwach verteidigt, bei Westwind schützte die Halbinsel Cotentin die Landungsflotte in der Seine-Bucht. Zudem lag die Normandie zentraler zu den Großhäfen Portsmouth und Southampton an der englischen Südküste, auf die sich die Alliierten vornehmlich stützen wollten.
Als ich zur 29. US-Infanteriedivision kam, wusste ich, welche Aufgabe uns bevorstand. Uns wurde gesagt, dass wir die Speerspitze der Invasion Europas sein würden und dass zwei von drei von uns nicht zurückkommen würden.
Harold Baumgarten, US-Soldat
Im Frühjahr 1944 begannen die Vorbereitungen für die Landung. Immer wieder übten die Truppen die Operation, erprobten das Zusammenspiel von Panzern und Infanterie. Fallschirmjäger trainierten die Einnahme von deutschen Batteriestellungen an originalgetreu nachgebauten Modellen. Nichts sollte dem Zufall überlassen sein. Bitteres Lehrgeld hatten die Alliierten bei den Landungen in Sizilien, Salerno und Anzio zahlen müssen. Immer wieder waren hier grobe Fehler unterlaufen, die zu schweren Verlusten geführt und die Operation gefährdet hatten. Man hatte somit wichtige Erfahrungen gesammelt, eine Unternehmung dieser Größe zu koordinieren und zu verhindern, dass ein Chaos entstand.
Ich kann mich erinnern, dass ein paar Tage vor Invasionsbeginn ein Aufklärungsflieger von uns drüben in England angeschossen worden ist. Er hat sich noch über den Kanal retten können und ist in unserem Abschnitt runtergekommen. Wir haben ihn aus dem Flugzeug geholt, und er hat uns dann sofort erzählt, dass die englischen Häfen knallvoll liegen, Schiff an Schiff. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ihm das nicht geglaubt. Wir haben gedacht, der Mann ist durch seinen Abschuss irgendwie verstört.
Hans Heinze, deutscher Offizier
Kommandotruppen und Kampfschwimmer erkundeten die Landestrände, Luftaufklärer fotografierten jeden Quadratmeter Küstenlinie und die Résistance versuchte, die deutschen Verteidigungsstellungen auszukundschaften.
Die Alliierten wollten nicht überrascht werden, wenn sie an der Küste der Normandie an Land gingen. Im Frühjahr 1944 begann die alliierte Luftarmada damit, die »Festung Europa« sturmreif zu bomben. Die Küstenbatterien, die Radarstellungen und vor allem die Verschiebebahnhöfe wurden angegriffen. Im Mai 1944 war der Eisenbahnverkehr in Frankreich fast lahm gelegt worden, obwohl die Organisation Todt 18 000 Arbeiter von den Baustellen an der Küste zur Instandsetzung der Schienenwege abzog. Damit fiel die Bahn als Transportmittel für schnelle Truppenverschiebungen praktisch aus. Die deutschen Reserven würden auf den engen Straßen zu den Landeköpfen marschieren müssen.
Im Mai 1944 waren die Vorbereitungen der Alliierten abgeschlossen. Jetzt kam es nur noch auf das richtige Wetter an, und die meteorologischen Anforderungen waren hoch: Die Fallschirmjäger brauchten für ihren nächtlichen Absprung Mondlicht, während die Landungstruppen in der Morgendämmerung bei Ebbe mit auflaufendem Wasser angreifen würden. Am 18. Mai besprach General Eisenhower, der Befehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, mit seinen Beratern die Lage. Zwischen dem 5. und 7. Juni sowie dem 12. und 14. Juni herrschten günstige Mond- und Gezeitenverhältnisse. Eisenhower legte daraufhin den Tag der Invasion auf den 5. Juni 1944 fest. Bereits am 2. Juni 1944 liefen die ersten alliierten Konvois in Richtung Normandie aus. Als zwei Tage später plötzlich das Wetter umschlug, starker Sturm und Regen einsetzte, wurde die ganze Operation abrupt gestoppt, die Schiffe zurückbeordert. Die alliierten Generäle wussten, dass die Landung nur bei ausreichend gutem Wetter gelingen konnte. Chefmeteorologe Group Captain Stagg teilte Eisenhower und seinen Stabschefs am frühen Morgen des 5. Juni mit, dass am Folgetag kurzfristig mit einer Wetterbesserung zu rechnen sei. Daraufhin gab Eisenhower um 3.30 Uhr den endgültigen Angriffsbefehl. Am Morgen des 6. Juni 1944 würden gegen 6.30 Uhr britischer Zeit die amerikanischen und eine Stunde später die britischen Truppen ihren Fuß auf französischen Boden setzen.
Der von der britisch-amerikanischen Kriegführung für die Westinvasion gegen den europäischen Kontinent festgesetzte Termin rückt näher. Ohne uns unter die Propheten mischen zu wollen, sind auch wir der Meinung, dass eine solche Aktion das allgemeine Bild des Krieges in verhältnismäßig kurzer Zeit total verändern könnte ... weil damit zum ersten Mal wieder der Westen aktiv in den Kriegsverlauf eintreten würde. Niemand kann voraussagen, mit welchem Erfolg dies geschehen wird.
Joseph Goebbels im Februar 1944 in der Wochenzeitung »Das Reich«
Auf der anderen Seite des Kanals waren sich die deutschen Stäbe darin einig, dass in den kommenden Tagen keine Landung zu befürchten sei. Man hatte die Invasion für den Mai 1944 erwartet – so wie es ursprünglich von den Alliierten auch geplant gewesen war. Bei dem anhaltend schlechten Wetter glaubte man indes, nichts befürchten zu müssen – die kurze Wetterbesserung wurde von den deutschen Meteorologen zwar vorausgesehen, von den höchsten Stäben aber nicht weiter beachtet. So nahm denn das Unheil seinen Lauf. Die deutschen Vorpostenboote liefen in der Nacht zum 6. Juni 1944 wegen des hohen Seegangs nicht aus und Generaloberst Friedrich Dollmann, der Oberbefehlshaber der 7. Armee, hatte für den 6. Juni eine Planübung in seinem Hauptquartier in Rennes angesetzt, zu der alle Divisionskommandeure beordert worden waren. Nicht ahnend, dass sich eine gewaltige feindliche Armada auf seine Streitkräfte zubewegte, wollte er mit seinen Generälen durchsprechen, welche Maßnahmen bei einer feindlichen Luftlandung in der Bretagne zu ergreifen wären. In den entscheidenden Stunden waren die Divisionen im Landeraum also ohne ihre Kommandeure. Selbst Rommel hatte die Schlechtwetterfront ausgenutzt, um einen Kurzurlaub bei seiner Frau in Herrlingen zu machen. Sie hatte am 6. Juni Geburtstag und er wollte den Tag gerne mit ihr verbringen. Es ist schon fast eine geschichtsphilosophische Frage, ob die Abwesenheit so vieler Entscheidungsträger den Lauf der Ereignisse mitbestimmt hat. Sicher ist jedenfalls, dass die Stabschefs in den Hauptquartieren zurückgeblieben waren und die Truppen auch ohne ihre Befehlshaber kämpfen konnten.
Meinem Vater war es äußerst unangenehm, dass er nicht im Hauptquartier war. Er hat dann über die Marine geschimpft und gesagt, diese hätte ihm versichert, der Seegang sei so hoch, dass die Alliierten gar nicht kommen könnten. Wie sich dann herausstellte, sind aus diesem Grunde sogar die deutschen Vorpostenschiffe zurückgezogen worden, sodass das Heer die Invasionsflotte als Erstes bemerkte.
Manfred Rommel, Sohn Erwin Rommels
Viel wichtiger war nun die Frage, wie es mit der Verteidigungsfähigkeit des Atlantikwalls an den Küsten der Seine-Bucht bestellt war. Insgesamt hatte die Wehrmacht Anfang Juni 1944 59 Divisionen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden versammelt, davon zehn Panzer- und Panzergrenadierdivisionen, die über 1800 gepanzerte Fahrzeuge aller Art verfügten. Dies war auf den ersten Blick eine beachtliche Streitmacht, die für die Alliierten gefährlich werden konnte. Betrachtete man die Verbände allerdings genauer, waren die Spuren des vierten Kriegsjahres nicht zu übersehen. Die Masse der Einheiten waren so genannte bodenständige Divisionen, welche aus älteren Jahrgängen zusammengesetzt worden waren und über keinerlei Fahrzeuge verfügten. Der Mannschaftsbestand rekrutierte sich manchmal zu 30 Prozent aus so genannten Ostbataillonen, das heißt ehemaligen Sowjetbürgern, die sich freiwillig der Wehrmacht angeschlossen hatten. Weil es zu befürchten war, dass sie in Russland zur Roten Armee überlaufen würden, setzte man sie im Westen ein. Selbstverständlich konnte man von Krimtataren, Kalmücken und Kosaken, die in Frankreich für die Deutschen gegen die Amerikaner eingesetzt wurden, nicht allzu viel Kampfgeist erwarten. Die Ausrüstung der meisten Divisionen war veraltet, sie war größtenteils ein Sammelsurium von Beutewaffen. Nur um wenige Einheiten war es besser gestellt, eine davon war die 352. Infanteriedivision, die den Westteil der Calvados-Küste verteidigte – die GIs, die am Omaha-Beach an Land gingen, sollten dies bitter zu spüren bekommen.
Monty wusste, dass Rommel uns direkt am Strand mit seinen Panzertruppen attackieren würde. Und darum mussten wir so schnell wie möglich Brückenköpfe landeinwärts errichten. Das bedeutete, dass die Invasion nur mit enormer Truppenstärke funktionieren konnte.
Sir Carol Mather, Adjutant Montgomerys
Ein weiteres großes Problem war die Verteilung der Panzerdivisionen. Über diese Frage entbrannte ein heftiger Streit. Er betraf letztlich die generelle Strategie, die zur Abwehr einer Invasion gewählt werden sollte: Rommel war davon überzeugt, dass die einzige Chance, die Landung erfolgreich abzuwehren, darin bestand, den Feind am Strand aufzuhalten und mit einem sofortigen Gegenstoß ins Meer zu werfen. Waren die Alliierten erst einmal gelandet, würden sie ihre gewaltige Materialüberlegenheit entfalten können und die deutschen Truppen zermalmen. Rommel wusste, wovon er sprach. Er hatte in Afrika die alliierte Luftüberlegenheit erlebt und ihm war bewusst, dass dies nur ein Vorspiel dessen gewesen war, was man bei der Invasion zu erwarten hatte. Die kampfstarken Panzerdivisionen wollte er deshalb direkt an der Küste postieren. Rundstedt war jedoch anderer Meinung. Er hatte noch keine Materialschlachten gegen die Alliierten erlebt, kannte den Krieg nur aus der Zeit der großen Siege 1940/41. Er wollte Briten und Amerikaner kommen lassen, um sie dann in einer klassischen Panzerschlacht zu vernichten. Die Panzerdivisionen sollten daher weit von der Küste abgesetzt versammelt werden, von wo man sie nach geraumer Zeit zentral auf die Gegner loslassen konnte. Wie immer entschied Hitler diesen Streit nicht, sondern fand einen Kompromiss: Die Panzerdivisionen wurden weder so weit an der Küste disloziert, wie Rommel dies vorschwebte, noch so weit im Hinterland, wie Rundstedt dies wünschte, sondern in der Mitte. Zudem waren die Unterstellungsverhältnisse denkbar kompliziert, es gab keinen einheitlichen Oberbefehl. Im Ernstfall würde man daher nur mit Verzögerungen reagieren können.
Ich will Minen gegen Menschen, gegen Panzer, gegen Fallschirmjäger; ich will Minen gegen Schiffe und Landungsboote.
Erwin Rommel
Die Desorganisation wirkte sich umso schlimmer aus, als die Abwehr der Landung praktisch ausschließlich auf den Schultern des Heeres ruhte. Luftwaffe und Marine waren derart schwach, dass sie im besten Fall Nadelstiche setzen konnten – mehr war von ihnen nicht zu erwarten. Dabei hatte sich die Marine gerade selbst um ihre wirksamste Waffe gebracht, die die Kampfhandlungen erheblich hätte beeinflussen können. Im Sommer 1943 war ein neuartiger Minenzünder entwickelt worden, der durch die Druckwellen eines Schiffes ausgelöst wurde und gegen den es keine Räummethode gab. Aus Angst, diese »Wunderwaffe« könnte in die Hände des Gegners fallen, wurde ihr offensiver Einsatz an der englischen Küste verboten. Allerdings wurden vor der eigenen Küste auch keine Defensivminensperren geworfen, die einen wirksamen Schutz gegen jede Invasionsflotte dargestellt hätten. Rommel forderte dies mehrfach von der Marine, die es jedoch immer wieder ablehnte. Hitler ordnete schließlich noch Ende Mai an, die streng geheimen Druckdosenminen aus den vorgeschobenen französischen Depots wieder nach Deutschland zurückzubringen. Als die Invasion dann am 6. Juni begann, mussten sie erst mühsam auf den zerbombten Eisenbahnstrecken an die Front gebracht werden, wo sie dann viel zu spät zum Einsatz kamen. Befehlswirrwarr, Organisationschaos und der Irrglaube, dass die Alliierten nur in den Pas de Calais landen könnten, haben die ohnehin spärlichen Chancen der Wehrmacht, die Invasion zurückzuschlagen, auf ein Minimum schrumpfen lassen.
Als am 5. Juni 1944 die Nacht anbrach, herrschte in den deutschen Verteidigungsstellungen die Ruhe vor dem Sturm. Franz Gockel lag in einem Widerstandsnest am Omaha-Beach. Er erinnert sich: »Am 5. Juni war es für uns ein Abend wie viele andere vorher. Nur die Spannung wuchs doch immer mehr. Wir haben in unserem Bunker, soweit wir nicht auf Wache waren, noch zusammengesessen. Es wurde immer wieder diskutiert, kommen sie oder kommen sie nicht? Da wir noch kein elektrisches Licht hatten, saßen wir im Schein von Kerzen zusammen. Es verbreitete sich eine richtig gemütliche Atmosphäre. Besonders Kameraden, die eine Familie hatten, waren nachdenklich, fragten sich, wie es zu Hause wohl aussah. Einige kamen aus den Städten und ein Kamerad hatte vor einigen Tagen noch die Nachricht bekommen, dass seine Großmutter und seine Schwester bei einem Bombenangriff umgekommen waren. Um die Stimmung etwas zu verbessern, legten wir Schallplatten auf und hörten ›Wenn der weiße Flieder wieder blüht‹ und ›Wenn du einmal ein Herz verschenkst‹.« Müde fielen die Männer um Franz Gockel schließlich ins Bett. »Hoffentlich kommen die Brüder diese Nacht nicht, hoffentlich können wir durchschlafen«, dachten viele.
Aus Langeweile haben wir am Abend des 5. Juni auf dem Kirchplatz von Ste. Mère Eglise Kunstradfahren veranstaltet. So gegen elf Uhr haben wir unsere Fahrräder zu einem Schuppen gebracht und sind zurückgekommen. Als wir bei der Kirche waren, kam ein Flugzeug – man konnte deutlich erkennen, dass schwarze Punkte ausstiegen. Wir glaubten, dass dies eine Flugzeugbesatzung sei, die abspringen musste. Plötzlich hörten wir Motorengebrumm, hunderte Flugzeuge überflogen uns und der Himmel war nur noch schwarz von Fallschirmjägern. Wir dachten: Da können wir paar Mann nichts ausrichten, und haben uns rasch nach Ste. Mère Eglise zurückgezogen.
Rudi Escher, deutscher Soldat
Es war 0.15 Uhr, als die ersten alliierten Fallschirmjäger in ihren Transportmaschinen auf ein kleines grünes Licht starrten: das Zeichen zum Absprung. Aus nur 300 Metern Höhe sprangen sie in das Dunkel der Nacht und schwebten der Erde entgegen. Es waren Pfadfinder, die Landezonen für die nachfolgenden Fallschirmjäger und Lastensegler markieren sollten. Doch die bis dahin größte Luftlandeoperation der Geschichte stand unter einem ungünstigen Stern: Die Transportmaschinen hatten Flakfeuer erhalten, waren zu heftigen Ausweichbewegungen gezwungen und fanden in der Nacht ihre Ziele nicht. Die meisten Pfadfinder standen völlig orientierungslos in dem von Hecken durchzogenen Gelände. Sie waren weit verstreut abgesetzt worden und konnten ihren Auftrag nicht erfüllen. Eine Stunde später donnerte dann eine Armada von 2000 Transportflugzeugen über den Kanal, in ihren Bäuchen 18 000 amerikanische und britische Fallschirmjäger.
Zwei amerikanische Luftlandedivisionen wurden auf der Halbinsel Cotentin abgesetzt und sollten das Hinterland des Landeabschnitts »Utah« sichern. Die 6. britische Luftlandedivision sprang an der Orne ab und hatte den Auftrag, die östliche Flanke des Landekopfes gegen deutsche Einheiten zu sperren. Besonders chaotisch verlief die Aktion bei den Amerikanern. Im deutschen Flakfeuer kurvten die Piloten der Dakota-Transporter wie wild hin und her und setzten die Fallschirmjäger in der Aufregung weit verstreut über ein großes Gebiet ab. Die Männer der 82. und 101. US-Airborne-Division sprangen ins Chaos. Wohlweislich hatten die Deutschen die Flüsse Douve und Merderet angestaut und riesige Sumpflandschaften geschaffen. Diese wurden vielen Fallschirmjägern zum Verhängnis. Unzählige ertranken in den Fluten, andere verloren auf den überschwemmten Wiesen ihre schwere Ausrüstung und retteten nur ihr nacktes Leben. Lastensegler krachten in die Hecken und Bäume, versanken in den Überschwemmungsgebieten. Ein Großteil des schweren Materials ging so verloren.
Als wir die Küste der Halbinsel Cotentin überflogen, kamen wir in Flakfeuer. Am Boden schoss alles auf uns, wir konnten hören, wie die Geschosse an unsere Flügel prallten. Je weiter wir ins Landesinnere flogen, desto heftiger wurde der Beschuss. Dann kam endlich das grüne Licht und wir sprangen. Als wir außerhalb des Flugzeugs waren, konnten wir die Leuchtspurgeschosse der Flak erkennen. Es sah aus wie ein Feuerwerk.
Dwayne Burns, US-Fallschirmjäger
Die Offiziere versuchten, ihre Männer zu sammeln und kampfkräftige Einheiten zu bilden. Ihr Glück war, dass die Verwirrung bei den Deutschen ebenso groß war wie bei den orientierungslos durch die Nacht irrenden Amerikanern. Die Alliierten hatten im Südosten der Halbinsel Cotentin zahlreiche mit Feuerwerkskörpern ausgerüstete Gummipuppen abgeworfen, die im Dunkel der Nacht wild um sich schießende Soldaten nachahmen sollten. In der Tat trugen sie dazu bei, dass aus der ganzen Normandie Meldungen über gelandete Fallschirmjäger in den deutschen Kommandozentralen eingingen und sich die Gegenangriffe verzettelten.
Bisher noch kein Bild gewonnen, ob Ablenkungs- oder Hauptangriff.
Lagebeurteilung des OB West am 6. Juni 1944, 9.55 Uhr
Im Hauptquartier der 7. Armee gewann der Chef des Stabes, Max Pemsel, freilich ein immer klareres Lagebild. Er versetzte die 7. Armee um 2.15 Uhr in Alarmbereitschaft. Radarstellungen und Horchstationen machten in der Seine-Bucht immer mehr feindliche Schiffe aus. Es konnte keinen Zweifel geben: Dies war die Invasion. Rommels Chef des Stabes, General Hans Speidel, konnte er mit dieser Sicht der Dinge allerdings nicht überzeugen. Er blieb skeptisch, glaubte nicht recht daran, dass man aus den Meldungen bereits schließen konnte, dass die Alliierten in der Normandie landen würden. Speidel wollte erst einmal abwarten, bis sich die Lage weiter klärte. Im Hauptquartier des Oberbefehlshabers West bei Paris sah man die Sache ähnlich. Auch hier wollte man nichts überstürzen, und dies, obwohl mittlerweile zahlreiche Gefangene eingebracht worden waren, die eindeutig belegten, was vor sich ging. Die 91. Luftlandedivision war in schwere Kämpfe mit den amerikanischen Fallschirmjägern verwickelt. Sie war der vom Himmel gefallenen Armee zahlenmäßig weit unterlegen, sodass keine Zeit zu verlieren war, um Verstärkungen heranzuführen, die die US-Luftlandetruppen noch angriffen, bevor sie sich zu größeren kampfkräftigeren Gruppen zusammengeschlossen hatten. Doch nichts dergleichen geschah. Der Zweifel der höchsten Stäbe lähmte die Deutschen.
Trotz der chaotisch verlaufenen Landung waren die beiden amerikanischen Luftlandedivisionen anschließend bald in der Lage, starke Kampfgruppen zu bilden und das Hinterland des Landeabschnitts »Utah« abzusichern. In den frühen Morgenstunden eroberten sie den wichtigen Verkehrsknotenpunkt Ste. Mère Eglise. Die Landung der 6. britischen Airborne-Division zwar etwas geordneter verlaufen, doch kam es auch hier zu erheblichen Verlusten. Dennoch gelang es, die strategisch wichtigen Brücken über die Orne einzunehmen und die Küstenbatterie Merville auszuschalten. Als sich die Landungsboote der Küste näherten, war auch die Ostflanke des geplanten Brückenkopfes gesichert. Jetzt kam es vor allem darauf an, ob es den Bodentruppen gelingen würde, die deutschen Verteidigungsstellungen an den Stränden zu überwinden.
Ich wurde nachts um zwölf alarmiert, und ich hatte mir so einen Kilometer hinter der Küste einen Baum ausgesucht, den ich leicht erklettern konnte. Ich setzte das Fernglas an, aber es war völliger Nebel. So gegen halb sechs kam etwas Wind auf. Dann habe ich geglaubt, ich sehe eine Vision. Es waren tausende von Schiffen, die in der Zwischenzeit vor der Küste aufgefahren waren.
Hans Heinze, deutscher Offizier
Am Strandabschnitt »Utah« lief alles ziemlich planmäßig ab: Die Landungsboote der 4. US-Division, die heftig gegen die raue See anzukämpfen hatten, brausten auf den Strand am Ostufer der Halbinsel Cotentin zu. Sieben Sturmboote sanken bei dem schweren Wellengang, aber der Rest gelangte problemlos ans Ufer. Unterstützt von den Schwimmpanzern, die wie Schildkröten aus dem Wasser krochen, stürmten die Infanteristen über den breiten Strand. Ganz vereinzelt schoss ein Maschinengewehr, einige Granatwerfer- und Artilleriegranaten detonierten. Das übermächtige Abwehrfeuer, das die GIs erwartet hatten, blieb jedoch aus. Kurze Zeit später waren die deutschen Widerstandsnester am Strand überrollt: Das Bombardement aus der Luft und von den Schiffsgeschützen aus hatte volle Wirkung gezeigt und die Verteidigungsstellungen zermalmt. Außerdem wurde dieser Küstenabschnitt von der Wehrmacht nur schwach verteidigt. Im Hinterland erstreckten sich ausgedehnte Überschwemmungsgebiete, die einen schnellen Vorstoß motorisierter Truppen erschwerten. Niemand hatte sich damals vorstellen können, dass die Amerikaner ausgerechnet an dieser Stelle landen würden.
Brigadegeneral Theodore Roosevelt, der Bruder des amerikanischen Präsidenten, war als einziger General schon mit der ersten Welle gelandet. Zufrieden konnte er den Befehl geben, so schnell wie möglich ins Landesinnere vorzustoßen und den Kontakt mit den Fallschirmjägern herzustellen. Bulldozer räumten Gassen durch die Vorstrandhindernisse und in wenigen Stunden war der ganze Strand ein Umschlagslager für Truppen und Nachschubgüter, die Stunde für Stunde die unzähligen Landungsboote ausspuckten. Bis zum Abend waren hier 22 000 Mann und 18 000 Fahrzeuge angelandet worden, die Männer der 4. US-Division weit ins Inland vorgestoßen. An diesem 6. Juni verlor sie nur 197 Männer. Die Landung war hier also geglückt.
Einzig zwei verwegene Küstenbatterien konnten sich noch halten und gaben den Kampf nicht auf: Die Marineküstenbatterie »Marcouf« unter dem 33-jährigen Kapitänleutnant Ohmsen und die Heeresküstenbatterie »Azeville« unter Oberleutnant Kattnig schlugen sich seit fünf Uhr morgens mit der Armada der alliierten Kriegsschiffe herum. Insbesondere die Batterie »Marcouf« war mit ihren drei 21-Zentimeter-Geschützen eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für die Invasionsflotte. Entsprechend groß war das Aufgebot, die Geschütze zum Schweigen zu bringen. Das Schlachtschiff »Nevada« und die Kreuzer »Tuscaloosa« und »Quincy« deckten mit ihren gut liegenden Salven immer wieder das Batteriegelände ein. Ohmsen gelang es, einen US-Zerstörer zu versenken, dann erhielten zwei seiner Geschütze Volltreffer. Gegen sieben Uhr griff ein Bataillon Fallschirmjäger seine Batterie an. Der Granatenbeschuss und der Bombenhagel hatten die Nahverteidigungsstellungen eingeebnet. Verzweifelt wehrten sich die Kanoniere mit einem notdürftig instand gesetzten Flakgeschütz. Unter schweren Verlusten kämpften sich die GIs immer näher an die Kampfstände der Deutschen heran. Dann kam Ohmsen die rettende Idee: Die Nachbarbatterie im nahe gelegenen Azeville war jetzt die letzte Hoffnung. Er gab Oberleutnant Kattnig den Befehl: »Feuer auf die eigene Stellung!« Dieser ließ seine 10,5-Zentimeter-Geschütze sprechen – und sofort ließen die verdutzten Amerikaner Waffen und Ausrüstung liegen und machten sich davon. Noch bis zum 10. Juni konnte Ohmsen seine Stellung halten und mit seinem letzten Geschütz immer wieder den mit Material voll gestopften Utah-Strand unter Beschuss nehmen. Dann schlug er sich mit den Überlebenden zu den deutschen Linien durch. Im Vorfeld der Invasion hatte den Amerikanern eine weitere deutsche Bunkerstellung Kopfzerbrechen bereitet: Hoch oben auf einem Plateau an der Steilküste der Pointe du Hoc befand sich eine Küstenbatterie, die mit ihren 15-Zentimeter-Geschützen den gesamten Omaha-Beach bestreichen konnte und zur tödlichen Gefahr für die Landungsflotte in diesem Abschnitt zu werden drohte. Seit April 1944 wurde die Batterie heftig bombardiert – doch man konnte nicht sicher gehen, die durch meterdicke Betondecken geschützten Kanonen zum Schweigen gebracht zu haben. Ein Bataillon Ranger sollte die Stellung an der Pointe du Hoc am D-Day stürmen und die Gefahr für den Omaha-Beach ausschalten. Als die Elitesoldaten in den Morgenstunden des 6. Juni am Fuß der Steilküste aus ihren Landungsbooten wateten, schlug ihnen ein mörderisches Abwehrfeuer entgegen. Die wochenlangen Bombardierungen und der Feuerorkan aus den Schiffsgeschützen hatten die Verteidiger nicht ausschalten können. Die Ranger versuchten im Hagel der deutschen Geschosse an Seilen und Leitern die Steilküste emporzuklettern. Immer wieder schnitten Deutsche die Taue ab – die Szenerie glich einem mittelalterlichen Kampf um eine Burgfestung. Schließlich gelang es den Angreifern doch, unter schweren Verlusten die Steilküste zu überwinden und das trichterübersäte Gelände der Batterie »Pointe du Hoc« einzunehmen. Als sie endlich die großen Geschützbunker erreicht hatten, mussten sie zu ihrer großen Überraschung feststellen, dass sie leer waren! Die Deutschen hatten bereits nach dem ersten schweren Luftangriff im April 1944 die Geschütze einige Kilometer landeinwärts verlegt. Hier fand sie ein Spähtrupp wenig später. Für die Landungsflotte waren die Kanonen in dieser Stellung keine große Gefahr – Ernüchterung machte sich breit, hatte die Erstürmung doch so viele Opfer gekostet. Obwohl die Alliierten über eine annähernd perfekt arbeitende Feindaufklärung verfügten, die normalerweise aus Luftbildern, aufgefangenen Funksprüchen und Meldungen der Résistance ein sehr genaues Lagebild erstellte, war auch sie nicht vor Fehlern gefeit. Der Fall von Pointe du Hoc ist hierfür nur ein Beispiel. Auch am Omaha-Beach hatte man zu lange daran geglaubt, dass der Landung keine großen Hindernisse im Weg stehen würden – ein schwerer Irrtum, der sich bitter rächen sollte.
Die Deutschen standen auf der Klippe und schössen auf uns an den Seilen. Ich war einer der Ersten, die verwundet wurden. Doch als wir oben ankamen, waren da überhaupt keine großen Geschütze. Unser Geheimdienst war falsch informiert, und wir haben uns da hochgekämpft für nichts und wieder nichts.
Leonard Lomell, US-Ranger an der Pointe du Hoc
Ursprünglich war die gesamte Calvados-Küste von der Vire bis zur Orne-Mündung von der bodenständigen 716. Infanteriedivision verteidigt worden. Sie war einer der schwächsten Einheiten an der ganzen Kanalküste, die aus älteren Soldaten bestand und nur Beutegeschütze und kaum Fahrzeuge besaß. Die knapp 9000 Mann waren für die alliierten Sturmtruppen kein ernst zu nehmender Gegner. Im März 1944 wurde allerdings die gut ausgerüstete, neu aufgestellte 352. Infanteriedivision an die Küste verlegt. Ihre Soldaten waren kampferfahren, jung und besaßen eine hohe Moral. Die Alliierten hatten erst im letzten Moment erkannt, dass der Verband nicht mehr im Hinterland lag, für eine Änderung des Angriffsplans war es da aber bereits zu spät. General Omar Bradley musste auf die Wirkung des Bombardements aus der Luft und von See her vertrauen – die Navy und die Air Force würden die Verteidigungsstellungen auch dieser neuen Division schon ausschalten. Doch all das, was am Utah-Strand gut gegangen war, lief am Omaha-Beach schief. Die Bomber klinkten ihre tödliche Fracht zu spät aus und wühlten nur normannische Wiesen um, statt todbringende deutsche Geschütze und MG-Stellungen auszuschalten. Zu allem Übel wurden auch noch die meisten der Schwimmpanzer viel zu weit vor der Küste ausgesetzt, sodass sie bei dem hohen Seegang leckschlugen und dann wie Steine auf den Meeresgrund sanken. Die erste Welle blieb daher ohne die notwendige Feuerunterstützung und traf auf eine entschlossene Abwehr.
Das war ein Gemetzel, was wir angerichtet haben, ein richtiges Gemetzel. Sie waren ja nicht in Deckung, wir dagegen schon. Es waren arme Leute da unten am Strand.
Bruno Plota, deutscher Soldat am Abschnitt »Omaha-Beach«
Franz Gockel war in der Nacht von den Alarmrufen eines Kameraden geweckt worden. »Wir haben uns umgedreht«, berichtet er. Man habe den Störer ausgeschimpft: »›Lass uns in Ruhe, wir wollen mal schlafen.‹ Es dauerte nicht lange, bis ein Unteroffizier von uns in den Bunker reinkam und brüllte: ›Jetzt wird es aber ernst!‹ Wir haben seine Aufregung gespürt und erst jetzt begriffen, dass es wirklich ernst wurde.« Doch noch konnten Franz Gockel und seine Kameraden im Dunkel der Nacht nichts ausmachen. Erst einige Stunden später ging es los. »Es war ein diesiger Morgen und wir sahen vor uns eine Flotte, die wie eine Wand auf uns zukam. Ein schaurig schöner Anblick, einfach überwältigend. Die Schiffe waren aufgefahren wie zu einer Parade. Man dachte: ›Hier kommst du jetzt nicht mehr weg.‹ Unsere Waffen konnten nicht so weit schießen, unsere Flugzeuge kamen nicht. Niemand konnte diese gewaltige Armada aufhalten. Langsam kam sie näher. Als es dann heller wurde und sie unsere Stellungen an der Küste einsehen konnten, fing die Schiffsartillerie an zu schießen. Zu einem Kameraden murmelte ich: ›Mensch, Siegfried, ein Schiff hat ja mehr Geschütze als wir hier in der ganzen Gegend.‹ Wir hatten den Kriegsschiffen nichts entgegenzusetzen. Die Feuerwalze zielte zunächst auf die Sperren am Strand und kam dann langsam auf uns zu. Als sie unsere Stellungen erreichte, dachte ich nur, das überlebst du nicht. Ich habe laut gebetet und mich im Bunker erst mal ganz klein gemacht, um Schutz vor den Splittern zu haben.«Franz Gockel überstand den Beschuss wohlbehalten. »Mit meiner Waffe war noch alles in Ordnung. Ich musste die Patronengurte sauber machen, weil viel Erde und Holzsplitter im Bunker lagen. Immer wieder sprach ich kurze Stoßgebete. Dann kam ein Kamerad herein und rief: ›Pass auf, jetzt kommen sie!‹«
Die haben sich vorgestellt, das wäre ein Spaziergang. Denn wenn erst einmal die Schiffsartillerie und die Bomber dabei wären, dann würde von unserer Seite kaum mehr Gegenwehr kommen. Aber es war ja dann in Wirklichkeit doch etwas anders für sie.
Hans Heinze, deutscher Offizier
Als die Rampen der Landungsboote herunterklappten, prasselte den amerikanischen Sturmtruppen am Omaha-Beach ein vernichtendes Abwehrfeuer entgegen. Hunderte Soldaten wurden niedergemäht und blieben tot oder verwundet liegen. Franz Lachmann berichtet: »Ich befand mich in einem MG-Stand und konnte gar nicht in das Inferno blicken. Ich habe nur draufgehalten. Als ich einmal über die Brüstung schaute, sah ich nur Leichen, nur Tote. Vom Strand und vom Sand war nichts mehr zu sehen, es war ein einziges Leichenfeld. Es war so grausam, man kann es gar nicht beschreiben.«
Für die überlebenden Amerikaner gab es kaum eine Chance, sich bei dem tödlichen Beschuss zu bewegen. Es herrschte heilloses Durcheinander am Strand, Einheiten waren auseinander gerissen worden, wichtige Ausrüstung war verloren gegangen. Die Pioniere konnten nur wenige Schneisen durch die Vorstrandhindernisse sprengen, um den bei aufkommender Flut nachfolgenden Einheiten den Weg zu bahnen. Am Vormittag sah alles danach aus, als sei die Landung am Omaha-Beach gescheitert. Als Franz Gockel erkannte, dass es den Amerikanern nicht gelingen würde, den Strand zu überwinden, dachte er: »Mensch, wir schaffen es, wir können sie aufhalten, weil keiner bis nach vorne kommt. An die Menschen haben wir nicht gedacht. Wir haben nur gesehen, wir schaffen es doch noch. Jetzt halten wir sie auf.«
Unmittelbar vor dem Strand flog das Landungsboot an unserer Steuerbordseite in die Luft – wahrscheinlich war es auf eine Mine gelaufen. Holz, Metall und Körperteile regneten auf uns herab. Als die Rampe heruntergelassen wurde, war dies das Signal für die Maschinengewehre am Strand, auf unser Boot das Feuer zu eröffnen. Glücklicherweise hatte mein Helm von einer Kugel nur eine Delle abbekommen. Ich stand bis zum Hals im vom Blut meiner Kameraden rot gefärbten Wasser, das Gewehr über meinem Kopf. Die Überlebenden aus meinem Boot wateten langsam durch das Wasser, bekamen schließlich trockenen Sand unter ihre Füße und rannten den Strand hoch.
Harold Baumgarten, US-Soldat am Abschnitt »Omaha-Beach«
Optimistische Nachrichten gingen von den örtlichen Befehlshabern ein, sodass der Kommandeur der 352. Infanteriedivision seine Verstärkungen zu den Brückenköpfen der Briten in Marsch setzte, wo die Lage weit ernster zu sein schien. Das war jedoch ein folgenschwerer Irrtum, wie sich bald herausstellen sollte. Gegen Mittag fuhren amerikanische Zerstörer nämlich dicht an den Strand heran und nahmen die deutschen Widerstandsnester unter direktes Feuer. Beherzt griffen die überlebenden amerikanischen Infanteristen an und es gelang ihnen tatsächlich, an zwei Stellen die deutschen Abwehrstellungen zu durchbrechen. Stellung auf Stellung wurde nun von hinten aufgerollt und am Abend war über die gesamte Länge von Omaha-Beach ein bis zu zwei Kilometer tiefer Brückenkopf gebildet. Doch dieser Erfolg war bitter erkauft worden. An die 1000 Amerikaner fanden am 6. Juni 1944 auf diesem Fleck französischer Steilküste den Tod. Darüber hinaus sind 2000 weitere zum Teil schwer verwundet worden. Nirgendwo hatten die Vereinigten Staaten bei einer Landungsoperation bislang schwerere Verluste erlitten. Und dennoch hatte sich der Einsatz gelohnt: Bis zum späten Abend waren auf dem schmalen Küstenstreifen 34 000 Soldaten an Land gegangen.
An den drei östlichen Abschnitten verlief die Landung weit besser. Die größten Probleme bereitete den Sturmtruppen das dichte Gewirr von verminten Vorstrandhindernissen. Kampfschwimmer waren kurz vor der ersten Welle gelandet und hatten Breschen in den Irrgarten aus verminten Pfählen und stählernen Dreieckskonstruktionen geschlagen. Im hohen Wellengang drifteten die Landungsboote aber oft ab und zerschellten an den Hindernissen. Nachdem der Strand erreicht war, trafen Briten und Kanadier indes auf keinen zusammengefassten Widerstand mehr. Nur noch an einigen wenigen Punkten gab es härtere Kämpfe, wie etwa in Le Harmel oder Courseulles. Meist war die Gegenwehr aber nur schwach, zum Teil gab es gar keine mehr. Die 716. Infanteriedivision konnte dem alliierten Ansturm nicht viel entgegensetzen, zumal die Soldaten der Ostbataillone oft die erstbeste Gelegenheit nutzten, um überzulaufen. Den Briten kam ferner zugute, dass sie ein ganzes Arsenal an Spezialpanzern aufgeboten hatten, um den Atlantikwall zu durchbrechen: Dreschflegelpanzer räumten Gassen durch deutsche Minenfelder, andere schalteten mit ihren großkalibrigen Mörsern Bunkerstellungen aus oder legten Brücken über Panzergräben. Die Amerikaner hatten auf solche Panzer verzichtet und dies mit schweren Verlusten erkauft. Hinzu kam, dass auch die deutsche Küstenartillerie in dieser Region nur schwach ausgebaut war. An der ganzen Küste zwischen Vire und Orne-Mündung gab es nur eine Batterie, die überhaupt in der Lage war, Seeziele zu bekämpfen. Die Marineküstenbatterie Longues kämpfte mit ihren vier 15-Zentimeter-Geschützen einen Kampf wie David gegen Goliath. Wie mögen sich die betagten Männer vorgekommen sein, als sie aus ihren Bunkern auf den Klippen westlich Arromanches diese gewaltige Armada sahen! So waren am Ende des »längsten Tages« ihre Geschütze von feindlichen Geschosssplittern durchsiebt und die meisten Kanoniere tot. Sie hatten den Lauf der Dinge nicht aufhalten können.
Die alliierten Invasionsstreitkräfte haben an der französischen Küste zwischen Le Havre und Cherbourg an mindestens zwei Stellen feste Brückenköpfe errichtet und setzen ihren Vormarsch nach dem Landesinneren fort.
Bekanntgabe aus dem Hauptquartier von General Eisenhower am 6. Juni 1944
Den heftigsten Widerstand im britischen Abschnitt gab es im Sektor »Juno«. Das vorbereitende Artilleriefeuer hatte die deutschen Stellungen nur teilweise oder gar nicht zerstört, zahlreiche Sturmboote fielen den vorgelagerten Riffen und Vorstrandhindernissen zum Opfer. Schließlich gelang es der 3. kanadischen Infanteriedivision aber, die Verteidigungslinien zu durchbrechen und rasch ins Landesinnere vorzustoßen.
Die Briten hatten den schwersten Widerstand ursprünglich im Abschnitt »Sword« erwartet und für die erste Welle bis zu 60 Prozent Verluste einkalkuliert. Als der Dudelsackpfeifer William Millin hier an Land watete, schlug ihm und seinen Kameraden heftiges MG-Feuer entgegen, was ihn freilich nicht daran hinderte, dem Angriff seines Regiments eine archaisch anmutende akustische Begleitung zu geben. Es war ein blutiger Kampf, der aber nur kurz dauerte. Auch hier waren die Verteidiger schnell geworfen, und schon bald winkten einige Franzosen am Strand vergnügt den britischen Soldaten zu und riefen: »Vive les Anglais!« Im Bereich zwischen »Juno« und »Sword« wehrten sich die Reste der 716. Infanteriedivision freilich so heftig, dass die Vereinigung beider Brückenköpfe vorerst nicht gelang und hier eine gefährliche zehn Kilometer breite Lücke klaffte.
Überall in den östlichen Brückenköpfen konnten die Truppen rasch ins Landesinnere vormarschieren. Sie waren guter Dinge, noch vor Mitternacht Bayeux und vor allem Caen einzunehmen, ganz so wie es der Operationsplan vorsah. Jetzt hing alles von möglichen deutschen Gegenangriffen ab. Wann würden die Panzerdivisionen der Wehrmacht und der Waffen-SS, die im Hinterland auf ihren Einsatz warteten, den britischen und kanadischen Truppen entgegentreten?
Mit einem völlig unbeschwerten Lächeln und in der Haltung eines Mannes, der endlich die lang erwartete Gelegenheit zur Abrechnung mit seinem Gegner gefunden hat, näherte er sich den Karten und ließ dabei in einem ungewöhnlich starken österreichischen Dialekt zunächst nur die Worte fallen: »Also – anganga is.«
Walter Warlimont über Hitlers Reaktion auf die alliierte Landung in der Normandie
Die Unentschlossenheit der obersten deutschen Führungsstellen, was die Reaktion auf die teilweise widersprüchlichen Nachrichten aus der Normandie anbelangte, hielt fast den gesamten 6. Juni über an. Hitler schlief auf dem Berghof, als die ersten alliierten Truppen an Land gingen, und niemand wagte es, ihn zu wecken. Die 21. Panzerdivision – sie stand südöstlich von Caen und konnte innerhalb von zwei Stunden zur Stelle sein – wurde noch in der Nacht alarmiert, ebenso die 12. SS-Panzerdivision, die rund 120 Kilometer von der Küste entfernt auf ihren Einsatz wartete. Doch bei der Heeresgruppe B und beim Oberbefehlshaber West konnte man sich auch nach Beginn der Landungsoperation nicht recht entscheiden, was zu tun sei: War dies nur ein Ablenkungsmanöver oder der erwartete Hauptstoß? Alle waren derart darauf fixiert, dass die Alliierten im Pas de Calais landen würden, dass sie an eine Invasion in der Normandie nicht glauben wollten. Bestärkt wurden sie in diesem fatalen Irrglauben durch geschickte feindliche Täuschungsoperationen. Die Richtlinie hieß: abwarten, bis sich die Lage klärt. Doch den Deutschen lief die Zeit davon – kostbare Zeit, denn die Landungstruppen hatten sich noch nicht formiert und ihre Schwächeperiode noch nicht überwunden. In den ersten Stunden nach den Landungen verlief selbst in den britischen Abschnitten noch vieles chaotisch, hatten sich die Verbände noch nicht geordnet. Doch das Oberkommando der Wehrmacht ließ die bereits in Marsch gesetzte 12. SS-Panzerdivision morgens um sieben Uhr wieder anhalten. Erst gegen 14.00 Uhr wurde sie für den Einsatz freigegeben, viel zu spät, um an diesem Tag noch die Front zu erreichen. So hing alles an der 21. Panzerdivision, die dem Geschehen am nächsten war und die bereits am Vormittag in Kämpfe mit Luftlandetruppen verwickelt wurde. Stunde um Stunde verging, ohne dass die Führung irgendeinen klaren Befehl gab. Erst am Nachmittag rollten die Panzer los, um den britischen Brückenkopf einzudrücken. Panzergrenadiere der Division schafften es, die noch dünnen Linien zu durchbrechen und bis zur Küste durchzustoßen. In Luc-sur-Mer starrten sie gebannt auf die mächtige Invasionsflotte und warteten auf ihre Panzer. Diese kamen allerdings nicht. Britische Panzerabwehrkanonen hatten sich auf strategisch wichtigen Höhen vor Caen eingenistet und den Angriff des Panzerregiments der 21. Panzerdivision zusammengeschossen. In der Nacht mussten sich dann auch die Grenadiere von der Küste zurückziehen – der erste deutsche Gegenangriff war gescheitert, weil er viel zu spät angesetzt worden war. Einzig konnte man verbuchen, dass auch der britische Vormarsch auf Caen zunächst gestoppt war. Die nächsten Tage würden zeigen, wer schneller in der Lage sein würde, Nachschub und Truppen an die Front zu bringen, um auf dem Schlachtfeld der Normandie die Oberhand zu behalten. Als sich der 6. Juni 1944 dem Ende zuneigte, standen bereits alle Chancen gegen die Deutschen. Hitler gab am Abend dieses denkwürdigen Tages den Befehl: »Hier gibt es kein Ausweichen und Operieren, hier gilt es zu stehen, zu halten oder zu sterben.«
Hochtrabende Worte vermochten dem ungleichen Kampf freilich keine Wendung mehr zu geben. Bereits in den ersten Tagen nach der Landung zeigte sich, dass die Wehrmacht nicht in der Lage war, den ständigen Strom von Nachschubgütern über den Kanal auch nur annähernd zu stören. Wo war die Marine, wo war die Luftwaffe, dachten viele Landser, die sich einer täglich größer werdenden Übermacht zu erwehren hatten. Auf dem Wasser konnte man den Alliierten im fünften Kriegsjahr fast nichts mehr entgegensetzen: Eine Hand voll Torpedoboote, Schnellboote und U-Boote versuchte in todesmutigen Einsätzen immer wieder, feindliche Transporter zu attackieren. Doch meist wurden sie schon nach dem Verlassen des Hafens von alliierten Schiffen und Flugzeugen unter Beschuss genommen – von Glück konnte reden, wer überhaupt in die Nähe des Dampferwegs von Südengland in die Seine-Bucht gelangte. Ein paar verwegene Kommandanten schafften es tatsächlich, einige Schiffe zu versenken – auf die Kämpfe an Land hatte dies freilich keinerlei Auswirkungen.
Am 6. Juni morgens rief General Speidel bei uns zu Hause an und teilte meinem Vater mit, dass eine große Unruhe an der Küste sei, man höre Maschinengewehrfeuer, aber man wisse noch nicht genau, ob die Invasion stattgefunden hätte. Mein Vater entschied sich, noch abzuwarten. Nach einer Stunde rief Speidel erneut an, und da hieß es: »Jawohl, sie sind gelandet.« Mein Vater ist daraufhin sofort abgereist.
Manfred Rommel, Sohn Erwin Rommels
In ihrer Ohnmacht griff die Kriegsmarine schließlich zu ganz abenteuerlichen Kampfmitteln: Einmanntorpedos, die »Neger« genannt wurden, sollten nun den ersehnten Erfolg bringen. Die Operationen mit diesen technisch nicht ausgereiften Geräten glichen regelrechten Kamikazeeinsätzen: Nur wenige der Männer kehrten von ihnen zurück. Erfolge gab es kaum – lediglich der Oberfähnrich Potthast schaffte es am 7. Juli durch einen Zufall, den polnischen Kreuzer »Dragon« zu versenken. Der Luftwaffe erging es nicht viel besser: Die 500 Flugzeuge der Luftflotte 3 hatten gegen eine 20-fache Übermacht anzukämpfen, sie wurden bereits nach dem Start in Luftkämpfe verwickelt und abgeschossen. Am 6. Juni 1944 flog die deutsche Luftwaffe ganze 319 Einsätze, die Alliierten brachten es im Vergleich auf knapp 15 000! Die Luftwaffenführung hatte seit langem den Fall »Drohende Gefahr West« vorbereitet. Bei einer feindlichen Invasion in Frankreich wollte man schlagartig die kampfstarken Jagdverbände aus dem Reich in den Westen verlegen und den eigenen Truppen Luftsicherung geben. Doch die Operation wurde einer der größten Fehlschläge der Luftwaffe: Überall in Frankreich hatten die Alliierten die vorgeschobenen Feldflugplätze zerbombt, und bei den widrigen Wetterbedingungen verflogen sich zahlreiche der schlecht ausgebildeten jungen Piloten und machten Bruchlandungen. Die Landser waren bei ihrem Abwehrkampf also gleichsam ohne Dach. Einzig in den Nächten überflogen deutsche Bomberverbände die Seine-Bucht und warfen Minen ab, die den Schiffsverkehr zwar behinderten, nicht aber unterbinden konnten.
In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Eingeleitet durch schwere Luftangriffe auf unsere Küstenbefestigungen, setzte er an mehreren Stellen der nordfranzösischen Küste zwischen Le Havre und Cherbourg Luftlandetruppen ab und landete gleichzeitig, unterstützt durch starke Seestreitkräfte, auch von See her. In dem angegriffenen Küstenstreifen sind erbitterte Kämpfe im Gang.
Bekanntgabe des Oberkommandos der Wehrmacht am 6. Juni 1944
Für die Alliierten blieb die Frage des Nachschubs aber dennoch ein Problem. Sie waren ganz bewusst an Küstenabschnitten abseits der gut gesicherten großen Häfen Cherbourg und Le Havre gelandet. Die gesamte Versorgung ihrer hoch technisierten Armee musste also über die Strände abgewickelt werden. Um dieses Nadelöhr zu umgehen, hatte man sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Wenn keine leistungsfähigen Häfen an der Calvados-Küste vorhanden waren, dann würde man eben welche bauen! In Windeseile entstanden vor Arromanches und Vierville künstliche Häfen, die so genannten »Mulberries«. Ausgediente Schiffe wurden als riesige Wellenbrecher vor der Küste versenkt, vorgefertigte Pontons über den Kanal geschleppt und zu Kaimauern zusammengefügt. Es dauerte nicht lange und die ersten Frachter konnten in den beiden Mulberries entladen werden. Viel stärker als die Deutschen behinderte das Wetter den steten Fluss an Menschen und Material. Zwischen dem 19. und 23. Juni fegte ein orkanartiger Sturm durch den Ärmelkanal, der den Nachschubverkehr sozusagen zum Erliegen brachte. Und damit nicht genug: Die Mulberries waren der Gewalt der haushohen Brecher nicht gewachsen. Stück für Stück wurden die kunstvollen Konstruktionen vom Meer zerschlagen. Der Mulberry am Omaha-Beach wurde irreparabel zerstört, jener in Arromanches sehr schwer beschädigt. Auch die Eroberung von Cherbourg – am 30. Juni stellten die letzten Widerstandsnester den Kampf ein – brachte keine wirkliche Erleichterung: Der Hafenkommandant, Fregattenkapitän Witt, hatte die Kaianlagen in die Luft jagen und die Einfahrten verblocken lassen, bevor er dann in Gefangenschaft ging. Für die Kämpfe in der Normandie sollte Cherbourg nun keine Rolle mehr spielen. Bis Ende August 1944 musste die Masse des alliierten Nachschubs über die Strände abgewickelt werden. Dass Munition, Betriebsstoff und Verpflegung dennoch niemals knapp wurden, ist wahrhaft eine logistische Meisterleistung gewesen.
Ich erwarte von Ihnen, dass Sie den Kampf führen wie einst Gneisenau die Verteidigung Kolbergs.
Adolf Hitler am 21. Juni 1944 an den Festungskommandanten von Cherbourg, General v. Schlieben
Sie haben uns nicht gesehen. Wir haben Jagd auf Menschen gemacht. Wir haben Soldaten erschossen, in Lastwagen, in Kolonnen, in Zügen. Sie können sich nicht vorstellen, was Bordkanonen anrichten, wenn sie in Menschenmengen feuern. Ich habe noch heute Alpträume.
Charles Mohrle, Pilot eines US-Jagdflugzeugs
Ganz anders gestaltete sich die Lage bei den Deutschen: Hunderte von alliierten Jagdbombern suchten jeden Tag die Landstraßen der Normandie nach deutschen Nachschubkolonnen ab und stürzten sich auf alles, was sich bewegte. Die Panzer-Lehr-Division verlor auf ihrem 180 Kilometer langen Marsch an die Front allein 180 Fahrzeuge. Außerdem machte sich jetzt auch die Résistance bemerkbar. Schlagartig flackerte überall in Frankreich der Widerstand auf, zahllose Brücken, Gleisanlagen und Telefonmasten wurden gesprengt. Gewiss waren diese Aktionen nicht kriegsentscheidend, aber sie behinderten die Bewegungen hinter der Front spürbar. Entsprechend hart waren auch die Reaktionen. Auch Frankreich erlebte nun die Schrecken des Partisanenkriegs – unter dem vor allem die unbeteiligte Zivilbevölkerung zu leiden hatte. Teile der SS-Division »Das Reich« verfielen hierbei in einen exzessartigen Rausch. In Oradour tötete eine Kompanie 642 Einwohner – Männer, Frauen und Kinder –, sodass selbst die übergeordnete Dienststelle scharf protestierte. Es sei von der Truppe in unverantwortlicher Weise geplündert, geschändet und zerstört worden. »Dieses schamlose Verhalten spricht dem alten Ruf des ehrlich und sauber kämpfenden deutschen Soldaten Hohn«, hieß es in einem Abschlussbericht. Rundstedt und Rommel wollten von Anfang an in einem mächtigen Panzerangriff den alliierten Brückenkopf spalten und zerschlagen. Doch die großen Verzögerungen beim Antransport der Panzerdivisionen und die fast schon krankhafte Fixierung auf eine immer noch für möglich gehaltene zweite Landung im Pas de Calais verhinderten, dass jemals ein solch kraftvoller Gegenstoß unternommen werden konnte. Die Einheiten mussten in vorderster Front eingesetzt werden, sobald sie in der Normandie eingetroffen waren. Alle Angriffe, die man mit sehr viel Mühe und Not trotzdem durchführen konnte, blieben im undurchdringlichen Abwehrfeuer der Schiffsartillerie liegen. Und hier offenbarte sich etwas, was bereits bei den Landungen in Salerno und Anzio deutlich geworden war: Die Deutschen konnten machen, was sie wollten, gegen die todbringenden Salven der Schlachtschiffe und Kreuzer, die vor der Calvados-Küste kreuzten, waren auch ihre Tiger- und Panther-Panzer machtlos.
Wir müssen alle überhaupt nur verfügbaren oder entbehrlichen Kräfte und Kriegsmittel so heranführen, dass wenigstens in der Normandie eine Front entsteht, die zusammenhängt und vom Feind nicht ohne weiteres durchbrochen werden kann. Ich muss darauf hinweisen, dass bei diesem Missverhältnis an Material eine Lage entstehen könnte, die zu grundsätzlichen Entschlüssen zwingt. Das wäre der Fall, wenn es dem Feinde etwa gelänge, mit starken Panzerkräften, unterstützt durch weit überlegene Luftwaffen, einen wirklichen Durchbruch nach Süden zu erzielen.
Feldmarschall Gerd von Rundstedt am 11. Juni 1944
Am 11. Juni 1944 hatten sich nach schweren Kämpfen die Landeköpfe vereint und eine einheitliche Frontlinie war entstanden. Die Halbinsel Cotentin fiel mit dem Hafen Cherbourg zwei Wochen später. Bald ging es aber nur noch schrittweise vorwärts, verbissen verteidigten die Deutschen jeden Meter Boden. Insbesondere im Abschnitt der Amerikaner, im Westen der Normandie, behinderte die wild wuchernde Heckenlandschaft ein schnelles Vorwärtskommen. Die Amerikaner mussten hier leidvoll erfahren, dass viele deutsche Einheiten erbitterten Widerstand leisteten. Die US-Panzer konnten sich nicht voll entfalten und wurden ein leichtes Opfer für die Panzerfaust. Am Ausgang des Kampfes konnte es freilich auch hier keinen Zweifel geben – es war lediglich die Frage, wie lange die Amerikaner aufgehalten werden würden. Auf deutscher Seite waren die Verluste in dem hartnäckigen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner enorm. Rolf de Boeser erinnert sich: »Ich habe manchmal im Graben gelegen und Ameisen oder Käfer betrachtet. Da dachte ich, die Käfer, die können sich in die Erde eingraben, verschwinden von der Bildfläche. Wir können das nicht. Unser ganzes Regiment ist aufgerieben worden, von den Kameraden war kaum einer mehr da. Wenn wieder einer von ihnen fiel, war es, als ob ein Bruder stirbt. Man war zusammen in Ausbildung gewesen, man hatte Freud und Leid geteilt. Als es morgens hell wurde, haben wir immer gedacht, wer ist der Nächste? Und ich habe ehrlich gedacht, wenn du jetzt eine Handgranate nimmst und hältst sie dir an den Kopf, dann hast du es hinter dir.«
Die Truppen aller Wehrmachtteile schlagen sich mit größter Verbissenheit und äußerster Einsatzbereitschaft trotz des ungeheuren Materialaufwandes des Feindes.
Feldmarschall Erwin Rommel am 11. Juni 1944
Der Kampfschwerpunkt in der Normandie lag indes im Osten, bei Caen. Eigentlich hatte der Union Jack schon am 6. Juni auf dem Kirchturm wehen sollen, beherzte deutsche Gegenangriffe machten den Briten aber einen Strich durch die Rechnung. Feldmarschall Montgomery gedachte einfach, mit seiner Materialüberlegenheit die deutschen Verteidiger gleichsam zu zerquetschen. Doch die Feuerwalzen von hunderten von Geschützen und die Bombenteppiche von ebenso vielen schweren Bombern brachten keine entscheidenden Erfolge. Nirgends konnte die deutsche Front aufgerissen werden, überall trafen die eigenen Vorstöße auf heftigen deutschen Widerstand und sahen sich wütenden Gegenangriffen ausgesetzt. Doch die Alliierten konnten ihre Verluste – bis Ende Juli 1944 rund 120 000 Mann – problemlos ersetzen. Die deutschen Divisionen hingegen bekamen keinen Ersatz. Sie brannten bis zur Schlacke aus, waren bald nur noch ein Schatten ihrer selbst. 117 000 Mann waren bis zum 22. Juli auf deutscher Seite gefallen, verwundet oder in Gefangenschaft geraten – jeden Tag 1500. Rommel wusste, dass die Front nicht mehr lange gehalten werden konnte. So schrieb er am 15. Juli 1944 in seiner Lagebetrachtung: »Die Truppe kämpft allerorts heldenmütig, jedoch der ungleiche Kampf neigt dem Ende entgegen. Es ist m. E. nötig, die (politischen) Folgerungen aus dieser Lage zu ziehen.« Das »politisch« strich er auf Anraten seiner Stabsoffiziere noch aus dem Bericht, um Hitler nicht unnötig zu provozieren. Diese Formulierung verdeutlicht freilich, dass Rommel einsah, dass der Krieg nun endgültig verloren war. Zwei Tage später wurde er bei einem Tieffliegerangriff schwer verwundet, wenige Tage später fiel Caen endgültig in britische Hand. Der Vormarsch konnte hier mit letzter Kraft noch einmal zum Stehen gebracht werden. Während die besten deutschen Divisionen Caen verteidigten, gelang es den Amerikanern weiter im Westen bei St. Lô, die deutschen Linien zu durchbrechen: 1500 viermotorige Bomber hatten einen vernichtenden Bombenteppich niedergehen lassen, der alle Verteidigungsstellungen zermalmte. Amerikanische Panzer stießen nun rasch ins Landesinnere vor. Dies war die Wende im Kampf um die Normandie.
Es wird gehalten und wenn kein Aushilfsmittel unsere Lage grundsätzlich verbessert, muss anständig auf dem Schlachtfeld gestorben werden!
Feldmarschall Hans Günther von Kluge zu seinen Offizieren Mitte Juli 1944
Am 31. Juli 1944 hatten die US-Truppen Avranches besetzt. Jetzt gab es kein Halten mehr: Die Front brach zusammen, fluchtartig strömten die abgekämpften Verbände nach Osten. Im Kessel von Falaise machten die Alliierten zwei Wochen später 50 000 Gefangene und eilten nun unaufhaltsam vorwärts – in Richtung Seine und Paris.