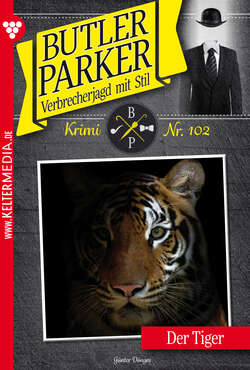Читать книгу Butler Parker 102 – Kriminalroman - Gunter Donges - Страница 3
Оглавление»Sie sind ein Flegel!« stellte Lady Agatha Simpson grollend fest und langte gleichzeitig sehr herzhaft mit ihrem Pompadour zu.
Der kräftige, breitschultrige Mann, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, hatte sie eben gnadenlos zur Seite gedrängt und ihr dabei ein kleines Paket aus der Hand geschlagen.
Dafür hatte Mylady sich revanchiert.
Der »Glücksbringer« im perlenbestickten Handbeutel enthielt ein leicht überschweres Hufeisen, das mal für ein stämmiges Brauereipferd gedacht war. Entsprechend war die Wirkung.
Der breitschultrige Mann war bereits in die Knie gegangen und hielt sich mit letzter Kraft an der Stange jenes Baldachins fest, der den Weg vom Hoteleingang bis zum Straßenrand überspannte. Seine Augen waren verglast. Er stierte auf die kriegerische ältere Dame, die ihn bereits vergessen zu haben schien. Sie nickte ihrer Begleiterin zu, die sich um das zu Boden gefallene Paket kümmerte, es aufhob und der passionierten Detektivin reichte. »Natürlich in Scherben, wie?« fragte Agatha Simpson verärgert.
»Ich fürchte, ja, Mylady«, erwiderte die attraktive junge Dame, die nur wenig über zwanzig sein mochte.
»Lümmel!« Lady Agatha Simpson marschierte auf äußerst stämmigen Beinen auf den jungen Mann zu, der schutzsuchend seinen linken Unterarm vors Gesicht hob. Er zog sich jetzt hoch, baute sich auf und schüttelte benommen den Kopf. Dazu massierte er mechanisch seine linke Kinnlade, die von Myladys Glücksbringer voll getroffen worden war.
»Sie werden mir Ersatz leisten«, stellte Agatha Simpson fest, worauf der kräftige junge Mann mit dem etwas dümmlichen Gesicht sich hilfesuchend nach dem Rolls-Royce umsah, der am Straßenrand parkte. Er wußte offensichtlich nicht, wie er sich verhalten sollte.
Vor dem Rolls-Royce stand ein zweiter Mann, fast eine Zwillingsausgabe des ersten. Das Gesicht dieses Mannes wirkte höchstens noch dümmlicher. Seine rechte Hand war unter dem linken Revers des Jacketts verschwunden und beulte den Stoff aus. Liebhaber von Kriminalfilmen hätten sofort gewußt, daß diese Finger den Griff einer Schußwaffe umspannte.
Ein dritter Mann stand hinter dem Rolls-Royce und beobachtete die gegenüberliegende Straßenseite. Seine rechte Hand war erstaunlicherweise ebenfalls unter dem linken Revers seines Jacketts verschwunden.
»Äußern Sie sich!« herrschte Agatha Simpson den jungen Mann an, den sie Lümmel und Flegel genannt hatte. Sie hielt ihm das Paket so abrupt, unter die Nase, daß der Mann zusammenzuckte. Er befürchtete offensichtlich, die kriegerische Dame würde ihm das kleine Paket auf die Nasenspitze setzen.
»Wieviel hat das Gerümpel denn gekostet?« schnarrte in diesem Moment eine herrische Stimme aus dem Rolls-Royce. Dieses unangenehme Organ gehörte einem untersetzten, kompakten Mann von etwa fünfzig Jahren. Er saß im Fond des Wagens und trug eine Sonnenbrille, die er abnahm. Der Mann hatte ein grobes Gesicht und kalte stechende Augen.
Agatha Simpson trat an das geöffnete Fenster des hochherrschaftlichen Fahrzeugs.
»Das Gerümpel hat rund fünfzig Pfund gekostet«, sagte sie mit ihrer baritonal gefärbten, weittragenden Stimme.
Der Mann im Rolls-Royce lächelte dünn und abfällig.
Er mußte Lady Agatha einfach falsch verstehen.
Sie trug eines ihrer üblichen, sehr weit geschnittenen und faltenreichen Kostüme. Ihre Füße steckten in ausgetreten wirkenden, einfachen Schuhen. Agatha Simpson, immens vermögend, erinnerte tatsächlich ein wenig an eine einfache Frau aus dem Volk, die so spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist.
»Fünfzig Pfund!« Der Mann im Rolls-Royce zückte bereits die Brieftasche und entnahm ihr eine Banknote, die er an den Jungen weiterreichte, der sich noch immer die Kinnlade massierte.
»Schicken Sie sie weg, Artie! Ich will nicht länger belästigt werden …«
Der Mann, der Artie hieß, beeilte sich, Mylady die Banknote in die Hand zu drücken. Dabei schielte er aber sicherheitshalber nach dem Pompadour an ihrem Handgelenk. »Hauen Sie ab, Mädchen«, sagte er und trat vorsichtshalber einen Schritt zurück. »Kaufen Sie sich etwas Hübsches!«
Lady Agatha Simpson erstarrte.
Es war geradezu empörend, wie Sie sie behandelte. Ein wenig verdutzt sah sie auf die Banknote. Es handelte sich um eine Fünfpfundnote.
Der junge Mann bestieg bereits hastig den Wagen und nahm neben dem Fahrer Platz. Die beiden anderen Männer verdrückten sich nach hinten zu dem Mann, der die Sonnenbrille wieder aufgesetzt hatte. Der Rolls-Royce fuhr an.
»Das ist doch eine ausgemachte Frechheit!« Lady Agathas Stimme grollte.
»Ich habe mir das Kennzeichen des Wagens eingeprägt«, sagte die junge attraktive Begleiterin. Sie hieß Kathy Porter, war Myladys Gesellschafterin und erinnerte ein wenig an ein scheues, empfindsames Reh. »Worum ich auch gebeten haben möchte«, antwortete Lady Agatha. »Wo steckt denn Mister Parker? Immer, wenn man ihn mal wirklich braucht, ist er nicht zur Stelle …«
*
Nachdem Mike Rander, der junge, erfolgreiche Anwalt, sich notgedrungen in seine Londoner Anwaltskanzlei zurückgezogen hatte, um der vielen Fälle einfach Herr zu werden, war Josuah Parker in die Dienste von Lady Agatha Simpson getreten.
Widerwillig, wie korrekterweise gesagt werden muß.
Jahrelang war Parker zusammen mit seinem jungen Herrn durch die Welt gezogen und hatte teilweise haarsträubende Kriminalabenteuer erlebt. Dies alles war aber nichts gegen die Zwischenfälle, die Lady Agatha förmlich provozierte.
Die streitbare Dame, so um die sechzig Jahre alt, stand mit beiden Beinen im Leben. Nach dem Tod ihres Mannes, des Lord John Simpson, war sie die Alleinerbin eines riesigen Vermögens geworden. Sie besaß hochkarätige Anteile an Brauereien, Fabriken, Werften und Reedereien. Lady Agatha war mit dem Hoch- und Geldadel Englands eng verschwistert und verschwägert. Man schätzte und fürchtete sie gleichzeitig. Als Detektivin war sie geradezu berüchtigt, was ihr ungeniertes Benehmen anbetraf. Sie konnte fluchen wie ein Fuhrknecht, ordinär sein wie die Wirtin einer Kaschemme oder eine unnahbare herzogliche Würde verbreiten, die lähmend wirkte.
Lady Agatha hatte ihre Vermögensanteile in eine Stiftung umgewandelt, aus deren Erlös begabte junge Menschen kostenlos studieren konnten. Als Realistin hatte sie selbstverständlich ihre persönlichen Belange nicht vergessen. Sie verfügte über das Geld, um das zu tun, was sie zu tun wünschte.
Parker stand also seit einiger Zeit in ihren Diensten und hatte seitdem Hochbetrieb, um Mylady vor Schaden zu bewahren. Sie ging keinem Ärger aus dem Weg und hatte die seltsame Gabe, immer wieder auf interessante Kriminalfälle zu stoßen. Sie war Amateurdetektivin aus Leidenschaft, die einfach nicht zu bremsen war.
Als Lady Agatha zurück ins Hotel kam, sah der Butler sofort, daß sich wieder mal ein peinlicher Zwischenfall ereignet hatte.
»Sie sehen mich empört«, stellte Lady Simpson fest und nahm ihren unmöglichen Kapotthut ab.
»Mylady werden dafür Gründe haben«, gab der Butler vorsichtig und abwartend zurück.
»Ich bestehe darauf, daß Sie diese Flegel zur Ordnung rufen«, grollte sie.
»Wie Mylady befehlen.« Parker blieb reserviert.
»Es geht mir nicht um das Geld«, erklärte Lady Agatha. »Es sind die schlechten Manieren, die mich ärgern.«
»Könnten Mylady vielleicht mit Einzelheiten dienen?« erkundigte sich Parker gemessen.
»Zuerst brauche ich eine Erfrischung«, verlangte Agatha Simpson und ließ sich in einem Sessel nieder.
»Ich werde sofort Tee kommen lassen«, versprach der Butler.
»Tee! Ich brauche eine Erfrischung …«
Josuah Parker hatte verstanden.
Würdevoll und gemessen begab er sich hinüber zu dem Wandtisch, wo Flaschen und Gläser standen. Er füllte ein Glas mit Whisky und servierte es auf einem Silbertablett.
»Das ist es, Mister Parker!« Sie nickte beifällig und nahm einen mehr als herzhaften Schluck. Dann strahlte sie ihren Butler aus funkelnden, unternehmungslustigen Augen an. »Ein zumindest eigenartiges Individuum, das mir da begegnet ist … Was sagen Sie dazu, Kindchen?«
Lady Agatha drehte sich zu Kathy Porter um, die das kleine Paket auspackte.
»Ich glaube, Mylady, daß die drei jungen Männer Schußwaffen trugen«, erklärte Kathy Porter. »Sie schienen eine Art Leibwache zu sein.«
»Das finde ich auch!« Agatha Simpson nickte bestätigend und erfreut.
»Vielleicht haben Mylady sich nur getäuscht.«
»Kathy und ich haben doch Augen im Kopf«, grollte die Detektivin. »Sie wollen diese Geschichte doch nur wieder herunterspielen, Mister Parker. Ich kenne Ihre Methode.«
»Die Vase ist zerbrochen«, meldete Kathy Porter, die das kleine Paket geöffnet hatte. Sie hielt einige Scherben hoch, die zu einer Jugendstilvase gehörten.
»Dieser Flegel behandelte mich wie eine Bettlerin«, ärgerte sich Lady Agatha. »Ich glaube, ich werde Sie zu diesem Individuum begleiten. Sie könnten sonst vielleicht etwas zu höflich sein.«
»Mylady bestehen darauf?« Parkers Gesicht blieb maskenhaft unbeweglich.
Innerlich gestattete er sich jedoch ein leichtes Beben. Er wußte schon jetzt ganz genau, was auf ihn zukam. Mylady konnte ausgesprochen aggressiv werden, wenn man ihr zu nahe trat. Und dies war hier schließlich der Fall gewesen.
»Ich weiß, daß Ihnen mein Vorschlag nicht gefällt, Mister Parker«, stellte Agatha Simpson wegwerfend fest, »aber das stört mich überhaupt nicht. Ich werde mitkommen! Mit Höflichkeit allein erreicht man bei diesen Flegeln selten etwas …«
*
Josuah Parker stoppte sein hochbeiniges Monstrum und stieg aus dem Wagen. Er öffnete die hintere Tür und lüftete respektvoll seine schwarze Melone.
Das Fahrtziel war erreicht.
Leider war es eine Kleinigkeit gewesen, den Besitzer des Rolls-Royce ausfindig zu machen. Er hieß Stephan Waters und wohnte ganz eindeutig in dem turm- und zinnenbewehrten Castle, das über eine Hängebrücke zu erreichen war.
Das Castle aus alter Zeit befand sich in tadellosem Zustand. Die Renovierung mußte ein kleines Vermögen gekostet haben. Die Trossen der Zugbrücke waren schneeweiß gestrichen. Diese Farbe harmonierte sehr gut mit dem ehrwürdigen Gemäuer, das auf der abgeflachten Kuppe einer Art Felsnadel stand. Nur diese Hängebrücke allein gab den Zugang zum Castle frei. Die Flanken der Felsnadel waren steil und nur von Hochalpinisten mit entsprechender Ausrüstung zu besteigen.
Hinter dem Schloß, das mehr einer alten Festung glich, war die breite, bayartige Mündung des Fal zu sehen, eines an sich kleinen Flusses, der sich dann bei Falmouth in den Atlantik ergoß. Man befand sich, um die Beschreibung abzurunden, im Süden Cornwalls in England, einem Landstrich, der fast mittelmeerähnlichen Charakter aufwies.
»Ein beneidenswert schönes Castle«, sagte Agatha Simpson, »ich möchte nur wissen, wie dieser Lümmel an dieses Schloß gekommen ist. Nun, ich werde ihn danach fragen, Mister Parker. Fahren wir weiter.«
Butler Parker sah keine Möglichkeit, Myladys Wunsch zu torpedieren. Nachdem Agatha Simpson zurück in den Fond des hochbeinigen Wagens gestiegen war, setzte sich Parker an das Steuer des ehemaligen Londoner Taxis, das nach seinen speziellen Wünschen gründlich umgebaut worden war. Dieser Wagen war eine technische Überraschung auf Rädern und zeichnete sich vor allen Dingen durch einen sehr leistungsstarken Motor aus.
Josuah Parker wußte mehr als Lady Simpson. Er besaß bereits einige Informationen über diesen Stephan Waters und hütete sich bisher, ihr davon Mitteilung zu machen. Der Besitzer des Castle war eine sehr dubiose Gestalt, die vor Jahren in der Unterwelt von London eine gewichtige Rolle gespielt hatte. Wie gesagt, davon hatte Parker seiner energischen Herrin nichts gesagt und hoffte inständig, daß sie ahnungslos blieb.
Der Weg von der sanften Bergkuppe hinunter zur Hängebrücke war schmal, aber gut gepflegt. Vor der Hängebrücke gab es eine Art Vorburg, deren Fallgitter hochgezogen war. Parker steuerte sein hochbeiniges Monstrum durch den Torbogen und mußte dann anhalten. Ein starkes Gitter versperrte die Fahrt über die Hängebrücke hinüber zum eigentlichen Schloß.
Bevor Josuah Parker sich nach einem geeigneten Meldemittel umsehen konnte, erschien ein junger Mann mit dümmlichem Gesicht. Es war der Zwilling jenes Mannes, der Myladys »Glücksbringer« ausgiebig gekostet hatte.
»Lady Simpson wünscht Mr. Stephan Waters zu sprechen«, sagte Parker, der ausgestiegen war. Mit einem einzigen prüfenden Blick hatte der Butler den Mann abtaxiert. Er sah sofort, daß er es mit einem Profi aus der Unterwelt zu tun hatte. Die Dümmlichkeit war nichts als Tarnung. Hinter dem schafsmäßigen Aussehen verbargen sich Härte und Brutalität.
»Lady Simpson?« Der junge Mann trat an den Wagen und sah sich Parkers Herrin sehr ungeniert an. Er grinste, als er Kathy Porter entdeckte.
Agatha Simpson blickte durch den jungen Mann hindurch. Er existierte für sie überhaupt nicht.
»Und warum will sie ihn sprechen?« erkundigte sich der junge Mann, der zu Parker zurückgekommen war.
»Rufen Sie Mr. Waters an«, erwiderte Parker. »Melden Sie Lady Simpson!«
Parker deutete auf die geöffnete Tür in einem Wachtturm. Das Telefon an der Wand war deutlich zu sehen. Er sprach in einem Ton, daß der junge Mann darauf verzichtete, weitere Fragen zu stellen, in den Rundturm ging und telefonierte.
Nach knapp einer Minute kam er zurück und grinste unverhohlen.
»Ihre Lady soll sich zum Teufel scheren«, sagte er, »genau das soll ich bestellen. Mr. Waters empfängt keinen Besuch!«
»Ich fürchte, Mylady wird diese Auskunft nicht günstig aufnehmen«, prophezeite der Butler. Er kannte doch seine Herrin. Widerstand reizte sie nur, um besonders aktiv zu werden.
»Danke, Sie brauchen mir nichts zu sagen«, meinte Lady Agatha, als er an den hinteren Wagenschlag trat. »Ich habe alles gehört, Mister Parker.«
»Ich möchte betonen, Mylady, daß ich bestürzt bin«, erklärte der Butler gemessen.
»Im Grunde war von diesem ausgedienten Gangster nicht mehr zu erwarten.«
»Mylady wissen?« Parker war überrascht. Er wußte zwar nicht, woher sie ihr Wissen hatte, aber darauf kam es auch gar nicht an. Er sah das angeregte Funkeln in ihren dunklen Augen und spürte, daß gewisse Dinge wieder mal ihren Lauf nahmen.
*
Sie waren nach Falmouth zurückgekehrt und befanden sich wieder im Hotel.
Während der Rückfahrt verharrte Agatha Simpson in Schweigen. Parker fürchtete, seine Herrin könnte über gewisse Vergeltungsmaßnahmen brüten. Eine Lady Agatha Simpson war nicht die Frau, die eine Beleidigung ohne weiteres einsteckte. Sie pflegte sich stets nachdrücklich zu revanchieren.
»Darf ich mir erlauben, daran zu erinnern, daß Mylady morgen in London erwartet wird?« sagte Parker.
»Wir bleiben!«
»Haben Mylady besondere Pläne?«
»Dumme Frage, Mister Parker! Das wissen Sie doch längst! Wir werden es diesem Subjekt zeigen.«
»Mylady sollten daran denken, daß man es mit einem Gangster zu tun hat.«
»Einem ausgedienten, Mister Parker. Auch ich habe so meine Informanten in London. Nicht nur Sie!«
»Mylady mögen meine Diskretion verzeihen«, entschuldigte sich der Butler würdevoll.
»Reden wir davon, wie wir es diesem Lümmel zeigen könnten, Mister Parker. Das ist unser Thema! Was wissen Sie über diesen Waters?«
»Stephan Waters, vierundfünfzig Jahre alt, geboren in Liverpool, zuerst Gelegenheitsarbeiter, dann Zuhälter, erste Kontakte mit den Gerichten, einige unerhebliche Geldstrafen wegen Körperverletzung, dann übergewechselt nach London und hier im Rauschgiftgeschäft tätig gewesen. Die Behörden sahen sich außerstande, Stephan Waters je etwas nachzuweisen. In eingeweihten Kreisen war seine Brutalität sprichwörtlich. Er soll einige Konkurrenten mittels Mord aus dem Weg geräumt haben. Nachzuweisen war ihm nichts. Er blieb unbehelligt. Stephan Waters hat sich vor etwa drei Jahren aus seinen Geschäften zurückgezogen und privatisiert, wenn ich es so ausdrücken darf.«
»Warum ist dieses Subjekt ausgestiegen, wie Sie sich ausdrückten?«
»Mister Waters geriet in Streit mit amerikanischen Syndikats Vertretern, die ihre Rauschgiftgeschäfte auch auf England ausdehnen wollten. Er soll, das sage ich mit allem Vorbehalt, einen dieser Männer erschossen haben.«
»Er hat es also mit der Angst zu tun bekommen, das ist doch die Wahrheit, oder?«
»So könnte man es natürlich auch ausdrücken.«
»Verschaffen wir diesem Strolch doch etwas Angst, Mister Parker.«
»Mylady wollen sich mit solch einem üblen Gangster anlegen?« Parkers Gesicht drückte Widerwillen aus.
»Ich will ihm aufspielen«, präzisierte Lady Agatha unternehmungslustig. »Ein wahrer Zufall, daß er meinen Weg kreuzte. Und sein Pech, daß seine Subjekte mir die Vase zerschmetterten.«
»Mister Waters wird sich kaum etwas bieten lassen, Mylady. Ich möchte entschieden warnen.«
»Lady Simpson läßt sich ebenfalls nichts bieten«, kommentierte die streitbare Dame. »Und wer warnt Waters?«
Bevor Josuah Parker darauf antworten konnte, griff die Detektivin bereits nach dem Telefonhörer und verlangte von der Hotel Vermittlung eine Verbindung mit Stephan Waters. Während sie auf diese Verbindung wartete, sah sie Parker und ihre Gesellschafterin kriegerisch an. Sie zupfte ihr undamenhaft solides Taschentuch aus dem Pompadour und legte es über die Sprechmuschel. Agatha Simpson hatte zu viele Kriminalfilme gesehen, um nicht zu wissen, wie man seine Stimme am Telefon verzerrt.
»Sie haben drei Tage, Waters«, sagte sie dann gedehnt, als sich die Gegenseite meldete, »drei Tage … Ich würde sie nutzen!«
Sie legte auf, stopfte das Taschentuch zurück in den Pompadour und sah sehr zufrieden aus.
»Waters könnte herausfinden, von wo aus angerufen wurde«, warnte Josuah Parker.
»Na, hoffentlich.« Lady Agatha ließ sich nicht beeindrucken.
»Er könnte seine Leibwächter aktivieren, Mylady.«
»Seit wann haben Sie Angst, Mister Parker?« wunderte sich die streitbare Dame. »Lassen Sie sich gefälligst etwas einfallen, wie wir dieses Subjekt auf Trab bringen.«
»Ich werde mich bemühen, Mylady.«
»Ich erwarte zündende Ideen, Mister Parker.«
»Deuten die drei Leibwächter nicht darauf hin, daß er Angst hat?« ließ Kathy Porter sich vernehmen. Sie errötete sanft und wirkte leicht verlegen.
»Natürlich, Kindchen.« Agatha Simpson freute sich, daß sie verstanden wurde. »Daher ja auch mein Anruf. Dieser Strolch wird noch auf Knien heranrutschen und darum bitten, daß er mir den Schaden ersetzen darf. Für mich ist das eine Frage des Prinzips!«
Lady Agatha Simpson reckte sich hoch auf und glich in diesem Moment einer Bühnenheroine aus längst vergangenen Zeiten. Mit einem gewaltigen Speer in der Hand hätte sie aber auch durchaus mit einer Walküre konkurrieren können.
*
Stephan Waters war gereizt.
Er selbst hatte den Anruf angenommen, der einer unverhüllten Drohung glich. Er dachte nicht einen Moment lang daran, diese Lady Simpson zu verdächtigen. Er hatte sie eigentlich schon wieder vergessen. Was hatte er schließlich mit einer alten Frau zu tun, die nun Lady sein mochte oder nicht.
Nein, Waters dachte selbstverständlich sofort an London. Genauer gesagt, er dachte an seine jüngste Vergangenheit. Seine früheren Konkurrenten fühlten sich jetzt wohl stark genug, ihm ihre Rechnung zu präsentieren. Es ging da um einen Ritchie Romney, den er aus dem Weg geräumt hatte.
Artie, sein erster Leibwächter kam zurück.
»Festgestellt?« fragte Waters. »Von woher kam das Gespräch?«
»Aus Falmouth.«
»Falmouth …?«
»Hotel Atlantik. Mehr war im Moment nicht rauszubekommen.«
»Dann nichts wie rüber nach Falmouth!« Stephan Waters fühlte wieder das Prickeln im Blut wie in früheren Zeiten. »Spürt den Anrufer auf!«
»Sollen wir ihn …?« Artie hielt es nicht für nötig, seinen Satz zu beenden. Er konnte davon ausgehen, daß Waters ihn gut verstand.
»Nein.« Waters schüttelte den Kopf. »Nur kein Aufsehen hier in der Gegend. Erst mal feststellen, wer angerufen hat. Und dann ab mit ihm nach London oder Plymouth. Hier in der Gegend sollen keine Leichen rumliegen. Alles klar?«
Artie nickte und ging.
Stephan Waters baute sich vor dem dreigeteilten, säulenverzierten Fenster auf und sah auf den Far-Fjord hinunter. Er fragte sich, wie er sich weiter verhalten sollte. Er saß hier an der äußersten Südspitze Englands in einer erstklassig ausgebauten Festung und hatte sich bisher sicher gefühlt. Doch dieser Anruf machte ihn bereits nervös. Waters kannte schließlich die Gegenseite.
Hatte es einen Sinn, England schleunigst den Rücken zu kehren? Geld hatte er genug, um sich irgendwo in der Welt zu verkriechen. Vielleicht gab es Landstriche und Festungen, die noch sicherer waren als dieses Castle hier.
Doch Waters verwarf diesen Gedanken.
Flucht war sinnlos. Das Syndikat würde sich kaum abschütteln lassen. Nein, jetzt und hier mußte die Sache durchgestanden werden. Und vielleicht konnte er versuchen, sich mit der aufgebrachten Konkurrenz zu arrangieren. Man mußte es auf einen Versuch ankommen lassen. Waters war nur irritiert, was den Telefonanruf betraf.
Warnungen dieser Art paßten nicht zum Syndikat. Die Vollstrecker von Unterweltsurteilen pflegten unauffällig und überraschend zu arbeiten. Vorwarnungen hatte es bisher noch nie gegeben.
Stephan Waters verließ sein Zimmer und wanderte durch das Castle. Es war ein langer Weg, bis er alle Räume kontrolliert hatte. Er prüfte die Sicherheitsvorkehrungen, die er hatte einbauen lassen. Als er wieder in seinem großen Arbeitszimmer war, hatte er zum ersten Mal in seinem Hiersein das Gefühl, ein Gefangener zu sein in einem luxuriösen, goldenen Käfig.
*
Josuah Parker hielt sich in der Halle des »Atlantik« auf und beobachtete über den Rand der Zeitung hinweg die ein- und ausgehenden Hotelgäste. Er hatte sich von seiner Herrin beurlauben lassen. Er ging von der Vermutung aus, daß früher oder später hier im Hotel ein junger Mann erschien, der sich durch ein leicht dümmliches Gesicht auszeichnete. Nach dem Anruf im Schloß hatte Waters gewiß feststellen lassen, von wo aus angerufen worden war.
Parkers Zeitplan war fast perfekt.
Mit einer Verspätung von sechs Minuten erschien der bewußte junge Mann.
Man hatte also herausgefunden, daß im »Atlantik« der geheimnisvolle Anrufer wohnte. Nun ging es darum, wer es war. Waters reagierte schnell. Der Anruf schien ihm nicht sonderlich behagt zu haben.
Der junge Mann wies sich an der Rezeption aus. Wahrscheinlich arbeitete er mit einem gefälschtem Ausweis. Der Chefportier ließ sich prompt düpieren und kam sogar aus seiner Empfangsloge hervor. Er führte den jungen Mann in einen schmalen Korridor und geleitete ihn zur Telefonvermittlung.
Josuah Parker erhob sich aus dem Sessel und schritt gemessen zum Hoteleingang. Von hier aus beobachtete er den unscheinbar aussehenden Minicooper, der rechts auf einem Parkplatz stand. Ein zweiter junger Mann mit ebenfalls dümmlichem Gesicht saß am Steuer und rauchte.
Josuah Parker ahnte, was kommen würde. Daher ging er zurück in die Hotelhalle und begab sich in eine der drei Telefonzellen. Er wählte die mittlere und schaute durch den Glaseinsatz der Tür hinüber zur Rezeption.
Der junge Mann erschien schon wieder auf der Bildfläche. Sein dümmliches Gesicht zeigte einen zusätzlichen, verwirrten Ausdruck. Der Mann hatte wohl gerade erfahren, daß eine gewisse Lady Agatha Simpson seinen Herrn und Meister angerufen hatte.
Der Profi trabte auf die Telefonzellen zu, genau wie Parker es erwartet hatte. Er wollte jetzt wohl Waters informieren und sich neue Instruktionen holen.
Parker hatte vorgesorgt.
Nachdem der junge Mann rechts von ihm in der Zelle verschwunden war, schaltete der Butler den kleinen Verstärker ein. Er preßte die Membrane eines Stethoskops gegen die Trennwand und den Ohrclip in seinen Gehörgang. Mit einem kleinen Knopf regulierte er die Lautstärke des Geräts, das eine klare und unverzerrte Übertragung lieferte.
Der junge Mann wählte eine Telefonnummer und bekam seine Verbindung.
»Artie hier«, meldete er sich, »ich hab’ ’ne tolle Überraschung für Sie. Wissen Sie, wer angerufen hat? Diese Lady Simpson. Ja, ganz klarer Fall. Bestimmt, sie ist es gewesen. Irrtum ausgeschlossen. Was sollen wir jetzt machen?«
Der junge Mann legte eine Pause ein und ließ sich instruieren.
»In Ordnung«, sagte er, als er wieder an der Reihe war. »Wir stauchen sie also leicht zusammen. Nein, nein, wir passen schon auf. Nur ’n kleiner Schock für das alte Mädchen, damit sie schleunigst abrauscht. Natürlich, Chef! Doch, sie ist wirklich ’ne Lady. Der Chefportier kennt sie. Irrtum ausgeschlossen.«
Nun war Waters wieder an der Reihe.
»Ich ruf in zehn Minuten zurück«, schloß dann der junge Mann, »die Sache ist so gut wie erledigt. Ende!«
Artie verließ die Telefonzelle und sah sich einem Butler gegenüber, den er völlig übersah. Der junge Profi kam überhaupt nicht auf den Gedanken, dieser Butler könnte jener Mann sein, der diese ältere Lady zum Castle begleitet hatte.
Als ihm das sprichwörtliche Licht aufging, war es allerdings schon zu spät für ihn.
*
Vorerst blieb der junge Profi ahnungslos.
Er hatte es ja schließlich mit einer Frau zu tun, wie er eben erst in der Telefonzentrale erfahren hatte. Sein Trick, sich als Kriminalbeamter auszugeben, hatte vollen Erfolg gehabt. Man hatte ihm bereitwillig Auskunft erteilt.
Leichtsinnigerweise verzichtete er darauf, seinen Partner aus dem Minicooper mitzunehmen. Den Schock, den er Agatha Simpson zugedacht hatte, konnte er ihr auch allein verpassen. So wenigstens dachte er optimistisch.
Fast wohlgestimmt stieg er in den Lift und trat höflich zur Seite, als der Butler ihm folgte. Belustigt nahm er diesen schwarzgekleideten Mann zur Kenntnis. Das Alter des Butlers war nur schwer zu schätzen. Er konnte Ende Vierzig, aber auch sehr gut bereits weit in den Fünfzigern sein. Der junge Profi hatte es mit einem Gesicht zu tun, das nahezu unbeweglich war. Die Augen waren grau und verrieten wache Intelligenz.
Der Butler trug einen schwarzen Zweireiher, darunter eine Weste, gestreifte Beinkleider und schwarze, derbe Schuhe. Er hatte eine schwarze Melone auf dem Kopf und einen altväterlich gebundenen Regenschirm, der über seinem linken Unterarm hing. Der Mann war die Korrektheit in Person.
»Welche Etage darf ich für den Herrn drücken?« erkundigte sich der Butler, seine schwarze Melone lüftend.
»Dritter Stock«, erwiderte der junge Mann, der in den vierten wollte, um ungestört zu bleiben, da er an Zuhörern oder Zuschauern nicht interessiert war.
Josuah Parker drückte den gewünschten Etagenknopf und wendete dem jungen Profi halb den Rücken zu. Dabei passierte dem Butler ein Mißgeschick. Mit dem rechten, eisenbeschlagenen Absatz seines linken Schuhs trat er dem Mann sehr nachdrücklich auf die Zehen.
»Oh, das ist mir aber äußerst peinlich«, entschuldigte sich der Butler, während der Profi weiß im Gesicht wurde. »Sollte ich Sie möglicherweise inkommodiert haben?«
Der Profi wußte nicht, was der Butler meinte, denn er hatte mit seinen mißhandelten Zehen zu tun. Er hob den Fuß und sog dabei pfeifend und scharf die Luft ein. Er hatte das deutliche Gefühl, daß seine Zehen total zerquetscht waren.
»Sie – Idiot!« keuchte der junge Profi.
»Sie sehen mich erschüttert«, behauptete Parker und schaltete sich ungefragt als Nothelfer ein. Er griff nach dem linken Unterarm des Mannes, um wenigstens dessen Gleichgewicht zu gewährleisten.
Parker schien dabei etwas zu hart zugegriffen zu haben. Der junge Profi zuckte nämlich zusammen. Er hatte das Gefühl, von einer Nadel gestochen worden zu sein.
Was übrigens genau den Tatsachen entsprach, denn der Butler hatte seine perlenverzierte Krawattennadel als Kampfmittel eingesetzt. Da die Spitze dieser Nadel präpariert war, fühlte Artie sich plötzlich besonders schlecht. Ein Betäubungsgift – an sich harmlos – begann im Blut zu kreisen und rief bei ihm Halluzinationen hervor. Artie verdrehte die Augen, schielte ein wenig planlos durch den Lift und lehnte sich dann schwer gegen den Butler.
Parker änderte die Fahrtrichtung des Lifts und fuhr mit seinem sehr müde werdenden Begleiter wieder nach unten zur Hotelhalle. Als sie dort ankamen, war Artie bereits in sich zusammengerutscht und geistig weggetreten.
»Schnell, einen Arzt«, rief Parker einem Pagen zu. »Den Herrn scheint eine Kreislaufschwäche erfaßt zu haben.«
Der Chefportier und sein Helfer eilten herbei. Sie nahmen Artie zwischen sich und schleiften ihn umgehend und schnell in den kleinen Korridor neben der Portierloge. Nur kein Aufsehen, das war ihre Parole.
Artie wurde im Umkleideraum für die Portiers abgelegt, dann alarmierte man einen Arzt.
»Noch so jung und schon so labil«, stellte Parker gemessen fest. »Nun, die Kunst der Ärzte wird den Bedauernswerten schon wiederherstellen. Falls ich nicht gebraucht werde, meine Herren, möchte ich mich jetzt entfernen.«
Die beiden Portiers hatten nichts dagegen.
Josuah Parker ging zurück in die Hotelhalle und sah vom Eingang aus hinunter auf den Minicooper. Der zweite Jungprofi war inzwischen ausgestiegen und lehnte sich gegen den Wagen. Er sah an der Fensterfront des Hotels hoch und rauchte eine Zigarette. Es war jener junge Mann, der die Telefonwache vor der Hängebrücke des Castle gehalten hatte.
Parker winkte einen Pagen zu sich heran und deutete auf den zweiten Jungprofi am Minicooper.
»Richten Sie dort dem Herrn im Namen eines gewissen Artie aus, er möge umgehend hinunter zum Fischereihafen fahren, Kai Nr. 9.«
»Ihr Name, Sir?«
»Artie!«
»Artie, Sir?« Der Page sah den Butler ein wenig irritiert an.
»Artie«, bestätigte der Butler und drückte dem Pagen eine Banknote in die Hand. »Zu Ihrer Erklärung: Es handelt sich um eine Wette.«
Der Page hatte sich die Zahl auf der, Banknote angesehen und hielt es für richtig, keine weiteren Fragen zu stellen. Er grinste und beeilte sich, seinen Auftrag auszuführen.
Vom Eingang aus, hinter einer Topfpalme verborgen, beobachtete der Butler das Ergebnis seines kleinen Bluffs. Der Page hatte den zweiten Jungprofi inzwischen erreicht und richtete seinen Auftrag aus.
Parkers Rechnung ging auf.
Der zweite Profi hörte den Namen Artie, der für ihn eine Art Codewort darstellte. Er nickte und warf sich förmlich in seinen Minicooper. Die Reifen quietschten, als er lospreschte.
Als er die Straßenausfahrt des Parkplatzes erreicht hatte, begegnete ihm ein Notarztwagen. Doch darauf achtete er verständlicherweise nicht. Der Minicooper fädelte sich in den Verkehr ein und entschwand Parkers Augen.
Der Butler war mit sich wieder mal zufrieden. Nun hatte er Zeit, Mylady zu gewissen Zugeständnissen zu überreden.
*
Stephan Waters brauchte nur eine Sekunde, um die Spitze der sprichwörtlichen Palme zu erreichen.
»Das darf doch nicht wahr sein«, brüllte er aufgebracht seine beiden Profis an, die wie begossene Pudel vor ihm standen. »Zwei ausgebuffte Männer lassen sich von einem alten Knilch auf die Bretter legen. So was gibt’s doch nicht!«
Artie und Ray sahen betreten zu Boden.
»Der eine wird mit ’nem Kreislaufkollaps ins Hospital geschafft, der andere kurvt unten im Fischereihafen herum.« Waters marschierte vor seinen beiden Leibwächtern auf und ab. »Nun sagt wenigstens etwas! Verteidigt euch!«
»Der Butler hat’s faustdick hinter den Ohren«, meldete Artie sich zu Wort. »Er muß mir ’ne Spritze in den Unterarm gerammt haben. Ich hab’ den Stich gemerkt, aber da war’s auch schon zu spät. Ich bin erst wieder im Hospital zu mir gekommen.«
»Und ich bin auf den Namen Artie reingefallen«, entschuldigte sich Ray, der zweite Jungprofi. »Woher er den Namen weiß, kann ich mir nicht erklären.«
»Wenn einer Profi ist, dann ist das dieser Butler«, stellte Waters wütend fest. »Ihr fahrt zurück in die Stadt und brecht dem Kerl ein paar Knochen.«
»Das geht nicht, Chef«, sagte Artie.
»Der Butler ist mitsamt der Lady und der Gesellschafterin abgehauen«, fügte Ray hinzu.
»Abgehauen? Wohin?«
»Nach Edinburgh, Pendington-Manor. Ich hab’ mir im Hotel die Postnachsendeadresse geben lassen.«
»Nach Schottland?« Waters zwang sich zur Ruhe. Konnte er es sich leisten, den Butler zu verfolgen? Die Entfernung nach Edinburgh war schließlich kein Pappenstiel.
»Ist das mit Schottland sicher?« vergewisserte Waters sich.
»Ich hab’ den Hotelpagen bestochen«, antwortete Ray, »der Junge wußte das aus erster Hand. Die Nachsendeadresse sollte eigentlich geheimgehalten werden.«
Ray ahnte nicht, daß Josuah Parker all dies nur inszeniert hatte.
»Also schön, vergessen wir den Butler und diese komische Lady«, entschied Waters mürrisch. »Wäre ja sinnlos, sie bis nach Schottland zu verfolgen. Irgendwann werde ich diesen Typen aber meine Rechnung unter die Nase halten.«
Während er noch redete, war das scharfe Schlagen von Helikopter-Rotoren zu hören.
Das Geräusch des Hubschraubers kam schnell und aufdringlich näher. Dann schien die Maschine über dem Castle stehen zu bleiben.
Waters öffnete die Tür zu einem Balkon und trat hinaus ins Freie. Er blieb so lange ahnungslos, bis ihm die ersten Geschosse um die Ohren pfiffen.
Die Schüsse selbst waren nicht zu hören. Der Lärm, der Rotoren verschluckte die Detonationen. Waters war aber Fachmann genug, um die Aufschläge auf dem harten Stein des Castle identifizieren zu können.
Er betätigte sich umgehend als Freizeitsportler und ging in die Kniebeuge.
Dann warf er sich auf den Boden und robbte umgemein schnell zurück in den schützenden Raum, während Glassplitter der berstenden Fenster ihn umschwirrten.
Waters war kreidebleich, als er sich endlich erhob.
»Artie – Ray!« Seine Stimme überschlug sich. Panik nistete in ihr.
Die beiden Jungprofis erschienen hinter dem schweren Sofa, wo sie volle Deckung genommen hatten.
»Holt das Schwein runter!« kreischte Waters und deutete nach draußen.
Artie und Ray schienen von diesem Auftrag nicht besonders begeistert zu sein. Sie sahen sich etwas zögernd an und gingen dann ohne jede Eile zur Balkontür.
Ihre Vorsicht zahlte sich aus.
Als sie endlich auf dem Balkon waren, hatte, der Helikopter bereits abgedreht und schwebte zur Bay hinunter, unerreichbar für Schüsse.
*
»Mylady mögen verzeihen, aber eine bessere Unterkunft war in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht zu finden«, erklärte der Butler würdevoll und öffnete die hintere Wagentür. Er deutete auf das malerische zweistöckige Fachwerkhaus, das drei Spitzgiebel aufwies. Dieses Haus lag an einer steil ansteigenden, schmalen Straße und gehörte zu den Kapitänshäusern, wie sie genannt wurden. Es handelte sich um die Häuser ehemaliger Segelschiffskapitäne, die jetzt für zahlungskräftige Touristen vermietet wurden.
»Sie haben diesmal genau meinen Geschmack getroffen«, antwortete Lady Simpson und nickte beifällig.
»Mylady machen mich relativ glücklich«, gab Parker zurückhaltend zur Kenntnis.
»Ich weiß, Ihnen paßt mein Entschluß nicht, oder?«
»Ich würde mir niemals erlauben, Mylady zu widersprechen«, lautete Parkers Antwort. »Ich möchte allerdings erneut darauf hinweisen, daß Mylady sich in große Gefahr begeben.«
»Ich werd’s schon überleben.« Agatha Simpson marschierte auf ihren stämmigen Beinen hinüber zum Haus.
Parker, der ihr gefolgt war, schloß die Haustür auf. Er hatte sich den Schlüssel vom Verwalter der Kapitänshäuser mitgeben lassen. Er hatte auch die geschäftlichen Verhandlungen erledigt. Um solche Kleinigkeiten kümmerte sich die Detektivin nie.
Lady Agatha war entzückt, wie sie mehrfach behauptete. Das Fachwerkhaus war voll eingerichtet, alles alte Mahagoni-Möbel mit Messingbeschlägen. Man fühlte sich behaglich wie in der Kajüte eines Hochseekapitäns.
Die Verteilung der wenigen Räume war schnell geregelt. Parker bezog ein kleines Kabinett im Erdgeschoß gleich neben der Küche. Die beiden Damen komplimentierte er hinauf ins Obergeschoß. Er hielt sie dort für sicherer.
Als Parker zurück zum Wagen ging, hörte er über der Bay das Geräusch eines Hubschraubers, der tief über das Wasser flog. Die Maschine kam direkt aus der Richtung des Schlosses, in dem Stephan Waters wohnte. Parker achtete nur kurz auf den Helikopter und widmete sich dann dem wenigen Gepäck, das er ins Haus trug. Anschließend ließ er seinen hochbeinigen Wagen seitlich neben dem Haus in einer Fachwerkremise verschwinden.
Parker war, wie er bereits deutlich zu erkennen gegeben hatte, mit dem! Entschluß Myladys nicht einverstanden. Er hätte Agatha Simpson und Kathy Porter in wenigen Stunden zurück nach Torquay bringen können, wo sich Lady Simpsons Sommerwohnsitz befand. Dort hätte er, was die Sicherheit anbetraf, gewisse Garantien geben können.
Die Detektivin hatte auf diese Rückfahrt verzichtet. Sie wollte ganz in der Nähe dieses Flegels bleiben, um ihre Forderungen an Waters einzutreiben. Agatha Simpson galt nicht umsonst als eine sehr skurrile Dame, die jeder Norm widersprach.
Nun befand man sich also südlich von Falmouth in einer sich genau westlich erstreckenden Seitenbucht der Bay und konnte von hier aus das Castle auf der Felsnadel genau beobachten. Parker stellte mit einiger Befriedigung fest, daß die Wasserfläche zwischen dem Kapitänshaus und dem Castle erfreulich groß war. Lady Simpson konnte als nicht unmittelbar tätig werden.
Die Hänge dieser Bucht zeigten eine subtropische Vegetation. Der Golfstrom war die ununterbrochen tätige, riesige Zentralheizung, die die Südwestspitze von Cornwall mit Wärme versorgte. Zitronen- und Apfelsinenbäume waren hier eine Selbstverständlichkeit. Selbst Bananenstauden waren reichlich vorhanden.
Der dicht bestandende Garten, der das Haus umgab, stand in voller Blüte und wirkte in seiner Üppigkeit wie ein kleiner Dschungel. Parker gab sich diesem Bild des Friedens für einen Moment voll hin. Er sah hinunter auf die Bay und beobachtete einen Fischkutter, der seewärts tuckerte. Dann aber schaute er unwillkürlich hinüber auf das Castle und besann sich auf die harte Gegenwart.
Er hatte Mylady gegenüber nicht übertrieben. Agatha Simpson wollte sich wegen einer Bagatelle mit einem Gangster anlegen, der noch vor wenigen Jahren gefürchtet war. Ahnte sie überhaupt, auf was sie sich da einließ? Hatte sie jeden Sinn für Gefahr verloren?
»Besorgen Sie ein gutes Fernrohr«, ließ die Detektivin sich in diesem Augenblick vernehmen. »Ich möchte dieses Subjekt immer vor Augen haben.«
»Wie Mylady wünschen.« Parker seufzte innerlich auf.
»Und lassen Sie sich einfallen, wie wir diesen Lümmel gründlich nervös machen können!« Sie deutete zum Castle hinüber.
»Ich werde mich bemühen, Mylady«, entgegnete der Butler, »aber wenn ich mir einen Vorschlag erlauben darf, so sollte man vielleicht noch eine gütliche Einigung in Betracht ziehen.«
»Und wie stellen Sie sich die vor?«
Agatha Simpson schien mit diesem Vorschlag nicht sehr einig zu gehen.
»Wenn Sie erlauben, werde ich mich mit Mister Waters noch mal in Verbindung setzen.«
»Gut, machen wir einen allerletzten Versuch«, räumte Lady Simpson ein. »Aber wenn ich erneut beleidigt werde, sind wir an der Reihe.«
Parker atmete innerlich auf.
*
Stephan Waters stand auf dem Balkon. Während er in kurzen Abständen immer wieder hinunter zur Bay und hinauf zum Himmel sah, um das Herankommen eines Hubschraubers früh genug zu beobachten, sah er sich die Einschläge im Gemäuer an.
Die Geschosse hatten den mächtigen Quadern natürlich kaum geschadet, doch sie hatten immerhin Schrammen ins Mauerwerk gerissen. Daß man ihn hatte ermorden wollen, stand für Stephan Waters hundertprozentig fest.
Der untersetzte, kompakte Mann hatte sich inzwischen wieder gefangen. Er fragte sich, in wessen Auftrag aus dem Hubschrauber geschossen worden war. Ging das US-Syndikat jetzt zur Sache über? Oder gab es noch andere Gruppen aus der Londoner Unterwelt, die sich an ihm rächen wollten?
Eine erste grobe Auswahl zu treffen, war für Waters sehr schwer. Er hatte einfach zu viele Gegner in London zurückgelassen. Jahrelang hatte er in der Stadt mit brutaler Faust regiert. Und immer wieder gelang es ihm, nach außen hin die weiße Weste zu wahren. Die Polizei konnte ihm nie etwas nachweisen.
Waters spürte, daß die Idylle beendet war. Er hatte sich eingeredet, einen Schlußstrich unter die Unterweltsjahre ziehen zu können. Die Vergangenheit hatte ihn aber schon wieder eingeholt. Jetzt ging es wahrscheinlich auf Leben und Tod. Er mußte sich seiner Haut wehren. Wer immer ihm ans Fell wollte, würde schnell merken, daß Stephan Waters noch den alten, scharfen Biß besaß.
Sein erster Entschluß, auf keinen Fall die Flucht zu ergreifen, war endgültig. Flucht war sinnlos. Hier vom Schloß aus konnte er nicht nur alle weiteren Angriffe abwehren, sondern auch zum Gegenangriff übergehen. Mit Geld ließ sich viel erreichen. Und Geld besaß er tatsächlich in mehr als ausreichender Menge. Die Jahre als Gangsterboß in London hatte er genutzt.
Er hörte das Läuten des Telefons in seinem großen Wohnraum, verließ den Balkon und ging an den Apparat. Er meldete sich und hörte auf der Gegenseite nur ein deutliches Atmen.
»Wer ist da?« fragte Waters scharf.
»Wirklich keine Ahnung?« Undeutlich und verzerrt klang die Stimme, die er erst vor wenigen Stunden gehört haben mußte.
Wenigstens kam ihm das so vor.
»Lady Simpson?« fragte er spontan.
Auf der Gegenseite war ein ersticktes Kichern zu hören.
»Sie sind ein Witzbold, Waters«, reagierte die Stimme.
»Wer spricht denn da?« Waters wurde wütend.
»Denken Sie darüber mal nach«, schloß die Stimme am anderen Leitungsende. »Ich bin’s gewöhnt, meine Rechnung zu präsentieren.«
Waters starrte auf den Hörer, nachdem die Verbindung getrennt worden war. Dann knallte er den Hörer in die Gabel und massierte sich nachdenklich seinen Nasenrücken.
Wie war das gewesen? Rechnung präsentieren!? Sollte diese Lady erneut angerufen haben? Waters war verunsichert. Ob diese komische Lady mit ihrem Butler und der Gesellschafterin vielleicht zum Syndikat gehörte?
*
Parker betrat nach etwa anderthalb Stunden wieder das Ferienhaus und machte einen recht zufriedenen Eindruck.
»Schon zurück?« erkundigte sich Agatha Simpson, die sich unten im Wohnraum befand.
»Die Verhandlung mit Mister Waters gestaltete sich erfreulich kurz«, schwindelte Parker. »Er konnte sich meinen Argumenten nicht länger verschließen, Mylady.«
»Und?!« Die streitbare Dame sah ihren Butler wachsam an.
»Mister Waters bittet um Entschuldigung für sein unmögliches Betragen und erstattet Ihnen hiermit die restlichen, geforderten 45 Pfund.«
Parker war hochherrschaftlicher Butler genug, um die Pfundnoten zuerst auf ein Silbertablett zu legen, bevor er sie Mylady reichte.
»Pfui, Parker.«
»Mylady!« Parker hatte eine dumpfe Ahnung, daß seine Herrin den Schwindel bereits durchschaut hatte.
»Mylady sind meiner bescheidenen Wenigkeit gram?« erkundigte sich Parker.
»Sie wollen mich beschwindeln«, gab die Detektivin zurück. »Dieses Geld stammt niemals von diesem Flegel Waters. Stimmt es?«
»Mylady sehen mich zerknirscht.« Parker senkte den Kopf, um damit seine Betroffenheit anzudeuten.
»Es geht mir schon gar nicht mehr um das Geld«, stellte Agatha Simpson fest. »Es geht um das Prinzip der Höflichkeit. Dieser Lümmel hat sich zu entschuldigen. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Ich wollte Mylady sehr viel Ärger ersparen.«
»Haben Sie solch eine Angst vor diesem Subjekt?« Ihre Augen funkelten kriegerisch.
»Mylady kennen Stephan Waters nicht.«
»So ähnlich drückten Sie sich schon mal aus, Parker. Ob es gefährlich ist oder nicht, interessiert mich nicht. Er hat sich an die Regeln der Höflichkeit zu halten, vor allen Dingen einer Dame gegenüber. Haben Sie das Fernrohr mitgebracht?«
»Sicherheitshalber, Mylady.«
»Sie rechneten also damit, daß ich Sie durchschauen würde?« Lady Agatha lächelte triumphierend.
»Ich fürchtete es, Mylady.«
»Bauen Sie das Fernrohr auf, daß ich das Castle beobachten kann. Und dann erwarte ich Ihre Vorschläge, Mister Parker.«
»Können Mylady mir noch mal verzeihen?«
»Was bleibt mir anderes übrig? Ich brauche Ihre Tricks. Und das wissen Sie sehr genau.« Sie entließ Josuah Parker mit einer Handbewegung und widmete sich wieder dem kleinen Erfrischungstrunk, den Kathy Porter ihr besorgt hatte. Sie genoß den alten Whisky und sah die junge, attraktive Frau dann augenzwinkernd an.
»Wer hat nun recht gehabt?« fragte sie. »Ich wußte gleich, daß er mich anschwindeln würde. Ja, Mister Parker muß noch viel lernen. Mister Rander scheint es ihm in all den Jahren etwas zu einfach gemacht zu haben.«
»Seine Warnungen klingen aber sehr ernst, Mylady.«
»Ich werde diesen Lümmel von einem Gangsterboß schon nicht unterschätzen, Kindchen.« Agatha Simpson trank das Glas leer und stiefelte dann über die etwas steile Holztreppe hinauf ins Obergeschoß. In einer kleinen Giebelkammer hatte Parker inzwischen die private Beobachtungsstation eingerichtet.
Auf ein schweres Holzstativ war ein Teleskop montiert, das über eine Brennweite von rund 900 mm verfügte. Dieses Gerät sah schon recht professionell aus.
Agatha Simpson nickte zufrieden.
»Der Verkäufer garantiert eine fast 450fache Vergrößerung«, erläuterte Parker. »An sich ist dieses Teleskop für die Beobachtung der Gestirne gedacht und für Amateurastronomen entwickelt worden.«