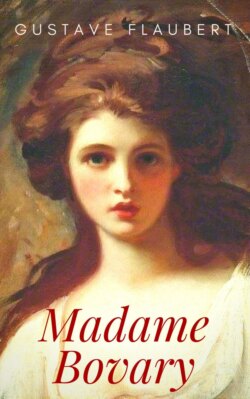Читать книгу Gustave Flaubert: Madame Bovary. Sitten in der Provinz - Gustave Flaubert, Gustave Flaubert - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
ОглавлениеEines Vormittags erschien Vater Rouault und brachte das Honorar für den behandelten Beinbruch: fünfundsiebzig Franken in blanken Talern und eine Truthenne. Er hatte Karls Unglück erfahren und tröstete ihn, so gut er konnte.
„Ich weiß, wie einem da zumute ist!“ sagte er, indem er dem Witwer auf die Schulter klopfte. „Habs ja selber mal durchgemacht, ganz so wie Sie! Als ich meine Selige begraben hatte, da lief ich hinaus ins Freie, um allein für mich zu sein. Ich warf mich im Walde hin und weinte mich aus. Fing an, mit dem lieben Gott zu hadern, und machte ihm die dümmsten Vorwürfe. An einem Aste sah ich einen verreckten Maulwurf hängen, dem der Bauch von Würmern wimmelte. Ich beneidete den Kadaver! Und wenn ich daran dachte, dass im selben Augenblicke andere Männer mit ihren netten kleinen Frauen zusammen waren und sie an sich drückten, schlug ich mit meinem Stocke wild um mich. Es war sozusagen nicht mehr ganz richtig mit mir. Ich aß nicht mehr. Der bloße Gedanke, in ein Kaffeehaus zu gehen, ekelte mich an. Glauben Sie mir das! Na, und so nach und nach im Gang der Zeiten, wie so der Frühling dem Winter und der Herbst dem Sommer folgte, da gings eins, zwei, drei, und weg war der Jammer! Weg! Hinunter! Das ist das richtige Wort: hinunter! Denn ganz kriegt man ja so was im ganzen Leben nicht los. Da tief drinnen in der Brust bleibt immer was stecken. Aber Luft kriegt man wieder! Sehen Sie, das ist nun einmal unser aller Schicksal, und deshalb darf man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Man darf nicht sterben wollen, weil andere gestorben sind. Auch Sie müssen sich aufrappeln, Herr Bovary! Es geht alles vorüber! Besuchen Sie uns! Sie wissen ja, meine Emma denkt oft an Sie. Sie hätten uns vergessen, meint sie. Es wird nun Frühling. Zerstreuen Sie sich ein bisschen bei uns. Schießen Sie ein paar Karnickel auf meinem Revier!“
Karl befolgte seinen Rat. Er kam wieder nach Bertaux und fand da alles wie einst, das heißt wie vor fünf Monaten. Die Birnbäume hatten schon Blüten, und der treffliche Vater Rouault war wieder mordsgesund und von früh bis Abend auf den Beinen. Und im ganzen Gut war mächtiger Betrieb.
Es war ihm eine Ehrensache, den Arzt mit der erdenklichsten Rücksicht auf sein Leid zu behandeln. Er bat ihn, sichs so bequem wie nur möglich zu machen, sprach im Flüsterton mit ihm wie mit einem Genesenden, und er war sichtlich außer sich, wenn man des Gastes wegen nicht, wie befohlen, die am leichtesten verdaulichen Gerichte auf den Tisch brachte, zum Beispiel feine Eierspeisen oder gedünstete Birnen. Er erzählte Anekdoten und Abenteuer. Zu seiner eignen Verwunderung lachte Karl. Aber mir einem Male erinnerte er sich seiner Frau und wurde nachdenklich. Der Kaffee wurde gebracht, und da vergaß er sie wieder.
Je mehr er sich an sein Witwertum gewöhnte, umso weniger gedachte er der Verstorbenen. Das angenehme, ihm neue Bewußtsein, unabhängig zu sein, machte ihm die Einsamkeit bald erträglicher. Jetzt durfte er die Stunden der Mahlzeiten selber bestimmen, konnte gehen und kommen, ohne Rechenschaft darüber geben zu müssen, und wenn er müde war, alle vier von sich strecken und sich in seinem Bett breit machen. Er hegte und pflegte sich und ließ alle Tröstungen über sich ergehen. Übrigens hatte der Tod seiner Frau keine ungünstige Wirkung auf seinen Beruf als Arzt. Indem man wochenlang in einem fort sagte: „Der arme Doktor. Wie traurig!“ blieb sein Name im Munde der Leute. Seine Praxis vergrößerte sich. Und dann konnte er nun nach Bertaux reiten, wann es ihm beliebte. Eine unbestimmbare Sehnsucht wuchs in ihm auf, ein namenloses Glücksgefühl. Wenn er sich im Spiegel betrachtete und sich den Bart strich, fand er sich gar nicht übel.
Eines schönen Tages kam er nachmittags gegen drei Uhr im Gute angeritten. Alles war draußen auf dem Felde. Er betrat die Küche. Emma war drinnen, aber er bemerkte sie zunächst nicht. Die Fensterläden waren geschlossen. Durch die Ritzen des Holzes stachen die Sonnenstrahlen mit langen dünnen Nadeln auf die Fliesen, oder sie brachen sich an den Kanten der Möbel entzwei und wirbelten hinauf zur Decke. Auf dem Küchentisch krabbelten Fliegen an den Gläsern hinauf, purzelten summend in die Apfelweinneigen und ertranken. Das Sonnenlicht, das durch den Kamin eindrang, verwandelte die rußige Herdplatte in eine Samtfläche und färbte den Aschehaufen blau. Emma saß zwischen dem Fenster und dem Herd und nähte. Sie hatte kein Halstuch um, und auf ihren entblößten Schultern glänzten kleine Schweißperlen.
Nach ländlichem Brauch bot sie dem Gast einen Trunk an. Als er ihn ausschlug, nötigte sie ihn, und schließlich bat sie ihn lachend, ein Gläschen Likör mit ihr zu trinken. Sie holte aus dem Schranke eine Flasche Curacao, suchte zwei Gläser heraus, füllte das eine bis zum Rande und goss in das andere ein paar Tropfen. Sie stieß mit Karl an und führte dann ihr Glas zum Munde. Da so viel wie nichts drin war, musste sie sich beim Trinken zurückbiegen. Den Kopf nach hinten gelegt, die Lippen zugespitzt, den Hals gestrafft, so stand sie da und lachte darüber, dass ihr nichts auf die Zunge lief, obgleich diese mit der Spitze aus den feinen Zähnen herausspazierte und bis an den Boden des Glases mehrmals suchend vorstieß.
Emma nahm wieder Platz und begann sich von neuem ihrer Handarbeit zu widmen. Ein weißer baumwollener Strumpf war zu stopfen. Mit gesenkter Stirn saß sie da. Sie sagte nichts und Karl erst recht nichts. Der Luftzug, der sich zwischen Tür und Schwelle eindrängte, wirbelte ein wenig Staub von den Fliesen auf. Karl sah diesem Tanze der Atome zu. Dabei hörte er nichts als das Hämmern seines Blutes im eignen Hirne und aus der Ferne das Gackern einer Henne, die irgendwo im Hof ein Ei gelegt hatte. Hin und wieder hielt Emma die Handflächen ihrer Hände auf den kalten Knauf der Herdstange und presste sie dann an ihre Wangen, um diese zu kühlen.
Sie klagte über die Schwindelanfälle, von denen sie seit Frühjahrsanfang heimgesucht wurde, und fragte, ob ihr wohl Seebäder dienlich wären. Dann plauderte sie von ihrem Aufenthalt im Kloster und er von seiner Gymnasiastenzeit. So gerieten sie in ein Gespräch. Sie führte ihn in ihr Zimmer und zeigte ihm ihre Notenhefte von damals und die niedlichen Bücher, die sie als Schulprämien bekommen hatte, und die Eichenlaubkränze, die im untersten Schrankfache ihr Dasein fristeten. Dann erzählte sie von ihrer Mutter, von deren Grabe, und zeigte ihm sogar im Garten das Beet, wo die Blumen wüchsen, die sie der Toten jeden ersten Freitag im Monat hintrug. Der Gärtner, den sie hatten, verstünde nichts. Mit dem seien sie schlecht dran. Ihr Wunsch wäre es, wenigstens während der Wintermonate in der Stadt zu wohnen. Dann aber meinte sie wieder, an den langen Sommertagen sei das Leben auf dem Lande noch langweiliger. Und je nachdem, was sie sagte, klang ihre Stimme hell oder scharf; oder sie nahm plötzlich einen matten Ton an, und wenn sie wie mit sich selbst plauderte, wurde sie wieder ganz anders, wie flüsternd und murmelnd. Bald war Emma lustig und hatte große unschuldige Augen, dann wieder schlossen sich ihre Lider zur Hälfte, und ihr schimmernder Blick sah teilnahmslos und traumverloren aus.
Abends auf dem Heimritt wiederholte sich Karl alles, was sie geredet hatte, bis ins einzelne, und versuchte den vollen Sinn ihrer Worte zu erfassen. Er wollte sich damit eine Vorstellung von der Existenz schaffen, die Emma geführt, ehe er sie kennen gelernt hatte. Aber es gelang ihm nicht, sie in seinen Gedanken anders zu erschauen als so, wie sie ausgesehen hatte, als er sie zum ersten mal erblickt, oder so, wie er sie eben vor sich gehabt hatte. Dann fragte er sich, wie es wohl würde, wenn sie sich verheiratete, aber mit wem? Ja, ja, mit wem? Ihr Vater war so reich und sie ... so schön!
Und immer wieder sah er Emmas Gesicht vor seinen geistigen Augen, und eine Art eintönige Melodie summte ihm durch die Ohren wie das Surren eines Kreisels: „Emma, wenn du dich verheiratest! Wenn du dich nun verheiratest!“ In der Nacht konnte er keinen Schlaf finden. Die Kehle war ihm wie zugeschnürt. Er verspürte Durst, stand auf, trank ein Glas Wasser und machte das Fenster auf. Der Himmel stand voller Sterne. Der laue Nachtwind strich in das Zimmer. Fern bellten Hunde. Er wandte den Blick in die Rötung nach Bertaux.
Endlich kam er auf den Gedanken, dass es den Hals nicht kosten könne, und so nahm er sich vor, bei der ersten besten Gelegenheit um Emmas Hand zu bitten. Aber sooft sich diese Gelegenheit bot, wollten ihm vor lauter Angst die passenden Worte nicht über die Lippen. Vater Rouault hätte längst nichts dagegen gehabt, wenn ihm jemand seine Tochter geholt hätte. Im Grunde nützte sie ihm in Haus und Hof nicht viel. Er machte ihr keinen Vorwurf daraus: sie war eben für die Landwirtschaft zu aufgeweckt. „Ein gottverdammtes Gewerbe!“ pflegte er zu schimpfen. „Das hat auch noch keinen zum Millionär gemacht!“ Ihm hatte es in der Tat keine Reichtümer gebracht; im Gegenteil, er setzte alle Jahre zu. Denn wenn er auch auf den Märkten zu seinem Stolz als gerissener Kerl bekannt war, so war er eigentlich doch für Ackerbau und Viehzucht durchaus nicht geschaffen. Er verstand nicht zu wirtschaften. Er nahm nicht gern die Hände aus den Hosentaschen, und seinem eigenen Leibe war er kein Stiefvater. Gutes Essen und Trinken waren ihm wichtig, ein warmer Ofen und ausgiebiger Schlaf. Ein gutes Glas Landwein, ein halb durchgebratenes Hammelkotelett und ein Tässchen Mokka mit Cognac gehörten zu den Idealen seines Lebens. Er nahm seine Mahlzeiten in der Küche ein und zwar allein für sich, in der Nähe des Herdfeuers an einem kleinen Tisch, der ihm — wie auf der Bühne — fix und fertig gedeckt hereingebracht werden musste.
Als er die Entdeckung machte, dass Karl einen roten Kopf bekam, wenn er Emma sah, war er sich sofort klar, dass früher oder später ein Heiratsantrag zu erwarten war. Daraufhin überlegte er sich die Geschichte. Besonders schneidig sah ja Karl Bovary nicht gerade aus, und Rouault hatte sich ehedem seinen künftigen Schwiegersohn ein bisschen anders gedacht, aber er war doch als anständiger Kerl bekannt, sparsam und tüchtig in seinem Beruf. Und zweifellos würde er wegen der Mitgift nicht lange feilschen. Vater Rouault hatte gerade eine Menge großer Ausgaben. Um allerlei Handwerker zu bezahlen, sah er sich gezwungen, zweiundzwanzig Acker von seinem Grund und Boden zu verkaufen. Die Kelter musste auch erneuert werden. Und so sagte er sich: „Wenn er um Emma anhält, soll er sie kriegen!“
Zur Weinlese war Karl drei Tage lang da. Aber Tag verging auf Tag und Stunde auf Stunde, ohne dass Karls Wille zur Tat wurde. Rouault gab ihm ein kleines Stück Wegs das Geleit; am Ende des Hohlwegs vor dem Dorfe pflegte er sich von seinem Gaste zu verabschieden. Das war also der Moment! Karl nahm sich noch Zeit bis zuallerletzt. Erst als die Hecke hinter ihnen lag, stotterte er los:
„Verehrter Herr Rouault, ich möchte Ihnen gern etwas sagen!“
Weiter brachte er nichts heraus. Die beiden Männer blieben stehen.
„Na, raus mit der Sprache! Ich kann mirs schon denken!“ Rouault lachte gemütlich.
„Vater Rouault! Vater Rouault!“ stammelte Karl.
„Meinen Segen sollen Sie haben!“ fuhr der Gutspächter fort. „Meine Kleine denkt gewiss nicht anders als ich, aber gefragt werden muss sie. Reiten Sie getrost nach Haus. Ich werde sie gleich mal ins Gebet nehmen. Wenn sie Ja sagt, — wohlverstanden! — brauchen Sie jedoch nicht umzukehren. Wegen der Leute nicht, und auch weil sie sich erst ein bisschen beruhigen soll. Damit Sie aber nicht zu lange Blut schwitzen, will ich Ihnen ein Zeichen geben: ich werde einen Fensterladen gegen die Mauer klappen lassen. Wenn Sie da oben über die Hecke gucken, können Sie das ungesehen beobachten!“
Damit ging er.
Karl band seinen Schimmel an einen Baum; kletterte die Böschung hinauf und stellt sich auf die Lauer, die Taschenuhr in der Hand. Eine halbe Stunde verstrich — und dann noch neunzehn Minuten ... Da gab es mit einem Male einen Schlag gegen die Mauer. Der Laden blieb sperrangelweit offen und wackelte noch eine Weile.
Am anderen Morgen war Karl vor neun Uhr in Bertaux. Emma wurde über und über rot, als sie ihn sah. Sie lächelte gezwungen ein wenig, um ihre Fassung zu bewahren. Rouault umarmte seinen künftigen Schwiegersohn. Die Besprechung der geschäftlichen Punkte wurde verschoben. Übrigens war noch viel Zeit dazu, da die Hochzeit anstandshalber vor Ablauf von Karls Trauerjahr nicht stattfinden konnte, das hieß, nicht vor dem nächsten Frühjahr.
In dieser Erwartung verging der Winter. Fräulein Rouault beschäftigte sich mit ihrer Aussteuer. Ein Teil davon wurde in Rouen bestellt. Die Hemden und Hauben stellte sie nach Schnitten, die sie sich lieh, selbst her. Wenn Karl zu Besuch kam, plauderte das Brautpaar von den Vorbereitungen zur Hochzeitsfeier. Es wurde überlegt, in welchem Raum das Festmahl stattfinden, wieviel Platten und Schüsseln auf die Tafel kommen und was für Vorspeisen es geben solle.
Am liebsten hätte es Emma gehabt, wenn die Trauung auf nachts zwölf Uhr bei Fackelschein festgesetzt worden wäre; aber für solche Romantik hatte Vater Rouault kein Verständnis. Man einigte sich also auf eine Hochzeitsfeier, zu der dreiundvierzig Gäste Einladungen bekamen. Sechzehn Stunden wollte man bei Tisch sitzen bleiben. Am nächsten Tage und an den folgenden sollte es so weitergehen.